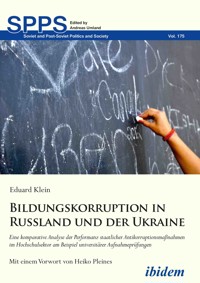
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Soviet and Post-Soviet Politics and Society
- Sprache: Deutsch
Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist Korruption ein Alltagsphänomen postsowjetischer Gesellschaften. Besonders betroffen ist der Bildungssektor. Doch was sind die Ursachen dieser Bildungskorruption, in welchen Formen manifestiert sie sich, wie verbreitet ist sie, und welche Folgen hat sie? Eduard Klein untersucht und vergleicht Korruption bei der Hochschulzulassung in Russland und der Ukraine im Zeitraum von 2000 bis 2014. Im Zentrum steht dabei die Frage, welche korruptionsmindernden Effekte eine 2008 in der Ukraine und 2009 in Russland umgesetzte Reform der Zulassungssysteme hatte. Vor dem Hintergrund der zahllosen gescheiterten Antikorruptionsprogramme im postsowjetischen Raum analysiert Klein, welche Faktoren Antikorruptionsmaßnahmen scheitern lassen – und welche sie erfolgreich machen. Die Ergebnisse der extensiven qualitativen Feldforschung – mehr als 50 Respondenten wurden interviewt – zeigen, dass trotz eines analogen Reformansatzes sehr unterschiedliche Wirkungen erzielt wurden, die Klein im Kontext der aktuellen Korruptionsforschung diskutiert. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass der ukrainische Bottom-up-Ansatz, der zivilgesellschaftliche und internationale Akteure maßgeblich in den Reformprozess involvierte, wesentlich effektiver war als die bürokratische Top-down-Implementierung in Russland, wo nichtstaatliche Akteure nur eine marginale Rolle spielten. Kleins Studie bietet praxisnahe Erkenntnisse für die Korruptions- und Osteuropa-Forschung sowie für Hochschulen, Institutionen und Nichtregierungsorganisationen auf dem Feld der Korruptionsbekämpfung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 764
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1 Abstract
2 Vorwort
Herausforderungen der Korruptionsbekämpfung
3 Einleitung
3.1 Gliederung
3.2 Forschungsstand
3.3 Erkenntnisinteresse und Relevanz
3.4 Methoden und empirische Basis
3.5 Hinweise zur Transliteration und Schreibweise
4 Korruption im interdisziplinären Spannungsfeld zwischen sozialer Beziehung, rationaler Handlung und informeller Institution
4.1 Definition von Bildungskorruption
4.2 Korruption als „soziale Beziehung“ im Mehr-Ebenen-Modell
4.3 Korruption als Principal-Agent-Modell
4.4 Korruption als Rational-Choice-basierter Neoinstitutionalismus
4.5 Zusammenfassung und Zusammenführung der Theoriestränge
5 Die Hochschulsysteme Russlands und der Ukraine im Spiegel von Bildungskrise und Bildungskorruption
5.1 Bildungspolitischer Kontext: Russland
5.2 Bildungspolitischer Kontext: Ukraine
5.3 Ursachen der Bildungskorruption
5.3.1 Ökonomische Faktoren
5.3.2 Institutionelle Faktoren
5.3.3 Historische, soziokulturelle und normative Faktoren
5.4 Ausmaß der Bildungskorruption
5.5 Formen der Bildungskorruption
5.5.1 Intransparente Zulassungssysteme als Nährboden für Korruption
5.5.2 Korruptionsformen im Rahmen der Hochschulzulassung
5.6 Folgen der Bildungskorruption
5.7 Zusammenfassung
6 Fallstudie Russland
6.1 Der Einfluss externer Akteure auf die russische Bildungspolitik
6.2 Konsolidierung und Modernisierung des russischen Hochschulsystems
6.3 Antikorruptionsbemühungen im russischen Hochschulsektor
6.4 Implementierung des Staatlichen Einheitsexamens EGE
6.4.1 Zur Idee eines Einheitsexamens als Mittel der Korruptionsbekämpfung
6.4.2 Widerstand gegen das EGE
6.4.3 Landesweite Einführung
6.5 Informelle Praxen und Korruption nach Einführung des EGE
6.5.1 Die neue Rolle der Repetitoren und Vorbereitungskurse
6.5.2 Korruption im Rahmen hochschulinterner Aufnahmeprüfungen
6.5.3 Bestechung hochrangiger Beamter aus Verwaltung, Bildung und Politik
6.5.4 „Tote Seelen“
6.5.5 Lehrer und Studierende legen im Auftrag der Schüler das EGE ab
6.5.6 Manipulation der Notenskala: schwache Kontrolle oder inoffizielle Bildungspolitik?
6.5.7 Problemregion Nordkaukasus? Massenhafte Korruption und „EGE-Tourismus“
6.5.8 Verwendung technischer Hilfsmittel
6.5.9 Olympiaden, geförderte Aufnahme und Bewerber mit Privilegien
6.6 Die Einführung des EGE – ein Erfolg?
6.6.1 Das EGE aus der Sicht der Bevölkerung
6.6.2 EGE 2014: geglückter Neustart?
6.7 Zusammenfassung und Ausblick
7 Fallstudie Ukraine
7.1 Das Zulassungsprojekt der International Renaissance Foundation
7.1.1 Institutioneller Aufbau der Testinfrastruktur
7.1.2 Die Pilotphase des Testing Technologies Center
7.2 Die Orange Revolution als window of opportunity
7.2.1 Der politische Wille des Präsidenten und seiner Bildungsminister
7.2.2 Politische Partizipation und die „Geburt der Zivilgesellschaft“
7.3 Die Implementierung des Externen Unabhängigen Examens ZNO
7.3.1 Das Ukrainische Zentrum zur Evaluation der Bildungsqualität UCEQA
7.3.2 Organisation des Testzentrums und Prozedur des Examens
7.3.3 Landesweite Einführung
7.3.4 Unabhängige zivilgesellschaftliche Kontrolle
7.4 Die Ukrainian Standardized External Testing Initiative USETI
7.4.1 Entstehung
7.4.2 Arbeitsschwerpunkte
7.4.3 Kooperation mit ukrainischen und internationalen Akteuren
7.5 Bruch mit der Reformpolitik nach der Präsidentschaftswahl 2010
7.5.1 Die reaktionäre Wende unter Bildungsminister Tabačnyk
7.5.2 Unterminierung des ZNO
7.5.3 Der Umgang mit Bildungskorruption unter Tabačnyk
7.6 Informelle Praxen und Korruption nach Einführung des ZNO
7.6.1 Schulabschlusszeugnis
7.6.2 Schulolympiaden
7.6.3 Nachwuchswettbewerbe der Jungen Akademie der Wissenschaften
7.6.4 Bewerber mit Privilegien
7.6.5 Zusätzliche Eignungs- und Auswahlprüfungen
7.6.6 Vorbereitungsseminare der Hochschulen
7.6.7 Geförderte Aufnahme
7.6.8 Immatrikulationsphase und Nachrückverfahren
7.6.9 Anfechtung der ZNO-Ergebnisse
7.7 Die Bilanz der Zulassungsreform
7.7.1 Rückgang der Korruption
7.7.2 Gesellschaftliche Akzeptanz des ZNO
7.7.3 Schaffung eines objektiven, fairen und effektiven Zulassungsprozesses
7.8 Der Konflikt um die Rolle des ZNO im neuen Hochschulgesetz
7.8.1 Das ZNO in den Gesetzesinitiativen
7.8.2 Der Euromaidan und die Folgen für Hochschulgesetz und ZNO
7.9 Zusammenfassung und Ausblick
8 Zusammenfassung und Vergleich der Fallstudien
8.1 Ausgangslage und gesellschaftspolitischer Kontext
8.2 Reformziele
8.3 Implementierungsprozess
8.4 Reformoutput
8.5 Reformoutcomes
8.5.1 Korruptionsbekämpfung
8.5.2 Verbesserung des Hochschulzugangs
8.5.3 Akzeptanz der Reformen
8.6 Effizienz und Effektivität der Reformen
8.7 Herausforderungen und Ausblick
9 Diskussion der Forschungsergebnisse
9.1 Was macht Antikorruption erfolgreich? Implikationen der Ergebnisse für die Praxis
9.2 Forschungsausblick
10 Anhang: Liste der Interviews
Literaturverzeichnis
SPPS Soviet and Post-Soviet Politics and Society
Impressum
1 Abstract
Academic Corruption in Russia and Ukraine.A Comparative Analysis of the Performance of Anti-Corruption Measures in the Sphere of University Admissions
After the collapse of the Soviet Union and the political, economic and ideological transformation of the successor states, everyday corruption has become ubiquitous in the post-Soviet region. The education systems were particularly affected. Corruption in higher education has large-scale social repercussions: it weakens the quality of education and has detrimental consequences on economics, politics, ethics and equal opportunities.
This study focuses on the period from 2000 to 2014 and examines and compares patterns of corruption in the sphere of university admissions in Russia and Ukraine. It analyses the anti-corruption effects of standardized admission testing systems, which were introduced 2008 in Ukraine and 2009 in Russia. Despite a similar approach, the reforms had diverse outcomes: Ukraine successfully managed to reduce corruption considerably from the very beginning. This was not the case in Russia, where corruption during admissions persisted for years and decreased only slowly.
Based on an original theoretical framework and extensive qualitative field work – more than 50 respondents were interviewed in both countries – the research offers explanations for the divergent outcomes and discusses the broader implications of the study for the implementation of effective anti-corruption policies in the post-Soviet region and beyond.
The author:
Eduard Klein studied Sociology and East European Cultural Studies at the University of Bremen and the Saint Petersburg State University (2003-2009). He received his PhD at the University of Bremen (2016) and was a lecturer at the Free University Berlin (2014/15) and the University of Regensburg (2015). He works as a political advisor in the German Bundestag.
The foreword author:
Prof. Dr. Heiko Pleines is Head of the Department of Politics and Economics and Vice Director of the Research Centre for East European Studies at the University of Bremen. His main research interests are informal politics, opposition and mass media in authoritarian and hybrid regimes and energy politics in Central and Eastern Europe.
2 Vorwort
Herausforderungen der Korruptionsbekämpfung
Von Heiko Pleines
Ein großer Teil der Literatur zur Korruptionsbekämpfung konzentriert sich auf einfache Maßnahmen zur Reduzierung von Korruption und versucht allgemeingültige Erfolgsrezepte zu erstellen. Die häufig wenig beeindruckende Praxis der Korruptionsbekämpfung zeigt aber, dass einfache Formeln nicht automatisch zum Erfolg führen. Deshalb weist eine zunehmende Zahl von Experten darauf hin, dass die erfolgreiche Durchführung der entsprechenden Maßnahmen vom Willen der Entscheidungsträger und den Kapazitäten der für die Durchführung zuständigen Institutionen abhängt und dass Korruptionsbekämpfung auch unerwünschte Nebenwirkungen haben kann.
Im Hinblick auf die post-sozialistischen Staaten hat Krastev so bereits 1998 argumentiert, dass Medienberichterstattung und öffentliche Debatten über Korruption, die eine Folge der demokratischen und marktwirtschaftlichen Reformen sind, autoritäre Politiker fördern können, die Recht und Ordnung versprechen.1 Aktuelle Entwicklungen in Ungarn und Polen bestätigen die Einschätzung, dass Korruptionsbekämpfung von populistischen Kräften nicht nur als Wahlkampfslogan, sondern auch als Argument zur Einschränkung demokratischer Regeln benutzt werden kann.
In einer neueren Studie zur Korruptionsbekämpfung in Georgien identifiziert di Puppo drei sehr unterschiedliche Interessen der maßgeblich beteiligten Akteure: Zivilgesellschaftliche Organisationen orientieren sich an Fördermöglichkeiten und übernehmen damit die Konzepte und Prioritäten ihrer internationalen Sponsoren. Politiker in Regierungsverantwortung benutzten im georgischen Fall Slogans der Korruptionsbekämpfung als Argument für ihr Projekt der Schaffung eines „neuen“ Staates ohne Korruption. Oppositionspolitiker wiederum forderten im Kontext der Korruptionsbekämpfung vor allem mehr Transparenz und Kontrollen, da diese ihren Einfluss vergrößerten. Di Puppo geht außerdem davon aus, dass alle Akteure ihren Erfolg nicht am tatsächlichen Ausmaß der Korruption messen (oder dem, was sie dafür halten), sondern vor allem daran interessiert sind, ob ihr Verständnis von Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Meinung geteilt wird.2
In einem systematischeren Zugang, wie in der Tabelle auf Seite 17 zusammengefasst, lassen sich vier Strategien der Korruptionsbekämpfung unterscheiden, die im Folgenden ausgehend vom zentralen Ziel ihrer Initiatoren vorgestellt werden. Dadurch wird deutlich, dass Korruptionsbekämpfung von sehr unterschiedlichen Akteuren zu verschiedenen Zwecken instrumentalisiert werden kann und dass sich daraus völlig unterschiedliche Maßnahmenpakete und Erfolgsaussichten ergeben.
Das erklärte Ziel der transnationalen Anti-Korruptionsbewegung, die auf der zivilgesellschaftlichen Seite besonders prominent von Transparency International vertreten wird, aber auch auf staatlicher Seite z.B. durch die Konvention der OECD gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger nachhaltig unterstützt wird, ist die Umsetzung von Transparenz und Praktiken guten Regierens zur Förderung des Gemeinwohls. Korruption wird als Diebstahl von Mitteln gesehen, die der Staat nutzen könnte um öffentliche Dienstleistungen zu verbessern und als Perversion von Regeln, die legitime und effiziente Ergebnisse im öffentlichen Interesse sichern sollen. Zentrale Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung konzentrieren sich in diesem Kontext auf Regeln. Die Entwicklung und Durchsetzung klarer Regeln soll die Möglichkeiten für Korruption nachhaltig verringern. Regeln zur Transparenz von Entscheidungsprozessen und zur Rechenschaftspflicht und Kontrolle von Amtsträgern sollen gleichzeitig helfen Korruptionsfälle zu entdecken und strafrechtlich zu verfolgen.
Die Durchsetzung dieser Maßnahmen verlangt nicht zwingend eine altruistische politische Elite, die tatsächlich vorrangig am Gemeinwohl interessiert ist. In Demokratien ist der zentrale institutionelle Anreiz zur Förderung des Gemeinwohls, z.B. auch durch Korruptionsbekämpfung, das Streben nach Unterstützung durch die Wähler. Auch in autoritären Regimen kann es für die Machthaber wichtig sein, die Unterstützung der Bevölkerung durch populäre Maßnahmen zu sichern oder im Falle von Protesten zurückzugewinnen. Auch drohende Imageschäden durch internationale Kritik und besonders im Falle finanzschwacher Staaten auch der Wegfall internationaler Fördergelder können ein Motiv für durchgreifende Korruptionsbekämpfung sein.
Korruptionsbekämpfung muss aber nicht auf einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive beruhen. Ein pragmatisches Ziel der politischen Eliten bei der Korruptionsbekämpfung kann die Wiedererlangung der Kontrolle über die eigene Staatsverwaltung sein. Wenn Korruption weitverbreitet ist, dann bedeutet dies, dass die staatliche Verwaltung nicht den Vorgaben der Politik folgt, sondern sich vom meistbietenden Bestechungszahler kaufen lässt. Um die Umsetzung ihrer politischen Entscheidungen zu gewährleisten, muss die Regierung in einer solchen Situation Korruption bekämpfen. Die Strategie der Korruptionsbekämpfung konzentriert sich dann häufig auf Kontrollen und Säuberungen. Ein Kontrollorgan wird geschaffen oder mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet, um die Staatsverwaltung zu überprüfen. Aufgedeckte Korruptionsfälle werden nicht nur geahndet, sondern zur Abschreckung medienwirksam inszeniert.
Diese Art der Korruptionsbekämpfung verbessert selbst im Erfolgsfall nicht zwingend das Gemeinwohl, da die Wiedergewinnung der Kontrolle über die Staatsverwaltung auch nur den Interessen der politischen Eliten dienen kann. Das existierende politische Regime wird hier nicht in Frage gestellt und die politische Elite ist nicht Ziel der Korruptionsbekämpfung.
Ein weiteres Ziel der Initiatoren von Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung kann es sein, Exzesse zu verhindern, ohne Korruption grundsätzlich abschaffen zu wollen. Denn Korruption kann ein Ausmaß erreichen, das alle Aktivitäten abwürgt. In der Wirtschaft können so Investoren zur Aufgabe gezwungen werden. Hier ergeben sich für die politischen Eliten zwei Probleme. Wenn Unternehmen ihre Tätigkeit im Land einstellen, leidet die Wirtschaftspolitik und gleichzeitig entfallen Unternehmen auch als Quelle von Bestechungsgeld. Im Falle der im vorliegenden Buch behandelten Hochschulkorruption gilt eine ähnliche Logik. Wenn die allgemeine Annahme ist, dass Hochschulzeugnisse im Rahmen von Korruption einfach an die Meistbietenden versteigert werden, dann verlieren sie offensichtlich ihren Wert als Beleg vorhandener Qualifikationen. Bildungspolitik wird absurd und gleichzeitig schwindet das Interesse, Zeugnisse durch hohe Bestechungszahlungen zu erwerben. Um eine Hochschulbildung für potenzielle Studierende weiterhin so attraktiv zu machen, dass einerseits das Bildungssystem einigermaßen funktioniert und sich andererseits Bestechung lohnt, muss also durch Korruptionsbekämpfung der Eindruck vermittelt werden, dass es zumindest auch um Bildung und nicht nur um Bestechung geht. Gleichzeitig dürfen die von verschiedenen Instanzen geforderten Bestechungsgelder in der Summe nicht den erwarteten Wert der Hochschulbildung auf dem Arbeitsmarkt übersteigen.
Im Ergebnis beschränkt sich die Korruptionsbekämpfung in so einem Fall auf einen eng begrenzten Bereich, im obigen Beispiel das Hochschulwesen, vielleicht aber auch nur das Verfahren zum Hochschulzugang oder nur ausgewählte Hochschulen, deren Lobby nicht stark genug ist, Kontrollen abzuwenden. Korruptionsbekämpfung ist dabei zu einem großen Teil eine PR-Maßnahme, da das eigentliche Ziel nicht die Abschaffung von Korruption ist, sondern die Änderung der Wahrnehmung. Dabei wird zum einen den „Klienten“ suggeriert, dass sich ein Engagement lohnt, da sich nicht alles nur um Korruption dreht. Zum anderen wird aber auch den zuständigen Mitarbeitern staatlicher Stellen vermittelt, dass Bestechungsforderungen Grenzen haben, damit die Gans, die goldene Eier legt, nicht geschlachtet wird.
Grundsätzlich nicht auf eine Reduzierung von Korruption, sondern auf ihre Instrumentalisierung zielen Strategien der Korruptionsbekämpfung, die sich nur auf (politische) Gegner konzentrieren. In diesem Fall werden Korruptionsfälle heimlich erfasst oder auch konstruiert, um bei Bedarf zur Erpressung oder Diskreditierung verwendet zu werden.
Diese Strategie dient allein der Machtsicherung und setzt eine personalisierte, nicht an rechtsstaatlichen Regeln, sondern an den Interessen der herrschenden Eliten orientierte Funktionsweise von Teilen der Strafverfolgungsbehörden und auch der Justiz voraus. In einem solchen System können einige korrupt sein, weil entsprechende Beweise verschwinden oder vor Gericht abgewiesen werden, während andere bestraft werden, nicht weil sie korrupt sind, sondern weil sie mit den Machthabern im Konflikt sind.
Überblick über Strategien der Korruptionsbekämpfung
Ziel
Maßnahmen
Interessen/Motive
Gemeinwohl
klare Regeln, Rechenschaft und Transparenz
Altruismus
Popularität
Internationale Akzeptanz
Kontrolle der Staatsverwaltung
hierarchische Kontrollen und Säuberungen
Implementierung politischer Beschlüsse
Vermeidung von Exzessen
Kontrolle und PR: Korruption Grenzen setzen und Image verbessern
Zukünftiges privates Engagement und/oder Bestechungszahlungen sichern
Diskreditierung von Rivalen
Personalisierung: heimliche Überwachung und selektive Strafverfolgung
Machtsicherung
In konkreten Fällen der Korruptionsbekämpfung sind die Interessen der politischen Entscheidungsträger oft nicht eindeutig bestimmbar und können sich auch auf mehrere Ziele gleichzeitig beziehen. Hinzu kommt, dass weitere relevante Akteure, in der Staatsverwaltung, der Wirtschaft oder der Zivilgesellschaft ihre eigenen Interessen und Vorstellungen bezüglich der Korruptionsbekämpfung haben. Diejenigen, die von Korruption profitieren, sei es als Bestechungszahler, der unerlaubte Vorteile erhält, oder als Empfänger, der sich bereichert, bilden eine umso stärkere Lobby je größer das Ausmaß der Korruption ist. Im Ergebnis ist Korruptionsbekämpfung immer eine Auseinandersetzung in einem Geflecht widersprüchlicher Interessen.
Die hier als Buch vorgelegte Dissertation von Eduard Klein befasst sich am Beispiel der Bildungskorruption in Russland und der Ukraine genau mit diesem Aspekt. Das primäre Erkenntnisinteresse ist auf die Möglichkeiten der Korruptionsbekämpfung gerichtet, während der Bildungssektor und konkret die universitären Aufnahmeprüfungen als geeigneter Untersuchungsfall und nicht im Hinblick auf bildungstheoretische Fragestellungen ausgewählt wurden. Dementsprechend bezieht sich der analytische Rahmen der Arbeit, von der Forschungsfrage über den Forschungsstand bis zum theoretischen Ansatz auf die Korruptionsforschung. Der Autor argumentiert zurecht: „Während die Ursachen und Folgen von Korruption bereits seit den 1970er Jahren Gegenstand unzähliger Forschungsarbeiten sind, steht die wissenschaftliche Erforschung von Antikorruptionsmaßnahmen noch relativ am Anfang und ist erst in den letzten Jahren in den Fokus des wissenschaftlichen Diskurses gerückt.“
Da die interdisziplinäre Forschung zu einem so vielfältigen Phänomen wie Korruption bereits bei der Frage der Ursachen so ziemlich alle Aspekte gesellschaftlicher Beziehungen aufgegriffen hat, wie auch die von Eduard Klein zum Forschungsstand erstellte Tabelle exemplarisch (und bei Weitem nicht umfassend) verdeutlicht, ist die Frage nach Antikorruptionsmaßnahmen prinzipiell genauso komplex, da sie ja bei jeder der vermuteten Ursachen ansetzen kann. Hier findet Eduard Klein einen gelungenen Ansatz, in dem er die Reform der durch Korruption geprägten universitären Aufnahmeprüfungen in Russland und der Ukraine im Hinblick auf die Erfolge bei der Korruptionsbekämpfung untersucht.
Aufgrund der gemeinsamen sowjetischen Vergangenheit, die das Hochschulwesen und auch die Haltung der Bevölkerung zu Bildung weiterhin prägt, ist die Ausgangssituation in beiden Ländern sehr ähnlich. Gleichzeitig haben beide mit der leicht zeitversetzten Einführung einer einheitlichen, zentral organisierten Zulassungsprüfung eine fast identische Reform durchgeführt, die als eines der erklärten Ziele die Korruptionsbekämpfung hatte. Trotz der sehr ähnlichen Bedingungen war aber die Reform in der Ukraine deutlich erfolgreicher als in Russland. Als zentralen Erklärungsfaktor macht Eduard Klein hier die Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Organisationen als Kontrollorgan aus. Damit hat er die Möglichkeit seine Analyse auf einen Aspekt der Korruptionsbekämpfung zu fokussieren.
Da Korruption und auch der Erfolg von Korruptionsbekämpfung aber offensichtlich nicht monokausal zu erklären sind und viele interdependente Prozesse umfassen, ist eine umfangreiche Einbeziehung des Kontextes unverzichtbar. Zu einem so komplexen und schwer fassbaren Thema wie Korruption ist dabei die erforderliche Datensammlung sowohl eine organisatorische als auch eine intellektuelle Herausforderung. Über 50 umfangreiche Interviews, u.a. auch mit zentralen Akteuren der untersuchten Reform, die software-basiert mit Hilfe von 600 Codes erschlossen wurden, stellen einen Kern der Fallstudien dar. Ein zweiter Schwerpunkt ist eine umfangreiche Dokumentenanalyse von Rechtstexten über Stellungnahmen und Erfahrungsberichten zur Reform bis zur Medienberichterstattung. Die Situation des Hochschulwesens wurde zusätzlich mit Hilfe deskriptiver Statistik analysiert und die Haltung der Bevölkerung mit Hilfe von Meinungsumfragen erfasst. Im Fall der Ukraine, wo zivilgesellschaftliche Organisationen am Verfahren beteiligt sind, gelang Eduard Klein sogar eine teilnehmende Beobachtung, indem er als offiziell registrierter Beobachter die Aufnahmeprüfungen an mehreren Testorten begutachtete.
Durch eine intensive Prüfung und Hinterfragung des gesammelten Materials gelingt es Eduard Klein, ein beeindruckend vollständiges und schlüssiges Bild von Korruption im Umfeld der Zulassung zum Hochschulstudium, von der Entstehung der Reformprojekte und von ihrer Implementierung und Wirksamkeit zu entwerfen. Durch eine detaillierte Beschreibung der Vielzahl der informellen bis illegalen Methoden zur Umgehung der offiziellen Zugangsbeschränkungen und das Aufzeigen des Erfindungsreichtums der Akteure bei der Pervertierung neuer Kontrollen, liefert die Dissertation tiefe Einblicke in die Funktionsweise von Korruption, die weit über das Zuweisen eines klaren Ursachenbündels hinausgehen. Die Dissertation vermittelt so ein tiefes Verständnis für den Kontext von Korruption und auch für zentrale Aspekte von Hochschulwesen und Hochschulreform in den beiden Untersuchungsländern. Auf einer abstrakteren Ebene – weitgehend unabhängig vom Länderkontext und Hochschulkontext – demonstrieren die Fallstudien gleichzeitig anschaulich und eindrücklich die Komplexität des Phänomens, die Vielfalt der möglichen Perspektiven und damit auch die Schwierigkeit über eindeutige rechtliche Definitionen und nicht manipulierbare Maßnahmen Korruption zu bekämpfen.
Im Ergebnis leistet Eduard Klein eine sehr differenzierte Analyse, die in ihrer Komplexität weit über das hinausgeht, was zu diesem Thema bisher vorliegt. Es passt zu dieser Darstellungsweise, dass trotz der markant formulierten These von der Zivilgesellschaft als zentralem Erfolgsfaktor am Ende doch ein deutlich differenzierteres Bild steht. In Russland gibt es 2014 einen „Neustart“ mit Fragezeichen und in der Ukraine wurde die Reform nach der Präsidentenwahl von 2010 fast wieder rückgängig gemacht, bevor sie ab 2014 mit neuem Schwung vorangetrieben wurde.
Gleichzeitig erlaubt es der offene Zugang zu den Fallstudien (anstelle einer auf einfache Kausalmechanismen fokussierten Analyse), auch weitere Effekte der Reformen, wie etwa die Frage der sozialen Gerechtigkeit beim Hochschulzugang, mit in den Blick zu nehmen. Dadurch wird deutlich, dass Korruptionsbekämpfung kein Selbstzweck ist und immer weitere Implikationen hat, die sowohl für ein Verständnis der Implementierungsprobleme als auch eine Bewertung des „Erfolges“ mit berücksichtigt werden müssen.
1 Krastev, Ivan (1998): Dancing with anticorruption, East European Constitutional Review No.3, 56-58.
2 Di Puppo, Lili (2010): Anti-corruption interventions in Georgia, Global Crime 11(2): 220-236.
3 Einleitung
„Corruption in education acts as a dangerous barrier to high-qualityeducation and social and economic development. It jeopardises theacademic benefits of higher education institutions and may even leadto the reputational collapse of a country’s entire education system“.(Huguette Labelle, Vorsitzende von Transparency International)
Die vorliegende Arbeit widmet sich zwei Themen von zentraler gesellschaftlicher Bedeutung: Bildung und Korruption. Bildung ist ein wesentlicher Schlüssel für die persönliche und soziale Entwicklung. In der globalisierten Wissensökonomie des 21. Jahrhunderts ist qualitativ hochwertige Bildung ein zentraler Wirtschaftsfaktor, legt gut ausgebildetes Fachpersonal mehr denn je das Fundament für die ökonomische Prosperität eines Staates. An den Hochschulen werden die zukünftigen Eliten und Leistungsträger ausgebildet, die ein funktionierender Staat für seine Wirtschaft, Politik, Justiz sowie im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen und in vielen weiteren Bereichen benötigt. Neben der Qualifizierung und Vermittlung von Wissen besitzt Bildung die Funktion, gesellschaftliche und kulturelle Werte und Normen zu vermitteln, und macht uns alle letztlich zu den Menschen, die wir sind. Daher stellt der freie Zugang zu Bildung auch ein zentrales Menschenrecht dar und wird in Artikel 26 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ deklariert:
„Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.“1
Korruption ist ein Hindernis für das universelle Recht auf Bildung. Sie beeinträchtigt nicht nur die Qualität der Bildung, sondern unterminiert vor allem auch die individuellen Bildungschancen. Bildung sollte diskriminierungsfrei und für alle gleichermaßen zugänglich sein, d. h. der Zugang sollte nach meritokratischen Kriterien wie Fähigkeit und Leistung erfolgen, und nicht auf Grundlage von informellen Absprachen oder Korruption. Die UNO, die den universellen Bildungszugang zu einem zentralen Entwicklungsziel erklärt hat, postuliert in ihrem Programm „Education for All“ (EFA): „Improvement of governance, including reduction of corruption, is key to achievement of the EFA goals“ (UNESCO 2008, S. 20).
Korruption im Bildungswesen ist, vor allem außerhalb der hochentwickelten Industriestaaten, ein verbreitetes Phänomen mit unterschiedlichen Ausprägungsformen. Die Problematik der Bildungskorruption lässt sich anhand ihrer negativen Auswirkungen verdeutlichen: Bildungskorruption schränkt nicht nur die individuellen Bildungschancen ein, sondern betrifft überproportional oft die schwächsten Gesellschaftsmitglieder: Laut dem Transparency International Global Corruption Barometer 2010 (Transparency International 2010) sind Personen aus einkommensschwachen Schichten doppelt so oft mit Korruption konfrontiert wie Personen aus einkommensstarken Schichten. In Bildungssystemen mit ubiquitärer Korruption werden bereits marginalisierte Schichten weiter an den gesellschaftlichen Rand gedrängt, da sie sich im Gegensatz zu den Eliten weder Studienplätze noch Leistungsnachweise oder Diplome auf informellen Wegen leisten können. Bildungskorruption institutionalisiert und reproduziert soziale Ungleichheiten.
Ein von Korruption durchdrungenes Bildungssystem wirkt sich negativ auf die Qualifizierung breiter Teile der Gesellschaft aus. Korruption untergräbt die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems, da gute Noten nicht mehr für gute Leistungen vergeben werden, sondern gekauft werden können. Dies führt zu einer adversen Elitenselektion und ist langfristig betrachtet ein Hindernis für ökonomischen und gesellschaftlichen Wohlstand und politische Stabilität. Die durch Bildungskorruption verursachten Kosten sind nicht nur monetärer Natur und ihre Folgen somit nur schwer in Zahlen zu messen und auszudrücken. Bildungskorruption kann sogar tödliche Folgen haben: Der ukrainische Arzt Andrij Sljusarčuk war in seiner Heimat sehr populär und behandelte zwei Präsidenten. Nach mehreren tragischen Todesfällen unter seinen Patienten deckte eine Zeitung 2011 auf, dass Sljusarčuk nie Medizin studiert, sondern seinen Hochschulabschluss gekauft hatte. Er hätte niemals als Arzt praktizieren, geschweige denn komplizierte Operationen durchführen dürfen. Ermittlungen ergaben, dass er mindestens 12 Patienten sprichwörtlich „zu Tode operiert“ hatte. 2014 wurde Sljusarčuk dafür zu einer achtjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.
Nicht in jedem Fall hat Bildungskorruption derart tragische Folgen. Dennoch lernen und verinnerlichen Schüler2 und Studierende in einer prägenden Sozialisationsphase die ungeschriebenen, informellen gesellschaftlichen Spielregeln und erfahren aus erster Hand, dass sich Korruption für sie auszahlt und in der Regel keine negativen Konsequenzen nach sich zieht. Da von den Studierenden über die Professoren bis zu den politischen Eliten praktisch alle Gesellschaftsschichten an Bildungskorruption beteiligt sind, wird sie als normativer Standard akzeptiert, habitualisiert und institutionalisiert. Einmal verinnerlicht, wird Korruption auch nach dem Ausscheiden aus dem Bildungssystem als legitime Handlungsoption wahrgenommen. Dabei obläge es paradoxerweise gerade den Schulen und Hochschulen, durch Bildungsprogramme, Aufklärung und Vermittlung ethischer und integrer Verhaltensstandards für Korruption zu sensibilisieren und über normative Präventionsmaßnahmen Korruption entgegenzuwirken. Ein korruptes Bildungssystem kann dies nicht leisten, sondern institutionalisiert Korruption im Gegenteil noch.
Während das Studium in der Sowjetunion kostenlos war, führten die postsowjetischen Staaten angesichts der nahezu verdreifachten Studierendenzahlen bei gleichzeitig sinkenden staatlichen Bildungsetats Studiengebühren ein. Es entstand ein zweigliedriges System mit kostenlosen „Budget“-Studienplätzen für die besten Studienbewerber und kostenpflichtigen „Kontrakt“-Studienplätzen für alle anderen Bewerber. Die Hochschulen schufen dadurch die Möglichkeit, sich trotz sinkender staatlicher Einnahmen zu finanzieren; gleichzeitig konnte durch diesen nachfrageorientierten Finanzierungsmechanismus der steigende Bedarf an Hochschulbildung gedeckt werden.
Die Budgetplätze genossen einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert als die gebührenpflichtigen Plätze, und der Konkurrenzkampf darum war besonders an den renommierten Hochschulen sehr stark. Um einen kostenlosen Studienplatz an einer durchschnittlichen Universität zu erhalten, reichten in der Regel gute Schulnoten aus und vielleicht noch Vorbereitungskurse für die universitären Aufnahmeprüfungen. Ähnliches galt für eigenfinanzierte Kontrakt-Studienplätze: Da die meisten Hochschulen durch das neue Finanzierungsmodell auf Studiengebühren angewiesen waren, wurden die Zulassungsvoraussetzungen derart gesenkt, dass praktisch alle zahlungswilligen Bewerber angenommen wurden.
Anders verhielt es sich mit den kostenlosen Studienplätzen an den renommierten Hochschulen (dazu zählen in erster Linie die traditionsreichen klassischen Universitäten), die viel weniger Budgetplätze anboten, als sie Bewerber darauf hatten. Um an solch einer Universität einen Budgetplatz zu erhalten, gab es praktisch drei Möglichkeiten, die sich sowohl vom Grad der Informalität als auch von den Erfolgsaussichten deutlich unterschieden:
a) Formeller Weg: Man zählte zu den absolut besten Bewerbern und vertraute auf sein Ergebnis bei den Auswahlprüfungen (großes Risiko, nicht angenommen zu werden)
b) Semi-formeller Weg: Man engagierte einen privaten Nachhilfelehrer („Repetitor“), der idealerweise an der angestrebten Universität tätig war und die Zulassungsprüfungen kannte (mittleres Risiko, nicht angenommen zu werden)
c) Informeller Weg: Man nutzte seine informellen Netzwerke oder korrupte Praktiken wie Bestechung, um das formelle Zulassungsverfahren zu umgehen (geringes Risiko, nicht angenommen zu werden).
Die Auswahlprüfungen waren zwar an jeder Universität unterschiedlich, die meisten wurden aber mündlich abgehalten, sodass es großen diskretionären Spielraum gab und die Ergebnisse leichter manipulierbar waren als z. B. bei schriftlichen Aufnahmetests. Da die Prüfungen üblicherweise landesweit zur selben Zeit stattfanden, konnten sich die Bewerber in der Regel nur an einer Hochschule bewerben. Das erhöhte den Druck, die Prüfung zu bestehen. Um den wertvollen Platz zu sichern, waren daher viele Bewerber bzw. deren Eltern dazu bereit, den informellen Weg zu gehen:
„Both the applicants to those institutions and their parents deem it a worthwhile enterprise to offer bribes to secure a spot in these institutions. […] Often much-less-qualified applicants take up spots that should have gone to more deserving students.“ (Johnson 2004, S. 83f.)
Bewerber, denen dafür die Mittel oder die Kontakte fehlten, hatten das Nachsehen. Korruption und informelle Praxen bei der Hochschulzulassung hebelten die Chancengleichheit aus; die Aufnahme eines Studiums hing immer stärker von der soziökomischen Herkunft der Bewerber ab, wie folgendes Beispiel aus dem Interviewmaterial dieser Arbeit zeigt: Ein Student aus Samara erzählte, dass er eigentlich an einer großen staatlichen Universität der Stadt Jura studieren wollte. Er war einer der besten Schüler seiner Schule und besaß exzellente Noten. Er kam aber aus einem Dorf etwas außerhalb der Stadt, und seine Eltern waren weder wohlhabend noch verfügten sie über gute Beziehungen. Als er zur Auswahlprüfung seiner Wunschuniversität erschien, lachte ihn die Auswahlkommission aus und sagte, dass er für 15.000 US-Dollar (USD) gerne einen Jura-Studienplatz sichern könne. Resigniert schrieb er sich daraufhin an einer weniger renommierten Hochschule der Stadt für einen anderen Studiengang ein. Einem motivierten und intelligenten jungen Menschen, der vielleicht ein hervorragender Jurist geworden wäre, wurden seine Zukunftspläne durch Korruption verbaut.
Die systemische Korruption im Rahmen der Studienplatzvergabe an russischen und ukrainischen Hochschulen bedeutete nicht, dass grundsätzlich alle Studienbewerber für einen Studienplatz bezahlen mussten. Vielmehr war es so, dass die Massenuniversitäten für die meisten Bewerber zugänglich waren, während die guten Universitäten, und damit qualitativ hochwertige Bildung, ohne Geld oder Kontakte nahezu unerreichbar wurden.
Dieses strukturelle Problem sollte durch eine Reform des Zulassungssystems in Russland und der Ukraine durchbrochen werden, um begabten Bewerbern, die nicht über das ökonomische oder soziale Kapital zur informellen Sicherung eines Studienplatzes verfügten, Zugang zu renommierten Hochschulen und einer guten Ausbildung zu ermöglichen. Die Untersuchung der Reformen, ihrer Implementierung sowie ihrer Auswirkungen auf Korruption stehen im Mittelpunkt der Dissertation. Bildungskorruption aufzudecken, zu systematisieren und zu analysieren und ihre komplexen Ursachen, Formen und Folgen zu verstehen, ist die zentrale Aufgabe der vorliegenden Arbeit.
3.1 Gliederung
Das erste Kapitel führt in das Problemfeld Korruption ein. Der Untersuchungsgegenstand, die Bildungskorruption in Russland und der Ukraine, wird anhand des aktuellen Forschungsstandes detailliert beschrieben, um daraus ableitend das Erkenntnisinteresse und die Fragestellung zu formulieren. Das Kapitel schließt mit der Erläuterung des methodischen Ansatzes und der Beschreibung des empirischen Materials.
Bevor es zu den beiden Fallstudien geht, nähern sich das zweite und dritte Kapitel dem untersuchten Phänomen aus theoretischer Perspektive an. Der aktuell den Korruptionsdiskurs dominierende ökonomische Ansatz von Korruption als rationalem, mit dem Principal-Agent-Client-Modell erklärbarem Tauschakt, wie ihn z. B. Klitgaard (1988) vertritt, wird erweitert um ein die postsowjetischen Spezifika besser berücksichtigendes Modell von Korruption als sozialer Beziehung nach Höffling (2002). Das in dieser Arbeit entwickelte Mehr-Ebenen-Modell von Korruption greift auch auf Ideen des neoinstitutionalistischen Korruptionskonzepts von Dietz (1998) zurück. So lassen sich nicht nur die individuellen korruptiven Handlungen der Akteure auf der Mikroebene, sondern auch die gesamtgesellschaftliche Ausbreitung der Bildungskorruption auf der Meso- und Makroebene erklären. Zugleich enthält es Ansätze für die Praxis, wie sich Korruption verringern ließe. Anschließend wird in Kapitel 3 der Kontext – Ursachen, Ausmaß, Formen und Folgen – der ubiquitären Bildungskorruption in Russland und der Ukraine erläutert.
Ausgestattet mit diesem fundierten theoretischen Hintergrund widmen sich Kapitel 4 (Russland) und 5 (Ukraine) den einzelnen Fallstudien, wobei diese einer ähnlichen Grundstruktur folgen und die Genese der untersuchten Antikorruptionsreformen in beiden Ländern nachzeichnen. Dabei steht der Implementierungsprozess der Antikorruptionsreformen im Zentrum der Betrachtung. Den Abschluss der beiden Fallstudienkapitel bildet die Analyse der Auswirkungen der Reformen, wobei der Schwerpunkt auf den Antikorruptionseffekten liegt. Dabei wird deutlich, dass sich die Reformansätze beider Länder trotz vieler äußerlicher Gemeinsamkeiten in grundsätzlichen Aspekten unterscheiden, was letztlich auch zu unterschiedlichen Reformeffekten führt.
In Kapitel 6 werden beide Fallstudien hinsichtlich Implementierung, Output und Outcomes der Reform systematisch analysiert und verglichen, um im folgenden Schritt Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze auszuarbeiten. Gegenwärtige Probleme und Herausforderungen für die Reformen in beiden Ländern runden diesen Teil der Arbeit ab.
Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse in Kapitel 7 im breiteren Kontext der aktuellen (Anti-)Korruptionsforschung diskutiert und die Ursachen für die unterschiedlichen Reformeffekte erklärt, was auch für die Praxis von Relevanz ist.
3.2 Forschungsstand
Obwohl Korruption bereits im babylonischen „Codex Hammurabi“, einer der ersten menschlichen Sammlungen von Rechtssprüchen aus dem 18. Jahrhundert v. Chr., erwähnt wird und somit seit Jahrtausenden bekannt ist, begann die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Phänomens erst in den 1960er Jahren. Inzwischen lässt sich die Vielzahl an interdisziplinären Abhandlungen zum Thema kaum noch überblicken. Doch trotz ihrer jahrzehntelangen Tradition und ihrer Interdisziplinarität stößt die Korruptionsforschung bei der Begriffsbestimmung sowie der Messung von Korruption an ihre Grenzen. Weder gibt es eine einheitliche und allgemein gültige Definition – die für die vorliegende Arbeit verwendete Definition wird zu Beginn des theoretischen Kapitels erarbeitet – noch exakte Messinstrumente zur Erfassung der Korruption.
Es folgt ein Überblick über die einschlägige Literatur zu Korruption im Allgemeinen, bevor die Forschung zu Korruption und Antikorruptionsmaßnahmen im postsowjetischen Raum aufgearbeitet und schließlich die Literatur zu Bildungskorruption zusammenfasst und eingeordnet wird.
Während zu Beginn der Erforschung von Korruption diese häufig noch als funktional für den gesellschaftlichen Modernisierungsprozess angesehen und mit positiven Effekten verbunden wurde, wie z. B. aus den Arbeiten von Nye (1967) oder Leff (1964) hervorgeht, manifestierte sich spätestens mit den viel beachteten Aufsätzen „Corruption“ von Shleifer und Vishny (1993) sowie „Corruption and growth“ von Mauro (1995) ein Verständnis von Korruption als dysfunktionalem Entwicklungshindernis. Stellvertretend für den Versuch, die Ursachen von Korruption mithilfe quantitativer Studien zu eruieren, stellt Treismans „The causes of corruption“ (2000) dar. Allerdings basiert seine Arbeit wie die Mehrzahl der auf quantitativen Daten beruhenden internationalen Vergleichsstudien auf Korruptionswahrnehmungsindizes und makroökonomischen Variablen, die das Phänomen nur äußerst oberflächlich und unscharf erfassen und daher zunehmend kritisiert werden (Lugon-Moulin 2010; Rose und Mishler 2010; Olken 2009; Sík 2002; Knack 2007).
Die stark ökonomisch geprägte Korruptionsforschung griff im Zuge der aufstrebenden Neuen Institutionenökonomik (North 1990; Scott 1995; Helmke und Levitsky 2004; Meyer 2008b) in jüngerer Zeit stärker auf deren Ansätze zurück (Lambsdorff 2007; Johnston 2005; Uslaner 2008; Gel’man 2012; Lambsdorff et al. 2005; Lauth 1999; Dietz 1998; Aidt 2009).4 Die Institutionenökonomik-basierte Korruptionsforschung berücksichtigt explizit auch kulturelle, normative, historische und soziale Aspekte wie z. B. Vertrauen, ethische Verhaltenskodizes oder Reziprozitätsnormen und ermöglicht dadurch ein besseres Verständnis der Problematik, da Korruptionsursachen häufig nicht nur unmittelbar in rational-ökonomischen Überlegungen liegen, sondern auch im soziokulturellen Kontext. Dabei verneinen diese Arbeiten nicht die rationalen Motive hinter korruptiven Handlungen, sondern ergänzen sie dort, wo die ökonomischen Modelle nicht greifen; denn wie Tanzi richtig festhält:
„Some public officials will be corrupt perhaps because of their own psychological or moral makeup, or because some of the bribes offered may be too large for some officials to resist. […] Not all officials respond in the same way to the same incentives.“ (Tanzi 1998, S. 572)
Einen dezidiert soziologischen Blickwinkel wählt die Arbeit von Höffling (2002), der Korruption als „soziale Beziehung“ versteht, die nicht aus ökonomischen Motiven entstünde, sondern vielmehr ein Handlungsresultat aus den komplexen sozialen Strukturen und Beziehungen sei.
Was die Determinanten von Korruption angeht, gibt es inzwischen eine kaum noch überschaubare Anzahl an Arbeiten. Dabei lässt sich grundsätzlich in ökonomische, politische bzw. institutionelle sowie soziale Faktoren unterscheiden (vgl. Tabelle 1).
1 Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ findet sich unter www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf, zuletzt geprüft am 29.10.2015.
2 Es wird versucht, der geschlechtergerechten Sprache Rechnung zu tragen, soweit es den Lesefluss nicht beeinträchtigt. Hierfür wird vor allem auf Neutralisierungsformen zurückgegriffen, z. B. Studierende, anstatt Studenten bzw. Studentinnen. Sollte die Benutzung eines Geschlechts erfolgen, impliziert sie auch das nicht genannte Geschlecht. Trotz der überwiegend verwendeten männlichen Anredeform wird gleichermaßen von Schülerinnen, Studentinnen, Lehrerinnen, Professorinnen, Politikerinnen, Testleiterinnen, Beamtinnen etc. gesprochen, sofern nicht explizit anders angegeben.
3 Ein ähnlich umfassendes Werk in deutscher Sprache ist der von Alemann (2005) herausgebrachte Sonderband „Dimensionen politischer Korruption“.
4 Ein guter Überblick über diesen stetig wachsenden Forschungsstrang findet sich in Pech (2009).
Tabelle 1: Determinanten von Korruption
Economic Factors
Political & Legal Factors
Social Factors
Competition
Shleifer und Vishny(1993); Ades und Di Tella(1997)
Accountability
Henisz(2000)
Culture
Paldam(2002); Banuri und Eckel(2012)
Economic freedom
Paldam(2002); Goel und Nelson(2005)
Administrative / political inefficiency
Gupta et al.(2000)
Education
Treisman(2000); Uslaner und Rothstein(2016); Truex(2011); Ades und Di Tella(1999)
Economic growth
Paldam(2002)
Anti-corruption policy
Hanna et al.(2011); Shah(2007); Krastev(2004)
Ethical separation
Mauro(1995); Treisman(2000)
Globalization / International Integration
Sung und Chu(2003); Sandholtz und Koetzle(2000)
Bureaucracy
Tanzi(1998); Kaufmann und Wei(1999)
Ethics
Treisman(2000); Homann(1997)
Income distribution
Paldam(2002); Gupta et al.(1998)
Civil participation and press freedom
Shen und Williamson(2005); Mungiu-Pippidi(2015); Stapenhurst(2000)
Gender
Sung und Chu(2003);
Inflation
Braun und Di Tella(2004); Paldam(2002); Treisman(2007)
Communist past
Miller et al.(2001); Holmes(2006); Obydenkova und Libman(2015)
Geography / History
Goel und Nelson(2008); Knack und Azfar(2003)
Natural resource
Ades und Di Tella(1999); Leite und Weidmann(1999)
Decentralization
Shleifer und Vishny(1993); Rose-Ackerman(1999); Treisman(2000); Paldam(2002)
Human development
Rose-Ackerman und Truex(2012)
Openness / Transparency
Paldam(2002); Rose-Ackerman(1996)
Delegation of power
Klitgaard(1988); Ades und Di Tella(1997)
Migration
Dimant et al.
Percapita income
Braun und Di Tella(2004); Serra(2006)
Democracy
Ades und Di Tella(1997); Treisman(2007); Rose-Ackerman(1999); Sandholtz und Koetzle(2000)
Population size
Knack und Azfar(2003)
Poverty
Gupta et al.(1998)
Government size
Goel und Nelson(1998)
Religion
Treisman(2000); Paldam(2002)
Regulations
Tanzi(1998); Treisman(2000)
Legal systems
Ades und Di Tella(1997); Theobald(1990)
Trust
Uslaner(2004); Graeff(2005); Rothstein und Eek(2009)
Taxation
Tanzi(1998)
Penalty system
Shleifer und Vishny(1993); Tanzi(1998)
Urbanization
Treisman(2000)
Trade openness
Ades und Di Tella(1999); Treisman(2000)
Political competition
Rose-Ackerman(1999); Shleifer und Vishny(1993); Braun und Di Tella(2004)
Values
Truex(2011)
Wages
Weder und van Rijckeghem(1997); van Veldhuizen(2013); Tanzi(1998)
Political instability
Treisman(2000); Leite und Weidmann(1999)
Property rights
Acemoglu und Verdier(1998)
Quelle: Zusammengestellt nach Dimant (2013, S. 14) mit eigenen Ergänzungen.
Korruption im postsowjetischen Raum
Mit dem Zerfall der Sowjetunion rückten die postsowjetischen Länder stärker in den Fokus der Korruptionsforschung. Trotzdem ist Korruption im postsowjetischen Raum in der Fachliteratur noch immer unterrepräsentiert (Schmidt 2007).
Eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten beleuchtet den Zusammenhang von Korruption und postsowjetischer Transformation (Åslund 2002; Wedel 2003; Volkov 2002; Varese 2001; Cheloukhine und Haberfeld 2011). Der Transformationsprozess in den postsowjetischen Staaten schuf nicht nur vielfältige Freiräume für Korruption, sondern auch eine neue Schicht von sog. Oligarchen, die sich in den 1990er Jahren auf Kosten der Allgemeinheit bereicherten und zu einflussreichen wirtschaftlichen und politischen Akteuren aufstiegen (Pleines 2005b; Stewart et al. 2012). Hervorzuheben ist die Arbeit von Hellman et al. (2000a), die dem postsowjetischen Phänomen der Aneignung staatlicher Strukturen durch wirtschaftliche Akteure einen Namen gab: state capture. Durch informelle Praxen und ihre Nähe zur Politik wirkten die Oligarchen massiv zu ihren Gunsten auf Privatisierungsauktionen und Gesetzgebungsprozesse ein, setzten auf ihre Unternehmen zugeschnittene Gesetze durch und übernahmen somit de facto die Kontrolle über die staatlichen Institutionen.1
Miller et al. (2001) gehen in ihren Fokusgruppendiskussionen nicht dieser grand corruption auf den höchsten staatlichen Ebenen nach, sondern der Alltagskorruption zwischen einfachen Bürgern und Beamten. Sie untersuchen, inwieweit sich in Ostmitteleuropa eine „Kultur der Korruption“ ausgebildet hat. Morris und Polese (2014b) beleuchten die postsozialistische informelle Ökonomie – schätzungsweise bis zu 50% der ukrainischen und der russischen Wirtschaft zählen zum informellen Sektor – und wie sich die Informalität auf den Alltag der Menschen auswirkt. Der Sammelband „Political corruption in transition“ von Kotkin und Sajó (2002) geht u. a. der Frage nach, weshalb kommunistisch und klientelistisch geprägte Gesellschaften korruptionsanfällig sind. Klientelistische und informelle soziale Netzwerke2 als „Fundament“ für Korruption thematisieren implizit auch die Arbeiten von Ledeneva: In ihrer viel beachteten empirischen Studie „Russia’s economy of favors. Blat, networking and informal exchange“ (1998) untersucht sie die historischen, sozioökonomischen und kulturellen Aspekte des (postsowjetischen) Blat – informelle Netzwerke, die in der sowjetischen Mangelwirtschaft zur Beschaffung defizitärer Güter unter Umgehung formaler Regeln und Prozeduren entstanden. Die teils über Jahrzehnte gewachsenen Blat-Netzwerke überstanden die postsowjetische Monetarisierung und existieren heute als Gefälligkeitsnetzwerke weiter, die u. a. Zugang zu exklusiven, häufig nicht käuflichen Dienstleistungen schaffen – wie z. B. Studienplätzen an renommierten Hochschulen.
Zwei weitere Arbeiten problematisieren die kommunistische Vergangenheit des postsowjetischen Raumes: Karklins‘ (2005) „The system made me do it“ macht drei postkommunistische Korruptionstypen aus: (systemische) Alltagskorruption (meist Bestechung zur Umgehung von Regeln), Korruption öffentlicher Institutionen (z. B. Selbstbedienung aus öffentlichen Mitteln durch Beamte) sowie politische Korruption (z. B. Missbrauch legislativer Macht). Obydenkova und Libman (2015) weisen am Beispiel Russlands nach, dass die Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KDPSU) ein pfadabhängiger3 korruptionsfördernder Faktor ist: In den russischen Regionen, in denen es gemessen an der Bevölkerung mehr Parteimitglieder gab, liege heute die Korruptionsbereitschaft höher als in den Landesteilen, die weniger Parteimitglieder verzeichneten.
Ein Erbe der kommunistischen Ära ist die enge Verflechtung von Staat und Wirtschaft, die zwangsläufig zu Interessenkonflikten führe und „parochiale Korruption“ fördere, wie die Arbeiten von Stykow (2006; 2004) nahelegen. Ihr zufolge seien in Russland weniger die fehlerhaften Reformen und intransparenten Privatisierungen der Transformationsphase für das hohe Korruptionsausmaß ursächlich, sondern die unvollständige Ausdifferenzierung der Bereiche Wirtschaft und Politik, die trotz der liberalen Reformen weiterhin eng verzahnt geblieben und unter Putin wieder näher aneinander gerückt seien.
Die hohe Toleranz der Bevölkerung gegenüber Korruption habe laut Rimskii (2013) inzwischen aus Korruption eine informelle Norm gemacht (zum Zusammenhang von informellen Normen und Korruption im postsowjetischen Raum siehe auch Grødeland (2010a)). Gel’man (2012) beobachtet eine informal institutionalization im postkommunistischen Russland: Subversive Institutionen mit negativen Effekten, z. B. Klientelismus, Korruption oder selektive Rechtsanwendung, verhinderten die Entstehung von inklusiven Institutionen (Acemoglu und Robinson 2012), die positive gesellschaftliche Effekte erzielen könnten; die Korruption setze sich immer stärker fest.
Diesen Effekt belegen auch die empirischen Arbeiten von Satarov, der am renommierten Moskauer INDEM-Institut arbeitet, das seit Jahren für qualitativ hochwertige Korruptionsforschung steht. Die INDEM-Umfragedaten zeigen, dass die russischen Bürger von Beamten korruptes Verhalten erwarten, während Beamte sich dazu legitimiert sehen, informelle Einnahmen aus ihrem Amt zu erwirtschaften. „The outcome is a society where corruption becomes part of the social norms of everyday life.“ (Levin und Satarov 2000, S. 130). 2013 gab Satarov mit dem 750 Seiten umfassenden Sammelband „Russische Korruption: Niveau, Struktur und Dynamik. Ergebnisse einer soziologischen Analyse“ (Satarov 2013) das bisher wohl umfangreichste Werk zu Korruption in Russland heraus. Darin wird auf Grundlage der von INDEM erhobenen Daten der letzten 15 Jahre Korruption auf allen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen beleuchtet, von grand corruption in Wirtschaft und Politik bis zur petty corruption zwischen einfachen Bürgern und Beamten im Justiz-, Gesundheits- und Bildungssektor. Das Material von INDEM ist insofern einzigartig im postsowjetischen Raum, als dass es über einen längeren Zeitraum erhoben wurde, ohne dass sich die vom Institut spezifisch ausgearbeitete Methodik verändert hat. Mit den Längsschnittdaten können die Autoren belegen – entgegen der weitläufigen Meinung, die „chaotischen“ 1990er Jahre seien besonders korrupt gewesen –, dass Korruption in der Wirtschaft, aber auch in einigen Alltagsbereichen stetig angestiegen ist. Trotz der umfangreichen und detaillierten Analyse stellt Satarov fest, dass es bisher noch zu wenig Wissen über Korruption gebe, vor allem darüber, wie sich spezifische Gegenmaßnahmen tatsächlich auf die Korruptionspraxis auswirken.
Dass Korruption im heutigen Russland weit verbreitet ist, hat auch viel mit der schwachen Sanktionierung zu tun: Wie Skoblikov (2006) anhand der Auswertung von Gerichtsurteilen zeigen konnte, erhielt 2005 zwar jeder zweite nach Art. 158, Abs. 3 („Diebstahl“) des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (UKRF) verurteilte Dieb eine Haftstrafe. Aber 64% der nach Art. 290, Abs. 1 UKRF („Bestechungsannahme“) und sogar 100% der nach Art. 291, Abs. 3 UKRF („Bestechungsannahme von Staatsbediensteten“) verurteilten Personen erhielten nur Bewährungsstrafen – selbst für den Fall, dass Ermittlungen eingeleitet werden, müssen korrupte Akteure also kaum mit ernsthaften Sanktionen rechnen.
Im Unterschied zu Russland ist Korruption in der Ukraine bisher deutlich weniger erforscht, und der Schwerpunkt der meisten Arbeiten liegt auf der Ebene der grand corruption. Infolge des Zusammenbruchs des Janukovyč-Regimes wurden unzählige Dokumente zugänglich, die das hohe Korruptionsausmaß an der Spitze des Staates belegen (Bullough 2014, S. 14) und vermutlich eine Korruptionsforschung in der Tradition von Darden (2002) beleben werden. Dieser zeichnet in seiner Arbeit „Graft and Governance. Corruption as an Informal Mechanism of State Control“ die informelle und auf Korruption basierende Politik des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Leonid Kučma nach. Auch Pleines (2005b; 2010; 2012), Zimmer (2005) und Åslund (2014) thematisieren klientelistische Elitennetzwerke und belegen in ihren Arbeiten, wie wirtschaftspolitische Akteure ihre Macht durch informelle Praxen sichern und ausbauen. Im Gegensatz dazu betrachtet Polese (2008; 2009) die Ebene der Alltagskorruption und untersucht, wie informelle Reziprozitätsnormen – z. B. obligatorische Geschenke an Bedienstete im Gesundheits- und Bildungssektor – zu Korruption beitragen. Čábelková und Hanousek (2004) weisen nach, dass in der Ukraine das Korruptionsniveau stark von der Korruptionsperzeption abhängig ist: Je korrupter eine Institution wahrgenommen werde, umso größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die mit diesen Institutionen interagieren, selbst korrupt handelten. Einen umfassenden Überblick über Korruption in der Ukraine bietet die Studie „Corruption in Ukraine 2012“ (Institute for Advanced Humanitarian Research 2012). Neben dem Ausmaß der Korruption in unterschiedlichen öffentlichen und privaten Sektoren werden die Ursachen für die weit verbreitete Korruption – hauptsächlich der fehlende politische Wille zu ihrer Bekämpfung – diskutiert und potenzielle Gegenmaßnahmen erörtert.
Antikorruption im postsowjetischen Kontext
Stand zu Beginn der Korruptionsforschung die theoretische Erklärung des Phänomens im Vordergrund, wanderte der Fokus nicht zuletzt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und die Transformation der postsowjetischen Gesellschaften und Institutionen immer stärker auf praxisrelevante Antikorruptionsmaßnahmen im Zuge von Good Governance-Reformen (Mungiu-Pippidi 2015; Hellman et al.; Melville und Mironyuk 2015; Rose-Ackerman 2004; Kasemets 2012; Hough 2013). In den 1990er Jahren entstand eine globale Antikorruptionsbewegung, die kritische auch als „Anti-Korruptionsindustrie“ bezeichnet wird (Sampson 2012). Zunächst stand vor allem das awareness raising im Fokus, z. B. durch die 1993 gegründete Nichtregierungsorganisation „Transparency International“ (TI). Ab Mitte des Jahrzehntes rückten dann zunehmend internationale Normen gegen Korruption in den Vordergrund, wie die „OECD Anti-Bribery Convention“ (1997) oder die „United Nations Convention against Corruption“ (2005), die inzwischen von 177 Staaten ratifiziert wurde. Damit wurde die Grundlage für Anti-Korruptionsreformen gelegt und der Druck auf die internationale Staatengemeinschaft erhöht, diese umzusetzen. Ende der 1990er Jahre setzte die Phase der Implementierung von Antikorruptionsmaßnahmen ein (Tisné und Smilov), in die auch der Analyserahmen der vorliegenden Arbeit fällt.
Bisher ist die Literatur zu Antikorruption im postsowjetischen Raum noch übersichtlich. Die wenigen vorhandenen Studien kommen trotz nunmehr zweieinhalb Jahrzehnten des internationalen Kampfes gegen Korruption durch zahlreiche Konventionen, Gesetze und Initiativen zu dem Schluss, dass die bisherigen Maßnahmen weitgehend ineffektiv geblieben seien (Mungiu-Pippidi 2006) und Korruption im postsowjetischen Raum weiterhin sehr verbreitet sei (Grødeland und Aasland 2011; Tisné und Smilov). Mungiu-Pippidi sieht eine Ursache für das Scheitern vieler Antikorruptionsmaßnahmen in der Zusammenfassung unterschiedlicher Phänomene unter einem Korruptionsbegriff:
„In fact, what we label corruption in these countries is not the same phenomenon as corruption in developed countries. In the latter, the term corruption usually designates individual cases of infringement of the norm of integrity. In the former, corruption actually means particularism’ – a mode of social organization characterized by the regular distribution of public goods on a nonuniversalistic basis that mirrors the vicious distribution of power within such societies.“ (Mungiu-Pippidi 2006, S. 86f.)
Ein Teil der Literatur zu Antikorruption in postkommunistischen Staaten kritisiert, dass Antikorruptionsreformen zu stark auf ökonomischen Rational-Choice-Konzepten á la Rose-Ackerman (1978) oder Klitgaard (1988) basierten. In dieser Region sei die ubiquitäre Korruption jedoch weniger ein rationaler Tauschakt als vielmehr eine gesellschaftliche Norm, und damit auch kein Problem individueller Devianz, sondern vielmehr ein Problem des kollektiven Handelns, weshalb viele Reformen auf falschen Grundannahmen basierten und daher nicht greifen würden:
„While contemporary anticorruption reforms are based on a conceptualization of corruption as a principal-agent problem, in thoroughly corrupt settings, corruption rather resembles a collective action problem. This, in turn, leads to a breakdown of any anticorruption reform that builds on the principal-agent framework, taking the existence of noncorruptible so-called principals for granted.“ (Persson et al. 2013, S. 449)
Auch internationale Akteure wie die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds (IWF), deren Antikorruptionspolicies zunächst vor allem auf ökonomischen Annahmen gründeten, kamen zu dem Ergebnis, dass diese im postsowjetischen Raum nicht greifen würden. Daniel Kaufman, ehemals Programmdirektor für Antikorruption bei der Weltbank, musste eingestehen: „Much was done, but not much was accomplished. What we are doing is not working“ (Naím 2005, S. 96). Offensichtlich scheiterten die auf ökonomischen Überlegungen fußenden „One-size-fits-all“-Lösungen an ihrer Unfähigkeit, lokale und kulturelle Spezifika zu berücksichtigen: „One of the key lessons that needs to be learnt […] is that context matters.“ (Hough 2013, S. 30). So kommt z. B. Grødeland (2010b) zu dem Schluss, dass die auf internationalen Druck erfolgten ukrainischen Antikorruptionsmaßnahmen nicht den lokalen Kontext berücksichtigt hätten, und sieht darin die Hauptursache für deren Scheitern.
Die Opponenten des „Rational-Choice“-Paradigmas sehen Korruption als soziokulturelles Phänomen (Cheloukhine und Haberfeld 2011), „kulturelle Praxis“ (Brovkin 2003) oder „Norm“ (Rimskii 2013), woraus sich Implikationen für Antikorruption ergäben: Diese Form der Korruption lasse sich nicht einfach durch ökonomische Anreize aus der Welt schaffen. Grødeland stellt auf Grundlage ihrer umfangreichen empirischen Studien die These auf, dass die soziokulturellen Faktoren ein „considerable obstacle to effective anti-corruption policies in post-communist Europe“ (Grødeland 2010a, S. 156) darstellten. Der Kampf gegen Korruption könne nicht durch eine Verschärfung der Gesetze gewonnen werden, sondern durch einen mithilfe von politischer Bildung und Aufklärung erwirkten Mentalitätswandel – erst auf dessen Grundlage könnten „klassische“ Antikorruptionsmaßnahmen wie die Stärkung des Rechtsstaats und Strafverfolgung effektiv greifen. Ein universelles Erfolgsrezept für Antikorruptionsmaßnahmen gibt es nicht, da sie stets kontextabhängig erfolgen sollten (Hanna et al. 2011). In den letzten Jahren haben sich dennoch einige zentrale Bedingungen für effektive Antikorruptionsinstitutionen herauskristallisiert:
„Lessons learned show that capable anti-corruption agencies tend to be well-resourced, headed by strong leadership with visible integrity and commitment, and situated amongst a network of state and non-state actors who work together to implement anti-corruption interventions.“ (UNDP 2011a, S. 3)
Ein zentrales Problem im postsowjetischen Raum ist der fehlende politische Wille, Korruption zu bekämpfen – abgesehen von Georgien (The World Bank 2012) blieben konsequente Maßnahmen gegen Korruption in den Staaten der Region zumeist Lippenbekenntnisse. Oft seien die Verantwortlichen der Aufgabe nicht gewachsen: „those in charge of enforcing the laws are neither of high enough quality nor adequately equipped for the task.“ (Grødeland 2010a, S. 155). Rothstein vermisst „Big-Bang“-Ansätze, um die ubiquitäre Korruption einzudämmen: „It is unlikely that small institutional devices can set in motion a process towards establishing ‚good governance’ in countries were corruption is systemic“ (Rothstein 2011, S. 228). Postsowjetische Gesellschaften zeichneten sich durch niedriges institutionelles bzw. generalisiertes Vertrauen aus (Roth 2007a). Um das Vertrauen wieder herzustellen, brauche es einen breiten und „revolutionären“ Institutionenwandel. Ein Big-Bang-Ansatz sei entscheidend „to change agents’ beliefs about what’ all’ the other agents are likely to do when it comes to corrupt practices“ (Rothstein 2011, S. 246). Rothstein bleibt jedoch eine Erklärung schuldig, wie dieser Ansatz im postsowjetischen Raum umgesetzt werden könnte, wo die Eliten selbst am meisten von Korruption profitieren und kein Interesse an ihrer Bekämpfung haben (Pleines 2001; Sajó 1998). Wo die politischen Eliten Korruption zu ihrem mode of (informal) governance(Gel’man 2012) gemacht haben, wie in Russland unter Putin oder der Ukraine unter Janukovyč, würden Antikorruptionsmaßnahmen entweder selektiv gegen Opponenten eingesetzt oder sie würden lediglich simuliert (Orttung 2014; Coulloudon 2002).
Wirkungsvolle Antikorruptionsmaßnahmen sollten idealerweise gemeinsam durch staatliche Anstrengungen „von oben“ und zivilgesellschaftliche Initiativen „von unten“ koordiniert und durchgeführt werden – zu diesem Ergebnis kommen Steves und Rousso in ihrer Studie über Antikorruptionsprogramme in 24 postkommunistischen Ländern:
„Where anti-corruption programs are applied from the top-down, without adequate transparency and sufficient participation of civil society groups in both the formulation and monitoring of the initiatives, they may be a smokescreen for inaction rather than a sincere attempt to reduce levels of corruption.“ (Steves und Rousso 2003, S. 29)
Fehlt der politische Wille, effektiv gegen Korruption vorzugehen, übernimmt die Aufgabe der Korruptionsbekämpfung zunehmend die Zivilgesellschaft4, die sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den Nachfolgestaaten unterschiedlich entwickelt ha (Grimes 2008; Holmes 2010; Hough 2013; Schmidt-Pfister 2009, 2010; Wolf und Schmidt-Pfister 2010). Auch laut der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) übernähmen zivilgesellschaftliche Organisationen in der Korruptionsbekämpfung elementare Funktionen:
„Channeling information from citizens to the State to design appropriate strategies, enrolling the participation and support of citizens and enterprises in the implementation of anti-corruption policies, maintaining pressure for a political commitment against corruption, while ensuring that anti-corruption drives are really rooted in public interest.“ (OECD 2003, S. 27)
Die Zivilgesellschaft sei der „key agent in fostering […] anti-corruption in post-communist countries“ (Schmidt 2007, S. 211), und der Rückgang der Korruption sei laut Orlova (2008) nur möglich, wenn eine starke Zivilgesellschaft sich dafür engagiere.
Was die bisherige Antikorruptionsliteratur zum postsowjetischen Raum eint, ist dass ihr „overall focus, however, seems to be more on explaining the lack of success rather than studying the anti-corruption measures themselves in systematic […] ways“ (Schmidt 2007, S. 216).
Bildungskorruption
Im wissenschaftlichen Diskurs wird Korruption im Bildungssektor, kurz Bildungskorruption, bisher nur am Rande thematisiert. Das geringe Interesse steht in krassem Widerspruch zur Relevanz des Themas: Zum einen gehört Bildung zu den wichtigsten staatlichen Aufgaben und den größten Ausgabenposten; zum anderen ist der Bildungsbereich besonders stark von Korruption betroffen. Transparency International hat das Thema Bildungskorruption 2013 mit dem „Global Corruption Report 2013: Education“ (Transparency International 2013b) auf die globale Agenda gesetzt, und es ist anzunehmen, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Thematik zunehmen wird.
Die Forschung zu Bildungskorruption ist noch sehr jung: Die ersten Publikationen erschienen in den Nuller Jahren (Chapman 2002; Waite und Allen 2003; Heyneman 2004; Hallak und Poisson 2005; Rumyantseva 2005).
Bildungskorruption kann in unterschiedlichen Bereichen auftreten, etwa in der Hochschuladministration, bei der Auftragsvergabe, Akkreditierung, Lizenzierung, aber auch in Zusammenhang mit der Lehre. Rumyantseva (2005) unterscheidet in ihrer „Taxonomy of Corruption in Higher Education“ zwischen Korruptionsformen, die Schüler und Studenten direkt betreffen („Education specific corruption“), und solchen, die sie nicht direkt betreffen („Administrative Corruption“). Chapman (2002) macht Bildungskorruption auf fünf Ebenen aus, die vom zentralen Ministerium bis hinunter auf die Klassenraum-/Kursebene reichten. Eine umfangreiche Übersicht der Bereiche und Formen von Bildungskorruption sowie ihrer Konsequenzen liefern Hallak und Poisson (2005, S. 5f.). Konkrete Beispiele, von Nepotismus über den Verkauf von Diplomen bis hin zu sexueller Erpressung, bietet der Sammelband von Heyneman (2009).
Die Folgen von Bildungskorruption werden vorrangig negativ beurteilt: „It has detrimental consequences on the quality of education, the student’s morals, the future opportunities for students, and quality of future leadership.“ (Rumyantseva 2005, S. 91). Bildungskorruption verletze nicht nur das universelle Menschenrecht auf Bildung, sondern reproduziere soziale Ungleichheiten (Luk'yanova 2012), wenn nicht die Fähigkeit der Lernenden, sondern ihr soziales oder finanzielles Kapital über Bildungserfolge entscheide. Bildungsabschlüsse würden durch ihre Käuflichkeit entwertet und verlören ihre Funktion (Heyneman et al. 2008). Eine Gefahr von Bildungskorruption liege in der Internalisierung von Korruption in einem prägenden Lebensabschnitt:
„The real damage to a society occurs when entire generations of youth are mis-educated – by example – to believe that personal success comes not through merit and hard work, but through favoritism, bribery, and fraud.“(Chapman 2002, S. 2)
Für Russland warnen Galickij und Levin: „Wenn es uns nicht gelingt, die Korruption im heutigen Bildungssystem zu senken, riskiert unsere Gesellschaft, sich in ein Kastenwesen zu verwandeln.“ (Galickij und Levin 2008a, S. 117). Denn in der Regel seien die ärmsten und bereits sozial benachteiligten Schichten von Bildungskorruption betroffen (Sahlberg 2009, S. 7) und im Unterschied zu anderen Korruptionsformen überwiegend jüngere Altersgruppen wie Schüler und Studierende, die sich schlechter zu Wehr setzen könnten als Erwachsene (Ochse 2004).
Nachhaltig negativ wirkt sich Korruption beim Zugang zu Hochschuleinrichtungen aus, ein Problem vieler Staaten: „Because of the lack of modern methods and technologies, the selection systems to higher education are riddled with bribery“ (Heyneman 2004, S. 647). Laut Klitgaard (1986) liege jedoch genau in der meritokratischen Elitenselektion ein Grundstein für wirtschaftliche Entwicklung. Piñera und Selowsky (1981) zufolge könnten Entwicklungsländer ihr Bruttoinlandsprodukt um fünf Prozentpunkte steigern, wenn sie ihre Eliten nicht nach sozialem Status, sondern nach meritokratischen Kriterien auswählen würden.
Heynemann, der in den 1990er Jahren für die Weltbank Bildungsreformen in den postsozialistischen Staaten begleitete, kommt zu der Annahme, dass Bildungskorruption in dieser Region deutlich zugenommen habe. In der Sowjetunion sei sie „modest by comparison to the level today“ (Heyneman et al. 2008, S. 21) gewesen; inzwischen habe sie sich zu einem „systemischen“ Problem (Galickij und Levin 2008b) bzw. einer „Routine“ (Temple und Petrov 2004) entwickelt. Das belegen zum Beispiel Preislisten für Noten, die Klein (2010) an einigen russischen Universitäten vorfand
Osipian hat die Forschung zu Bildungskorruption in Russland und der Ukraine in den letzten Jahren mit zahlreichen Publikationen (Osipian 2012b; 2012a; 2011; 2009a; 2009b) vorangetrieben. Sie zeigen die vielfältigen Formen von Bildungskorruption an russischen und ukrainischen Hochschulen, die den korrupten Erwerb von Studienplätzen, Leistungsnachweisen und Diplomen bis hin zu Doktortiteln umfassen. Für Russland stammt die bisher umfangreichste Arbeit zum Thema von Zaborovskaja et al. (2004), die u. a. die unterschiedlichen informellen Praxen bei der Hochschulzulassung untersuchen, wie Bestechung, Blat oder den Nachhilfeunterricht Repetitorstvo, der häufig alle Eigenschaften von Korruption besitzt (ausführlicher zu dieser im postsowjetischen Raum verbreiteten Praxis siehe Büdiene et al. 2006). Im Schnitt etwa 20% der Studienplätze würden über korrupte Praxen vergeben, so die Autoren, wobei der Anteil an angesehenen Universitäten grundsätzlich höher sei. Dies deckt sich auch mit den Daten von Galickij und Levin (2010), die anhand der Auswertung indirekter Befragungen den Anteil der informell vergebenen Studienplätze in Russland auf etwa 25% schätzen. Wobei der Großteil der Studienplätze nicht über direkte Bestechungsleistungen erworben werde, sondern über Blat oder Repetitorstvo. Laut Shaw (2005) lag in der Ukraine der Anteil der informell erworbenen Studienplätze sogar noch höher. In seiner Studie berichteten 56% aller Studierenden, eine Bestechung für ihren Studienplatz geleistet zu haben.
Zaloznaya (2012) geht der Frage nach, weshalb bestimmte Hochschulen stärker und andere weniger stark von Bildungskorruption betroffen sind und warum das Korruptionsniveau sogar innerhalb von Hochschulen – z. B. auf Fakultätsebene – variiert. Anhand von Sutherlands Theorie der Differentiellen Assoziation (Sutherland 1947) und auf Grundlage von Experteninterviews an ukrainischen Hochschulen kommt sie zu dem Schluss, dass es vor allem die von der Führungsebene geschaffene Organisationskultur auf der Mesoebene der einzelnen Hochschule sei, die das Korruptionsausmaß begründe, und weniger strukturelle Ursachen der Makroebene oder persönliche Präferenzen der Mikroebene. Die Akteure erlernten durch „organizational enactment“ (Weick 1995) die jeweils an ihrer Institution geltenden Normen, wie auch Leontyeva (2013; 2011) in ihren Forschungen zu informellen Netzwerkstrukturen an russischen Hochschulen belegt. Mit der Zeit entstünde, so Titaev (2012), an vielen Hochschulen ein Klima der „academic collusion“, eine stillschweigende Übereinkunft zwischen Lernenden und Lehrenden, dass Korruption eine Win-win-Situation und für beide Seiten von Vorteil sei. Zaloznayas und Titaevs Ergebnisse decken sich mit der Studie von Shaw (2005) zu den Determinanten von Bildungskorruption in der Ukraine, der zufolge die Korruptionsperzeption die individuelle Korruptionsbereitschaft maßgeblich beeinflusse.
Temple und Petrov (2004) untersuchen die Ursachen für Bildungskorruption im postsowjetischen Raum. Neben ökonomischen Motiven (Löhne und Renten unterhalb des Subsistenzminimums, fehlende staatliche Investitionen in die Bildungsinfrastruktur5) betrachten sie das sowjetische Erbe sowie die postsowjetische Mentalität als wesentliche Gründe für das hohe Korruptionsniveau. Golunov hingegen sieht in schwachen oder fehlenden Gegenmaßnahmen und Kontrollinstanzen an den Universitäten eine zentrale Ursache:
„In the vast majority of Russian universities mechanisms for maintaining academic integrity (such as university self-government, ethics codes, professional unions, student trust lines, internal and external audit) are weak, imitative, or non-existent.“ (Golunov 2013b, S. 1)
Publikationen zu Antikorruptionsmaßnahmen in postsowjetischen Bildungssystemen gibt es bisher nur wenige. Hallak und Poisson (2002; 2005; 2007) haben Gegenmaßnahmen aus mehr als 60 Ländern zusammengetragen. Sie sehen das Machtmonopol der Bildungsinstitutionen und ihrer Lehrenden sowie die fehlende Transparenz und Rechenschaftspflichten als idealen Nährboden für Korruption. Um Korruption einzudämmen, brauche es entsprechend mehr Transparenz, Informationen und Verantwortlichkeit. Waite und Allen weisen jedoch darauf hin, wie schwierig es sei, ein korruptes System von innen heraus zu ändern, da dieses selbsterhaltend sei:
„Once someone becomes an active, willing participant in a corrupt system (say, an administrator in such a system), the inducements are there to maintain the system and the ill-gotten benefits accrued.“ (Waite und Allen 2003, S. 294)
Ergo kommt Sahlberg zu der Erkenntnis: „Success stories in fighting education corruption are still rare“ (Sahlberg 2009, S. 15).
Das Handbuch „Preventing Corruption in the Education Sector“ (Ochse 2004) zeigt Schwachstellen auf, die Bildungskorruption im Bereich der Personalpolitik, Finanzverwaltung und beim Zugang zu Bildungsinstitutionen begünstigten, und leitet daraus Lösungsvorschläge ab. Als korruptionsfördernde Faktoren beim Hochschulzugang sieht die Autorin intransparente Auswahlprozesse ohne interne/externe Kontrolle der Entscheidungsträger; fehlende Informationen/Dokumentationen über den Entscheidungsprozess sowie sog. „high-stakes-exams“6. Um Korruption in diesem Bereich einzudämmen, sollte man Eltern, Schüler und Studierende besser über ihre Rechte informieren, die externe zivilgesellschaftliche Kontrolle erhöhen, Vorgänge digitalisieren, den Entscheidungsprozess auf mehrere Personen verteilen sowie ein zivilgesellschaftlich begleitetes Berufungssystem etablieren. Explizit verweist das Handbuch auf Aserbaidschan, eines der ersten postsowjetischen Länder, das sein Hochschulzulassungssystem reformiert und Korruption erfolgreich eingedämmt habe.
Die Studie von Teodorescu und Andrei (2009) zu Antikorruptionsmaßnahmen in südosteuropäischen Staaten kommt zum Ergebnis, dass aufgrund schwacher staatlicher Institutionen zivilgesellschaftliche und studentische Maßnahmen effektiver seien. Die Autoren empfehlen daher, externe Akteure stärker in staatliche Antikorruptionsprogramme einzubeziehen.
Der vom United Nations Development Programme (UNDP) erstellte, auf internationaler Expertise basierende Bericht „Fighting Corruption in the Education Sector“ (Wood und Antonowicz 2011) sieht in effektiven legislativen Rahmenbedingungen, moderner Finanzverwaltung, unabhängigen und externen Kontrollinstanzen (z. B. zur Kontrolle des Zulassungssystems), Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen7, Capacity Building und Digitalisierung die Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung der Bildungskorruption. Außerdem müssten erfolgte Maßnahmen genauer evaluiert werden. Zu dieser dringend notwendigen Evaluierung möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten.
3.3 Erkenntnisinteresse und Relevanz
Die vorliegende Arbeit analysiert und vergleicht die reformierten Hochschulzulassungssysteme in Russland und der Ukraine im Hinblick auf ihre Wirkung zur Eindämmung von Korruption.
Da die vorhandene Literatur keine schlüssigen theoretischen Konzepte für den Untersuchungsgegenstand liefert, stellt sich als Erstes die Frage:
1. Anhand welcher Theorieansätze kann postsowjetische Bildungskorruption am besten erfasst und erklärt werden?
Nach der Konzeption eines geeigneten theoretischen Rahmens werden die Spezifika von Bildungskorruption in beiden untersuchten Ländern anhand folgender Leitfragen erarbeitet:
2. Welche konkreten Formen der Bildungskorruption gibt es und wie sehen diese in Zusammenhang mit der Hochschulzulassung aus?





























