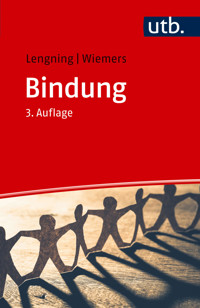
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kurz und bündig, für alle, die mehr über zwischenmenschliche Beziehungen erfahren möchten! Menschliche Beziehungen lassen sich mit der Bindungstheorie besser verstehen. Das Buch führt kompakt in Bindungstheorie und -forschung ein. Es stellt Verfahren zur Erfassung der Feinfühligkeit und der Bindungsqualität dar und erklärt den Zusammenhang zwischen Bindung und Emotionen. Abschließend werden Bindungsstörungen, ihre Behandlung und geeignete Präventionsmaßnahmen beschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
utb 3758
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Psychosozial-Verlag · Gießen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Anke Lengning, Carsten Alexander Wiemers
Bindung
3., überarbeitete Auflage
Ernst Reinhardt Verlag München
Anke Lengning, Prof. Dr. phil, Dipl. Psych., setzt in Forschung, Lehre und Anwendung Schwerpunkte auf Themen der Entwicklungs- und Gesundheitspsychologie, z. B. Bindung, Emotionsentwicklung, Schutzfaktoren psychischer Gesundheit.
Carsten Alexander Wiemers, M. Sc. Psychologe, staatlich anerkannter (Heim-) Erzieher, ist tätig in einer Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Bad Wildungen-Reinhardshausen.
Hinweis
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
UTB-Band-Nr.: 3758
ISBN 978-3-8252-6458-1 (Print)
ISBN 978-3-8385-6458-6 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-8463-6458-1 (EPUB)
3., überarbeitete Auflage
© 2025 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG einschließlich Einspeisung/Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise/Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Die früheren Auflagen dieses Werkes entstanden unter Mitautorenschaft von Nadine Lüpschen, Essen
Reihenkonzept und Umschlagentwurf: Alexandra Brand
Umschlagumsetzung: siegel konzeption | gestaltung, Stuttgart
Covermotiv: © istock.com/patpitchaya
Satz: Bernd Burkart; www.form-und-produktion.de
Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Einführung
Hauptteil
1Was ist die Bindungstheorie?
2Wie lassen sich individuelle Bindungsunterschiede feststellen?
3Beeinflusst Bindung unseren Umgang mit Emotionen?
4Kann Bindung auch pathologisch sein?
5Wie lässt sich eine sichere Bindung fördern?
Anhang
Glossar
Literatur
Register
Hinweis
Autorin und Autor dieses Buches haben sich um die geschlechtsneutrale Formulierung ihrer Inhalte bemüht. Wo dies der Lesbarkeit halber nicht umgesetzt ist, beziehen sich die verwendeten Personenbezeichnungen – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.
Einführung
„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.“
Dieses Goethe zugeschriebene Zitat verdeutlicht anschaulich zentrale Grundlagen der Bindungstheorie. Hiernach sollen Eltern – es können aber auch andere wichtige Bezugspersonen sein – eine sichere Basis bieten, der die Kinder vertrauen, auf die sie sich verlassen können und die ihnen Schutz gibt (Wurzeln). Nur dann fühlen sich Kinder sicher, die Welt zu erkunden und Neues zu entdecken (Flügel). Erfahrungen in diesen engen Eltern-Kind-Beziehungen haben Einfluss auf zentrale Bereiche der kindlichen Entwicklung. Beispiele hierfür sind das Selbstkonzept und der Umgang mit Emotionen (siehe Kapitel 1).
Das vorliegende Buch führt zunächst in die Grundlagen der Bindungstheorie ein. Im ersten Kapitel werden wesentliche Konzepte beschrieben, um ein Verständnis für die Bindungstheorie zu schaffen. Hierbei werden aktuelle empirische Forschungsergebnisse mit aufge-nommen. Im zweiten Kapitel werden vornehmlich Verfahren zur Erfassung der Bindungsqualität / -muster dargestellt, wobei nicht nur Verfahren zur Erhebung der Bindungsqualität / -muster im Kindesalter berücksichtigt werden, sondern auch solche, die eine Erfassung in späteren Lebensabschnitten ermöglichen. Das dritte Kapitel ist dem Zusammenhang zwischen Bindung und Emotionen gewidmet. Es wird herausgearbeitet, dass Bindungsmuster auch als Emotionsregulationsmuster angesehen werden können. Das vierte Kapitel gibt eine Übersicht über verschiedene Bindungsstörungen, wobei auf häufig genutzte Klassifikationssysteme und u. a. auf Ursachen und → Prävalenz eingegangen wird. Abschließend werden im letzten Kapitel Präventions- und Interventionsmaßnahmen dargestellt, die auf eine Verbesserung der Feinfühligkeit bzw. der Bindungsmuster / -qualität abzielen.
Das Buch richtet sich besonders an Studierende der Fachrichtungen Psychologie, Pädagogik, Sonderpädagogik, Sozialpädagogik, Frühpädagogik, Soziale Arbeit, des Lehramts und der Medizin. Im Grunde sind alle Personen, die in ihrem Beruf oder auch in ihrem Privatleben engen Kontakt zu anderen Menschen unterschiedlichen Lebensalters haben, die Adressaten. Wissen über die Bindungstheorie erleichtert es, das Erleben und Verhalten von Menschen besser einordnen und verstehen zu können. Darüber hinaus kann ein Bewusstsein dafür erlangt werden, wie es einer Person gelingen kann, zuverlässige Beziehungen aufzubauen und warum dies so wichtig ist. Zur Veranschaulichung dienen folgende Fragen, die im Umgang mit anderen Menschen verschiedener Altersklassen und in unterschiedlichen sozialen, pädagogischen wie psychologischen Berufen häufiger auftreten:
Warum reagieren einige Kinder so extrem, wenn sie von ihren Bezugspersonen getrennt werden?
Wie kann ich als Erzieherin / Erzieher eine gute Beziehung zu den Kindern aufbauen und ihnen eine sichere Basis bieten, damit sie sich möglichst gut entwickeln?
Warum haben einige Menschen ein negatives Selbstkonzept?
Warum ist es wichtig, in der Therapie eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen?
Warum fällt es manchen Klienten / Klientinnen leichter als anderen, auf die Beziehungsangebote des Therapeuten einzugehen?
Das vorliegende Buch soll es erleichtern, diese und ähnliche Fragen zu beantworten, indem es grundlegendes Wissen über Bindung vermittelt. Dabei gilt es zu beachten, dass es nicht dazu befähigt, andere Menschen in Bezug auf ihre Bindung einzuschätzen oder die beschriebenen Verfahren und Präventions- bzw. Interventionsmaßnahmen ohne entsprechende Schulung einzusetzen. Das Buch erhebt nicht den Anspruch, alle theoretischen Annahmen und empirischen Befunde bezüglich Bindung darzustellen. Das würde den Rahmen des Buches sprengen.
Die Bindungstheorie gehört zu einer der am weitesten ausgearbeiteten Theorien der Entwicklungspsychologie, in deren Rahmen in den letzten Jahrzehnten – unter anderem auch wegen ihrer hohen praktischen Relevanz – intensiv geforscht wurde. Dementsprechend kann nur ein Teil der Forschungsergebnisse in diesem Buch berücksichtigt werden. Wir bitten alle Forscher und Forscherinnen, die bedeutsame Beiträge zur Bindungstheorie geleistet haben und hier nicht genannt wurden, um Verständnis.
So umfangreich im Rahmen der Bindungstheorie bereits geforscht wurde: Es gibt immer noch ungeklärte Aspekte bzw. deutliche Kritikpunkte. Auf diese wollen wir ebenfalls eingehen, um den Lesern und Leserinnen auch einen kritischen und damit möglichst umfassenden Blick auf das Thema Bindung zu ermöglichen.
Hauptteil
Kapitel1Was ist die Bindungstheorie?
Die Bindungstheorie beschreibt und klärt wissenschaftlich, warum Menschen dazu tendieren, sich auf enge emotionale Beziehungen einzulassen und inwieweit die psychische Gesundheit einer Person beeinflusst wird, wenn diese Beziehungen beeinträchtigt, unterbrochen bzw. beendet werden. Im Folgenden werden grundlegende Aspekte der Bindungstheorie dargestellt und zentrale Begriffe erläutert. Den Abschluss des Kapitels bildet auf Grundlage dessen ein praktischer Bezug zur Tages- / Fremdbetreuung.
Anfänge der Bindungstheorie
Abbildung 1: John Bowlby (1907–1990)
Die Grundzüge der Bindungstheorie stammen von John Bowlby, der 1907 geboren wurde.
1924 begann er an der Universität von Cambridge sein naturwissenschaftliches Studium und bekam Einblick in die Entwicklungspsychologie. Im Rahmen seiner Arbeit in zwei psychoanalytisch orientierten Kinderheimen, für die er sein Studium unterbrach, beobachtete er zwei Kinder, die äußerst unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legten: Ein sehr distanziertes Kind und ein sehr anhängliches Kind. Das Verhalten dieser beiden Kinder sah er in der Trennung von ihren Eltern begründet. Angeregt durch diese Erfahrungen setzte er sein Studium fort mit dem Ziel, Psychoanalytiker und Kinderpsychiater zu werden. Im Jahr 1933 beendete er dieses Studium und trat eine Stelle an der London Child Guidance Clinic an. Durch seine Arbeit dort wurde für John Bowlby immer deutlicher, dass nicht – wie es bis dahin für die meisten Psychoanalytiker üblich war – die kindlichen Phantasien die stärkste Beachtung finden sollten, sondern Familienereignisse, die real stattgefunden hatten. In diesem Sinne betonte er die andauernden Folgen, die sich für Kinder aus der Trennung von ihren Eltern ergeben können. Später wurde er Leiter der Kinderabteilung der Tavistock Clinic, welche er „Abteilung für Eltern und Kind“ taufte und so die Wichtigkeit der Eltern-Kind-Beziehung hervorhob. Die Untersuchung von verschiedenen Familienbeziehungen, die unter Umständen eine gesunde bzw. gestörte kindliche Entwicklung beeinflussen können, fand sein besonderes Interesse. Aus diesem Grund bildete er eine Forschungsgruppe, in der auch Mary Ainsworth mitarbeitete (vgl. Bretherton 2019).
Mary Ainsworth ist die erste → empirische Bestätigung der Bindungstheorie zu verdanken. Darüber hinaus erweiterte sie die Bindungstheorie durch die Betrachtung individueller Unterschiede (vgl. Bretherton 2019) und betonte das Gleichgewicht von Bindung auf der einen Seite und Erkundung / Exploration auf der anderen Seite (Waters 1982; siehe auch weiter unten). Durch sie wurden zudem die Grundgedanken der Sicherheitstheorie von William Blatz (1940) in die Bindungstheorie integriert. Laut der Sicherheitstheorie ist es Voraussetzung, dass der Säugling bzw. das Kleinkind zunächst Vertrauen in seine Eltern entwickelt, bevor es ihm möglich ist, unbekannte Situationen aufzusuchen, in denen er / es nicht mit der Unterstützung eines Erwachsenen rechnen kann. Folglich ermöglicht die durch die Eltern erlangte Sicherheit, dass ein Kind Neues erkunden kann, was der Aufnahme von Wissen förderlich ist (vgl. Bretherton 2019).
Grundlagen der Bindungstheorie
Bindung bezieht sich in der Kindheit in den meisten Fällen auf die Eltern oder auf andere primäre Bezugspersonen (Bowlby 2019b). Damit sich eine Bindung entwickelt, ist es notwendig, dass die Bindungsperson häufig mit dem Kind interagiert.
Definition1
Bindung bezeichnet eine enge emotionale, länger andauernde Beziehung zu bestimmten Menschen, die nach Möglichkeit sowohl Schutz bieten als auch unterstützend wirken, z. B. wenn ein Kind verunsichert oder traurig ist und sie dem Kind helfen, seine Emotionen zu regulieren.
Hauptbindungsperson wird die Person sein, die sich am meisten um das Kind kümmert (Bowlby 2019b). Wenn das Kind Trost oder Schutz benötigt, wendet es sich an diese Person (Bowlby 2019b). Ist die Hauptbindungsperson nicht anwesend, kann sich das Kind bei Stress auch an andere ihm vertraute Menschen wenden. Somit entwickelt es eine Hierarchie von Bindungspersonen (Bowlby 1988; siehe hierzu in diesem Kapitel den Abschnitt „Bindung an unterschiedliche Personen“). Die Bindungserfahrungen mit verschiedenen Bindungspersonen werden vom Kind in sogenannten internalen Arbeitsmodellen abgespeichert (siehe in diesem Kapitel den Abschnitt „Internale Arbeitsmodelle“).
Von anderen Beziehungen sind Bindungsbeziehungen darin zu unterscheiden, dass das Kind bemüht ist, in der schützenden Reichweite seiner Bindungsperson zu bleiben. Wie groß die Entfernung zu der Bindungsperson dabei sein kann, ist abhängig von der jeweiligen Situation. Ist ein Kind geängstigt bzw. fühlt es sich durch eine Situation bedroht, werden bei ihm negative Gefühle ausgelöst und es zeigt Bindungsverhalten (Weiss 1991).
Definition2
Zum Bindungsverhalten werden die Verhaltensweisen gezählt, die darauf abzielen, die physische oder psychische Nähe zu Bindungspersonen herzustellen bzw. aufrecht zu erhalten.
Beispiele für Bindungsverhaltensweisen:
Rufen
Anklammern
Weinen
Hinkrabbeln
Hinlaufen
Protest, wenn die Bezugsperson das Kind absetzt oder verlässt
Beispiele für Auslöser von Bindungsverhalten:
Krankheit
Stress
Trauer
Neue Reize z. B. Auftreten unbekannter Personen
Müdigkeit
Schmerzen
Zu beachten ist, dass Bindung eine Fähigkeit darstellt und nicht etwa eine Schwäche (Bowlby 2019b). Erlangen Kinder Sicherheit durch die Anwesenheit der Bezugsperson und die Gewissheit, mit ihr in Kontakt zu stehen (Sroufe / Waters 1977), so ist es ihnen möglich zu spielen, aber auch zu explorieren / erkunden.
Merksatz3
Bindungs- und Explorationsverhalten stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Fühlt sich ein Kind sicher und wohl, kann es seine Umwelt frei explorieren. Erfährt es jedoch Unsicherheit, wird das Explorationsverhalten eingestellt und das Kind zeigt vermehrtes Bindungsverhalten.
Bei einer Trennung von der Bezugsperson oder auch nur bei drohender Trennung wird das Kind protestieren und darum bemüht sein, die Nähe der Bezugsperson zu erhalten oder wieder zu erlangen (Weiss 1991). Die Bezugsperson kann so als sichere Basis genutzt werden, von der aus das Kind die Umgebung erkunden kann.
Merksatz4
Die (primäre) Bezugsperson dient dem Kind als sichere Basis (secure base), von der aus es seine Umwelt spielerisch erkunden und bei Bedarf, d. h. etwa bei Unsicherheit oder Gefahr, zu ihr zurückkehren kann.
Es wird also eine deutliche Beziehung zwischen Bindung und Exploration angenommen, wenn davon ausgegangen wird, dass das kindliche Explorationsverhalten eingeschränkt wird, sofern der Bedarf des Kindes nach Sicherheit hoch ist, bzw. dass dem Kind eine freie Exploration möglich ist, sofern das kindliche Sicherheitsbedürfnis niedrig ist. Ebenso wird ein Zusammenhang zwischen Bindung und Exploration postuliert, wenn die Mutter als sichere Basis zur Exploration angesehen wird (vgl. z. B. Schölmerich / Lengning 2022). Kulturvergleichende Studien legen allerdings nahe, dass eine solche Verallgemeinerung nicht möglich ist, da der postulierte Zusammenhang zwischen Bindung und Exploration lediglich in westlichen Gesellschaften zu gelten scheint (Rothbaum et al. 2000). So konnte in Studien gezeigt werden, dass amerikanische im Vergleich zu japanischen Babys sowohl in Spielsituationen (Bornstein et al. 1990) als auch in der Fremden Situation (Takahashi 1990) mehr explorieren (zur „Fremden Situation“ siehe in diesem Kapitel den Abschnitt „Verschiedene Bindungsmuster“ sowie Kapitel 2). Außerdem orientierten sich die amerikanischen Babys vermehrt an der Umwelt, während die japanischen Babys sich stärker an ihren Müttern ausrichteten – sowohl bei positiver als auch bei negativer Stimmung (Bornstein et al. 1990; Miyake et al. 1985). Für eine ausführliche Diskussion weiterer Modelle über den Zusammenhang zwischen Bindung und Exploration (Neugier) sei auf Schölmerich und Lengning (2022) verwiesen.
Sind Kinder noch nicht selbst in der Lage, die Nähe der Bezugsperson bei Unsicherheit aufzusuchen, bemüht sich diese in der Regel von sich aus, die kindliche Unsicherheit zu reduzieren. Bindung bzw. das Bindungssystem stellt demnach ein Verhaltenssystem dar und kann als Steuerungssystem angesehen werden, da es Sorge dafür trägt, dass die Distanz zwischen Kind und Bezugsperson nicht zu groß wird.
Als komplementäres Verhaltenssystem zum Bindungssystem, welches sich u. a. im schutzsuchenden Verhalten des Kindes äußert, ist die elterliche Fürsorge zu betrachten (Bowlby 2019b). Damit die Eltern als Bezugspersonen die Bedürfnisse ihrer Kinder erkennen können, sind sie auf die Gefühlsäußerungen der Kinder angewiesen. Die kindlichen Signale sowie die darauf folgenden elterlichen Reaktionen beeinflussen die frühkindliche Bindungsentwicklung. Wenn die Eltern sich responsiv / sensitiv (siehe in diesem Kapitel den Abschnitt „Einflussfaktoren auf die Bindungsqualität – Feinfühligkeit“) verhalten, werden offene Gefühlsäußerungen des Kindes ermöglicht. So können Kinder ihren Eltern offen zeigen, wenn sie z. B. traurig, ängstlich, ärgerlich oder auch glücklich sind.
Definition5
Responsivität bezeichnet das Ausmaß, in dem Bezugspersonen in der Lage sind, die Signale des Kindes wahrzunehmen, und inwieweit sie bereit sind, darauf einzugehen.
Zu einer Unterdrückung der Gefühle vonseiten des Kindes wird es kommen, wenn die Eltern sich ablehnend verhalten. Dies wiederum hat Auswirkungen auf das Bewältigungsverhalten in schwierigen (zwischenmenschlichen) Situationen (Grossmann et al. 1989).
Bindungsphasen
In der Bindungsentwicklung können nach Ainsworth und Kollegen (1978) vier Phasen unterschieden werden, wobei verschiedene Autoren unterschiedliche Zeitangaben und teilweise auch unterschiedliche Entwicklungsschritte zu den verschiedenen Phasen angeben. Richtwerte sind in den folgenden Ausführungen aufgenommen:
1. Die Vor-Bindungsphase: In den ersten sechs Lebenswochen eines Babys wird von der Vor-Bindungsphase gesprochen. Da sich in dieser Zeit noch keine Bindung entwickelt hat, bereitet es dem Baby in der Regel kein Unwohlsein, auch bei anderen, unbekannten Erwachsenen zu bleiben. Mithilfe angeborener Signale wie z. B. Weinen, Lächeln oder Augenkontakt vermag das Baby in Interaktion mit anderen Menschen zu treten.
2. Die beginnende Bindung: Die Phase der beginnenden Bindung erstreckt sich über das Alter von sechs Wochen bis zu sechs bis acht Monaten. Das Baby ist nun in der Lage, zwischen Familienmitgliedern und anderen Personen zu unterscheiden, wobei dem Baby aber auch bereits eine Differenzierung zwischen den einzelnen Familienmitgliedern möglich ist. Da in dieser Zeit ein starker Anstieg im aktiven Bindungsverhalten zu verzeichnen ist, besteht die Möglichkeit, das Baby bereits in dieser frühen Phase als gebunden zu betrachten, sofern als Kriterium für die Bindung an eine Person deren schlichte Bevorzugung gegenüber anderen Menschen angesehen wird. Wird jedoch die Fähigkeit zum aktiven Suchen von Nähe zur Bindungsperson als Kriterium betrachtet, wäre das Kind erst in der dritten, also der eigentlichen Bindungsphase bindungsfähig.
3. Die eigentliche Bindungsphase: Im Alter von sechs bis acht Monaten bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr entwickelt das Baby bzw. Kleinkind die Fähigkeit, sich eigenständig fortzubewegen. Der Erwerb der Lokomotion (Fortbewegung) ist dem Bindungssystem insofern nützlich, dass sie es dem Baby bzw. Kleinkind ermöglicht, der bevorzugten Person zu folgen bzw. aktiv deren Nähe zu suchen. Aber auch die beginnende Sprachentwicklung und die Möglichkeit zu zielgerichtetem Verhalten erlauben dem Kind, die Planung des eigenen Verhaltens auf das Verhalten, welches das Kind von seiner Bindungsperson erwartet, auszurichten. Das Kind ist dabei nicht mehr nur auf die Bindungsperson fixiert, sondern kann diese nunmehr als sichere Basis nutzen, von der aus es möglich ist, die Umwelt zu explorieren.
4. Die zielkorrigierte Partnerschaft: Ab dem Alter von zwei Jahren entwickelt sich eine → reziproke Beziehung zwischen dem Kind und seiner Bindungsperson. Durch die abnehmende egozentrische Sichtweise wird es den Kindern möglich, auch den Blickwinkel ihrer Bindungsperson einzunehmen, und sie gewinnen die Erkenntnis, dass dem Verhalten der Bindungsperson bestimmte Gefühle oder Motive zugrunde liegen können. Bowlby bezeichnet dies als zielkorrigierte Partnerschaft, bei der das kindliche Bindungsverhalten sich nun flexibel gestaltet und das reziproke Verhalten der Bindungsperson in konzeptuellen Plänen gespeichert ist (z. B. Ainsworth et al. 1978).
Verschiedene Bindungsmuster
Kinder können sich in ihrer Bindungssicherheit voneinander unterscheiden. Dieses wird zum einen auf das Verhalten der Bezugsperson, zum anderen aber auch auf individuelle → Dispositionen der Kinder zurückgeführt (siehe in diesem Kapitel den Abschnitt „Einflussfaktoren auf die Bindungsqualität – Temperament“). Die Unterschiede in der Bindungssicherheit zeigen sich in unterschiedlichen Bindungsmustern. Zunächst wurden im Rahmen der Bindungstheorie drei Bindungsmuster unterschieden, deren Identifizierung zuerst mit der Fremden Situation von Ainsworth und Wittig (1969) gelang. Die hierbei vorgenommene Unterscheidung wurde in weiteren Untersuchungen bestätigt.
An dieser Stelle soll die Fremde Situation dargestellt werden, um die Einteilung der Bindungsmuster zu verdeutlichen. Der Darstellung der Auswertung der Fremden Situation sowie weiterer Verfahren zur Erfassung der Bindungsmuster / Bindungsqualität und der Feinfühligkeit ist Kapitel 2 gewidmet.
Merksatz6
Ainsworth und Wittig (1969) entwickelten mit der „Fremden Situation“ die klassische Laborbeobachtungsmethode zur Erfassung der Bindungsmuster von Kindern im Alter von elf bis zwanzig Monaten.
Die Fremde Situation wird im Labor als Beobachtungsmethode durchgeführt, um zu untersuchen, welche Beziehung zwischen dem Verhaltenssystem Bindung und dem Verhaltenssystem der Exploration besteht (Bretherton 2019). Sie ist für Kinder im Alter zwischen elf und zwanzig Monaten validiert (→ Validität) (Grossmann et al. 1989). Insgesamt besteht die Fremde Situation aus acht Episoden, in denen das Ausmaß an ausgelöstem Stress beim Kind variiert wird. Die verschiedenen Episoden nach Ainsworth et al. (1978) sind Tabelle 1 zu entnehmen.
Tabelle 1: Episoden der Fremden Situation (nach Lengning 2004)
Episode
anwesende Personen
Beschreibung der Situation
(ungefähre Dauer)
1
Beobachter
Mutter
Kind
Der Beobachter führt die Mutter und das Kind in den Beobachtungsraum und verlässt ihn wieder. (30 Sekunden)
2
Mutter
Kind
Die Mutter beteiligt sich nicht, während das Kind exploriert. Falls notwendig, wird das Spiel des Kindes nach zwei Minuten angeregt. (3 Minuten)
3
fremde Person
Mutter
Kind
Die fremde Person betritt den Raum.
1. Minute: Die fremde Person ist still.
2. Minute: Die fremde Person unterhält sich mit der Mutter.
3. Minute: Die fremde Person nähert sich dem Kind.
Nach drei Minuten verlässt die Mutter unauffällig den Raum. (3 Minuten)
4
fremde Person
Kind
1. Trennungsphase:
Die fremde Person richtet ihr Verhalten auf das des Kindes aus. (3 Minuten – bei großem → Distress des Kindes auch kürzer)
5
Mutter
Kind
1. Wiedervereinigungsphase:
Die Mutter begrüßt das Kind und / oder beruhigt es, falls notwendig, während die fremde Person unauffällig den Raum verlässt. Dann bemüht sich die Mutter, das Kind wieder ins Spielen zu vertiefen. Danach verlässt sie den Raum, nachdem sie sich verabschiedet hat. (3 Minuten – oder länger, falls das Kind nicht ins Spiel zurück findet)
6
Kind alleine
2. Trennungsphase:





























