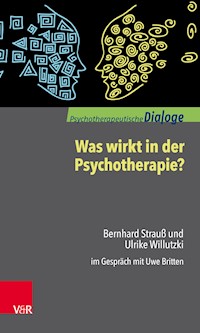Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nachdem über viele Jahrzehnte in der Entwicklungspsychologie zahlreiche Befunde zur Bindungsentwicklung vorgelegt wurden, sind diese und die ursprünglich von John Bowlby entwickelte Bindungstheorie auch in der klinischen Psychologie, Psychotherapie und in der Medizin angekommen. Das Handbuch fasst die Befunde zur Bedeutung von Bindung in unterschiedlichen Lebensabschnitten ebenso zusammen wie Ergebnisse der klinischen Bindungsforschung bezogen auf psychische und körperliche Störungen. Die besondere Relevanz der Theorie liegt in ihren Anwendungsbereichen, also der Prävention und der Psychotherapie in unterschiedlichen Behandlungssettings.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Strauß
Henning Schauenburg (Hrsg.)
Bindung in Psychologie und Medizin
Grundlagen, Klinik und Forschung – Ein Handbuch
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2017
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-023355-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-032252-3
epub: ISBN 978-3-17-032253-0
mobi: ISBN 978-3-17-032254-7
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Verzeichnis der Herausgeber und Autoren
Teil I Grundlagen
1 Bindungsentwicklung im Kindesalter
Gottfried Spangler und Iris Reiner
1.1 Einführung
1.2 Phasen der Bindungsentwicklung
1.3 Das Innere Arbeitsmodell von Bindung
1.4 Individuelle Unterschiede der Bindungsqualität: Bindungssicherheit und Bindungsdesorganisation
1.5 Determinanten von Bindungsunterschieden im Kindesalter
1.5.1 Transmission von Bindung
1.5.2 Elternverhalten: Feinfühligkeit als Prädiktor von Bindungssicherheit
1.5.3 Elternverhalten: Prädiktoren der Bindungsdesorganisation
1.5.4 Die Rolle individueller Dispositionen des Kindes
1.6 Konsequenzen von Bindungsunterschieden für die Persönlichkeitsentwicklung
2 Bindung und Mentalisierung in der Adoleszenz
Svenja Taubner, Paul Schröder, Tobias Nolte und Laura Zimmermann
2.1 Einleitung
2.2 Adoleszente Entwicklungsaufgaben
2.2.1 Transformation der Qualität von Bindungsrepräsentationen
2.2.2 Abwendung von den Eltern
2.2.3 Ad hoc Bindungsbeziehungen zu Gleichaltrigen und erste romantische Beziehungen
2.3 Bindungsnetzwerke in der Adoleszenz
2.4 Transformation von Bindung aus ethologischer Sicht
2.5 Integrierte und reflektierte Innere Arbeitsmodelle von Bindung
2.6 Transformation von beziehungsspezifischen Bindungsmustern zu einem übergeordneten Inneren Arbeitsmodell von Bindung
2.6.1 Stabilität von Bindung von der Kindheit zur Adoleszenz
2.6.2 Bindungsstabilität aus genetischer Perspektive
2.7 Individuelle Unterschiede der Bindungssicherheit in der Adoleszenz
2.8 Risiken und Chancen der Bindungstransformation in der Adoleszenz
3 Das Innere Arbeitsmodell von Bindung bei Erwachsenen
Johanna Behringer
3.1 Hintergründe und Ursprünge des Interesses an Bindung im Erwachsenenalter
3.2 Das Adult Attachment Interview zur Erfassung des Inneren Arbeitsmodells von Bindung im Erwachsenenalter
3.2.1 Die Durchführung des Adult Attachment Interview
3.2.2 Die Auswertung des Adult Attachment Interview
3.2.3 Besondere Merkmale und Funktionen des Adult Attachment Interviews
3.3 Kontinuität und Diskontinuität des Inneren Arbeitsmodells (IAM) von Bindung
3.3.1 Das Innere Arbeitsmodell von Bindung als zentrales Element für das Verständnis von Bindungsphänomenen
3.3.2 Transgenerationale Übertragung von Bindung: Grundsätzliches und organisierte Muster
3.3.3 Transgenerationale Übertragung von Bindungsdesorganisation: klinische Implikationen
3.3.4 Kontinuität von Bindung bis ins und während des Erwachsenenalters
3.3.5 Bindung und Beziehungsverhalten im Erwachsenenalter
3.3.6 Bindungsabhängige Unterschiede in psychischen Funktionen
3.4 Zusammenfassung
4 Bindung im höheren Lebensalter
Helmut Kirchmann
4.1 Altern als psychische Herausforderung
4.2 Ergebnisse bindungstheoretischer Alternsforschung
4.2.1 Anzahl und Qualität der Bindungsbeziehungen im Alter
4.2.2 Verteilung von Bindungsmerkmalen bei Älteren
4.2.3 Zusammenhänge zwischen Bindungsmerkmalen und Wohlbefinden/Lebenszufriedenheit bei Älteren
4.2.4 Zusammenhänge zwischen Bindungsmerkmalen und körperlichen Gesundheitsbeschwerden bei Älteren
4.3 Zusammenfassung
5 Bindung und Paarbeziehung
Kirsten von Sydow
5.1 Problem
5.2 Theoretische Grundkonzeptionen, Klassifikation und Diagnostik
5.3 Forschungsergebnisse
5.3.1 Metaanalysen
5.3.2 Befunde aus Primärstudien zu Partnerschaft und Bindung
5.3.3 Befunde aus Primärstudien zu Paar-Interaktionen (einschließlich Aggression und Gewalt) und Bindung
5.3.4 Befunde aus Primärstudien zu Emotionen, neuropsychologischer Selbstregulation und interaktioneller Ko-Regulation
5.3.5 Befunde aus Primärstudien zu Sexualität und Bindung
5.4 Spezifische Bindungsstörungen in Partnerschaften
5.4.1 Das Vermeider-Ausweicher-Beziehungsdilemma
5.4.2 Komplexe Traumafolgen und desorganisierten Beziehungen
5.5 Diskussion
6 Methoden zur Erfassung von Bindungsmerkmalen
Helmut Kirchmann, Sashi Singh und Bernhard Strauß
6.1 Einleitung
6.2 Erhebung von Bindungsmerkmalen bei Kleinkindern im Alter von etwa zwölf Monaten
6.3 Erhebung von Bindungsmerkmalen bei Kindern im Kindergarten-, Vorschul- und frühen Schulalter (2–9 Jahre)
6.4 Erhebung von Bindungsmerkmalen im mittleren und späteren Schulalter (9–15 Jahre)
6.5 Erhebung von Bindungsmerkmalen bei Adoleszenten und Erwachsenen (ab ca. 16 Jahre)
6.6 Fragebogenmethoden zur Erfassung von Bindungsmerkmalen
6.7 Schlussfolgerungen
7 Neurobiologie der Bindung
Beate Ditzen und Markus Heinrichs
7.1 Einleitung
7.2 Neurobiologische Mechanismen der Bindungsmotivation
7.3 Der Einfluss von Bindung auf neurobiologische Funktionen
7.3.1 Körperliche Stresssysteme
7.3.2 Haupteffekt der Bindung auf stresssensitive biologische Funktionen
7.3.3 Puffereffekt der Bindung auf die neurobiologische Stressantwort
7.3.4 Beziehungsinterne Stressoren
7.3.5 Beziehungsexterne Stressoren
7.3.6 Bindung und Stress im Entwicklungsverlauf
7.4 Ausblick
7.5 Zusammenfassung
Teil II Klinische Themen
8 Bindungsbezogene psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen
Inge Seiffge-Krenke
8.1 Einleitung
8.2 Unsichere Bindungsmuster, elterliche Erziehungsstile und Psychopathologie
8.2.1 Zusammenhänge zwischen unsicheren Bindungsstilen und verschiedenen Störungsbildern bei Kindern und Jugendlichen
8.2.2 Unsichere Bindungsmuster, elterliche Erziehungsstile und Psychopathologie
8.2.3 Hochunsichere Bindungen, Bindungsstörungen und Traumata und ihr Einfluss auf Psychopathologie
8.2.4 Einflüsse elterlicher psychischer Störungen und desorganisierte Bindungsmuster ihrer Kinder
8.3 Forschungsprobleme und Forschungsbedarf
8.4 Klinische Implikationen
8.5 Ausblick
9 Bindungsdesorganisation
Anna Buchheim
9.1 Einleitung
9.2 Definition von Bindung und internalen Arbeitsmodellen von Bindung
9.3 Bindung als Schutz- und Risikofaktor für die psychische Entwicklung
9.4 Genetische Abweichungen bei Kindern mit einer desorganisierten Bindung
9.5 Transgenerationale Weitergabe von Bindung
9.6 Einfluss von Bindungssicherheit oder Bindungsunsicherheit auf die körperliche und psychische Gesundheit
9.7 Diagnostik von Bindungsdesorganisation bzw. unverarbeiteten Traumata
9.8 Befunde zur Bindungsdesorganisation bei verschiedenen Störungsbildern
9.9 Genetische und neuronale Korrelate von Bindungsdesorganisation
9.10 Fazit
10 Bindungsprozesse bei Angststörungen
Katja Petrowski und Peter Joraschky
10.1 Einleitung
10.2 Panik und Agoraphobie – Definition und klinisches Erscheinungsbild
10.3 Bindungstheorie und die Ätiologie der Angststörung
10.4 Interpersonelle Faktoren als Auslöser von Angststörungen
10.5 Angstvulnerabilität als ätiologisches Modell für die Entstehung der Panikattacken und der Agoraphobie
10.5.1 Genetische Modelle
10.5.2 Neurophysiologische Vulnerabilität
10.5.3 Bindung und Psychophysiologie
10.5.4 Konditionierungsmodell
10.5.5 Kognitive Faktoren
10.5.6 Kindliche Trennungsangst
10.5.7 Elterlicher Erziehungsstil
10.5.8 Konfliktdynamik der Panikstörung
10.5.9 Von der Panikattacke zur Panikstörung
10.5.10 Erwartungsangst
10.6 Das Bindungs- und Entwicklungstrauma bei Angststörungen
10.7 Bindungsklassifikation bei Angststörungen
10.8 Bindung, Selbstkonzepte und Konflikttoleranz bei Angststörungen
10.9 Interpersonelles Wechselspiel von Bindungssicherheit und Konflikt
10.10 Angststörungen und Psychotherapie
10.11 Bindungsorientierte Psychotherapie
10.11.1 Therapieleitfaden
10.11.2 Therapierational bei verstrickter Bindungsunsicherheit:
10.11.3 Vermeidender Bindungsstil
10.12 Zusammenfassung
11 Bindungsaspekte bei der Depression
Henning Schauenburg
11.1 Einleitung
11.2 Biologie, Bindung und Depression – eine Vorbemerkung:
11.3 Bindungsbezogene Krankheitsmodelle der Depression
11.4 Bindungsaspekte der Depression
11.4.1 Bindungsmuster bei depressiven Erkrankungen
11.4.2 Transgenerationale Weitergabe depressiver Risikofaktoren
11.4.3 Von der frühen Bindungsunsicherheit zur Depression des Erwachsenen
11.4.4 Bindungssicherheit, Emotionsregulation und Konfliktverarbeitung
11.5 Bindungsaspekte in der Psychotherapie depressiver Erkrankungen
11.5.1 Bindungsmuster und Therapieergebnis
11.5.2 Bindungsbezogene Wirkfaktoren
11.6 Zusammenfassung
12 Bindung und Persönlichkeitsstörungen
Eva Neumann
12.1 Persönlichkeitsstörungen und unsichere Bindung
12.2 Zusammenhänge der einzelnen Persönlichkeitsstörungen mit Bindung
12.2.1 Paranoide Persönlichkeitsstörung
12.2.2 Schizoide Persönlichkeitsstörung
12.2.3 Schizotypische Persönlichkeitsstörung
12.2.4 Antisoziale Persönlichkeitsstörung
12.2.5 Borderline-Persönlichkeitsstörung
12.2.6 Histrionische Persönlichkeitsstörung
12.2.7 Narzisstische Persönlichkeitsstörung
12.2.8 Vermeidende Persönlichkeitsstörung
12.2.9 Dependente Persönlichkeitsstörung
12.2.10 Zwanghafte Persönlichkeitsstörung
12.3 Abschließende Bewertung
13 Bindung und substanzbezogene Störungen
Andreas Schindler
13.1 Einleitung
13.2 Substanzbezogene Störungen
13.3 Theoretisches Modell der Zusammenhänge zwischen Bindung und substanzbezogenen Störungen
13.4 Empirie
13.4.1 Methodische Probleme
13.4.2 Sichere und unsichere Bindung
13.4.3 Befunde zu einzelnen Bindungsmustern
13.4.4 Befunde zu spezifischen Konsumentengruppen
13.4.5 Exkurs: Ist Bindung eine Suchtstörung?
13.4.6 Adoleszenz und familiäre Bindungsmuster
13.4.7 Exkurs: Elterliche Sucht als Risikofaktor
13.5 Diskussion
13.6 Therapeutische Implikationen
13.6.1 Die therapeutische Beziehung
13.6.2 Mentalisierungsbasierte Psychotherapie (MBT)
13.6.3 Systemisch-familientherapeutische Ansätze
13.7 Fazit
14 Bindung und somatoforme Störungen
Elisabeth Waller und Carl Eduard Scheidt
14.1 Einleitung
14.2 Verhältnis zum Körper und interaktionelle Aspekte bei somatoformen Störungen
14.3 Körper und Beziehung: eine entwicklungspsychologische Perspektive
14.4 Ein bindungstheoretisches Modell somatoformer Störungen
14.4.1 Bindung, Mentalisierung und Affektregulation
14.4.2 Bindung und Stressregulation
14.4.3 Bindung und Schmerzwahrnehmung
14.4.4 Bindung und Krankheitsverhalten
14.5 Untersuchungen zur Bindungsrepräsentationen bei somatoformen Störungen
14.6 Ausblick: klinische Implikationen
15 Bindung, körperliche Krankheit und Krankheitsbewältigung
Claudia Subic-Wrana
15.1 Einleitung
15.2 Bindung und physiologische Stressverarbeitung
15.3 Bindung und Rückgriff auf externe Stressregulatoren
15.4 Bindung und Krankheitsverarbeitung
15.5 Zusammenfassung und Ausblick
Teil III Interventionen/Psychotherapie
16 Frühe Hilfen und Kinderschutz
Ute Ziegenhain und Anne Katrin Künster
16.1 Einleitung
16.2 Frühe Hilfen und Kinderschutz: Entwicklungen in Deutschland
16.3 Interdisziplinäre Kooperations- und Vernetzungsstrukturen für passgenaue Unterstützung und Versorgung von jungen Familien
16.4 Optimierung des Angebotsrepertoires zur Förderung elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen
16.5 Stand der empirischen Evaluation zur Förderung elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen
16.6 Zusammenfassung und Ausblick
17 Bindungsaspekte in der primärmedizinischen Versorgung
Katja Brenk-Franz
17.1 Einführung und bindungstheoretische Grundlagen
17.2 Interindividuelle Unterschiede in den Bindungsmerkmalen
17.3 Modell der Aktivierung des Bindungssystems und deren Bedeutung für die Primärmedizin
17.4 Bindung und Krankheitsverarbeitung
17.5 Bindung und Selbstmanagement in der Primärversorgung
17.6 Die Arzt-Patient-Beziehung in der Primärmedizin
17.7 Bindungsmerkmale des Arztes
17.8 Bindung als Prädiktor für Adherence und Behandlungserfolg
17.9 Ausblick
18 Bindung und Psychotherapie
Johannes C. Ehrenthal
18.1 Einleitung
18.2 Hintergrund
18.3 Bindung als Prädiktor
18.4 Bindung als Outcome
18.5 Desiderate für zukünftige Forschung
18.6 Fazit für die therapeutische Praxis
19 Bindungsaspekte im Psychotherapieprozess
UIrike Dinger
19.1 Einleitung
19.2 Theoretische und klinische Grundlagen
19.3 Bindungsmerkmale von Patienten
19.3.1 Exploration in der Psychotherapie: Öffnungsbereitschaft und narrativer Prozess
19.3.2 Qualität der therapeutischen Allianz
19.3.3 Andere Merkmale von therapeutischen Beziehungen
19.4 Bindungsmerkmale von Therapeuten
19.4.1 Verteilung der Bindungsmuster von Therapeuten
19.4.2 Reaktion und Gegenübertragung auf verschiedene Patienten
19.4.3 Therapeutische Allianz und Bindung an den Therapeuten
19.4.4 Passung von Patienten und Therapeuten
19.5 Veränderungen von Bindungsmerkmalen während der Therapie
19.6 Implikationen für die therapeutische Praxis
20 Bindungsaspekte in der Gruppenpsychotherapie
Bernhard Strauß
20.1 Einleitung
20.2 Bindung und Gruppentherapie: Theoretische Überlegungen
20.3 Befunde zum Zusammenhang zwischen Bindungsmerkmalen und Gruppenprozessen
20.4 Bindungsstatus und Behandlungserfolg in Gruppentherapien
20.5 Schlussfolgerungen
21 Bindungstheorie und Verhaltenstherapie
Diane Lange und Daniela Victor
21.1 Einleitung
21.2 Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP)
21.2.1 Liste prägender Bezugspersonen und Übertragungshypothese
21.2.2 Diszipliniertes persönliches Einlassen
21.2.3 Situationsanalyse
21.2.4 Zusammenhang zwischen CBASP und Bindungstheorie
21.3 Strategisch-Behaviorale Therapie (SBT)
21.3.1 Überlebensregel
21.3.2 Interventionen aus der SBT
21.3.3 Zusammenhang zwischen SBT und Bindungstheorie
21.4 Schematherapie
21.4.1 Interventionen aus der Schematherapie
21.4.2 Zusammenhang zwischen Schematherapie und Bindungstheorie
21.5 Interpersonelle Psychotherapie (IPT)
21.6 Verschiedene weitere Verfahren
21.7 Zusammenfassung
22 Bindungstheorie und Humanistische Psychotherapie
Jochen Eckert
22.1 Einleitung
22.2 Zur Bedeutung einer emotionalen zwischenmenschlichen Beziehung für die menschliche Entwicklung
22.3 Grundannahmen der Gesprächspsychotherapie zur Persönlichkeitsentwicklung
22.4 Die Persönlichkeitstheorie von Rogers und die Bindungstheorie von Bowlby im Vergleich
22.5 Zur Qualität der Beziehung zwischen Kind und Pflegeperson
22.5.1 Die Qualität einer bindungsfördernden Beziehung aus Sicht der Bindungstheorie
22.5.2 Die Qualität einer psychischen Stabilität fördernden Beziehung aus Sicht der Gesprächspsychotherapie
22.6 Mentalisierung und empathische Erfassung des Inneren Bezugsrahmens
22.7 Ein empirischer Vergleich von »Mentalisierung« und »Selbstexploration«
22.8 Welchen praktischen Gewinn können humanistische Therapieansätze aus den Erkenntnissen der Bindungstheorie ziehen?
22.9 Zusammenfassung
23 Bindungstheorie und Psychodynamische Therapie
Anna Buchheim
23.1 Einleitung
23.2 Die Veränderbarkeit von unsicheren Bindungsrepräsentationen durch Psychodynamische Psychotherapien
23.2.1 Psychodynamische Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung
23.2.2 Langzeitpsychoanalysen und Veränderung von Bindungsrepräsentationen im Münchner Bindungs- und Wirkungsforschungsprojekt
23.2.3 Veränderung von Bindungsrepräsentation bei chronisch depressiven Patienten in der Hanse-Neuro-Psychoanalyse-Studie
23.2.4 Einsatz der Bindungsdiagnostik in der Katathym Imaginativen Therapie
23.3 Fazit
24 Bindung, Paar-/Familientherapie und Systemische Therapie
Kirsten von Sydow
24.1 Problem
24.2 Systemische Therapie und ihre theoretischen Grundlagen
24.3 Bindungstheorie
24.4 Versuch einer Integration: Systemische Bindungstheorie
24.5 Implikationen für die therapeutische Praxis
24.6 Spezifische bindungsorientiert-systemische Paar- und Familientherapie-Ansätze
24.6.1 Emotionsfokussierte Paartherapie (Emotion Focused Couple Therapy, EFT)
24.6.2 Multidimensionale Familientherapie (Multidimensional Family Therapy, MDFT)
24.6.3 Bindungsorientierte Familientherapie (Attachment-Based Family Therapy, ABFT)
24.7 Diskussion und Ausblick
Teil IV Versuch einer Integration
25 Bindung in Psychologie und Medizin – Perspektiven einer klinischen Bindungsforschung
Henning Schauenburg und Bernhard Strauß
25.1 Einleitung
25.2 In welchem Spannungsfeld bewegt sich die Bindungstheorie und -forschung heute?
25.2.1 Manifestationen von Bindungsstrategien und ihre Erfassung
25.2.2 Psychobiologie der Bindung
25.2.3 Bindung und (Psycho-)Pathologie
25.2.4 Bindung und psychologische Interventionen
25.3 Was nützt die Bindungstheorie den Psychotherapeuten?
25.4 Potential und Grenzen der Bindungstheorie in Psychologie und Medizin
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Für Mechthild und Renate
Vorwort
John Bowlby (1913–1990) begann mit den Vorarbeiten seiner Bindungstheorie schon vor dem Zweiten Weltkrieg, als er bei schwer verhaltensauffälligen Jugendlichen die Folgen emotionaler Deprivation für die kindliche Entwicklung studierte. Der klinische Kontext dieser Theorie war also eigentlich immer evident, dennoch sah sich Bowlby in der Gemeinschaft insbesondere der psychoanalytischen Psychotherapeuten seiner Zeit wegen seiner behaupteten »reinen Verhaltensorientierung« und seiner kritischen Haltung gegenüber der klassischen Triebtheorie starker Kritik und Ablehnung ausgesetzt. Dies trug dazu bei, dass die Bindungstheorie zwar in der Entwicklungspsychologie florierte und eine Vielzahl von Fortentwicklungen erlebte, in der Psychotherapie und in der psychosozialen Medizin dagegen lange nicht beachtet, wenn nicht gar unbekannt blieb.
In den 1980er und 1990er Jahren begann sich dieses Bild zu wandeln. Zuerst noch recht zögerlich und nun wiederum von den Entwicklungspsychologen kritisch beäugt, begann ein zartes Pflänzchen klinischer Bindungsforschung zu wachsen, wobei zu Beginn hauptsächlich die Frage im Blickpunkt stand, ob und in welcher Weise Bindungsunsicherheiten entwicklungspsychopathologisch relevant sind (Strauß et al., 2002).
In der Folge hat sich die klinische Bindungsforschung sehr rasch weiter differenziert. Bindungstheoretische Aspekte spielen heute sowohl in Psychotherapietheorien wie auch in der empirischen Psychotherapieforschung eine große Rolle. Auch in Bereichen, die eher der psychosomatischen Medizin zuzuordnen sind, aber auch im primärärztlichen Kontext ist die Zahl klinischer Studien mit bindungstheoretischem Hintergrund deutlich gewachsen.
Dieses große Wachstum war letztendlich Anregung für unsere Idee, den Stand des Bindungsthemas in Psychologie und Medizin zusammenzufassen und diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die die jeweiligen Bereiche im deutschen Sprachraum repräsentieren, zu bitten, kompakte und aktuelle Übersichten zu diesem Handbuch beizusteuern.
Das Ergebnis ist in unseren Augen ein sehr erfreuliches: Im Abschnitt Grundlagen werden die Bindungsentwicklung und ihre Stabilität in unterschiedlichen Lebensaltern, die Bedeutung von Bindung in Paarbeziehungen, neurobiologische Grundlagen und Methoden zur Erfassung von Bindungsmerkmalen zusammengefasst.
In dem Abschnitt über klinische Themen finden sich insgesamt neun Kapitel zum Zusammenhang von Bindungsmerkmalen und typischen psychischen Störungsbildern bzw. altersspezifischen Beeinträchtigungen.
Schließlich gibt es in dem Abschnitt über Bindungsaspekte von therapeutischen Interventionen eine Übersicht über Frühe Hilfen, über generelle Zusammenhänge zwischen Bindung und Psychotherapie bzw. Therapieprozess, in der Einzel- wie in der Gruppenpsychotherapie. Die vier wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren werden sodann aus der Perspektive der Bindungstheorie beleuchtet (Verhaltenstherapie, Gesprächspsychotherapie, Psychodynamische Therapie und Systemische Therapie).
Die Herausgeber haben versucht, in einem abschließenden Beitrag die vielfältigen Aspekte klinischer Bindungsforschung zu integrieren.
Wir sind allen Autorinnen und Autoren zu großem Dank verpflichtet, dass Sie ihre Beiträge so kompetent verfasst haben und gleichzeitig geduldig waren abzuwarten, bis alle Beiträge vorlagen und noch einmal auf den aktuellen Stand gebracht wurden.
Wir danken außerdem den Vertretern des Kohlhammer Verlags, Frau Brutler und Herrn Poensgen und insbesondere Frau Laux, die das Lektorat für diesen Band übernommen hat, für ihre sorgfältige und zuverlässige Arbeit.
Wir würden uns wünschen, dass der vorliegende Band die aktuellen Meilensteine der klinischen Bindungsforschung markiert und anregt, auf ihren Feldern weiter zu arbeiten und würden uns natürlich auch wünschen, dass es nicht allzu lange dauern muss, bis wir diese Übersicht mit neuen Ergebnissen versehen aktualisieren können.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine anregende Beschäftigung mit der Bindungstheorie, die mittlerweile aus dem klinischen Kontext nicht mehr wegzudenken ist.
Jena und Heidelberg im Sommer 2016
Bernhard Strauß und Henning Schauenburg
Verzeichnis der Herausgeber und Autoren
Herausgeber
Prof. Dr. Bernhard Strauß
Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie
Universitätsklinikum Jena
Stoystraße 3
07740 Jena
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Henning Schauenburg
Universitätsklinikum Heidelberg
Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik
Thibaustraße 2
69115 Heidelberg
E-Mail: [email protected]
Autoren
Dr. Johanna Behringer
Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie
Universität Erlangen
Nägelsbachstraße 49a
91052 Erlangen
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Anna Buchheim
Institut für Psychologie
Universität Innsbruck
Bruno-Sander-Haus
Innrain 52
A 6020 Innsbruck
E-Mail: [email protected]
Dr. Katja Brenk-Franz
Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie
Universitätsklinikum Jena
Stoystraße 3
07740 Jena
E-Mail: [email protected]
Dr. Dipl.-Psych. Ulrike Dinger
Universitätsklinikum Heidelberg
Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik
Thibautstraße 2
69115 Heidelberg
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. phil. Beate Ditzen
Universitätsklinikum Heidelberg
Institut für Medizinische Psychologie
Lehrstuhl für Medizinische Psychologie und Psychotherapie
Bergheimer Str. 20
69115 Heidelberg
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Jochen Eckert
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf
Institut für Psychotherapie
Von-Melle-Park 5
20146 Hamburg
E-Mail: [email protected]
Dr. Dipl.-Psych. Johannes C. Ehrenthal
Universitätsklinikum Heidelberg
Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik
Thibautstraße 2
69115 Heidelberg
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Markus Heinrichs
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Psychologie
Lehrstuhl für Biologische und Differentielle Psychologie
Stefan-Meier-Straße 8
79104 Freiburg i. Br.
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Peter Joraschky
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
E-Mail: [email protected]
Dr. Helmut Kirchmann
Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie
Universitätsklinikum Jena
Stoystraße 3
07740 Jena
E-Mail: [email protected]
Dr. Anne Katrin Künster
Institut Kindheit und Entwicklung
Herrenweg 10
89079 Ulm
E-Mail: [email protected]
Dr. Diane Lange
Eos-Klinik für Psychotherapie
Alexianer Münster GmbH
Hammer Straße 18
48153 Münster
E-Mail: [email protected]
Dr. Eva Neumann
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Medizinische Fakultät
Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Bergische Landstraße 2
40629 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]
Tobias Nolte
The Anna Freud Centre
12 Maresfield Gardens
London NW3 5SU
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Dipl. Psych. Katja Petrowski
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
E-Mail: [email protected]
Dr. phil. Dipl.-Psych. Iris Reiner
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Universitätsmedizin Mainz
Untere Zahlbacher Straße 8
55131 Mainz
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Carl Eduard Scheidt
Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin
Universitätsklinik Freiburg
Hauptstraße 8
79104 Freiburg
E-Mail: [email protected]
Dr. Andreas Schindler
Spezialambulanz für Persönlichkeits- und Belastungsstörungen
Integrierte Versorgung Borderline
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52
20246 Hamburg
E-Mail: [email protected]
Paul Schröder
Institut für Psychosoziale Prävention
Universitätsklinikum Heidelberg
Bergheimerstr. 54
69115 Heidelberg
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Inge Seiffge-Krenke
Johannes Gutenberg Universität Mainz
Kostheimer Landstraße 11
55246 Mainz-Kostheim
E-Mail: [email protected]
Dipl. Psych. Sashi Singh
Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie
Universitätsklinikum Jena
Stoystraße 3
07740 Jena
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Gottfried Spangler
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Institut für Psychologie
Nägelsbachstraße 49a
91052 Erlangen
E-Mail: [email protected]
PD Dr. Dipl.-Psych. Claudia Subic-Wrana
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Universitätsmedizin Mainz
Untere Zahlbacher Straße 8
55131 Mainz
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Kirsten von Sydow
Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie
Psychologische Hochschule Berlin (PHB)
Am Köllnischen Park 2
10179 Berlin
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Svenja Taubner
Universitätsklinikum Heidelberg
Institut für Psychosoziale Prävention
Bergheimerstraße 54
69115 Heidelberg
E-Mail: [email protected]
Dr. Daniela Victor
Eos-Klinik für Psychotherapie
Alexianer Münster GmbH
Hammer Straße 18
48153 Münster
E-Mail: [email protected]
Dr. Elisabeth Waller
Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin
Universitätsklinik Freiburg
Hauptstraße 8
79104 Freiburg
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Ute Ziegenhain
Sektion Pädagogik, Jugendhilfe, Bindungsforschung und Entwicklungspsychopathologie
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
Universitätsklinikum Ulm
Steinhövelstraße 5
89075 Ulm
E-Mail: [email protected]
Laura Zimmermann
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Teil I Grundlagen
1 Bindungsentwicklung im Kindesalter
Gottfried Spangler und Iris Reiner
1.1 Einführung
Unser Wissen über die Bindungsentwicklung beim Kind ist wesentlich durch die Bindungstheorie und die darauf aufbauende empirische Forschung geprägt. Die Bindungstheorie geht auf John Bowlby zurück (1969), der sie in den 1950er Jahren vor dem Hintergrund psychoanalytischer und verhaltensbiologischer Grundannahmen erstmals formuliert hat. Sie befasst sich mit dem Aufbau von emotionalen Beziehungen zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen, deren individuellen und sozialen Grundlagen sowie mit deren Konsequenzen für die weitere Entwicklung. Im Gegensatz zu früheren psychoanalytischen und lerntheoretischen Vorstellungen von Bindung als sekundärem Motivationssystem, das sich aus der Befriedigung von Primärbedürfnissen des Säuglings (z. B. Hunger) durch die Mutter entwickelt, wird Bindung aus der Sicht der Bindungstheorie als ein Primärmotiv gesehen, also einem grundlegenden Bedürfnis des Kindes nach Geborgenheit, Kontakt und Liebe, welches sich unabhängig von anderen Primärbedürfnissen entwickelt. Die Entstehung des Primärmotivs wird phylogenetisch mit dessen biologischer Schutzfunktion bzw. dem daraus resultierenden Überlebenswert erklärt. Das Potential zur Ausbildung des Bindungsverhaltenssystems ist also universell. Allerdings können sich durch Lerneinflüsse Unterschiede in ihrer qualitativen Ausprägung ausbilden (Grossmann und Grossmann, 1986a).
Die psychologische Funktion von Bindung besteht in der emotionalen Regulation des Kindes (z. B. Zimmermann, 1999). Vor allem Neugeborene und Säuglinge sind auf Regulation durch ihre Bezugspersonen angewiesen. Ältere Säuglinge können ihr Verhalten in Alltagssituationen, die nur geringe emotionale Belastungen mit sich bringen, zu einem gewissen Grad selbst organisieren (Als, 1986; Spangler et al., 1994), benötigen aber die Unterstützung der Bindungsperson, um Situationen, die in ihnen negative Emotionen auslösen, angemessen bewältigen zu können. Entsprechende Erfahrungen führen zum Aufbau spezifischer Erwartungen des Kindes bezüglich der Verfügbarkeit der Bezugsperson, die sich nach Bowlby in sogenannten Inneren Arbeitsmodellen von Bindung widerspiegeln und welche in zukünftigen bindungsrelevanten, emotional belastenden Situationen entscheidend zur Verhaltens- und Emotionsregulation beitragen. Nachdem dies etwa bis zur Mitte des 2. Lebensjahres prozedural organisiert ist, also kindliche Erwartungen mit spezifischen Verhaltensstrategien einhergehen, spielen mit fortschreitender kognitiver und sprachlicher Entwicklung zunehmend mentale Strategien und kognitive Repräsentationen eine zunehmend wichtige Rolle in der Organisation des Inneren Arbeitsmodells (Spangler und Zimmermann, 1999). Diese beinhalten schließlich Vorstellungen und Erwartungen bezüglich der Bezugsperson und ihrer Verfügbarkeit, über die eigene Person und verfügbare Handlungsmöglichkeiten und Bewertungen über die Bedeutung von Bindungen.
Sowohl die biologische Schutzfunktion als auch die emotionale Regulationsfunktion von Bindung wird gewährleistet durch eine stabile Neigung des Kindes, Nähe zu Bezugsperson zu suchen. Zur Herstellung von Nähe dienen Bindungsverhaltensweisen, beim Kleinkind beispielsweise Schreien, Weinen, Anklammern, Rufen oder Nachfolgen. All diese Verhaltensweisen haben Nähe oder Körperkontakt zur Bezugsperson zur Folge, entweder weil sie die Bezugsperson veranlassen, die Nähe zum Kind herzustellen, oder weil das Kind diese Nähe aktiv herstellt. Bindungsverhalten zeigt das Kind allerdings nur dann, wenn sein Bindungsverhaltenssystem aktiviert ist, welches die innere Organisation von Bindung darstellt. Das Bindungsverhaltenssystem steht antithetisch zum Explorationsverhaltenssystem (Bowlby, 1969; Ainsworth et al., 1978), einem weiterem biologisch angelegtem Verhaltenssystem, das darauf ausgerichtet ist, die Umwelt zu erkunden. Eine Aktivierung des Explorationsverhaltenssystems ist nur dann möglich, wenn das Bindungsverhaltenssystems nicht aktiviert ist, da das Gefühl gewisser psychischer Sicherheit Voraussetzung für Spiel und Exploration beim Kind ist. Gleichermaßen führt eine Aktivierung des Bindungssystems unmittelbar zu einer Deaktivierung des Explorationsverhaltenssystems. Auf Seiten der Bezugsperson steht dem Bindungsverhaltenssystem des Kindes das sogenannte Fürsorgeverhaltenssystem gegenüber, welches Aufmerksamkeit gegenüber dem Kind und eine Bereitschaft oder Tendenz beinhaltet, auf kindliches Signalverhalten angemessen zu reagieren. Durch die Komplementarität der Verhaltenssysteme ist das Kind prä-adaptiv an seine soziale Umwelt angepasst.
Die Organisation des Bindungsverhaltenssystems erfolgt nach Bowlby (1969) über Emotionen, die als Bewertungsprozesse der gegebenen Situation sowohl als Warnsystem zur Regulation der eigenen Verhaltensweisen als auch – über den emotionalen Ausdruck – als Kommunikationssystem zur Regulation der Verhaltensweisen der Bezugsperson dienen. So aktivieren negative Emotionen des Kindes (z. B. Kummer oder Angst) das Bindungsverhaltenssystem, was durch Weinen oder ängstliches Rufen zum Ausdruck kommt und/oder aktives Bindungsverhalten wie Suchen oder Nachfolgen hervorruft. Durch den emotionalen Ausdruck teilt das Kind dabei der Bezugsperson seine emotionalen Bedürfnisse mit und veranlasst sie über die Aktivierung ihres Fürsorgeverhaltenssystems, Körperkontakt aufzunehmen und es zu trösten (Bowlby, 1969). Beide Prozesse, also sowohl die internen wie die externen Regulationsmechanismen, tragen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der nötigen Nähe zur Bezugsperson bei.
1.2 Phasen der Bindungsentwicklung
Kindliche Bindungen entwickeln sich im Laufe der ersten Lebensjahre in vier Phasen (Bowlby, 1969; Marvin und Bittner, 2008). Bindungsverhaltensweisen wie Weinen, Schreien oder Anklammern zeigt ein Kind schon nach der Geburt. In der ersten Phase von zwei bis drei Monaten zeigt das Kind deutlich Orientierungsverhalten gegenüber Menschen, reagiert spezifisch auf soziale Reize, differenziert aber noch kaum zwischen verschiedenen Personen. Während dieser Phase werden allerdings beim Kind schon gewisse Erwartungen an Personen seiner Umwelt aufgebaut (Ainsworth et al., 1978). In der zweiten Phase, die bis etwa zum 6. Monat dauert, wird das Orientierungsverhalten zunehmend auf vertraute Personen, die primären Bezugspersonen, beschränkt. Von einer Bindung wird hier noch nicht ausgegangen. In der dritten Phase, ab ca. sechs bis sieben Monaten, wird das Kind zunehmend wählerisch im Umgang mit Personen. Fremden begegnet es mit Zurückhaltung, Vorsicht oder Angst. Es bemüht sich, Nähe zur Bezugsperson aufrechtzuerhalten und benutzt sie als «sichere Basis« für seine Erkundungen der Umwelt. Es zeigt Kummer, wenn die Bezugsperson weggeht, und lässt sich gegebenenfalls nur von ihr trösten. Mit fortschreitender lokomotorischer Entwicklung zeigt es zusätzlich zu Signalverhalten zunehmend aktives Bindungsverhalten in Form von Kontaktaufnahme, Nachfolgen usw. Die Bindungsverhaltensweisen sind zunehmend ziel-orientiert und werden dem Bindungsverhaltenssystem funktionell untergeordnet (Ainsworth et al., 1978), so dass sie in Abhängigkeit vom Aktivierungszustand des Bindungsverhaltenssystems nach Art und Intensität zunehmend flexibel eingesetzt werden können. In der vierten Phase, die etwa im dritten Lebensjahr beginnt, bildet das Kind eine zielkorrigierte Partnerschaft zu seinen Bezugspersonen aus (Marvin und Bittner, 2008). Es ist aufgrund seiner kognitiven Entwicklung nun auch zunehmend in der Lage, Erwartungen, Bedürfnisse und Pläne der Bezugspersonen in die eigene Verhaltenssteuerung mit einzubeziehen und sie mit eigenen Plänen zu koordinieren. Das Kind kann auf zielkorrigierte Weise mit der Bezugsperson um Zeitpunkt und Ausmaß von Nähe verhandeln und benötigt zunehmend weniger körperlichen Kontakt zur emotionalen Regulation.
Die Bindungsentwicklung ist kein individueller Prozess auf Seiten des Kindes, sondern findet in enger Wechselwirkung mit dem Interaktionsverhalten der Bezugsperson statt, deren komplementäres Fürsorgeverhaltenssystem prä-adaptiv zum kindlichen Verhalten ist. Nach Bowlby (1969) versuchen auch Mütter, eine gewisse Nähe zum Kind aufrechtzuerhalten, und zeigen Rückholverhalten, wenn das Kind zu weit entfernt ist. Eine wesentliche Komponente des elterlichen Fürsorgeverhaltens ist nach Ainsworth et al. (1978) die Feinfühligkeit der Mutter für kindliche Signale. Durch die prä-adaptiv komplementären Verhaltenssysteme von Kind und Eltern ist in der Regel die Entwicklung einer ersten Bindung gewährleistet. Steht allerdings keine Bindungsperson zur Verfügung, so hat dies gravierende Konsequenzen, wie die Deprivationsforschung gezeigt hat (vgl. Zeanah et al., 2005; Bowlby, 1973; Harlow, 1971).
1.3 Das Innere Arbeitsmodell von Bindung
Während der Aufbau einer Bindung also phylogenetisch determiniert und somit umweltstabil ist, entwickeln Kindern unterschiedliche Qualitäten von Bindungen, die sich in der Art der kindlichen Verhaltensorganisation im Umgang mit emotional verunsichernden (d. h. bindungssystem-aktivierenden) Situationen zeigen (Ainsworth et al., 1978). Als psychologische Organisationsstruktur des Bindungsverhaltenssystems, welches individuelle Unterschiede in der Bindungsqualität erklären soll, wird das Innere Arbeitsmodell von Bindung postuliert (Bowlby, 1969; Main et al., 1985; Bretherton, 1985). Die Arbeitsmodelle sind Verinnerlichungen der frühen Erfahrungen des Individuums mit seinen ersten Bezugspersonen. Sie enthalten als solche Wissen zum einen über die Verfügbarkeit der Bindungsperson, verbunden mit Erwartungen an deren Verhalten in bindungsrelevanten Situationen, und zum anderen über eigene Selbstwert- oder Kompetenzeinschätzungen bzw. Wissen und Vorstellungen über eigene Handlungsmöglichkeiten. Schließlich gehört dazu Wissen um die Bedeutung von Bindungen sowie die Bedeutung von Emotionen und ihre Funktion in der Gestaltung von sozialen Beziehungen. Innere Arbeitsmodelle von Bindung wirken im Laufe der Entwicklung zunehmend auch in Abwesenheit der Bezugsperson. Mit fortschreitendem Alter wird das Innere Arbeitsmodell auch durch die zunehmende kognitive Entwicklung ausgeweitet und flexibler in seiner Organisation und Funktion. Die Arbeitsmodelle stellen im gewissen Sinne zielkorrigierte Pläne oder kognitive Landkarten dar, die bewusst oder unbewusst sein können, und die das individuelle Verhalten in spezifischen, insbesondere belastenden Situation beeinflussen. Theoretisch sind Innere Arbeitsmodelle von Bindung Voraussetzung für die Erklärung situations- und altersübergreifender Zusammenhänge und der Funktion und Dynamik der Bindungsorganisation (Bretherton et al., 1990).
Das Innere Arbeitsmodell von Bindung enthält sowohl emotionale als auch kognitive Anteile. Wesentliche auch empirisch zugängliche Komponenten könnten hier das Emotionsverständnis, Wissen über eigenen Handlungsmöglichkeiten, Erwartungen an das Verhalten der Bezugsperson sowie die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme sein (vgl. Delius et al., 2008). In Anlehnung an kognitive Theorien zur Entwicklung bereichsspezifischen Wissens (Hirschfeld und Gelman, 1998) könnte davon ausgegangen werden, dass Kinder im Verlauf ihrer Entwicklung in Auseinandersetzung mit der Umwelt immer komplexere Vorstellungen über Bindung entwickeln und dies in Form einer Wissenstheorie organisieren. Das Innere Arbeitsmodell von Bindung wäre in diesem Sinne als eine »Theorie von Bindung« zu verstehen, in der Kinder auf der Grundlage ihrer Erfahrungen in bindungsrelevanten Situationen Wissen erwerben über deren emotionale Bedeutung, über eigene Verhaltensmöglichkeiten und über Gefühle und typische Reaktionen der Bezugspersonen (Delius et al., 2008).
Die Organisation des Inneren Arbeitsmodells von Bindung erfolgt in verschiedenen Alterstufen auf unterschiedlichen Ebenen (vgl. Spangler und Zimmermann, 1999). Im Neugeborenenalter ist Bindungsverhalten eher auf der Reflexebene organisiert und noch nicht an spezifischen Personen orientiert, das Bindungswissen ist im Wesentlichen in Form eines phylogenetisch erworbenen Moduls (im Sinne von Gopnik und Meltzoff, 1997) vorhanden. Dieses primäre Bindungssystem erfüllt die Funktion des Bindungsverhaltens in einer Entwicklungsphase, in der spezifische Bindungsbeziehungen noch nicht bestehen. Auf der Basis des primären Bindungssystems und spezifischer Erfahrungen mit den Fürsorgepersonen und erster sozial-kognitiver Fertigkeiten entwickelt das Kind bis zum Ende des ersten Lebensjahres spezifische Bindungsbeziehungen mit primären Bezugspersonen. Es verfügt über affektiv-prozedural organisiertes Wissen um Bindung (vgl. Spangler und Zimmermann, 1999). So kann die emotionale Bewertung einer emotional anfordernden Situation zu einem Bedürfnis nach Nähe und damit gegebenenfalls zur Aktivierung des Bindungsverhaltenssystems führen, wodurch dann eine spezifische, durch die Erwartungen an die Bezugsperson determinierte Verhaltenstrategie ausgelöst wird. Die individuelle Organisationsstruktur der Bindung zeigt hier kaum Freiheitsgrade. Das Kind verfügt über implizite Erwartungen bezüglich des Verhaltens der Bezugsperson, die in der aktuellen Situation unmittelbar mit spezifischen Verhaltensstrategien verknüpft werden. Aus der Theorie-Theorie Perspektive hat das Kind eine Theorie über Handlungen und ihre Konsequenzen (Gopnik und Meltzoff, 1997). Dieses prozedural organisierte IWM ist ein implizites affektives Modell, bei dem kognitive Bewertungsprozesse auf bewusster oder repräsentationaler Ebene noch kaum eine Rolle spielen.
Mit dem Beginn des symbolischen Denkens bzw. der Sprachentwicklung erlangt das Kind die Fähigkeit, psychische Zustände (z. B. Wünsche und Bedürfnisse) und Handlungsoptionen zu repräsentieren – nicht nur eigene, sondern durch die zunehmende Fähigkeit zur Perspektivenübernahme auch diejenigen der Bezugsperson (Bovenschen, 2006), und sie mental zu verknüpfen. Die Repräsentation psychischer Zustände und Handlungsoptionen sowie deren Koordination ermöglicht spezifischere Bewertungsprozesse, erweitert das Spektrum von alternativen Reaktionsmöglichkeiten und eröffnet vielfältigere Entscheidungsoptionen bei der Reaktionsauswahl. Das Innere Arbeitsmodell wird nun zunehmend auf der Repräsentationsebene organisiert und stellt aus der Theorie-Theorie Perspektive nun eine vollständige Theorie von Bindung dar.
1.4 Individuelle Unterschiede der Bindungsqualität: Bindungssicherheit und Bindungsdesorganisation
Individuelle Unterschiede in der Bindungsqualität können im Hinblick auf Bindungssicherheit (Ainsworth et al., 1978) und Bindungsdesorganisation (Main und Solomon, 1990) festgestellt werden. Die Bindungssicherheit äußert sich in der Art der Strategien, die ein Kind zur Nähe-Distanzregulierung verwendet, insbesondere in der Fähigkeit, bei Aktivierung des Bindungssystems der Bezugsperson die Bedürfnisse nach Nähe mitzuteilen, und somit auf der Basis der Verfügbarkeit der Bezugsperson die emotionale Stabilität wiederzuerlangen und eine Deaktivierung des Bindungssystems zu erreichen. Sicher gebundene Kinder zeigen deutliches Explorationsverhalten bei Anwesenheit der Bezugsperson, signalisieren bei der Trennung deutlich, dass sie sie vermissen (reduzieren Explorationsverhalten, zeigen Bindungsverhalten) und sie nehmen bei der Rückkehr der Bezugsperson Interaktion oder Kontakt zu ihr auf und können mit ihrer Hilfe die negativen Gefühle regulieren und dadurch ihre emotionale Stabilität wiedergewinnen. Andere Kinder zeigen unsichere Bindungsmuster (vgl. Ainsworth et al., 1978). Kinder mit einer unsicher-vermeidenden Bindung scheinen während der Trennung kaum betroffen, zeigen kaum Bindungsverhalten und halten zumindest oberflächlich ihr Explorationsverhalten aufrecht, bei der Rückkehr der Bezugsperson ignorieren sie diese und vermeiden deutlich den Kontakt mit ihr. Sie scheinen also nicht in der Lage, ihre Bezugsperson zur Emotionsregulation zu nutzen. Kinder mit einer unsicher-ambivalenten Bindung wirken von Anfang an eher ängstlich und lösen sich nur schwer von der Bezugsperson. Durch die Trennung sind sie stark betroffen; sie zeigen deutlich ihren Kummer, und nehmen bei der Rückkehr der Bezugsperson Kontakt auf, der aber mit deutlichem Ärger verbunden ist. Sie zeigen also Bindungsverhalten, können jedoch die Nähe zur Bezugsperson nicht nutzen, um sich bald wieder emotional zu stabilisieren und zum Spiel zurückzukehren.
Main und Solomon (1986) haben die Bindungsdesorganisation als ein weiteres Bindungsmuster beschrieben. Dieses äußert sich darin, dass keine durchgängigen Bindungsstrategien festzustellen sind bzw. trotz zugrundeliegender Strategien ein großes Ausmaß an desorganisiertem Verhalten zu beobachten ist, welches z. B. durch ungeordnete oder unterbrochene Bewegungen, sich widersprechende Verhaltensweisen bzw. Verwirrung oder Furcht vor der Bezugsperson zum Ausdruck kommt. Während die durch die Ainsworthschen Kategorien beschriebenen Gruppen die Sicherheit der Bindung beschreiben, bezieht sich die Mainsche Kategorie auf die Qualität der Organisation. Das Verhalten der Kinder in der Fremden Situation kann im Hinblick auf beide Dimensionen unabhängig voneinander beschrieben werden (vgl. z. B. Spangler, 2011).
Die Bindungsmuster und ihre Interpretation im Hinblick auf die Angemessenheit bezüglich der Funktion des Bindungsverhaltenssystems wurden mittlerweile auch durch Studien validiert, die die psychobiologische Organisation des Bindungsverhaltens erforscht haben. So belegt die erhöhte Nebennierenrindenaktivität (Cortisolanstieg) nach der Fremden Situation bei unsicher bzw. desorganisiert gebundenen Kindern emotionale Belastung und die adaptive Unangemessenheit unsicherer Bindungsstrategien (Spangler und Grossmann, 1993; Hertsgaard et al., 1995; Spangler und Schieche, 1998). Weiterhin fanden sich Hinweise auf die soziale Pufferfunktion einer sicheren Bindung bei gegebenen ungünstigen individuellen Dispositionen: Bei ängstlichen oder verhaltensgehemmten Kleinkindern kam es in Anforderungssituationen nur dann zu einer physiologischen Stressreaktion (Cortisolanstieg), wenn gleichzeitig keine sichere Bindung gegeben war (Nachmias et al., 1996; Gunnar et al., 1996; Spangler und Schieche, 1998). Herzfrequenzakzelerationen bei unsicher-vermeidenden Kindern während der Trennung in der Fremden Situation zeigen, dass es auch bei diesen Kindern zu einer Aktivierung des Bindungsverhaltenssystems kommt (Spangler und Grossmann, 1993), obwohl augenscheinlich kein Bindungsverhalten gezeigt wird. Ebenso konnte mit Hilfe von Herzfrequenzparametern bei desorganisierten Kindern der theoretisch postulierte psychophysiologische Alarmierungszustand belegt werden, auch wenn dieser auf Verhaltensebene teilweise nur sehr subtil in Erscheinung tritt (Spangler und Grossmann, 1999).
Die altersabhängige Organisation des Bindungssystems hat Implikationen für die Erfassung von individuellen Unterschieden. Die Erfassung der Bindungsqualität erfolgt in emotional belastenden Situationen bzw. emotionalen Anforderungssituationen, die dazu führen, dass das Bindungssystem aktiviert wird. Dies ist im Kleinkindalter die Fremde Situation (Ainsworth und Wittig, 1969), in deren Verlauf die Kinder zwei kurzen räumlichen Trennungen von der Mutter unterworfen werden. Nach der Bindungserfassung auf der Verhaltensebene im Kleinkindalter wird in späteren Altersabschnitten zunehmend die Repräsentationsebene einbezogen, während gleichzeitig die Verhaltensebene mit steigendem Alter in den Hintergrund rückt. Gemeinsam ist allen Verfahren, dass sie kategoriale Verhaltens- bzw. Repräsentationsmuster erfassen, die von ihrer Struktur her mit den in der Fremde Situation beobachteten klassischen Verhaltensmustern von Bindungssicherheit und -desorganisation korrespondieren. Als direkte Beobachtungsmethode wird im Kleinkind- und Vorschulalter auch der Attachment Q-Sort von Waters und Deane (1985) verwendet. Der entscheidende Unterschied zu den anderen Verhaltensbeobachtungsmethoden besteht darin, dass hier eine Bindungserfassung durch Beobachtung kindlichen Verhaltens in Alltagssituationen erfolgt, in denen eine Aktivierung des Bindungssystems nicht explizit induziert wird, jedoch davon ausgegangen wird, dass in Alltagssituationen auch Bindungsverhalten aktiviert wird und somit Bindungsverhaltensstrategien beobachtbar sind.
Im Vorschulalter und beginnenden Grundschulalter werden einerseits – vergleichbar der Fremden Situation – Verhaltensstrategien in bindungsrelevanten Situationen untersucht (z. B. Main et al., 1985; Wartner et al., 1994). Hierbei erfolgt eine Ausweitung der Trennungssituation, in der Kriterien der Emotions- und Nähe-Regulation zunehmend weniger den direkten Körperkontakt und mehr Aspekte eines flüssigen Dialogs sowie eines entspannten und unverkrampften Umgangs mit körperlicher Nähe einbeziehen. Auch schon im Vorschulalter werden Verfahren verwendet, die Bindungsrepräsentationen erfassen sollen. Nach Bretherton (1985) beginnen Kinder im frühen Vorschulalter damit, ihr Bindungswissen konzeptuell in Form mentaler Repräsentation zu organisieren. Zur Erfassung solcher internalen Repräsentation von Bindung im Vorschulalter wurden projektive Verfahren entwickelt, bei denen die Kinder entweder zu bildlich dargestellten Bindungsszenen befragt werden (Klagsbrun und Bowlby, 1976) oder in ein bindungsthematisches Puppenspiel involviert werden (Bretherton et al., 1990; Gloger-Tippelt et al., 2002; Geyer et al., 1999). Am häufigsten benutzt wurde das Geschichtenergänzungsverfahren von Bretherton et al. (1990), bei dem die Kinder aufgefordert werden, bindungsrelevante Geschichtenstämme, bei denen Gefühle wie Kummer und Angst bzw. Trennung und Wiedervereinigung thematisiert werden, nach einer standardisierten Einführung zu Ende erzählen bzw. zu Ende zu spielen (vgl. auch George und Solomon, 1996). Kriterien sind hier die Kohärenz der Darstellung der Geschichten und eine inhaltlich adäquate Auflösung. Bei älteren Kindern werden dann in Anlehnung an das Bindungserwachseneninterview auch Interviewverfahren zur Erfassung der Bindungsrepräsentation durchgeführt (z. B. Zimmermann und Scheuerer-Englisch, 2003).
1.5 Determinanten von Bindungsunterschieden im Kindesalter
Eine zentrale Frage der Bindungsforschung beschäftigt sich damit, welche Faktoren zu individuellen Unterschieden der Bindungsmuster führen. Derzeitige theoretische Ansätze gehen vor allem von der Annahme aus, dass Bindungsmuster der Eltern – gemessen mit dem Bindungsinterview für Erwachsene (Adult Attachment Interview, AAI; Main und Goldwyn, 1985) – auf die Kinder übertragen werden, was mit dem Begriff »Transmission von Bindung« beschrieben wird (Bretherton, 1990; Main et al., 1985). Das AAI erfasst Innere Arbeitsmodelle von Bindung auf der Repräsentationsebene. Bei der Auswertung wird die Zuordnung zu einer der vier Bindungsgruppen (sicher, unsicher-distanzierter, unsicher-verwickelter oder ungelöster Bindungsstatus) überwiegend durch Kohärenz und aktuelle Bewertung frühere Bindungsbeziehungen vorgenommen (Reiner et al., 2013). Nachstehend werden wir auf empirische Untersuchungen dazu eingehen und verschiedene Mechanismen und Einflussfaktoren diskutieren, die der Transmission von Bindung zugrunde liegen können. Dazu zählen das elterliche Verhalten, insbesondere elterliche Feinfühligkeit und verwandte Konzepte. Zudem wird auf den Beitrag dispositioneller kindlicher Merkmale für die Entstehung von Bindungsunterschieden beim Kind eingegangen.
1.5.1 Transmission von Bindung
Mehrere Studien zeigen, dass die Bindungsmuster zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson durch den Bindungsstatus der Bezugsperson vorausgesagt werden kann: In einer Metaanalyse berichtete van IJzendoorn (1995) eine Konkordanzrate von 70 % zwischen elterlicher Bindungsrepräsentation und kindlicher Bindungsqualität im Hinblick auf die Kategorien der Bindungssicherheit (sicher, unsicher-distanziert/vermeidend, unsicher-verwickelt/ambivalent), wobei die Vorhersage der kindlichen Bindung durch die elterliche Bindungsrepräsentation beim sicheren Muster sehr hoch war (82 %), beim vermeidenden Muster bei etwa zwei Drittel und beim ambivalenten Muster nur bei etwa einem Drittel lag, was aber trotzdem statistisch noch überzufällig war. Unter Einbeziehung der Bindungsdesorganisation wurde bei Eltern mit unverarbeitetem Bindungsstatus in der Hälfte der Fälle beim Kind Bindungsdesorganisation festgestellt. Die Konkordanzen waren recht robust und konnten in mehreren Studien gefunden werden, wobei geringere Effektstärken bei älteren Kindern und nicht-amerikanischen Stichproben zu finden waren.
Als vermittelnder Prozess für die Transmission von Bindungsunterschieden von der Bezugsperson auf das Kind gilt das elterliche Verhalten. Bezüglich der Dimension der Bindungssicherheit ist dies die Feinfühligkeit der Bezugsperson (s. u.). Eltern mit einer sicheren Bindungsrepräsentation reagieren feinfühliger auf kindliche Signale (z. B., wenn das Kind ängstlich ist) als unsicher Eltern mit unsicherer Bindungsrepräsentation (z. B. Grossmann et al., 1988; van IJzendoorn, 1995). Elterliche Feinfühligkeit wiederrum gilt als zuverlässiger Prädiktor von Bindungssicherheit (Ainsworth et al., 1978; Grossmann et al., 1985). Van IJzendoorn (1995) zeigte in seiner Metaanalyse allerdings auch, dass die Transmission von Bindung zwischen Eltern und Kind zwar zu einem gewissen Anteil, jedoch nicht vollständig über elterliche Feinfühligkeit zu erklären sei: zusammengenommen klärte mütterlicher Feinfühligkeit dabei nur 23 % der gemeinsamen Varianz zwischen mütterlicher Bindungsrepräsentation und der Bindungsqualität des Kindes auf. Van IJzendoorn sprach deswegen vom »Transmission gab« (Übertragungslücke), da Wirkfaktoren und Ursachen einer transgenerationalen »Übertragung« von Bindung nicht vollständig verstanden und erforscht sind, und stellte die Frage nach weiteren vermittelnden Prozessen.
In einer jüngsten Metaanalyse zur Transmission von Bindung, welche insgesamt 95 Studien inkludierte, konnten die Befunde der ersten Metaanalyse von 1995 im Wesentlichen repliziert werden, wobei schwächere Effekte in jüngeren und nicht-publizierten Studien zu finden sind (Verhage et al., 2015). Außerdem wiesen die Autoren auf den Einfluss situationsbezogener Merkmale (z. B. Risikostichprobe, Qualität der Partnerschaft) und genetischer Faktoren hin.
Eine wichtige Rolle könnte zudem die Mentalisierungsfähigkeit der Eltern spielen. Im AAI und Bindungskontext zeigt sich diese unter anderem im »Reflective Functioning«. Refelctive Functioning äußert sich vor allem in der Fähigkeit, Verhalten durch Zuschreibung mentaler Zustände zu interpretieren, zwischen innerer und äußerer Realität unterscheiden zu können und – sowohl bei sich selbst und auch bei anderen – Zusammenhänge oder Abweichungen zwischen psychischen Zuständen und äußerer Realität zu erkennen (Fonagy et al., 1991b; Fonagy et al., 1998). Mentalisierungsfähigkeit wird idealerweise im Kontext sicherer Bindungsbeziehungen erworben und zeigt auch empirisch starke Zusammenhänge zu Bindungssicherheit (Bouchard et al., 2008). Gleichzeitig fördert eine hohe Menatlisierungsfähigkeit der Eltern den Aufbau einer sicheren Bindung zum eigenen Kind, da sie es den Eltern erleichtert, innerpsychische Zustände und Emotionen des Kindes zu verstehen (»Mind-Mindedness«) und entsprechend zu reagieren. In der Erlanger Eltern und Partnerstudie konnte eine hohe Mentalisierungsfähigkeit der Mutter (pränatales Reflective Functioning im AAI) hohe Feinfühligkeit (drei Monate postnatal) zuverlässiger vorhersagen als Bindungssicherheit der Mutter (Reiner et al., 2009). Die amerikanische Bindungsforscherin Arietta Slade und ihre Arbeitsgruppe konnten außerdem zeigen, dass sich hohe Mentalisierung in Bezug auf das eigene Kind und Elternverhalten (»Parental Reflective Functioning«) auch in positiveren Eltern-Kind-Interaktionen widerspiegelt und sichere Bindungen begünstigt (Slade, 2005; Ordway et al., 2014).
1.5.2 Elternverhalten: Feinfühligkeit als Prädiktor von Bindungssicherheit
Die Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth (1931–1999), eine Schülerin John Bowlbys, beschäftigte sich als Erste mit dessen zunächst eher theoretisch formulierten Postulaten der Bindungstheorie empirisch. In einer Pionierstudie der Bindungsforschung, der Baltimore-Studie (Ainsworth et al., 1978), führte sie ausführliche und lange Beobachtungen von Interaktionen verschiedener Mutter-Kind-Dyaden in häuslicher Umgebung durch. Dabei stellte sie fest, dass vor allem die Feinfühligkeit (andere Faktoren waren Akzeptanz, Kooperation und Verfügbarkeit) besonders wichtig für die Bindungsentwicklung des Kindes ist. Sie entwickelte die bis heute weit verbreitete »Ainsworth Sensitivity Scale« (Ainsworth und Wittig, 1969) als eine Methode, die elterliche Feinfühligkeit auf einer Rating Skala von 1–9 einzuschätzen und somit empirisch messbar zu machen. Feinfühligkeit ist dabei definiert als Fähigkeit, das Befinden und die Bedürfnisse des Kindes a) wahrzunehmen b) richtig zu interpretieren und c) prompt und d) angemessen darauf zu reagieren. Eine feinfühlige Bezugsperson muss im ersten Schritt also die (Bindungs-)Signale ihres Kindes wahrnehmen können, und in einem zweiten Schritt diese Signale richtig interpretieren. Dies ist wesentlich, da fehlerhafte Wahrnehmung (Übersehen von Signalen) oder Fehlinterpretation (»wenn das Kind schreit, will es mich nur ärgern«) eine feinfühlige Reaktion im Sinne des Kindes verhindern, die darin besteht, dass die Bezugsperson in den beiden letzten Schritten zeitnah und angemessen auf die Signale ihres Kindes reagiert. Im Kontrast dazu wird eine wenig feinfühlige Mutter von Ainsworth et al. (1974) folgendermaßen beschrieben: »Socialize with the baby when he is hungry, play with him when he is tired, and feed him when he is trying to initiate social interaction« (S. 129). Nach den Längsschnittbefunden von Ainsworth et al. (1978) war bei Müttern von sicher gebundenen Kindern eine hohe Feinfühligkeit zu beobachten, während bei Müttern von unsicher vermeidenden und unsicher ambivalenten Kindern eine geringe durch Zurückweisung kindlicher Bedürfnisse gekennzeichnete Feinfühligkeit gegeben war.
Zwischenzeitlich wurde der Zusammenhang zwischen elterlicher Feinfühligkeit und Bindung im Kindesalter vielfach untersucht und bestätigt (im deutschsprachigen Raum z. B. Grossmann et al., 1985; Spangler et al., 1996; vgl. auch Metaanalyse von De Wolff und van IJzendoorn, 1997). Zudem konnten Interventionsstudien mit einer Erhöhung der elterlichen Feinfühligkeit auch eine Verbesserung der Bindungsqualität erreichen (van den Boom, 1994). Die Metaanalyse von De Wolff und van IJzendoorn (1997) bestätigte Feinfühligkeit als wichtigsten Prädiktor für die Entwicklung von Bindungsunterschieden, verwies aber vor dem Hintergrund der Heterogenität der Studien auch auf bestimmte Einflussvariablen. Während der Beobachtungskontext (Labor versus häusliche Umgebung) und die Untersuchungsdauer keinen Einfluss hatten, fanden sich größere Effekte in Studien, die Feinfühligkeit nach Ainsworth gemessen haben als in Studien, die Elternverhalten in verwandten Konzepten (z. B. elterliche Unterstützung, Kooperation) erfasst haben. Es zeigten sich auch stärkere Zusammenhänge zwischen Feinfühligkeit und Bindung des Kindes, wenn die Kinder älter (d. h. älter als ein Jahr) waren. Ein weitere Rolle spielte das Zeitintervall zwischen der Einschätzung des Elternverhaltens und der Erhebung der Eltern-Kind-Bindung: Je größer das zeitliche Intervall zwischen Messung der beiden Variablen, umso geringer die Zusammenhänge. Zusammenfassend stellten De Wolff und van IJzendoorn (1997) fest, dass Feinfühligkeit kindliche Bindung vorhersagt, aber ein statistisch nur moderater Zusammenhang besteht.
In der Annahme, dass der Zusammenhang tatsächlich größer sei, diskutieren Belsky und Fearon (2008) vor dem Hintergrund aktueller Empirie mögliche Ursachen und fassen sie als »Technical gap«, »Moderator gap« und »Domain gap« zusammen. Der Technical gap entsteht aus Ungenauigkeiten in der Messung von Feinfühligkeit: Um Messfehler zu vermeiden, führen zum Beispiel wiederholte Beobachtungen beziehungsweise Messungen von Mutter-Kind Interaktionen (Lindhiem et al., 2011) und eine Erhebung von Feinfühligkeit in stressinduzierten Kontexten anstelle von freiem Spiel (Leerkes et al., 2011) zu zuverlässigeren Ergebnissen. Der Moderator Gap bezieht sich auf Befunde, die insbesondere anlagebedingte Variablen (Temperament, genetische Disposition) berücksichtigen und dabei Gen-Umwelt-Interaktionen beziehungsweise eine genetische Suszeptibilität gegenüber umweltbezogenen Einflüssen (wie zum Beispiel eine feinfühlige oder wenig feinfühlige Mutter) feststellen konnten. Der Domain Gap bezieht sich darauf, dass Feinfühligkeit als Elternverhalten sehr umfassend ist und verwandte oder Teilaspekte davon genauere Prädiktoren beziehungsweise Determinanten von einer sicheren Eltern-Kind Bindung sein können.
Die britische Psychologin Elizabeth Meins (1999) fokussierte sich in ihren Studien auf die Angemessenheit der Reaktionen auf die Signale des Kindes als zentralen Kern der Feinfühligkeit. Ebenso wie van IJzendoorn (1995) kritisiert sie, dass Feinfühligkeit häufig zu global erfasst werde und wenig Konsens bestehe, welcher Kontext der Interaktion zwischen Mutter und Kind (z. B. Wickeln, Füttern, Spielen) zur Auswertung herangezogen wird. Sie entwickelte das Konzept der mütterlichen »Mind-Mindedness«, welches den Schwerpunkt im Gegensatz zur mütterlichen Feinfühligkeit – bei der das feinfühlige Reagieren auf emotionale oder physische Bedürfnisse eines Kindes im Vordergrund steht – in den angemessenen und damit feinfühligen Reaktionen auf innere mentale Prozesse setzt. Mind-Mindedness greife dann, wenn physische Zustände und emotionale Bedürfnisse des Kindes bereits befriedigt sind (Meins et al., 2001) und die Bezugsperson darauf angemessen, speziell in der sprachlichen Bewertung, reagiert. Die empirische Umsetzung dieser Idee führte bisher zu vielversprechenden Ergebnissen. Auch Mind-Mindedness sagte zuverlässig und konsistent Bindungssicherheit vorher (Laranjo et al., 2010; Meins et al., 2012).
1.5.3 Elternverhalten: Prädiktoren der Bindungsdesorganisation
Main und Solomon (1990) vermuteten ängstliches bzw. beängstigendes Verhalten (frightening/frightend behavior) der Bezugsperson als Ursache für die Entwicklung von Bindungsdesorganisation beim Kind. Die Ursache für solches Verhalten sehen sie in nicht verarbeiteten traumatischen Erfahrungen der Bezugspersonen. Bezüglich der Transmission des elterlichen unverarbeiteten Bindungsstatus auf die kindliche Bindungsdesorganisation zeigt die elterliche Feinfühligkeit auch nur geringe Effekte (van IJzendoorn et al., 1999). Mittlerweile belegen Studien aus Risikostichproben, dass vor allem Misshandlungserfahrungen und psychische Erkrankungen der Mutter (oder der Bezugsperson) einen desorganisierten Bindungsstatus vorhersagen (Carlson, 1998; Cyr et al., 2010). Die Schutzfunktion der Bezugsperson als sichere Basis geht bei misshandelnden Eltern verloren und psychische Störungen der Mutter beeinträchtigen deren Verfügbarkeit. Main und Hesse (1990) weisen indessen darauf hin, dass nicht eine traumatisierende Erfahrung der Eltern per se, sondern deren mangelnde Verarbeitung (wie sie sich im ungelösten Bindungsstatus im AAI widerspiegelt) zu misshandelndem Verhalten führen kann. Zudem können aber auch subtilere Formen von ängstigendem oder beängstigtem Elternverhalten zu desorganisiertem Bindungsverhalten bei Kindern führen. »Abweichendes Elternverhalten« hat sich als starker Prädiktor für desorganisiertes Bindungsmuster beim Kind erwiesen (Madigan et al., 2006) und umfasst neben beängstigen/verängstigtem Elternverhalten auch weitere affektive Störungen in der Kommunikation zum Kind, extreme Unfeinfühligkeit und dissoziatives Verhalten. Der Einfluss elterlichen Verhaltens, insbesondere abweichenden Elternverhaltens spielt vor allem in Risikostichproben eine große Rolle bei der Entstehung von Bindungsdesorganisation, während in Nichtrisikostrichproben dispositionelle Verhaltenscharakteristika einen höheren Vorhersagewert haben (Spangler et al., 1996).
Diese Befunde deuten an, dass Feinfühligkeit bzw. ängstigendes oder beängstigtes Elternverhalten vermutlich auch durch weitere psychosoziale Einflussfaktoren beeinflusst werden, welche somit indirekt die Bindungsqualität beeinflussen: In verschiedenen Studien wurden unterschiedliche familiäre Risikofaktoren für unsichere und vor allem desorganisierte Bindung festgestellt, wie eine problematische Paarbeziehung der Eltern (Owen und Cox, 1997) oder ein niedriger sozioökonomischer Status (Vondra et al., 2001).
1.5.4 Die Rolle individueller Dispositionen des Kindes
Im Hinblick auf die Genese von Unterschieden in der Bindungsqualität wird immer wieder auch die Rolle individuelle kindliche Dispositionen diskutiert, die in Merkmalen kindlicher Verhaltensorganisation oder des kindlichen Temperaments zum Ausdruck kommen. Individuelle Unterschiede des Temperaments als zeitlich stabile, genetisch bedingte dispositionelle Personenvariable zeigen sich in unterschiedlicher Ausprägung der Emotionalität, Reaktivität, Irritierbarkeit und werden umgangssprachlich oft als schwierigeres oder leichteres Temperament bezeichnet (Goldsmith et al., 1987). Auf Grund theoretischer Überschneidungen in der Beschreibung individueller Unterschiede in Bindung und Temperament (z. B. der Emotionalität in Stresssituationen) diskutierte Kagan et al. (1984), ob das Verhalten von Kindern in der Fremden Situation, die ausschlaggebend für die Klassifikation der Bindungsqualität ist, allein durch Temperamentsunterschiede zu erklären sei. Empirische Befunde sprechen klar gegen diese Annahme: So kann ein Kind verschiedene Bindungen mit unterschiedlicher Qualität zu zwei verschiedenen Bindungsfiguren (z. B. Mutter und Vater) aufbauen (z. B. Grossmann et al., 1981; Steele et al., 1996). Die Bindungsqualität ist somit ein dyadisches Merkmal und kein individuelles Merkmal des Kindes, was Bindung als »stabiles dispositionelles Temperamentsmerkmal« ausschließt. Obwohl einige Verhaltensweisen in der Fremden Situation durch Temperament vorhergesagt werden können (z. B. Emotionalität bei der Trennung von der Bezugsperson), sind andere kindliche Verhaltensweisen (Kontaktstrategien bei Wiedervereinigung) beziehungsspezifisch (Belsky und Rovine, 1987; Vaughn et al., 1989). Trotzdem weisen einige Befunde darauf hin, dass dispositionelle Merkmale Unterschiede in der Bindungsqualitäten vorhersagen können: so zeigen Kinder, die als Neugeborene durch eine hohe Irritierbarkeit oder eine eingeschränkte Orientierungsfähigkeit gekennzeichnet waren, am Ende des ersten Lebensjahres häufiger ein unsicheres Bindungsmuster (Grossmann et al., 1985; van den Boom, 1994). Hier kann es möglicherweise auch zu Wechselwirkungen zwischen einem schwierigen Temperament und der elterlichen Feinfühligkeit bzw. anderen sozialen Merkmalen, z. B. einer geringen soziale Unterstützung im familiären Umfeld, kommen (vgl. z. B. Crockenberg, 1981).
Einige Studien in den letzten Jahren deuten darauf hin, dass dispositionelle Merkmale insbesondere für die Bindungsdesorganisation eine entscheidende Rolle spielen (Gervai et al., 2007; Spangler und Grossmann, 1999). Wie bereits theoretisch von Main und Hesse (1990) postuliert, legen Befunde von Spangler et al. (1996) nahe, dass in der Fremden Situation mit Bindungssicherheit und Bindungsdesorganisation zwei unabhängige Verhaltensdimensionen erfasst werden: Sie untersuchten an 90 Kindern und deren Müttern der Regensburger und Bielefelder Längsschnittstudie, inwiefern die Verhaltensregulation im Neugeborenenalter einerseits und mütterliche Feinfühligkeit andererseits die Bindungssicherheit und die Bindungsqualität im Alter von einem Jahr vorhersagen. Bindungssicherheit konnte nur durch Feinfühligkeit vorhergesagt werden, und nur Defizite in der Verhaltensorganisation im Neugeborenenalter (geringere Orientierungsfähigkeit und niedrigere emotionale Regulationsfähigkeit) erlaubten die Vorhersage der Bindungsdesorganisation. Bindungssicherheit scheint demnach ein Beziehungskonstrukt darzustellen, welches die Interaktionsgeschichte zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson widerspiegelt, wogegen die Vorhersage der Bindungsdesorganisation aus dem Neugeborenenverhalten die Frage aufwirft, ob Bindungsdesorganisation möglicherweise auf einer generellen eingeschränkten Fähigkeit zur Verhaltensorganisation basiert. Hier stellt sich die Frage nach genetischen Dispositionen.
Nach verhaltensgenetischen Untersuchungen an Zwillings- und Adoptionsstichproben (unter Berücksichtigung geteilter und nicht geteilter Umwelt) ergaben sich keine Hinweise auf signifikante genetische Varianzanteile (Bokhorst et al., 2003; Fearon et al., 2006). Molekulargenetische Untersuchungen versuchen, einen direkten Zusammenhang zwischen genetischen Markern, vor allem diejenigen Marker, welche bei der Regulation des Neurotransmittersystem mitwirken, und Bindungsmerkmalen nachzuweisen. Erstmals konnte eine ungarische Forschergruppe einen genetischen Polymorphismus im Exon III des DRD4 Gens mit Bindungsdesorganisation, aber nicht mit Bindungssicherheit in Verbindung bringen (Lakatos et al., 2002; Lakatos et al., 2000). Bisher konnten diese Befunde nicht repliziert werden (Bakermans-Kranenburg und van IJzendoorn, 2007; Spangler et al., 2009). Spangler, Johann, Ronaj und Zimmermann (2009) fanden allerdings das desorganisierte Bindungsmuster häufiger bei Kindern mit dem kurzen Polymorphismus des Serotonin-Transporter-Gens (HTT5-LPR). Interessanterweise wurden diese genetischen Einflüsse durch das mütterliche Verhalten moderiert, in dem Sinne, dass eine ungünstige genetische Disposition bei günstigen Umweltbedingungen (z. B. feinfühliges Elternverhalten) nicht manifest wurde. Insgesamt verweisen die molekulargenetischen Befunde auf genetische Assoziationen bezüglich der Bindungsdesorganisation, aber nicht bezüglich der Bindungssicherheit, was die Konzeptualisierung der Desorganisation als individuelles Merkmal bzw. der Bindungssicherheit als dyadisches Merkmal entspricht (Spangler, 2013). Problematisch an molekulargenetischen Untersuchungen bleibt aktuell jedoch die teilweise mangelnde Replizierbarkeit (z. B. Luijk et al., 2011).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Entwicklung von Bindungsqualität multifaktoriell zu verstehen ist. Der bedeutendste Einflussfaktor bleibt nach zahlreichen Studien das Elternverhalten – Feinfühligkeit zählt als das am besten untersuchte Konzept und gilt als zuverlässiger, wenn auch nicht einziger Prädiktor von Bindungssicherheit. Dispositionelle Faktoren spielen bei Bindungsdesorganisation eine größere Rolle als bei der Entstehung von Bindungssicherheit, wobei genetische Merkmale in ihrem Einfluss auf die Bindungsentwicklung durch Regulationsmerkmale der Bezugsperson moderiert werden und nur zum Ausdruck kommen, wenn eine soziale Regulation nicht in ausreichendem Maße erfolgt. Dies zeigt auch, dass Befunde zur Bedeutung individueller (auch genetischer) Dispositionen für die Entwicklung von Bindungsdesorganisation nicht im Widerspruch zu Befunden über den Einfluss inadäquaten Elternverhaltens stehen müssen. Möglicherweise gibt es unterschiedliche Wege zur Entstehung von Bindungsdesorganisation. Während bei manchen Kindern die Ursache in abweichenden Elternverhalten liegen kann (dies häufiger in Risikokontexten) schein bei anderen Kindern grundlegende Probleme in der Verhaltensorganisation vorzuliegen (vgl. auch Spangler, 2013).
1.6 Konsequenzen von Bindungsunterschieden für die Persönlichkeitsentwicklung
Die Bindungstheorie geht davon aus, dass Bindungserfahrungen wesentlich zur Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen bzw. zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen (Bowlby, 1980; Main et al., 1985). Im Laufe des ersten Lebensjahres ist es vor allem die primäre Bezugsperson (meist Mutter), welche insbesondere negative Emotionen ihres Kindes extern reguliert. In einer sicheren Bindungsbeziehung zwischen Mutter und Kind funktioniert diese Rollenaufteilung: das Kleinkind wendet sich bei negativen Gefühlen an die Mutter, welche in diesen kritischen Situationen verfügbar ist und feinfühlig reagiert. In einer sicheren Bindungsbeziehung internalisiert das Kind die Erfahrungen, dass nahestehende Personen prompt und angemessen reagieren, wenn es seine Emotionen offen und klar ausdrückt. Es wird deswegen angenommen, dass ein sicher gebundenes Kind auch in der späteren Entwicklung sowohl positive als auch negative Emotionen wahrnehmen, erleben und kommunizieren kann (vgl. z. B. Kochanska, 2001). Unsicher-vermeidend gebundene Kinder hingegen machen die Erfahrung, zurückgewiesen zu werden, wenn sie ihre Gefühle frei äußern und können infolgedessen nur eingeschränkt negative Emotionen wahrnehmen oder kommunizieren. Realität, Wahrnehmung und Beurteilung schwieriger Situation weichen infolgedessen immer stärker voneinander ab, was in maladaptiven Verhaltens- und Copingstrategien resultiert. Das inkonsistente und widersprüchliche Verhalten der Eltern von unsicher-verwickelt gebundenen Kindern (Cassidy und Berlin, 1994) führt dazu, dass die Kinder ihre Bezugspersonen bezüglich ihrer emotionalen Verfügbarkeit nicht gut einschätzen können. Infolgedessen werden negative Emotionen übertrieben deutlich ausgedrückt, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Suche nach Trost und Unterstützung doch noch Erfolg hat. Dadurch geht im Verlauf der Entwicklung eine adaptive Beurteilungs- und Bewertungsfunktion von Emotionen verloren. Eine sichere Bindung und die dieser zugrundeliegenden Erfahrungen mit der Bezugsperson bilden damit ein Fundament an Erwartungen über die Funktionsweise sozialer Beziehungen (Bowlby, 1969/1982), fördern die kindliche Fähigkeit zur Wahrnehmung und Kommunikation negativer Gefühle und zur Inanspruchnahme sozialer Unterstützung in der Emotionsregulation.
In frühen Interaktionen mit einer feinfühligen und verfügbaren Bindungsperson erfährt ein sicher gebundenes Kind, dass seine geäußerten Bedürfnisse anerkannt werden und es erlebt sich selbst im Umgang mit seinen Bezugspersonen als wirksam (Berlin et al., 2008a; Thompson, 2008). Damit tragen Bindungserfahrungen auch zur Entwicklung von Autonomie bei, die nach Sroufe (1979) im zweiten Lebensjahr eine wesentliche Entwicklungsaufgabe darstellt und durch eine sichere Bindung unterstützt wird. Autonomie schließt hier explizit auch die Inanspruchnahme sozialer Unterstützung mit ein, wenn eigene Bewältigungsmöglichkeiten nicht ausreichen (vgl. Matas et al., 1978; Schieche und Spangler, 2005).
Positive frühe Bindungserfahrungen haben auch Konsequenzen für eine angemessene Verarbeitung sozialer Informationen (Bowlby, 1973), was empirisch mehrfach belegt wurde. So zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen der Bindungsqualität im frühen Kindesalter und der adäquaten Wahrnehmung sozialer Reize (Suess et al., 1992). Ebenso steht die frühe Bindungsqualität in Verbindung mit der Fähigkeit, im Alter von sechs Jahren Emotionen zu interpretieren (Steele et al., 2002). Auch die bindungstheoretisch formulierte Annahme, dass Bindungssicherheit Empathie und soziale Kompetenz im Grundschulalter vorhersagt, gilt als empirisch belegt (Sroufe et al., 1999). Effekte von Bindung kommen auch in Persönlichkeitsmerkmalen zum Ausdruck, die Prozesse der Anpassung und Regulation beschreiben, wie Ich-Flexibilität und Ich-Kontrolle (Arend et al., 1979).
Entsprechend der psychischen Funktion von Bindung im Hinblick auf emotionale Regulation sind Konsequenzen unterschiedlicher Bindungserfahrungen gerade im Bereich der Emotionsregulation zu erwarten. Hier sei beispielhaft auf Studien mit Jugendlichen verwiesen. Spangler und Zimmermann (1999) nahmen an, dass Innere Arbeitsmodelle von Bindung die Regulation von Emotionen auf unterschiedliche Arten beeinflussen: der Wahrnehmung von Emotionen, dem Emotionsausdruck (Kommunikation von Emotionen) und dem kohärenten Zusammenspiel emotionaler Subsysteme auf deklarativer und prozeduraler Ebene. Während Jugendliche unabhängig von der Bindungsrepräsentation auf deklarativer Ebene in gleicher Weise zwischen positiven und negativen Emotionen unterscheiden konnten (korrekte Einschätzung von Emotionen in Filmszenen vornahmen), war dies auf prozedurale Ebene bei den Jugendliche mit unsicher-distanzierter Bindungsrepräsentation nicht der Fall, da sie im mimischen Ausdruck undifferenziert auf positive und negative Szenen reagierten. Dagegen spiegelte der Emotionsausdruck von Jugendlichen mit sicherer Bindungsrepräsentation ihre wahrgenommenen Emotionen wider, ihre Gefühle ließen sich sprichwörtlich am Gesicht ablesen. Hier liegt also eine Kohärenz von Wahrnehmung und Ausdruck von Gefühlen bzw. von deklarativen und prozeduralen Prozessen vor, die bei den unsicher-distanzierten Jugendliche nicht gegeben ist.
Zimmermann (1999) stellte in einer prozessorientierten Analyse Emotionsregulationsprozesse in folgenden drei Basisprozessen dar, die durch das Innere Arbeitsmodell von Bindung gesteuert werden: (1) Die Person bewertet die Situation aufgrund eines inneren oder äußeren sensorischen Inputs und reagiert emotional darauf. (2) Es werden kognitiv mögliche Bewältigungsstrategien abgewogen bzw. Handlungen aktiviert. (3) Es erfolgt eine mögliche zielkorrigierte Selbststeuerung (Herstellen einer »inneren Stimmigkeit«) bezüglich der emotionalen Reaktion und Bewältigungshandlungen. Zimmermann et al. (2001) wiesen nach, dass Jugendliche mit sicheren Arbeitsmodellen beim Aufkommen negativer Emotionen (Hilflosigkeit während einer komplexen Problemstellung) versuchen, die Situation mit Hilfe ihres Freundes aktiv zu verändern. Jugendliche mit unsicheren Arbeitsmodellen hingegen neigten dazu, beim Auftreten negativer Emotionen die Vorschläge eines anwesenden Freundes zu übergehen und suchten weniger Unterstützung, weil sie gelernt haben, bei emotionaler Belastung keine Hilfe einzufordern, sondern sich auf sich selbst zu verlassen. Soziale Ressourcen können also von Kindern und insbesondere von Jugendlichen mit unsicherer Bindungsorganisation weniger genutzt werden, obwohl dies in Belastungssituationen gerade adaptiv und sinnvoll wäre.
Auch weitere Ergebnisse zu Bindungsrepräsentation im Jugendalter und Verhaltensproblemen oder klinischen Konstrukten zeigen klar, dass Bindungssicherheit mit einer besseren Emotionsregulation und damit einem geringeren Auftreten von sowohl internalisierendem als auch externalisierendem Problemverhalten verbunden ist. In Hochrisikostichgruppen von Jugendlichen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung stationär untergebracht waren, sind unsichere Bindungsmuster, vor allem in Kombination mit desorganisiertem Bindungsverhalten stark überrepräsentiert (Wallis und Steele, 2001). Aber auch in weniger risikoreichen Stichproben hängt Bindungsunsicherheit allgemein mit Verhaltensproblemen zusammen (Allen et al., 2007). Werden die einzelnen Gruppen von Bindungsunsicherheit betrachtet, leiden unsicher-verwickelte Jugendliche im Vergleich zu den anderen Bindungsgruppen stärker unter internalisierenden Verhaltensproblemen wie Depression und Angst, vor allem wenn sie mit kritischen Lebensereignissen konfrontiert werden (Allen et al., 1998; Bernier et al., 2005). Allerdings gibt es auch Befunde, die zeigen, dass unsicher-verwickelte Jugendliche in Kombination mit anderen ungünstigen Umweltbedingungen wie Armut oder ineffektives Elternverhalten gehäuft delinquentes Verhalten zeigen (Allen et al., 1998). Eine vermeidende Bindungsrepräsentation im Jugendalter wurde als ein Prädiktor für vor allem externalisierendes und delinquentes Problemverhalten festgestellt (Allen et al., 2002).
Insgesamt weisen diese Befunde darauf hin, dass Bindungssicherheit auch im Jugendalter mit zahlreichen positiven Resultaten assoziiert ist: Im Vergleich zu unsicher gebundenen Jugendlichen zeigen sichere gebundene Jugendliche eine bessere soziale Kompetenz, erfolgreichere Beziehungen zu Peers und Partnern und weniger Psychopathologie und Verhaltensauffälligkeiten. Eine unsichere Bindungsqualität bzw. ein desorganisierter Bindungsstatus allein kann nicht für die Entwicklung einer psychischen Störung verantwortlich gemacht werden. Bowlby nahm vielmehr ein Zusammenspiel frühkindlicher Erfahrungen, folgender Lebensereignisse und aktueller Umstände an (Bowlby, 1980). Eine unsichere Bindung kann allerdings der Ausgangspunkt eines Entwicklungspfades sein, der die Entwicklung einer psychopathologischen Störung begünstigt. Befunde aus Längsschnittstudien belegen, dass nur eine mäßige Kontinuität von Bindung im Kindesalter ins Jugendalter hinein besteht (Allen und Miga, 2010). Kontinuität von Bindung – auch innerhalb des Jugendalters – ist vor allem unter beständigen, kontinuierlichen Umweltbedingungen zu beobachten, wohingegen unter wechselnden, instabilen Umweltbedingungen häufiger Diskontinuität festgestellt werden kann (Allen and Miga, 2010; Weinfield et al., 2004). Daher wird unter anderem diskutiert, ob Kontinuität von Bindung mit einer Kontinuität elterlichen Verhaltens einhergeht (Belsky und Fearon, 2002).
Effekt von Bindung kommen häufig weniger als Haupteffekt zum Ausdruck, sondern scheinen insbesondere im Konzert mit anderen Einflussmerkmalen wirksam zu sein. Eine sichere Bindung stellt beim Vorliegen von Risikofaktoren einen Schutzfaktor dar: Im Rahmen des Minnesota Parent-Child Projects (Pianta und Egeland, 1990) wurde längsschnittlich eine Risikostichprobe von