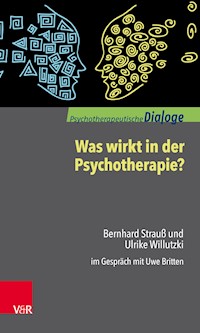Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch verbindet drei verschiedene theoretische Felder: die Bindungstheorie, klinische Theorien der sexuellen Entwicklung und die interpersonale Theorie der Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Neben einer Einführung in diese Theorien werden anhand von zwei Falldarstellungen Möglichkeiten der unterschiedlichen Betrachtungsweisen demonstriert. Speziell im Zusammenhang mit sexuellen Störungen, die immer auch Beziehungsdimensionen betreffen, sind interpersonale und bindungstheoretische Ansätze sinnvoll. Das Buch soll Anstöße geben, die Sexualität aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zu verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch verbindet drei verschiedene theoretische Felder: die Bindungstheorie, klinische Theorien der sexuellen Entwicklung und die interpersonale Theorie der Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Neben einer Einführung in diese Theorien werden anhand von zwei Falldarstellungen Möglichkeiten der unterschiedlichen Betrachtungsweisen demonstriert. Speziell im Zusammenhang mit sexuellen Störungen, die immer auch Beziehungsdimensionen betreffen, sind interpersonale und bindungstheoretische Ansätze sinnvoll. Das Buch soll Anstöße geben, die Sexualität aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zu verstehen.
Prof. Dr. Bernhard M. Strauß ist Professor für Medizinische Psychologie und Psychotherapie sowie Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dipl. Psych. Helmut Kirchmann und Dipl. Psych. Andrea Thomas sind wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) des Instituts. Dipl. Psych. Barbara Schwark war lange Jahre am Institut tätig und ist nun Psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis.
Bernhard Strauß, Helmut Kirchmann, Barbara Schwark, Andrea Thomas
Bindung, Sexualität und Persönlichkeitsentwicklung
Zum Verständnis sexueller Störungen aus der Sicht interpersonaler Theorien
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eignes als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2010
Alle Rechte vorbehalten © 2010 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-018646-0
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-022726-2
epub:
978-3-17-028066-3
mobi:
978-3-17-028067-0
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
1 Einleitung: Sexuelle Entwicklung
1.1 Linien der sexuellen Entwicklung
1.2 Jugendsexualität als Spiegel soziokulturellen Wandels?
1.3 Sexuelle Sozialisation und Beziehungsgeschichte
2 Fallbeispiel 1: Verhungern auf halber Strecke
2.1 Diskussion des Falles aus einer psychodynamischen Perspektive
2.2 Diskussion des Falles aus der Perspektive der Bindungstheorie
2.3 Diskussion des Falles aus der Perspektive der interpersonalen Theorie
2.4 Zusammenfassung
3 Grundlagen der Bindungstheorie
3.1 Historische Wurzeln der Bindungstheorie
3.2 Neurobiologische Grundlagen von Bindung
3.3 Das Konstrukt Bindung
3.4 Bindungsqualitäten im Kleinkindalter
3.5 Bindungsqualitäten bei sechsjährigen Kindern
3.6 Bindungsrepräsentation in der Präadoleszenz und Adoleszenz (8.–16. Lebensjahr)
3.7 Bindungsqualität im Erwachsenenalter
3.8 Bindungsentwicklung und interpersonale Erfahrungen
3.9 Bindung und Partnerschaft
3.10 Klinische Relevanz der Bindungsforschung
4 Grundlagen einer interpersonalen Theorie der Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung
4.1 Das interpersonale Verständnis von Persönlichkeit und seine Wurzeln
4.2 Die Wegbereiter der interpersonalen Theorie – Ausarbeitung interpersonaler Konzepte
4.3 Interpersonale Modellerweiterungen der Psychopathologie und Psychotherapie
4.4 Der Kommunikationsansatz der Persönlichkeit und Psychotherapie nach Kiesler
4.5 Die Theorie interpersonaler Motive
4.6 Die strukturale Analyse Sozialen Verhaltens (SASB)
5 Bedeutung der Theorien für das Verständnis der menschlichen Sexualität
6 Fallbeispiel II: Der Geruch der Mutter
6.1 Diskussion des Falles aus einer psychodynamischen Perspektive
6.2 Diskussion des Falles aus der Perspektive der Bindungstheorie
6.3 Diskussion des Falles aus der Perspektive der interpersonalen Theorie
7 Zusammenfassung
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorbemerkung
Die Idee, zu dem Thema „Bindung, Sexualität und Persönlichkeitsentwicklung“ ein Buch zu gestalten, kam von Herrn Dr. Poensgen vom Kohlhammer-Verlag anlässlich eines Gesprächs bei den Lindauer Psychotherapiewochen. Dort wurde zu diesem Thema vom Erstautor über einige Jahre hinweg ein Seminar angeboten. Dieses wiederum basierte auf Veranstaltungen (einem Vortrag und diversen Workshops) im Zusammenhang mit den in München abgehaltenen Internationalen Kongressen über die Theorie und Therapie von Persönlichkeitsstörungen (IKTPP, vgl. Strauß, 2001).
Ziel dieses Buches ist es, bislang weitgehend unverbundene Theoriekonzepte (und dazu gehörige Forschungsergebnisse) zu integrieren, nämlich die (klinische) Bindungsforschung, sexualwissenschaftliche Theorien zur sexuellen Entwicklung und zum Zusammenhang von Sexualität und Beziehungsgestaltung sowie interpersonale Theorien der Persönlichkeit und der Persönlichkeitsentwicklung.
Das klinische Verständnis sexueller Motive, Verhaltensweisen und Störungen ist weitgehend geprägt durch psychodynamische und lerntheoretische Theoriekonzepte, die sich in der klinischen Arbeit bisher auch bestens bewährt haben (z. B. Strauß, 2004; Hauch, 2006; Sigusch, 2007). Ein Problem, speziell manch psychodynamischer Auffassung, ist aber, dass eine empirische Absicherung u. a. deshalb gelegentlich fehlt, da bestimmte Konstrukte (z. B. ödipale Konflikte, Fixierungen, unbewusste Ängste) in der Regel schwer operationalisierbar sind. Dies hat dazu geführt, dass sich psychodynamisch orientierte Kliniker und Forscher in letzter Zeit nicht selten anderer Theoriekonzepte bedienen, die eine bessere empirische Fundierung aufweisen (vgl. z. B. Fonagy et al., 2004). Moser und Zeppelin (1991) nannten dies „Konzepttransfer“.
Im Hinblick auf das Konstrukt Persönlichkeit ist eines der Konzepte, das sehr gut mit psychodynamischen, insbesondere objektbeziehungspsychologischen Auffassungen kompatibel ist, die interpersonale Theorie der Persönlichkeit, die u. a. von Autoren wie Karen Horney oder Harry Stack Sullivan in die klinische Literatur eingeführt wurde. Später, nachdem Persönlichkeitspsychologen wie etwa Timothy Leary, Donald J. Kiesler oder Leonard M. Horowitz diese Theorie weiterentwickelt und weiter untersucht haben, waren es z. B. Autoren wie Hans H. Strupp oder Lorna S. Benjamin, die einen interpersonalen Ansatz unmittelbar im psychotherapeutischen Kontext vertreten haben, ohne dass diese Ansätze sich aber wirklich verbreiten konnten. Jedenfalls ist es eine Erfahrung aus den o. g. Seminaren, dass klinisch tätige Psychotherapeuten in der Regel allenfalls manche Namen, nicht aber die damit verbundenen Theorien kennen.
Es gibt deutliche Bezüge zwischen der interpersonalen Theorie der Persönlichkeit und der in den letzten Jahren so bedeutend gewordenen und „mentalistisch veredelten“ Bindungstheorie John Bowlbys. Insbesondere die Arbeitsgruppe um Leonard Horowitz und Kim Bartholomew (z. B. Bartholomew & Horowitz, 1991) hat früh versucht, diese beiden Perspektiven zu verbinden (Horowitz hat übrigens auch den eingangs gezeigten Cartoon „entdeckt“ und damit verdeutlicht, wie wenig bestimmte Konzepte innerhalb der klinischen Psychologie – trotz ihrer naheliegenden Relationen – miteinander verbunden sind).
Wie steht es um die Sexualität? Wie das nachfolgende Kapitel zeigen wird, lässt sich die Entwicklung der Sexualität als ein sehr komplexer Prozess verstehen, in den verschiedene Erfahrungen, Entwicklungsprozesse und -linien integriert und verwoben sind. Es wird in den wichtigsten psychotherapeutischen Theorien entsprechend davon ausgegangen, dass das Sexualleben Erwachsener, inklusive die Beeinträchtigungen der Sexualität, das Resultat körperlicher, sozialer und psychologischer Entwicklungsprozesse darstellt, zu denen vorrangig auch (verinnerlichte) Beziehungserfahrungen gehören. So verwundert es nicht, dass mit der Renaissance der Bindungstheorie auch vermehrt theoretische und empirische Arbeiten zum Zusammenhang von Bindungserfahrungen und sexuellem Verhalten und Erleben vorgelegt wurden, die von potenzieller klinischer Relevanz sein könnten.
Es ist – von wenigen Ausnahmen abgesehen – auffällig, wie wenig sich die akademische Psychologie in den vergangenen Jahrzehnten mit dem Thema Sexualität befasst hat. Die Sexualwissenschaften wiederum waren in der jüngeren Vergangenheit entweder stark medizinisch-naturwissenschaftlich, also „sexualmedizinisch“ ausgerichtet (z. B. Beier et al., 2006) oder aber eher kritisch-gesellschaftswissenschaftlich (z. B. Sigusch, 2006). Psychologische Zugänge zum Sexuellen sind auch hier eher rar, was erklären mag, wieso die Verbindung der drei in diesem Buch betrachteten Bereiche und Theorien – Bindung, Sexualität und Persönlichkeit(sentwicklung) – bisher so selten betrachtet wurde.
So gesehen stellt dieses Buch einen ersten Versuch an, die Themen – in Snoopys Sprache – zu „verknubbeln“. Wir haben diesen Versuch aus einer primär klinischen Perspektive unternommen und beginnen – nach einem kurzen Abriss eines Konzepts von sexueller Entwicklung (Kap. 1) – mit einem Fallbeispiel (Kap. 2), das aus insgesamt drei Perspektiven, einer psychodynamisch-psychotherapeutischen, einer bindungstheoretischen und einer interpersonalen beleuchtet wird.
Es folgen kondensierte Darstellungen der Bindungstheorie (Kap. 3) und der interpersonalen Theorie der Persönlichkeit (Kap. 4) und eine Betrachtung jener Teilaspekte dieser Theorien, die für das Verständnis der Sexualität wichtig sein können (Kap. 5).
Ein weiteres Fallbeispiel (Kap. 6) soll erneut verdeutlichen, dass die Perspektiven der beiden Theorien hilfreich sein können, um sexuelle Probleme und Phänomene besser zu verstehen. Das Buch endet mit dem Versuch einer Integration, der vielleicht – so hoffen wir – weitere Bemühungen inspirieren kann, wichtige klinische Teiltheorien bekannter zu machen und in Zukunft noch effektiver aufeinander zu beziehen.
In den oben erwähnten Lindauer Seminaren haben die Teilnehmer früh die Metapher benutzt, dass bezüglich bestimmter Themen und klinischer Details „unterschiedliche Folien“ verwendet werden könnten, um diese genauer zu betrachten. Es war – nicht zuletzt für den Dozenten – eine äußerst kreative und inspirierende Art und Weise, sich mit Fällen – unter Verwendung der einzelnen „Folien“ – zu beschäftigen, auch wenn es sicher nicht gelang, die verschiedenen Theorien gänzlich zu durchdringen und mit Bezug auf die in der klinischen Praxis gebräuchlicheren Theorien eine echte Metatheorie zu entwerfen. Diesen Anspruch kann naturgemäß auch dieses Buch nicht haben. Anregungen und Denkanstösse aber sollte es dennoch geben können.
Die Realisierung des Buchprojektes hat sich über längere Zeit hingestreckt, weswegen wir dem Verlag, insbesondere der Lektorin Frau Ulrike Merkel, für die entgegengebrachte Geduld danken wollen. Letztlich ist das Buch ein Gemeinschaftsprodukt der vier Autoren, die sich in vielen Diskussionen mit dem Gegenstand befasst und ihre unterschiedliche Expertise in diese Diskussionen eingebracht haben. Das Kapitel zur Bindungstheorie wurde federführend von Barbara Schwark und Helmut Kirchmann, das zur interpersonalen Theorie von Andrea Thomas entworfen.
Jena, im Herbst 2009
Bernhard Strauß
Helmut Kirchmann
Barbara Schwark
Andrea Thomas
1 Einleitung: Sexuelle Entwicklung1
Die Sexualität, von der Freud sagte, sie gehöre zu den „gefährlichsten Betätigungen des Individuums“ (Nunberg & Federn, 1977), kann auf unterschiedliche Weise definiert werden:
Sexualität ist eine biologisch verankerte Form des menschlichen Erlebens, die aber nicht notwendigerweise manifest werden muss (Schorsch, 1975).
Sexualität ist ein vielschichtiger, zahlreiche Aspekte umfassender Verhaltens- und Erlebensbereich, der durch eine enge Verknüpfung von körperlichen und psychischen Prozessen gekennzeichnet ist (Bancroft, 1986).
Beim Menschen hat die Sexualität neben ihrer biologischen Funktion (Fortpflanzung) eine große Bedeutung für die Selbstbestätigung (narzisstischer Aspekt der Sexualität) und eine zentrale interpersonale Funktion (Sexualität als Mittel der Bezogenheit und Beziehungsgestaltung) (Bancroft, 1989).
Sexuelles Erleben, sexuelle Erregung und sexuelle Lust sind in starkem Maße subjektiv und beeinflusst durch biologische, psychologische und soziokulturelle Faktoren.
1.1 Linien der sexuellen Entwicklung
Die Entwicklung der Sexualität ist multidimensional und immer in Bezug auf den komplexen soziokulturellen Kontext zu betrachten. Bancroft (1986) schlug ein interaktionelles Modell der sexuellen Entwicklung vor, in dessen Rahmen verschiedene Entwicklungsstränge differenzierbar sind, die sich zwar zunächst relativ unabhängig voneinander entwickeln mögen, dann aber zunehmend miteinander verschränkt bzw. verwoben werden. Die sexuelle Entwicklung kann somit anhand einer Matrix von Entwicklungslinien oder Entwicklungskonstituenten differenziert werden, die zusammengenommen die Phänomenologie des Sexuellen bestimmen. Diese Linien der sexuellen Entwicklung beziehen sich auf biologische Funktionen als Basis für die Entwicklung des Erlebens und Verhaltens, Differenzierungen sexueller Motive und Bedürfnisse, die Entwicklung sexueller Reaktionen und sexueller Reaktionsfähigkeit, die Entwicklung von Bindung bzw. Bindungsfähigkeit und möglicher Funktionen der Sexualität in Beziehungen, die Entwicklung der Geschlechtsidentität und Geschlechtsrolle, sexueller Orientierungen und des manifesten sexuellen Verhaltens (Strauß, 2005).
Die biologische Differenzierung des anatomischen/genitalen Geschlechts ist naturgemäß eine wesentliche Grundlage für die sexuelle Entwicklung. Diese Differenzierung manifestiert sich primär auf chromosomaler Ebene (genetisches Geschlecht, Determinierung), auf der Ebene der gonadalen Entwicklung (Keimdrüsengeschlecht), der Ebene der inneren (gonoduktalen) und äußeren Geschlechtsmerkmale sowie auf der Ebene der geschlechtstypischen Differenzierung des Gehirns (für Details siehe Beier, 2007).
Die Entwicklung sexueller körperlicher Reaktionen setzt in der Regel eine ungestörte Entwicklung der Geschlechtsorgane voraus, die in einem frühen Stadium der pränatalen Entwicklung gebahnt wird (Ausnahmen sind möglich; so wird berichtet, dass einige Menschen mit körperlich-sexuellen Fehlentwicklungen, wie etwa dem Adrenogenitalen Syndrom, durchaus reaktionsfähig sein können, siehe Richter-Appelt, 2004). Ultraschalluntersuchungen machen deutlich, dass männliche Embryonen bereits Erektionen entwickeln. Außerdem sind Hand-Genitalkontakte in utero bei beiderlei Geschlecht beschrieben. Es ist also möglich, dass bereits der Fötus genitalbezogene Lust erlebt (Calderone, 1985). Die Kapazität für genitale Reaktionen besteht bei Jungen und Mädchen wahrscheinlich bereits vor der Geburt. Eine Reihe von Studien belegt, dass Säuglinge beiderlei Geschlechts bereits in den ersten Lebensmonaten mit den Genitalien spielen und sexuelle Reaktionen zeigen. Sexualwissenschaftliche Studien deuten an, dass Jungen Masturbation und Orgasmus häufig durch Kontakte zu Gleichaltrigen erlernen, während Mädchen ihre ersten Orgasmen durch Selbstexploration oder „zufällig“ über indirekte Stimulation erfahren (Beier, 2007). Es ist das Verdienst der Sexualwissenschaftler Masters und Johnson (1966), die sexuelle Reaktion bei Erwachsenen erstmalig systematisch mit psychophysiologischen Methoden erforscht zu haben. Von diesen Wissenschaftlern stammen die prototypischen Darstellungen sexueller Erregungsabläufe bei Frauen und Männern und die Definition von Phasen der sexuellen Reaktion, die allerdings individuell stark variieren können und nicht als normativer Bezug gesehen werden sollten.
Es wird heute nach wie vor davon ausgegangen, dass sich eine Kerngeschlechtsidentität (also die innere „Überzeugung“, männlich oder weiblich zu sein) bereits bis zum Ende des zweiten Lebensjahres gebildet hat, wenngleich im weiteren Entwicklungsverlauf bis ins Erwachsenenalter Veränderungen der Geschlechtsidentität möglich sind (Coates, 2006). Wie oben erwähnt, definiert die anatomische Ausstattung des Neugeborenen maßgeblich, welches Geschlecht ihm zugewiesen wird. Mit der Geschlechtszuweisung ist eine Kaskade differentieller Verhaltensweisen durch die Bezugspersonen gegenüber dem Kleinkind verbunden (resultierend aus einer kulturellen Übereinkunft der Zweigeschlechtlichkeit), die zur Formierung der Kerngeschlechtsidentität beitragen. Geschlechtsspezifisches Verhalten ist deutlich abhängig von den Einflüssen der Umgebung (also sozialen Lernprozessen) und kulturellen bzw. gesellschaftlichen Faktoren. Bereits im Säuglingsalter ist unterschiedliches Verhalten von kleinen Jungen und Mädchen gegenüber Männern und Frauen sichtbar (Maccoby, 2000). Für die Ausformung geschlechtstypischen Verhaltens ist neben sozialen Lernprozessen und neurobiologischen Faktoren, wie etwa dem Einfluss von Androgenen auf das Verhalten, auch die kognitive Entwicklung bedeutsam. Es wird davon ausgegangen, dass sich in den ersten Lebensjahren „sexuelle Schemata“ entwickeln, die zu einer kognitiven Selbstkategorisierung (Zugehörigkeit zu einer Geschlechtergruppe und Geschlechtskonstanz) führen. Diese Kategorisierung ist wiederum die Voraussetzung für die Identifikation mit einer spezifischen Rolle bzw. für die Aneignung von Rollenvorstellungen und -erwartungen. Der Prozess der Rollenaneignung ist bis zum Ende des Vorschulalters vorläufig abgeschlossen und am Verhalten sichtbar: Jungen spielen zu diesem Zeitpunkt beispielsweise lieber mit Jungen, haben typisch männliche Zukunftsvorstellungen etc. In dieser Entwicklungsphase sind die Rollenvorstellungen meist noch rigide und unflexibel, erst ab ca. dem achten Lebensjahr sind die kognitiven Voraussetzungen dafür gegeben, selektiv Eigenschaften von unterschiedlichen (Geschlechts-)Rollenmodellen zu übernehmen. Im Jugendalter, verbunden mit der ausgebildeten Fähigkeit zu abstraktem Denken, erfolgt eine weitere Flexibilisierung der Geschlechtsrollen und eine Neubewertung der Rollenaneignung, die u. a. durch die Qualität der Beziehung zu den Elternfiguren bestimmt wird (Maccoby, 2000). Eine Reihe von empirischen Studien belegen die Schichtspezifität der Rollenvorstellungen, ebenso die Tatsache, dass Geschlechtsrollenbilder starken soziokulturellen Schwankungen unterworfen sind.
Die sexuelle Orientierung (Präferenz, Identität) bezieht sich auf die gesamte Reaktivität einer Person gegenüber Männern und Frauen. Es ist das Verdienst Alfred Kinseys, im Rahmen seiner sexualwissenschaftlichen Umfragen in den späten 40er/frühen 50er Jahren die sexuelle Orientierung in verschiedene Komponenten differenziert zu haben (Kinsey et al., 1948, 1953). Zum einen zeigte Kinsey, dass die sexuelle Orientierung auf einem Kontinuum mit den Extremen einer exklusiven Homo- bzw. Heterosexualität anzusiedeln ist, zum anderen konnte er zeigen, dass sich die sexuelle Orientierung auf verschiedenen Ebenen manifestiert, nämlich der physiologischen Reaktion (auf homo- bzw. heterosexuelle Reize), der Fantasie (Tagträume, Masturbationsfantasien), des Verhaltens (v. a. tatsächliche Interaktion mit gleich- bzw. gegengeschlechtlichen Personen) sowie der Selbsteinordnung (die durch die vorherrschende erotische Anziehung definiert wird). Die vier oben genannten Ebenen müssen diesen Ergebnissen zufolge keineswegs konvergieren. Die ausschließlich homosexuelle oder heterosexuelle Partnerwahl repräsentiert somit nur die Endpunkte einer Verteilungskurve. Transkulturelle Untersuchungen zeigen ebenfalls die Plastizität der sexuellen Orientierung. Die Einstellung gegenüber Homosexualität ist in verschiedenen Kulturen unterschiedlich und beeinflusst das tatsächliche, beobachtbare Verhalten. Soziokulturelle Veränderungen innerhalb einer Gesellschaft schlagen sich dementsprechend auch in den konkreten Erfahrungen nieder. Dies zeigt sich in der Tendenz beispielsweise an regelmäßig durchgeführten Studien zur Studentensexualität in der BRD (Schmidt, 2000), die in der Zeit zwischen 1966 und 1996 deutliche Fluktuationen in der Häufigkeit bisexuellen Verhaltens reflektieren.
Eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung von Theorien zur Differenzierung sexueller Bedürfnisse und Motive kommt der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie zu, der zufolge von Geburt an – im weitesten Sinne – sexuelle (sinnliche) Bedürfnisse zu erkennen sind und die Entwicklung des Sexualtriebes definierte Phasen durchläuft. In der frühen Entwicklung kommt außerdem der Ausbildung des Selbstsystems eine große Bedeutung für die Sexualität zu. Der Narzissmus, also das Ausmaß positiver Gefühle, die mit der Erfahrung des Selbst verbunden sind und die einen wesentlichen Bestandteil späterer Selbstrepräsentanzen darstellen, kann als eine wesentliche Grundvoraussetzung für sexuelle Befriedigung gesehen werden. Auch wenn im Detail die empirische Absicherung der triebpsychologischen Entwicklungstheorie nicht eindeutig geglückt ist, finden sich auf der Verhaltensebene deutliche Entsprechungen mit den primären Bedürfnissen, die in der Phasentheorie postuliert werden (Krause, 1998). Die Annahme der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie, dass nach der Überwindung des Ödipuskomplexes eine „Latenzzeit“ eintrete, in der die Sexualität keine wesentliche Rolle spiele, ist heute sicher nicht mehr haltbar. Viele sexualwissenschaftliche Studien belegen, dass vom Grundschulalter bis zur Pubertät eine stetige Zunahme des Interesses an Sexualität und (teilweise noch verborgener) sexueller Aktivitäten zu verzeichnen ist (Beier, 2007).
Sexuelle Verhaltensweisen formieren sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Entwicklungsphase. Übereinstimmungen mit den in bestimmten Entwicklungsphasen vorherrschenden sexuellen Motiven werden dabei offensichtlich. Schon sehr früh, etwa ab dem zweiten Lebensjahr, werden deutliche Geschlechtsunterschiede im Sexualverhalten manifest. Die Entwicklung des Sexualverhaltens von Mädchen und Jungen in der frühen und mittleren Kindheit und das generelle Verhalten der Geschlechter dienen zunächst „ganz dem Ziel der Trennung“ (Maccoby, 2000) und verlaufen – von Kontakten etwa im Rahmen von Doktorspielen abgesehen – separiert (Coates, 2006). Erst mit Beginn der Pubertät gehen die Geschlechter wieder offen aufeinander zu.
1.2 Jugendsexualität als Spiegel soziokulturellen Wandels?
Die Sexualität Jugendlicher war häufig Gegenstand sexualwissenschaftlicher Untersuchungen. In den frühen siebziger Jahren zeigte eine groß angelegte Studie (Sigusch & Schmidt, 1973), dass Jugendliche – immer noch orientiert an traditionellen Wertvorstellungen – mit sexuellen Aktivitäten einige Jahre früher begannen als die Generation vor ihnen und die Sexualität deutlich weniger angstvoll und schuldhaft erlebten. Die Einführung hormonaler Kontrazeption und die sog. sexuelle Liberalisierung trugen dazu maßgeblich bei. 20 Jahre später wurden von Schmidt (1993) Jugendliche erneut untersucht. Wenn sich auch grundlegend an den Verhaltensweisen nicht sehr viel verändert hatte, zeigte sich hier, dass Emanzipation einerseits und sexuelle Aggression andererseits sich durchaus gegenüberstehen. Ein spezifischer Gegenstand der Untersuchung war, wie 1970, die Gruppe der 16 bis 17-jährigen Mädchen und Jungen aus Großstädten. Ein Detailergebnis: „Einerseits erleben Jungen ihre Sexualität heute seltener als vor 20 Jahren als impulsiv und drängend; Grenzen, die Mädchen selbstbewusster setzen und Wünsche, die sie selbstbewusster äußern, wollen und können sie besser respektieren. Andererseits haben viele Mädchen, kaum 16 oder 17 Jahre alt, traumatische sexuelle Erfahrungen gemacht, Erfahrungen mit sexuellem Zwang bis zur Gewaltandrohung und Gewaltausübung und dies durchaus auch mit Gleichaltrigen“ (Schmidt, 1993, S. 87).
Sigusch (2005) wertet die Jugendsexualität der heutigen Zeit insgesamt – auf der Ebene des Verhaltens – als erstaunlich wenig verändert im Vergleich zu den 70er Jahren, meint aber, dass die symbolische Bedeutung der Sexualität für Jugendliche abgenommen hätte und Sexualität also selbstverständlicher geworden sei, was alle Möglichkeiten zulasse: „Das Sexualleben der Heranwachsenden … oszilliert heute zwischen stiller Beziehungstreue und schrillen Selbstinszenierungen auf Liebesparaden“ (ebd. S. 3).
Nicht nur an den Untersuchungen zur Jugendsexualität wird sichtbar, dass sexuelle Einstellungen und Verhaltensweisen stark durch den jeweiligen soziokulturellen Hintergrund geprägt werden. Beispielsweise gibt es Kulturen, in denen bezüglich bestimmter sexueller Praktiken sehr freizügige Einstellungen bestehen, während diese in anderen eher restriktiv sind. Auch unterliegen sexuelle Werte, Einstellungen und Praktiken immer einem historischen Wandel, der sich in der Postmoderne an unterschiedlichen Phänomenen zeigt, die beispielsweise bei Schmidt, 2004, Sigusch, 2005 oder Strauß, 2007 skizziert sind.
1.3 Sexuelle Sozialisation und Beziehungsgeschichte
Neben der Berücksichtigung biologischer und soziokultureller Einflüsse wird speziell in der klinischen Arbeit mit Patienten mit sexuellen Störungen – weitgehend unabhängig von der theoretischen Ausrichtung – davon ausgegangen, dass das sexuelle Erleben und Verhalten auch das Resultat einer komplexen Lerngeschichte darstellt, in der intrapsychische und interpersonale Prozesse eine gleichermaßen bedeutende Rolle spielen. Insbesondere spezifische Beziehungserfahrungen mit signifikanten Personen – die keineswegs notwendigerweise allesamt (potentielle) Sexualpartner sein müssen – werden als relevant für die Entwicklung von interpersonalen Stilen im Kontext der Sexualität gesehen, ebenso für die Entwicklung von speziellen Vorlieben und Aversionen gegenüber Personen und sexuellen Praktiken. Beziehungserfahrungen determinieren also maßgeblich die sexuelle Sozialisation im Kontext der sozialen Umwelt (vgl. z. B. die Theorie der sexuellen Skripte; Gagnon, 2000).
In der Sozial-, Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie sind es insbesondere zwei Theorien, die im Zusammenhang mit der Formierung sexueller Beziehungsmuster hilfreich sein können: Die interpersonale Theorie der Persönlichkeit, die auf Autor(inn)en wie Horney, Sullivan, Leary und Kiesler zurückgeht und ein Modell für die Entwicklung und Phänomenologie interpersonalen Verhaltens, interpersonaler Motive, Einstellung und Probleme bietet. Im Kontext dieser Theorie wurden bislang allerdings nur wenige Studien durchgeführt, die einen Bezug zu sexuellen Problemen und Verhaltensweisen erlauben.
Die Bindungstheorie bietet ein entwicklungspsychologisches Modell für die Entstehung von Beziehungen und inneren Repräsentanzen des Selbst und anderer Personen und eine Basis für die Qualität von Beziehungen. Im Sinne Bancrofts (1986) wäre die Bindungsfähigkeit ein wesentlicher Bestandteil der „Kapazität für enge dyadische Beziehungen“. Es liegt nahe, einen Zusammenhang zwischen der Bindungsentwicklung und der Entwicklung sexuellen Erlebens und Verhaltens anzunehmen. Es liegen bereits einige empirische Befunde zum sexuellen Verhalten und Erleben in Abhängigkeit von Bindungsmustern vor (z. B. Brenk, 2005). Bisherige Studien deuten beispielsweise an, dass eine sichere Bindung eher einher geht mit einer vergleichsweise geringeren Präferenz für Sex außerhalb der Beziehung sowie einer größeren Bedeutung von Gegenseitigkeit und körperlichem Kontakt in sexuellen Beziehungen. Für Personen mit ambivalenter Bindung scheinen sexuelle Praktiken weniger Bedeutung zu haben als die Erfahrung von Zärtlichkeit und „Gehaltenwerden“. Personen mit abweisender Bindung sollen eher eine positivere Einstellung zu Gelegenheitssex („one night stands“) und „Sexualität ohne Liebe“ zeigen und weniger Intimitätsempfinden berichten.
Die Befunde, die in Kapitel 3 ausführlicher dargestellt werden, sind vielversprechend genug, um sie in klinische Reflexionen über die Entstehung und Aufrechterhaltung sexueller Störungen zu integrieren. Um dies an einem konkreten Beispiel zu demonstrieren, werden wir im Folgenden zunächst eine Fallvignette darstellen und diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln, einschließlich dem bindungstheoretischen und dem interpersonalen, diskutieren. Leser, denen diese Perspektiven noch wenig vertraut sind, können in den Kapiteln 3 und 4 ausführlichere Informationen zu den Theorien erhalten und sollten diese beiden Abschnitte ggf. vor dem Kapitel 2 studieren.
1 Teile dieses Kapitels sind einem Aufsatz des Erstautors für das Bundesgesundheitsblatt zum Thema „Sexuelle Entwicklung im Kontext soziokulturellen Wandels“ entnommen (vgl. Strauß, 2007).
2 Fallbeispiel 1: Verhungern auf halber Strecke
Herr L.2, 45 Jahre alt, wird in eine psychosomatische Ambulanz mit der Diagnose „Versagen genitaler Reaktionen“ (F52.2) überwiesen.
Symptomatik: Der Patient kommt auf Veranlassung eines internistischen Kollegen, bei dem er mehrere Monate wegen eines Hypophysenadenoms und einer damit einhergehenden Hyperprolaktinämie in Behandlung war (Es handelt sich hierbei um eine bei Männern eher seltene Hormonstörung, von der allerdings bekannt ist, dass sie die Sexualität, speziell die sexuelle Appetenz, negativ beeinflusst).
Mit der Hormonstörung ging ein Libidoverlust einher, dem später Erektionsstörungen folgten. Durch die Vergabe von Bromocriptin konnten die Hormonwerte wieder normalisiert werden, an der Symptomatik der Erektionsstörung hatte sich aber überraschenderweise nichts geändert, weswegen eine Überweisung zum Psychotherapeuten erfolgte.
Der Patient gibt sich im Gespräch sehr wortgewandt und freizügig (aber emotional zunächst sehr kontrolliert) und berichtet, dass er vor einiger Zeit, nach dem Ende einer längeren Beziehung, über sein Hobby eine ca. 25 Jahre jüngere Frau kennengelernt habe. Mit dieser Frau habe er einige Zeit „hemmungslosen“ und „sehr befriedigenden“ Sex gehabt. Mit der Zeit hätten sich dann aber Störungen ergeben: Zunächst sei die Freundin erkrankt; danach habe er bei sich selbst Probleme im Sinne von Erektionsschwierigkeiten wahrgenommen. Bei der Beschreibung der Symptomatik durch den Patienten fällt auf, dass der Patient eine ganz eigene Sprache bzw. Metaphorik benutzt. So sagt er beispielsweise, wenn er von seiner Erektionsstörung spricht: „Er verabschiedet sich…“, „Er taucht ab…“, „Er verhungert auf halber Strecke …“. Die sexuellen Probleme hätten ihn veranlasst, irgendwann zum Arzt zu gehen, wo dann das Hypophysenadenom diagnostiziert worden sei.
Herr L. beschreibt zunächst typische Reaktionen auf die sexuelle Störung (wie die sog. Performance-Angst, die das sexuelle Problem über einen Selbstverstärkungsmechanismus aufrechterhalten kann), er schildert in bunten Worten die Lebendigkeit des Sexuallebens vor der Störung (wobei sich allerdings zeigte, dass er immer schon relativ schnell zur Ejakulation kam) und fragt sich, welche Rolle der Altersunterschied wohl spielen mag (generell gibt er an, zu bemerken, dass er mittlerweile „ein paar Bewerbungen mehr schreiben“ müsse als früher). Die junge Freundin bestehe auf regelmäßigem Sex, was ihn deutlich unter Druck setze.
Auf Nachfrage gibt Herr L. an, in Beziehungen schon häufiger erlebt zu haben, dass das sexuelle Interesse an seinen Partnerinnen und Partnern nach einer Zeit geschwunden, die „Liebe aber noch vorhanden“ gewesen sei. Generell wisse er nicht so recht, was er wolle: Er habe viele Beziehungen gehabt, auch Beziehungen zu Männern, sei sicher bisexuell. Auch in anderen Lebensbereichen sei er oft unentschlossen gewesen. Sein aktueller Beruf sei schon der fünfte oder sechste, er habe außerdem immer wieder das Interesse an einer Tätigkeit verloren und sich aufgemacht, eine neue Ausbildung zu durchlaufen.
Befragt nach seiner Biographie berichtet der Patient, das jüngste von drei Kindern (Bruder von zwei älteren Schwestern) zu sein, er sei unerwünscht gewesen, aber dann doch zu Mutters Liebling geworden (und habe mit zwölf noch auf dem Schoß der Mutter gesessen). Die Eltern, zu denen er keine enge Bindung spürt, werden als eher streng beschrieben, wobei der Vater, ansonsten scheinbar freundlich und gutmütig, die Ausübung von Prügelstrafen an die Mutter delegierte, die ihren Sohn dann beispielsweise mit einer Hundepeitsche schlagen musste. Erst gegen Ende des Gesprächs berichtete der Patient von einem lange gehüteten Familiengeheimnis, von dem er zufällig als Student erfuhr: Als ein Kommilitone sich mit der Geschichte der NS-Diktatur befasste, wurde er darauf aufmerksam, dass der Vater des Patienten in exponierter Stellung Mitglied der SS gewesen war.
Angeblich weil er Konflikte mit den pubertären Schwestern nicht mitbekommen sollte, wurde der Patient zu Beginn der Gymnasialzeit in ein Internat verbracht, wo er relativ viel körperliche Gewalt erfuhr, vor der er sich von den Eltern nicht geschützt fühlte. Im Gegenteil, die Eltern hätten ihm immer vermittelt, dass die strafenden Lehrer schon das Richtige täten.
Der Patient hat ein durchweg ambivalentes Verhältnis zu den Eltern, was auch dazu führte, dass er nach dem Abitur sehr schnell von zuhause weg wollte. Im Gespräch fällt auf, dass der Patient völlig dialektfrei spricht, obwohl er aus einer Region stammt, in der normalerweise ein sehr akzentuierter Dialekt gesprochen wird, was als zusätzliches Zeichen seiner Distanzierung verstanden werden kann.
Der Patient, der mit spürbarem Leidensdruck in das Erstgespräch kam, berichtet, schon vor längerer Zeit das Angebot erhalten zu haben, eine Psychoanalyse zu machen. Sein Therapeut habe damals sogar einen Psychotherapieantrag geschrieben. Herr L. zog es dann aber vor, an einen anderen Ort zu ziehen, weswegen er die Psychoanalyse nie begonnen hatte.
Immer noch mit der leisen Hoffnung, dass das sexuelle Symptom vielleicht doch körperlichen Ursprungs sein könnte, macht der Patient aber deutlich, dass er sich durchaus vorstellen könnte, jetzt eine Psychotherapie zu beginnen, zumal er mittlerweile in einem Alter sei, in dem er sich um seine Zukunft doch größere Sorgen mache.
2.1 Diskussion des Falles aus einer psychodynamischen Perspektive
Der Patient wird auf Anraten eines Internisten in die Psychotherapie „geschickt“, was auf eine gewisse Ambivalenz bezüglich seiner eigenen Motivation verweist, die sich auch im Hinblick auf frühere Versuche, Hilfe zu suchen, andeutet. Herr L. wurde in ein strenges Elternhaus als vermeintlich unerwünschtes Kind hineingeboren. Die Beschreibungen seiner Eltern wirken recht widersprüchlich. Seine dominante Mutter scheint insbesondere in den ersten Lebensjahren eher ablehnende Gefühle gegenüber ihrem Kind signalisiert zu haben. Seine Bedürfnisse nach Schutz und emotionaler Zuwendung blieben vermutlich unterversorgt oder gar nicht befriedigt. Dennoch berichtet der Patient, später Mutters Liebling geworden zu sein. Seinen Vater beschreibt er als oberflächlich gutmütig und liebevoll. Gleichzeitig scheint dieser sich jedoch seiner erzieherischen Verantwortung entzogen zu haben, indem er ausschließlich der Mutter die strafende Rolle zuwies. Es stellt sich die Frage, ob er als „schwacher Vater“ seinen Sohn nicht schützen konnte oder wollte.
In der ödipalen Phase hatte der Patient nur diesen recht schwachen Vater als männliche Identifikationsfigur verfügbar, vermutlich halfen ihm idealisierende Fantasien zum Gelingen der Entwicklungsstufe. Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass er beim Bericht über das Aufdecken der nationalsozialistischen Vorgeschichte des Vaters im Gespräch infolge seiner Enttäuschung offenbar wirklich unvorbereitet getroffen gewesen zu sein schien. Auch an dem Beispiel dieser Vorgeschichte wird deutlich, dass in der Familie mit Problemen nicht wirklich offen umgegangen und vieles über Umwege ausgedrückt wurde.
Aus seiner im Gespräch berichteten Geschichte wird nicht deutlich, weshalb die Mutter Schläge austeilte. Da diese Schläge aber auch eine Form von Aufmerksamkeit und Zuwendung darstellten, könnte man vermuten, dass der Patient daraufhin ein eher provozierendes Verhalten entwickelte und sein Wunsch nach Zuwendung dadurch an Gewalt gekoppelt und diese Gewalt wiederum für ihn auch mit etwas Lustvollem verknüpft war. An der Wortwahl in der Beschreibung seiner aktuellen sexuellen Praktiken findet sich diese sadomasochistisch anmutende Verknüpfung durchaus wieder.
Die oft ablehnende Haltung seiner Eltern ihm gegenüber vermittelte dem Patienten wahrscheinlich, so wie er war, nicht richtig zu sein. Vermutlich versuchte er als Kind vieles, um doch irgendwie die Aufmerksamkeit seiner Eltern zu erhalten. Letztlich hatte er es offenbar auch geschafft, doch zumindest zeitweise zu einer Art Liebling seiner Mutter zu werden, was er beispielsweise damit begründet, dass er mit zwölf Jahren noch auf dem Schoß der Mutter gesessen habe. Aufgrund der immer wieder erfahrenen Abweisung durch die Eltern ist der Realitätsgehalt dieser Einschätzung allerdings eher kritisch zu betrachten. Möglich ist, dass hier eine Wunschvorstellung des Patienten oder eine idealisierende Wahrnehmung zur Stabilisierung des fragilen Selbst deutlich werden. Mit Bezug auf seine aktuellen zwischenmenschlichen Beziehungen scheint eine gewisse Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der anderen und seine Sorge, diese Bedürfnisse zu erfüllen, recht augenfällig. Mit dieser Fähigkeit wiederum erreicht er es, die Aufmerksamkeit Gleichaltriger zu erhalten.
Das Verhalten des 12-Jährigen gegenüber seiner Mutter, wenn es denn so gewesen war, ist offensichtlich kein altersadäquates Mutter-Sohn-Verhalten. In der Zeit der Latenz und der beginnenden Pubertät sollte sich ein Kind eigentlich zunehmend mit Gleichaltrigen beschäftigen und sich mit dem Wertesystem der Eltern eher konfrontativ auseinandersetzen. Im Kontakt zur Mutter wirkt der Patient seiner Schilderung nach aber eher noch wie in einer Kleinkindrolle. Möglicherweise kam es aber auch zu einer Rollenumkehr, indem der Patient eine versorgende Rolle zugewiesen bekam und die mütterlichen Bedürfnisse befriedigen sollte. Dies würde auch sein versorgendes und eher submissives Verhalten in aktuellen Partnerschaften bzw. in zwischenmenschlichen Beziehungen allgemein erklären. Er scheint dafür verantwortlich, für die Bedürfnisbefriedigung der anderen zu sorgen. Seine Wünsche nach Nähe sind für ihn erst dann erfüllbar, wenn er die Bedürfnisse der anderen versorgt hat. Dies führte vermutlich auch zu Frustrationen, die den Wunsch nach Distanz erzeugten. Dieser Mechanismus entspricht dem bisher erlebten Muster, dass er nicht um seiner selbst willen geliebt wird. Wünsche des Patienten nach Nähe erlebte dieser vermutlich immer sehr ambivalent.
Seine „Sexgeschichten“ und sein prahlerischer Umgang damit, scheinen heute die Funktion zu haben, sich darüber interessant zu machen und gleichfalls eine Möglichkeit zu Kontakten zu bieten. Zwischenmenschliche Beziehungen lebt der Patient zunächst über Sexualität. Dabei fehlt es ihm aber offenbar an emotionaler Tiefe und Verbundenheit. Auch wirken die sexuellen Darstellungen durchaus wie eine Selbstaufwertung.
Die erlebte Beziehungslosigkeit in der frühen Kindheit scheint sich in seinen aktuellen beruflichen wie auch in seinen intimen Beziehungen wiederzuspiegeln. Er beschreibt diese sehr sprunghaft und von den Interessen sehr wechselhaft, quasi ohne roten Faden. Nach einer gewissen Zeit ist „immer wieder die Luft raus“. Er benötigt immer wieder neue Impulse zur Stimulation (fast vergleichbar einem immer wiederkehrenden Bedürfnis nach „sensation seeking“). Es scheint für ihn schwierig zu sein, länger anhaltende Beziehungen zu gestalten und die darin entstehende Nähe auszuhalten. Andererseits bietet ihm die berufliche wie intime Vielseitigkeit (Frauen und Männer als Partner) immer wieder die Möglichkeit, sich darüber selbst aufzuwerten.
In der aktuellen Beziehung helfen ihm die sexuellen Probleme, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten. Nun muss die Frau auf ihn warten und sich auf ihn einstellen. Sexualität wurde in der elterlichen Familie nicht als dazugehörig und bereichernd, sondern als konflikthaft und gefährlich erlebt. So wurde der Patient in ein Internat geschickt, um ihn von der Pubertät der Schwestern fernzuhalten. Vielleicht muss sich Herr L. dadurch auch in seinen Beziehungen nach einer gewissen Zeit des freien sexuellen Erlebens wieder zurückziehen, aus unbewusster Angst, dann vielleicht auch wieder fortgeschickt zu werden. Damit könnte sein sexueller Rückzug beziehungsstabilisierend wirken. Andererseits entsteht durch den Rückzug seiner jungen Freundin infolge einer Krankheit die Fantasie von aktiven, intensiven und aggressiven Sexualpraktiken. Damit hätten seine schuld- und schamhaften Anteile eine Verstärkung erfahren, woraufhin er sich nun zurückhalten bzw. „abtauchen“ muss.
Diese Überlegungen zu Herrn L. basieren auf klinischen Reflexionen und Assoziationen, die bei der Betrachtung des (videographierten) Erstgesprächs entstanden sind. Bei Heranziehung der operationalisierten diagnostischen Kriterien der OPD (Arbeitskreis OPD, 2006) würden auf der Ebene der Konflikte am ehesten ein Konflikt zwischen Individuation und Abhängigkeit sowie ein ödipaler Konflikt signiert. Auf der Ebene der psychischen Struktur würde der Patient überwiegend als gut integriert eingeschätzt, allerdings mit Einschränkungen (mäßige Integration) auf den Feldern der Regulierung des Objektsbezugs und der Fähigkeit zur Bindung. Als zentrales Beziehungsthema würde man in erster Linie die Fähigkeit, sich im Kontakt zu anderen angemessen zu öffnen und abzugrenzen, fokussieren.
2.2 Diskussion des Falles aus der Perspektive der Bindungstheorie
Die Bindungstheorie (vgl. Kap. 3) interpretiert – vereinfacht ausgedrückt – das Verhalten und Erleben von Menschen in Bezug auf enge emotionale Beziehungen entwicklungspsychologisch und betont dabei reale Erfahrungen und die Adaptivität der Entwicklung. Aus dieser Sicht weist die Vignette des Patienten Herrn L. einige interessante Besonderheiten auf.
Er gibt an, dass sich ein wiederkehrendes Muster von Interessenverlust und abrupten Abbrüchen und Neuanfängen wie ein roter Faden durch sein Leben ziehe. So habe er mehrere ganz unterschiedliche berufliche Tätigkeiten in verschiedenen Städten erlernt und ausgeübt, nach recht kurzer Zeit jedoch das Interesse verloren. In intimen Beziehungen verliere er nach einiger Zeit das sexuelle Interesse und wolle dann nur noch eine freundschaftliche Basis aufrechterhalten. Auch in der derzeitigen Beziehung habe er dies bereits temporär beobachtet, wisse aber nicht, ob seine Erektionsstörung damit in Zusammenhang stehe. Weiterhin lässt sich in diesen Kontext die Aussage des Patienten einordnen, dass vor vielen Jahren eine durch die Krankenkasse bereits bewilligte psychoanalytische Behandlung daran scheiterte, dass Herr L. kurzfristig den Wohnort wechselte. Diese beruflichen und sexuellen Interessenverluste und Neuorientierungen implizierten jeweils auch einen Wechsel sozialer Bezugspersonen (z. B. Kollegen, Liebespartner), so dass die Annahme plausibel erscheint, dieses Verhaltensmuster könnte allgemein eine beziehungsregulierende, distanzierende Funktion ausüben. Aus bindungstheoretischer Perspektive lassen sich sehr unterschiedliche Bindungscharakteristika und -konstellationen postulieren, die diesem Verhaltensmuster die angenommene Funktion der Herstellung von Distanz zuweisen können. Insofern ist die Fallvignette auch ein Beispiel dafür, dass sehr viele Informationen über eine Person nötig sind, um sie fundiert und kohärent bindungstheoretisch einordnen zu können.
Im Folgenden werden drei unterschiedliche bindungstheoretische Interpretationen diskutiert und gegeneinander abgewogen:
1.Ambivalenter Bindungsstil
Abbrüche/Interessenverluste wie die oben beschriebenen könnten auf eine ambivalente Bindung hinweisen. Stark vereinfacht zeigen ambivalente Personen ein intensives Erleben in und einen starken Wunsch nach engen Beziehungen bei gleichzeitiger Angst davor, abgelehnt oder verlassen zu werden. Im Erwachsenen-Bindungsprototypen-Rating (EBPR), auf das weiter unten noch eingegangen wird, wird die übliche Typologie der drei Bindungsstile (sicher, ambivalent, vermeidend) durch sog. Bindungsprototypen weiter spezifiziert. Dabei werden ein sicherer, drei ambivalente und drei vermeidende Prototypen charakterisiert. Einer der ambivalenten Prototypen wird als „instabil beziehungsgestaltend“ bezeichnet, der durch stark schwankende Gefühle von Idealisierung und Abwertung sowie häufige Wechsel in Freundschaften und Partnerschaften charakterisiert ist. Das Grunddilemma instabil beziehungsgestaltender Personen ist ein fragiles Selbstwertgefühl bei gleichzeitig wenig ausdifferenzierten Beziehungsschemata und Affekten. Neue, das Selbstwertgefühl stützende Bekanntschaften werden zunächst idealisiert und intensiv positiv erlebt. Bereits kleinere Enttäuschungen und Kränkungen, wie sie in engeren, länger dauernden Beziehungen unvermeidlich vorkommen, werden als stark selbstwertbedrohend erlebt mit entsprechenden Emotionen eigener Wertlosigkeit und heftigen Ärgers. Die Bezugsperson wird in der Folge generell entwertet, die Beziehung abgebrochen und eine neue Beziehung schnell eingegangen – mit neuerlichen Idealisierungen. In diesem Kontext könnte die Erektionsstörung bei Herrn L. die Funktion besitzen, nach einer erlebten Kränkung durch die Partnerin (etwa deren Krankheit) eine emotionale Distanz aufrechtzuerhalten oder die Beziehung insgesamt abzuwerten, um im Falle zu erwartender neuerlicher Kränkungen eine potentiell selbstwertbedrohliche Nähe zu vermeiden.
2.Vermeidender Bindungsstil
Aus der vorliegenden Fallvignette lassen sich allerdings im Zusammenhang mit den geschilderten Abbrüchen keine Hinweise auf Enttäuschungen und Kränkungen durch nahe Bezugspersonen entnehmen. Vielmehr finden sich Anhaltspunkte, die eine Interpretation im Hinblick auf einen vermeidenden Bindungsstil (Neigung zu Rationalisierung und Affektarmut, Unbehagen in engen Beziehungen, Wunsch nach Unabhängigkeit) nahelegen. So zeigt sich Herr L. emotional wenig betroffen, als er Episoden von Zurückweisung und Bestrafung durch seine Eltern berichtet (Affektüberregulation) und gibt weiterhin an, der Grund, damals eine Psychotherapie beginnen zu wollen, sei seine Unfähigkeit gewesen, nahe Beziehungen einzugehen. Im EBPR wird einer der drei vermeidenden Prototypen als „übersteigert autonomiestrebend“ bezeichnet. Für diese Personen ist charakteristisch, dass sie sich leicht eingeengt fühlen, mit Beziehungen einhergehende Verpflichtungen sowie eigene Abhängigkeit scheuen und ein hohes Maß an Handlungsfreiheit wünschen. Auch in Bezug auf diesen Prototyp liegt die Vermutung nahe, dass das Muster von Interessenverlust und abrupten Abbrüchen/Neuanfängen ebenso wie das derzeitige Erektionsversagen die Funktion haben könnten, eine als bedrohlich erlebte Nähe in zwischenmenschlichen Beziehungen zu regulieren. Hier allerdings würde die Bedrohung als Gefühl der Einengung und dem Unbehagen, in eine Falle zu geraten, erlebt. Im Widerspruch dazu stehen jedoch die Aussagen des Patienten, er sei mit seiner jetzigen Partnerin recht schnell in eine gemeinsame Wohnung gezogen und er wolle eine Therapie, da er sich sorge, seine Partnerin könne ihn verlassen, weil sie sexuell unbefriedigt bleibe.
Allerdings müssen sich die Angst davor, verlassen zu werden, und ein empfundenes Unbehagen in nahen Beziehungen nicht ausschließen. In bindungstheoretischen Begriffen gesprochen: Ambivalente Bindungsanteile (Furcht, verlassen zu werden) können einhergehen mit vermeidenden Anteilen (Unbehagen in nahen Beziehungen), womit die dritte bindungstheoretische Interpretation umschrieben ist:
3.Die Kombination ambivalenter und vermeidender Bindungsanteile
Diese findet Berücksichtigung in verschiedenen Fragebogenverfahren (etwa im „Experience in Close Relationships Inventory“, in dem hinsichtlich dieser Kombination von einem unsicher-furchtsamen Bindungsstil gesprochen wird) sowie im Erwachsenen-Bindungsprototypen-Rating (EBPR), in dem die entsprechende Bindungskategorie als gemischt-unsicher bezeichnet wird. Menschen mit gemischt-unsicherer Bindung befinden sich in einem spezifischen psychosozialen Konflikt: Einerseits wollen sie enge Beziehungen, andererseits fühlen sie sich in solchen unwohl. Leider gibt es bisher keine Forschungsarbeiten über die Regulation von Nähe bei gemischt-unsicheren Personen. Das dürfte auch schwierig sein, da anzunehmen ist, dass dieser Konflikt sehr unterschiedliche Arrangements zulässt: etwa „Beziehungen“ zu führen, die wesentlich nur fantasiert sind – etwa in virtuellen Gemeinschaften (z. B. Internet-Foren und Chat-Rooms) oder mit Personen, die faktisch nicht verfügbar sind (z. B. Strafgefangene oder „Liebesobjekte“ im Rahmen von Stalking) – oder reale, alltägliche, nahe Beziehungen zu führen, in der durch verschiedene Verhaltensweisen immer wieder (räumliche oder emotionale) Distanz geschaffen wird. Beispiele hierfür sind etwa das Ergreifen einer Berufstätigkeit, die mit hohem Zwang zur Mobilität verbunden ist; die Ausübung eines Hobbys, das häufige temporäre Trennungen impliziert, oder auch herbeigeführter Streit mit nachfolgendem Rückzug.
Vor diesem Hintergrund ließe sich die Erektionsstörung des Patienten etwa folgendermaßen einordnen: Herr L. hat ein sehr starkes Bedürfnis nach Nähe, kann aber eine enge emotionale Beziehung nicht wirklich ertragen und empfindet darin Anspannung und Unwohlsein. In den bisherigen langjährigen Beziehungen ging Herr L. nach einiger Zeit dazu über, sexuelle Kontakte zu vermeiden und eher freundschaftliche Beziehungen zu führen, wodurch er jeweils eine nahe Beziehung aufrechterhalten und gleichzeitig die Nähe auf ein für ihn erträgliches Maß reduzieren konnte. Dies konnte so jeweils über mehrere Jahre gelingen, da die Partnerinnen dies akzeptierten. Die jetzige Partnerin hingegen fordert ein höheres Maß an Nähe und sexuellen Aktivitäten ein und droht implizit damit, Herrn L. zu verlassen. Dieser reagiert mit einem psychosomatischen Arrangement in Form einer Erektionsstörung, die es ihm einerseits ermöglicht, emotionale Distanz zu wahren („abzutauchen“), und andererseits, die Partnerin in ihren Nähewünschen nicht persönlich zu enttäuschen und damit die Beziehung vorerst zu erhalten („auf halber Strecke verhungern“). Auch an dieser Strategie wird deutlich, dass bei Herrn L. die vermeidenden Bindungsanteile zu überwiegen scheinen, was auch an seiner emotional distanzierten Art, über sich und seine Beziehungen zu sprechen, deutlich wird.
Aus verhaltenstheoretischer Perspektive wäre auch denkbar, dass sich Herr L. in einer sexuellen Situation aufgrund eines zu hohen Ausmaßes an empfundener Nähe eingeengt und unwohl gefühlt haben könnte, woraufhin ein Erektionsversagen auftrat. Die sexuellen Forderungen der Freundin könnten bei Herrn L. zu starken Verlustängsten mit entsprechenden Versagensängsten in neuerlichen sexuellen Situationen geführt haben, was zu erneutem erektilen Versagen führte, womit ein Teufelskreis geschlossen wurde.
2.3 Diskussion des Falles aus der Perspektive der interpersonalen Theorie
Eine notwendige Vorbemerkung
Im Rahmen der interpersonalen Tradition wird zwischen individuumszentrierten und dyadisch orientierten Ansätzen unterschieden (vgl. Thomas & Strauß, 2008). Allen Ansätzen gemein ist die Betonung der Wichtigkeit früherer Beziehungserfahrungen, insbesondere der Bindung an die Eltern und vergleichbarer primärer Bezugspersonen, für die Entwicklung eigener zwischenmenschlicher Verhaltensmuster. Der interpersonale Ansatz, der in Kap. 4 ausführlicher dargestellt wird, geht davon aus, dass gegenwärtige interpersonale Bestrebungen durch soziales Lernen im Kontext früher Beziehungserfahrungen geformt werden: Dabei werden interpersonale Motivationen, Erwartungen und die Gestimmtheit gelernt, mit der ein Mensch mit anderen interagiert, wie andere Personen auf ihn reagieren, wie diese Reaktionen von ihm wahrgenommen und bewertet werden sowie welche inneren und Verhaltensreaktionen in ihm selbst ausgelöst werden. Besonders bedeutsam sind dabei die Empfindungen Angst und Ärger mit hemmendem Einfluss bzw. Zufriedenheit und Sicherheit mit verstärkendem Einfluss auf Motivation, Erwartung, Gestimmtheit und zukünftige Verhaltenstendenzen. Aus den frühen Beziehungserfahrungen und Bindungen werden also Erwartungen bezüglich interpersonaler Situationen geformt, bezüglich der eigenen Person und dem Gegenüber sowie Motive und Handlungstendenzen, auf welche Weise eine Person Sicherheit erlangen bzw. Angst vermeiden kann. Nach Sullivan sind jegliche zwischenmenschliche Bestrebungen darauf ausgerichtet, Sicherheit zu erzeugen und Erfahrungen von Angst zu vermeiden.
Ausgehend von einer differentiellen Perspektive werden interpersonale Modelle zur Beschreibung interindividueller Unterschiede in interpersonalen Transaktionen genutzt. interpersonales Verhalten lässt sich dabei auf verschiedenen Ebenen beschreiben: auf der direkt beobachtbaren Verhaltensebene (z. B. durch Fremdbeobachtung), der Ebene der interpersonalen Persönlichkeitseigenschaften (Traits), der Motivebene und der Problemebene. Verschiedene diagnostische Instrumente liegen hierfür vor (Thomas & Strauß, 2008). Die Betrachtung verschiedener Ebenen zwischenmenschlichen Verhaltens und möglicher bestehender Inkonsistenzen liefert wichtige Informationen für die Erklärung konkreter zwischenmenschlicher Verhaltensweisen einer Person sowie das Auftreten von Störungen. Der dyadische Ansatz basierend auf der Strukturalen Analyse sozialen Verhaltens (SASB, Benjamin, 1974) beleuchtet hingegen direkt die zwischenmenschlichen Wechselwirkungen in der Dyade. Dabei werden aktuelle interpersonale Transaktionen vor dem Hintergrund insbesondere bedeutsamer frühkindlicher Beziehungserfahrungen gewertet, die über verschiedene Kopierprozesse internalisiert werden und in gegenwärtigen Beziehungen nachwirken.
Zum Fallbeispiel
Aus interpersonaler Sicht werden sexuelle Funktionsstörungen, soweit nicht organisch bedingt, als Beziehungsstörungen aufgefasst. Relevante Analysefragen zum Verständnis einer Störung betreffen dabei die interpersonalen Persönlichkeitseigenschaften des Patienten einschließlich seiner bisherigen Beziehungsgeschichte – also das verinnerlichte „interpersonale Muster“, die Funktion der Störung in der Beziehung (Wofür steht „das Symptom“ innerhalb der Beziehung? Wofür ist es adaptiv?), sowie der Umgang von Partnern miteinander und mit der Störung (Komplementarität/Gegenseitigkeit).