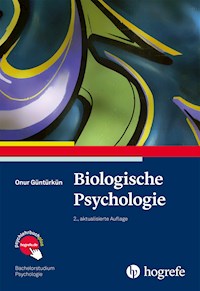
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bachelorstudium Psychologie
- Sprache: Deutsch
Alle unsere Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und Handlungen werden von unserem Gehirn gesteuert. Dieses Lehrbuch vermittelt die biologischen Grundlagen, die für das Verständnis dieser psychologischen Prozesse eine wichtige Rolle spielen. Hierzu gehören der Aufbau und die Funktionsweise von Neuronen, Nervenzellen und Synapsen. Weitere Kapitel gehen den folgenden Fragen nach: Wie werden unsere Sinneseindrücke im Gehirn repräsentiert? Welche Strukturen sind an unseren Denkprozessen beteiligt und wie entsteht die Ordnung der Gedanken? Wie verändert Lernen das Gehirn? Darüber hinaus wird erläutert, wo und wie Emotionen verarbeitet werden und wie sie unser Verhalten beeinflussen, wie Hunger und Durst entstehen und wie es zu Suchtverhalten kommen kann. Ein abschließendes Kapitel geht auf geschlechtsspezifische biologische Einflüsse ein. Die Inhalte des Buches werden anhand von Kurzgeschichten, Grafiken und Kästen veranschaulicht. Klassische und aktuelle wissenschaftliche Studien ergänzen die Darstellungen und zahlreiche Übungen regen dazu an, das Gelernte zu reflektieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Onur Güntürkün
Biologische Psychologie
2., aktualisierte Auflage
Bachelorstudium Psychologie
Biologische Psychologie
Prof. Dr. Onur Güntürkün
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Eva Bamberg, Prof. Dr. Hans-Werner Bierhoff, Prof. Dr. Alexander Grob, Prof. Dr. Franz Petermann
Prof. Dr. Onur Güntürkün, geb. 1958. 1975–1980 Studium der Psychologie in Bochum. 1984 Promotion. 1984–1987 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum in der Arbeitseinheit Tierpsychologie. 1987–1988 Post-Doktorand in Paris und San Diego. 1988–1991 Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Konstanz. 1991 Habilitation. 1992–1993 Hochschuldozent an der Universität Konstanz. Seit 1993 Professor für Biopsychologie an der Fakultät für Psychologie, Ruhr-Universität Bochum. Seit 1996 verschiedene Forschungsaufenthalte im Ausland als Gastwissenschaftler.
Informationen und Zusatzmaterialien zu diesem Buch finden Sie unter www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © José Marafona – Dreamstime.com
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
2., überarbeitete Auflage 2019
© 2012, 2019 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2941-0; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2941-1)
ISBN 978-3-8017-2941-7
http://doi.org/10.1026/02941-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 Neurone und Gliazellen
1.1 Nervenzellen
1.1.1 Das Soma
1.1.2 Der Dendrit
1.1.3 Das Axon
1.2 Gliazellen
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 2 Die Funktionsmechanismen von Nervenzellen
2.1 Die Entstehung des neuronalen Signals
2.1.1 Die Ionen innerhalb und außerhalb der Zelle
2.1.2 Die neuronale Zellmembran
2.1.3 Die Ionenkanäle
2.1.4 Die Konzentrationsgradienten der Ionen
2.1.5 Die elektrostatische Kraft
2.1.6 Das Membranpotenzial
2.2 Das Aktionspotenzial
2.2.1 Entstehung und Verlauf eines Aktionspotenzials
2.2.2 Die Reise des Aktionspotenzials
2.2.3 Myelinisierte Axone
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 3 Synapsen und Neurotransmitter
3.1 Die Übertragung an der Synapse
3.1.1 Die chemische Synapse
3.1.2 Die postsynaptischen Rezeptoren
3.2 Das postsynaptische Potenzial
3.3 Neurotransmitter
3.3.1 Aminosäuren
3.3.2 Amine
3.3.3 Peptide
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 4 Neuroanatomie
4.1 Die Terminologie der Ortsbeschreibungen im Gehirn
4.2 Die Hirnhäute
4.3 Prosencephalon
4.3.1 Telencephalon
4.3.2 Diencephalon
4.4 Mesencephalon
4.4.1 Tectum
4.4.2 Tegmentum
4.5 Rhombencephalon
4.5.1 Metencephalon
4.5.2 Myelencephalon
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 5 Der sensomotorische Schaltkreis
5.1 Die sensorische Landkarte
5.2 Die verzerrte Landkarte unserer Sinne
5.3 Jenseits der primären sensorischen Landkarte
5.3.1 Primär sensorische Areale
5.3.2 Assoziativ-sensorische Areale
5.3.3 Multimodale Areale
5.3.4 Prämotorische Areale
5.3.5 Primäres motorisches Areal
5.4 Der sensorische Thalamus: Das „Tor zum Bewusstsein“
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 6 Die Ordnung des Denkens
6.1 Die Makroebene des Gehirns: Die Topografie des Denkens
6.1.1 Die anteroposteriore Achse des präfrontalen Cortex
6.1.2 Die dorsoventrale Achse des präfrontalen Cortex
6.2 Die Mikroebene des Gehirns: Die fragile Welt der Zellensembles
6.2.1 Das Entstehen und Vergehen eines Ensembles
6.2.2 Die Spur der Ensembles
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 7 Gedächtnissysteme: Arbeitsgedächtnis und deklaratives Gedächtnis
7.1 Das Arbeitsgedächtnis
7.2 Die Rolle des Hippocampus
7.3 Die Entstehung des deklarativen Langzeitgedächtnisses
7.4 Die Rolle der NMDA-Rezeptoren
7.5 Ungelöste Fragen
7.6 Der Abruf aus dem Gedächtnisspeicher
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 8 Gedächtnissysteme: Nicht deklaratives Gedächtnis
8.1 Prozedurales Gedächtnis
8.2 Bahnung
8.3 Klassische Konditionierung
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 9 Emotionen
9.1 Die Evolution des emotionalen Gehirns
9.2 Die Anatomie der Amygdala
9.3 Regulation von aggressivem Verhalten
9.4 Regulation von Furchtverhalten
9.4.1 Schnelles und vorbewusstes Reagieren
9.4.2 Aufmerksamkeit für emotional relevante Reize
9.4.3 Reaktionen auf emotionale Stimuli
9.4.4 Lernen emotionaler Stimuli
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 10 Sucht
10.1 Erstkonsum
10.2 Gewöhnung
10.3 Abstinenz
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 11 Hunger und Durst
11.1 Hunger
11.1.1 Die Energiereserven
11.1.2 Hunger und Nahrungsaufnahme
11.1.3 Sättigung
11.2 Durst
11.2.1 Das osmometrische System
11.2.2 Das volumetrische System
Zusammenfassung
Fragen
Kapitel 12 Geschlecht
12.1 Das genetische Geschlecht
12.2 Das körperliche Geschlecht
12.3 Das neuronale Geschlecht
12.4 Das kognitive Geschlecht
Zusammenfassung
Fragen
Anhang
Literatur
Glossar
Sachregister
|9|Vorwort
Es ist Jahrzehnte her, aber ich kann mich noch an alle Details erinnern. Es war ein sehr großer, gekachelter Raum, eigentlich schon eher ein Saal. Die Edelstahltische standen in Reihen. Es lag ein merkwürdiger Geruch in der Luft. Ich hatte einen verfleckten Laborkittel an und trug Einmalhandschuhe. Die Studenten waren schon lange weg und ein Kollege hatte mich reingelassen, hatte auf einen weißen Plastikeimer auf einem der Tische gezeigt und einfach nur „da“ gesagt. Dann war er gegangen. Jetzt saß ich davor und war aufgeregt.
Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass der Inhalt mich ekeln würde. Vorsichtig nahm ich den Eimer auf den Schoß, machte den Deckel auf und blickte hinein. Sofort brannten meine Augen von dem scharfen Formalingeruch, aber ich hatte das Gehirn schon gesehen. Als ich es rausnahm, rutschte der Ärmel meines Kittels rein und schnell sog der Stoff das Formalin auf. Mir war alles egal. Zum ersten Mal in meinem Leben hielt ich ein menschliches Gehirn in der Hand. Ehrfurcht durchflutete mich; aber auch Scham, einem mir unbekannten Menschen auf so intime Art und Weise so nahe zu kommen. Mir war klar, dass die gesetzlichen Vorgaben es erforderten, dass die Fixierung des Gehirns lange nach dem Tod der Person erfolgt und somit die synaptische Feinstruktur des Gehirns in meiner Hand schon erheblich zerfallen war. Aber zelluläre Reste des Gedächtnisses dieses Menschen waren zweifellos noch vorhanden. Erinnerungen an warme Sommertage, an Momente des Glücks und der Liebe, dunkle Geheimnisse, deren letzte unlesbare Spuren ich in meiner Hand hielt.
Die Faszination und die Ehrfurcht, die ich damals als Doktorand verspürte, haben nie nachgelassen. Heute, viele Jahre später, weiß ich erheblich mehr über die neuronalen Mechanismen des Denkens und trotzdem weiß ich viel zu wenig. Die Begeisterung für mein Fach ist in dieses Buchprojekt eingeflossen, und ich hoffe, man spürt es. Das Buch behandelt drei Themenbereiche: die Architektur des Gehirns (Kapitel 1 bis 4), das lernende und erinnernde Gehirn (Kapitel 5 bis 8), das fühlende und agierende Gehirn (Kapitel 9 bis 12). Somit wird zuerst eine Grundlage über den Aufbau des Gehirns und die Funktionen von Neuronen gelegt, bevor die Mechanismen der Informationsspeicherung und des Verhaltens dargestellt werden. Es gibt in diesem Buch keine Trennung zwischen Struktur und Funktion, da diese Trennung auch im Gehirn nicht existiert. Schließlich lassen sich nur bei einem Computer Hard- und Software unterscheiden, während das Gehirn lernabhängig seine Hardware und somit seine Funktion ständig verändert und damit seine Struktur den gemachten Erfahrungen anpasst. Ich habe in allen Kapiteln versucht, die neuronalen Grundlagen psychologischer Prozesse mechanistisch zu erklären. Das heißt, ich wollte die Leser nicht mit korrelativen Zusammenhängen langweilen, sondern ihnen klarmachen, |10|wie im Einzelnen unsere mentalen Funktionen entstehen. Es ist nicht einfach, diesen Anspruch so umzusetzen, dass dabei trotzdem ein Buch entsteht, dass für Bachelorstudenten nicht nur verständlich ist, sondern sogar Spaß macht. Ich hoffe, es hat geklappt. Um meine Leser zu verlocken, immer weiterzulesen, habe ich jedes Kapitel mit einer Kurzgeschichte begonnen, die das Thema und einige wesentliche inhaltliche Punkte umreißt. Innerhalb der zwölf Kapitel sorgen farbig hervorgehobene Kästen für die detaillierte Darstellung einzelner Methoden, wichtiger Experimente oder die Zusammenfassung des Lebens wichtiger Wissenschaftler.
Mittlerweile erscheint das Buch in der zweiten Auflage, und ich freue mich, dass es offensichtlich Anklang gefunden hat. Für die zweite Auflage sind viele neue Erkenntnisse und Zitationen eingebaut worden.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben Teile des Buches gelesen und mir sowohl für die erste als auch für die zweite Auflage wichtige Hinweise gegeben oder eigenes Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Dafür danke ich ihnen sehr. Ich möchte hier vor allem nennen: Christian Beste, Hubert Dinse, Michael Falkenstein, Klaus Funke, Markus Hausmann, Sebastian Ocklenburg, Maik Stüttgen, Carsten Theiß, Juliana Yordanova und Karl Zilles. Oliver Wrobel danke ich für einen Teil der Abbildungen in den Kapiteln 4, 9 und 11. Meine Frau Monika hat viele Kapitel sehr kritisch Korrektur gelesen. Ich danke ihr sehr für die Mühe. Zum Schluss geht mein Dank an Levent, meinen jüngsten Sohn. Er hat einige Kapitel auf Studententauglichkeit getestet. Zudem spielte er bei der Realisierung des Buchprojektes eine entscheidende Rolle: Als ein Kollege fragte, ob ich ein solches Buch schreiben würde, erbat ich mir Bedenkzeit und erzählte zu Hause von diesem Angebot. Levent sagte dann beim Abendessen: „Hey Papa, mach’s doch einfach.“ Das Ergebnis halten Sie in den Händen.
Bochum, im November 2018
Onur Güntürkün
|11|Kapitel 1Neurone und Gliazellen
|12|Die Fahrt nach Stockholm kam Camillo Golgi vor wie eine Ewigkeit. Nun bekam er also den Nobelpreis. Welch ungeheure Ehre und Befriedigung für die Jahrzehnte harter Arbeit. Aber er musste sich den Preis mit jemand anderem teilen und dieser andere war ausgerechnet Santiago Ramón y Cajal. Wie er ihn hasste! Er wusste, dass er ihm unterlegen war; jeder wusste es. Es war schwer mit einem Mann zu konkurrieren, der sowohl genial als auch auf fast unmenschliche Art und Weise fleißig war. Das Schlimmste aber war, dass er selbst diesem Konkurrenten die Methode für seine Forschungen geliefert hatte.
1872, als 29-Jähriger, hatte Camillo Golgi aus Geldnot den Posten eines Arztes in einer kleinen Klinik mit psychiatrischen Patienten angenommen. Er war fest davon überzeugt, dass seine Patienten keine Krankheit der Seele hatten, sondern eine Erkrankung des Gehirns. Um dies zu beweisen, wollte er das Gehirn erforschen, aber das war sehr schwierig, denn das Gehirn war eine graue homogene Masse. Golgi wollte darin Strukturen identifizieren, aber der Klinikleitung war Forschung egal. Erst nach langem Bitten stellte man Golgi eine winzige Küche als Labor zur Verfügung. Dort entwickelte er histologische Methoden für die Hirnfärbung. Eines Morgens nahm er ein kleines Stück Gehirn aus einem Gefäß, das über Tage in Wechselbäder aus Kaliumdichromat, Osmium und Silbernitrat getaucht worden war. Unter der Lupe erkannte er, dass kleine Pünktchen das Präparat überzogen. Die Betrachtung eines dünnen Hirnschnittes unter dem Mikroskop tauchte ihn plötzlich in eine neue Welt, die er zeitlebens nie wieder verlassen sollte: Der Schnitt war durchsichtig geworden, aber einige wenige Zellen waren in all ihren Details zu sehen. Camillo Golgi wurde zum ersten Menschen, der Zugang zu den Bausteinen des Gehirns bekam.
Die nach Camillo Golgi benannte Golgi-Methode wurde zum Standard der Hirnforschung. Mit ihr erkannte Golgi, dass es zwei Arten von Zellen im Gehirn gab: Neurone und Gliazellen. Erstere waren für die Denkprozesse verantwortlich, letztere hatten stützende und versorgende Funktionen. Einige Jahre nach der Veröffentlichung der Golgi-Färbetechnik fing auch ein junger spanischer Anatom namens Cajal an, diese Methode zu verwenden und brachte sie zur Perfektion. Cajal erkannte, dass Neurone lange, Dendriten genannte Fortsätze besitzen, mit denen sie Informationen von anderen Nervenzellen aufnehmen. Neurone gaben Informationen über Axone weiter, die teilweise über lange Strecken zu entfernten Hirnstrukturen reichten, ähnlich den Telegrafenkabeln, die Europa durchzogen. Cajal formulierte mithilfe von Golgi-Färbungen die Neuronendoktrin, nach der die Funktion des Gehirns auf der Wechselwirkung von spezialisierten Neuronentypen beruht. Die Doktrin besagte auch, dass Nervenzellen neurale Netzwerke bildeten, aber in diesen Netzwerken nach wie vor als individuelle Zellen existierten. Veränderungen des Denkens gin|13|gen demnach mit Veränderungen der Kontaktstellen zwischen den Neuronen dieses Netzwerkes einher. Cajal stellte die Hypothese auf, dass verschiedene mentale Funktionen an unterscheidbaren Stellen des Gehirns lokalisiert waren, und dass in diesen Hirnarealen die Neurone so verschaltet waren, dass ihr lokales Netzwerk genau diese mentale Funktion erzeugte.
Camillo Golgi dagegen behauptete, dass im Gehirn die Neurone zu einem Nervennetz verschmelzen, dass Dendriten nur eine Ernährungsfunktion haben und dass es keinerlei Lokalisation von Funktionen im Gehirn gibt. Camillo Golgi hatte diese wunderbare Färbemethode entwickelt. Er hatte so viele weitere wichtige Beiträge geleistet. Aber immer, wenn es um große Theorien ging, irrte er. Und so fuhr er also nach Stockholm und hielt dort am 11. Dezember 1906 eine peinliche Feierrede, in der er im Beisein von Santiago Ramón y Cajal alles verteidigte, woran er selbst kaum noch glaubte.
Tabelle 1: Das Gehirn des Menschen in Zahlen (nach Blinkov & Glezer, 1968; Pakkenberg & Gundersen, 1997; Azevedo et al., 2009)
Durchschnittliches Gewicht
1,5 kg
Anzahl der Nervenzellen
86 Milliarden (86 × 109)
Anzahl der Nervenzellen im Cortex
16 Milliarden (16 × 109)
Anzahl der Nervenzellen im Kleinhirn
69 Milliarden (69 × 109)
Anzahl der Synapsen
1 Billiarde (1 × 1015)
Anzahl corticaler Neurone pro mm3
14.000
Axonlänge pro mm3
4 km
Dendritenlänge pro mm3
400 m
Oberfläche aller Neuronen
25.000 m2 (4 Fußballfelder)
Das Gehirn des Menschen ist ein gewaltiges Organ, das aus mehr als einer Billion Zellen besteht (vgl. Tab. 1). Die zwei wichtigsten Zelltypen sind die Nervenzellen (auch Neurone genannt) und die Gliazellen. Das menschliche Gehirn besitzt etwa 86 Milliarden (86 × 109) Nervenzellen. Die Anzahl der Gliazellen ist ungefähr genauso hoch. Beide Zelltypen kommen sowohl im Zentralnervensystem (ZNS; umfasst das Gehirn und das Rückenmark) als auch im peripheren Nervensystem vor |14|(PNS; umfasst das Nervensystem außerhalb des ZNS, das im gesamten Körper inkl. der Eingeweide liegt). Sowohl Neurone als auch Gliazellen sind spezialisierte Formen von normalen Körperzellen und enthalten deshalb all die Merkmale, die auch alle anderen Zellen unseres Körpers besitzen. Allerdings besitzen Neurone und Gliazellen darüber hinaus einige Eigenschaften, die einzigartig und nur für ihre Funktionen innerhalb des Nervensystems notwendig sind. Diese Eigenschaften werden im Folgenden erläutert.
1.1 Nervenzellen
Abbildung 1: Darstellung von Nervenzellen (aus Ris, 1899)
Anmerkungen: Jede Nervenzelle sieht anders aus und trotzdem sind sie alle gleich aufgebaut. Dies wird deutlich, wenn man sich diese Darstellung eines Teils des Vogelgehirns anschaut, die mit der Golgi-Methode erstellt wurde. Der aus dünnen Strichen gebildete dunkle Streifen am oberen Rand besteht aus Tausenden von Axonen von Neuronen der Retina, die an der Oberfläche des Gehirns entlanglaufen. An einem bestimmten Punkt knicken diese Axone vertikal nach unten ab und teilen sich in Dutzende Terminalien auf. Bei (1) sind viele dieser unterschiedlichen Axonterminalien dargestellt. Bei (2) sieht man Neurone, die sich mit ihren Dendriten horizontal ausbreiten. Die Nervenzelle bei (3) bildet mit ihren nach oben reichenden Dendriten eine buschige Schicht, während ihr Axon (Pfeil) nach unten zieht. Bei (4) ist ein Bipolarneuron abgebildet, dessen dendritische Verzweigungen sowohl nach oben als auch nach unten auswachsen.
Nervenzellen leisten die Informationsverarbeitung und Informationsweitergabe unseres Gehirns. Abhängig von ihrer genauen Funktion und der Lokalisation im Gehirn können sie sehr unterschiedlich aus|15|sehen (vgl. Abb. 1). Trotz dieser verschiedenen Formen sind die Funktionsmechanismen der Neurone immer nahezu gleich. Dies gilt nicht nur für Menschen, sondern für alle Tiere. Überall funktionieren Nervenzellen nach exakt den gleichen Prinzipien. Dies macht es möglich, die Mechanismen von Neuronen bei Schnecken oder Tintenfischen zu untersuchen und Schlussfolgerungen für das Nervensystem des Menschen zu ziehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Nervenzellen von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen, der vor fast einer Milliarde Jahren lebte. Zumindest ist das die Meinung der meisten Wissenschaftler. Allerdings gibt es alternative Ansichten, die davon ausgehen, dass Nervenzellen auf unserem Planeten mehrfach unabhängig voneinander entstanden sind (Moroz, 2009). Dies könnte bedeuten, dass es doch eine kleine Anzahl von Tiergruppen gibt, deren sensorische und motorische Verarbeitungsprinzipien sich von dem unterscheiden, was wir in diesem Buch besprechen werden (Moroz & Kohn, 2016). Diese Diskussion hält noch an.
Die Menschen hinter den Entdeckungen
Camillo Golgi
Camillo Golgi wurde am 7. Juli 1843 im Städtchen Corteno bei Brescia (Italien) geboren und starb am 21. Januar 1926 in Pavia. Er war Mediziner und Physiologe und wurde für seine Entdeckungen in der Anatomie des Nervensystems 1906 zusammen mit Santiago Ramón y Cajal mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Golgi studierte Medizin in Pavia und promovierte 1865 über Geisteskrankheiten. Danach wandte er sich der Neuroanatomie zu. Da er kaum Geld verdiente und die Karriereaussichten an der Universität sehr schlecht waren, ging er als Oberarzt an eine Klinik für chronisch Kranke nach Abbiategrasso. Die Klinik hatte keine sanitären Einrichtungen, war verfallen und ohne jeden Bezug zur Wissenschaft. Nach langem Drängen durfte er in seiner Freizeit einen Teil der Küche für Forschungen nutzen. Hier entwickelte er neue histologische Verfahren. Hier kam ihm auch die Idee, Silbernitrat zur Imprägnierung der Gewebeschnitte zu verwenden. Das Ergebnis war die heute nach ihm benannte Golgi-Technik, mit der einzelne Neurone mit all ihren Fortsätzen sichtbar werden, während die anderen Nervenzellen durchsichtig bleiben.
Mit diesem und weiteren histologischen Verfahren wurde Camillo Golgi zum Entdecker vieler struktureller Eigenschaften des Gehirns und seiner Zellen. 1881 kehrte Golgi als Professor an die Universität in Pavia zurück. Er erhielt neben dem Nobelpreis noch zahlreiche weitere bedeutende Ehrungen aus dem In- und Ausland. Er war der Hauptverfechter der Retikulum-Theorie, nach der alle Neuronen in einem großen Hirnnetz |16|verschmelzen. Golgi arbeitete bis zu seinem Tod jeden Tag im Labor. Er starb am 21. Januar 1926. Sein Denkmal steht heute im „Cortile della Salute“ der Universität Pavia.
Nervenzellen bestehen aus vier Hauptregionen: dem Soma, dem Axon, der Synapse und dem Dendriten. Diese werden im Folgenden dargestellt.
1.1.1 Das Soma
Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Neurons
Anmerkung: Der weitere Verlauf des nach unten laufenden Axons ist nicht dargestellt. Zahlreiche Dornen sind sowohl auf den Dendriten als auch auf dem Soma zu erkennen. Der Axonhügel ist die konische Ausstülpung des Somas, aus der das Axon entspringt. Rechts oben ist in schwarz das Axon eines anderen Neurons dargestellt, das mit einer Dorne eine Synapse bildet (mit gestrichelten Linien eingerahmt). Dieser Bereich wird im Rahmen vergrößert dargestellt. Die gepunkteten Pfeile geben die Richtung des Signaltransfers wieder, der von den Dendriten Richtung Soma und vom Soma Richtung Axon verläuft.
Ähnlich unserem Körper haben auch Nervenzellen ein Skelett. Man nennt es Cytoskelett. Da Nervenzellen ihre Form häufig ändern, wird auch das Cytoskelett ständig umgebaut und stabilisiert die vielen Verästelungen einer Nervenzelle. Entlang den Hohlzylindern des Cytoskeletts wandern ununterbrochen Eiweiße, Stoffwechselprodukte oder ganze Zellorgane innerhalb des Soma oder entlang der Dendriten (vgl. Kapitel 1.1.2) und der Axone (vgl. Kapitel 1.1.3) hin- und her (Theiss et al., 2005).
1.1.2 Der Dendrit
Ein Dendrit ist ein Fortsatz, der von einem Soma ausgeht. Neurone haben meist sehr viele Dendriten. Wenn man eine Nervenzelle flach ausbügeln würde, kämen bei den meisten Neuronen ungefähr 90 % ihrer Fläche auf die Dendriten. Das heißt, eigentlich besteht ein Neuron hauptsächlich aus Dendriten. Dies wird besonders deutlich, wenn man sich die Purkinjezellen des Kleinhirns anschaut (vgl. Abb. 3). Diese Neurone integrieren die einlaufenden Informationen und senden anschließend die motorischen Koordinierungsbefehle zu Strukturen außerhalb der Kleinhirnrinde. Die Dicke der Dendriten kann sehr unterschiedlich sein und über kurze Distanzen variieren. Meistens sind Dendriten dicker als Axone (vgl. Kapitel 1.1.3). In Abbildung 3, einer sehr schönen Zeichnung eines Purkinjeneurons, wird deutlich, wie groß der Anteil der Dendriten an der Gesamtzelle ist.
Die Menschen hinter den Entdeckungen
Santiago Felipe Ramón y Cajal wurde am 1. Mai 1852 in Petilla de Aragón bei Navarra (Spanien) geboren und starb 1934 in Madrid. Er war Mediziner und wurde für seine Entdeckungen in der Anatomie des Nervensystems 1906 zusammen mit Camillo Golgi mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
|18|Santiago Felipe Ramón y Cajal
Cajals Vater war ein Arzt mit Interesse für Sektionen. Cajal assistierte seinem Vater längere Zeit, wollte aber eigentlich Künstler werden und wurde nur durch Druck seines Vaters Arzt. Ab 1873 arbeitete Santiago Ramón y Cajal in Saragossa, promovierte 1877 in Madrid und bekam 1883 die Professur für Anatomie an der Universität Valencia. In dieser Zeit hatte er schon die Golgi-Technik kennengelernt und perfektionierte sie. Mit einer geradezu übermenschlichen Produktivität studierte er die Feinstruktur der Retina, des Gehirns und des Rückenmarks. Seine Arbeiten, die im Schnitt alle zwei Monate erschienen, waren Meisterwerke der präzisen Beobachtung und des intelligenten Schlussfolgerns. Cajal postulierte, dass Neurone eine Polarität besitzen und über ihre Dendriten Informationen aufnehmen und durch ihre Axone weitergeben. Er ging ferner davon aus, dass Synapsen sich durch Erfahrung ändern können und die tiefere Verarbeitung von Informationen durch kleine Netzwerke und lokale Verknüpfungen entsteht.
Santiago Ramón y Cajal gilt als der eigentliche Begründer der Hirnforschung. Weltweit sind viele Krankenhäuser, Forschungsinstitutionen und Preise nach ihm benannt. Seine Neuronendoktrin, nach der Neurone zwar mit ihren Synapsen funktionell in Netzwerke eingebettet sind, aber dennoch abgeschlossene Zellen bleiben, konnte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die Elektronenmikroskopie endgültig bewiesen werden. Er starb am 18. Oktober 1934 in Madrid, wo er seit 1892 als Professor tätig war.
Im Bereich der Synapsen befinden sich sehr viele Rezeptoren auf einem Dendriten. Werden diese durch ein Signal aus der Präsynapse aktiviert, entsteht ein elektrischer Erregungs- bzw. Hemmungsprozess (erregende und hemmende Neurotransmitter werden im Kapitel 3 besprochen), der sich in alle Richtungen auf dem Dendriten ausbreitet. So kann diese Spannungsänderung auch das Soma erreichen und Einfluss auf die Gesamtaktivität der Nervenzelle nehmen. Die Erregungs- oder Hemmungswelle ebbt auf den Dendriten mit der zurückgelegten Distanz ab und kann bei sehr langen Strecken sogar ganz verschwinden. Warum das so ist, wird ebenfalls in Kapitel 3 erläutert. Funktionell bedeutet diese Abnahme der dendritischen Spannungsänderung über Distanz, dass Dendriten in der Nähe des Somas ein großes Privileg genießen. Synaptische Eingänge auf diesen sogenannten basalen Dendriten nehmen einen großen Einfluss auf das Neuron, da die hier erzeugte Aktivierung kaum abgeklungen ist, wenn sie das Soma erreicht. Synapsen, die aber an den Spitzen der dendritischen Verzweigungen sitzen, sind so weit vom Soma entfernt, dass ihre Aktivierung auf dem |19|Weg zum Soma schon stark abgeklungen ist. Deshalb haben Synapsen an dendritischen Spitzen häufig nur modulatorischen Einfluss auf das Neuron.
Abbildung 3: Dendriten in einer Purkinjezelle (Zeichnung von Santiago Ramón y Cajal, aus Gray, 1918)
Anmerkungen: Neurone bestehen zum größten Teil aus ihren Dendritenbäumen. Dies wird bei dieser Purkinjezelle sehr deutlich. Purkinjezellen haben hochragende Dendriten (mit c gekennzeichnet), die mit Dornen übersät sind und bekommen damit Informationen von mehr als hunderttausend anderen Nervenzellen. Ihre Axone (a) verlassen das Soma unten, verzweigen sich kurz danach (b) und kontaktieren Nervenzellen der Kleinhirnkerne.
Modulatorischer Einfluss am Dendriten
Die Funktion des beschriebenen modulatorischen Einflusses soll an einem Beispiel erläutert werden. Nehmen wir an, Sie warten auf das charakteristische, aber leider sehr leise Geräusch, das entsteht, wenn |20|jemand die Haustür aufschließt. Sie konzentrieren sich intensiv auf Ihr Gehör, um dieses Geräusch nicht zu verpassen. Was passiert nun in diesem Augenblick in Ihrem Gehirn? Ihre hohe Konzentration bedeutet, dass die Nervenzellen, die ihre corticale Erregung regulieren, im Bereich Ihres auditorischen Systems die dendritischen Spitzen derjenigen Neurone aktivieren, die das Geräusch der Haustür verarbeiten werden. Da diese Spitzen vom Soma weit entfernt sind, reicht diese erhöhte Grundaktivität nicht aus, um das Neuron überschwellig zu erregen. Wenn aber das leise Geräusch der Haustür, das Sie normalerweise überhört hätten, die basalen Dendriten der Neurone in Ihrem Hörcortex erregt, kann die modulatorische Aktivierung an den dendritischen Spitzen (Ihre Erwartung des Geräusches der Haustür), kombiniert mit der schwachen Erregung der Basaldendriten (das leise Geräusch des Öffnens der Haustür), Ihre auditorische Nervenzelle überschwellig erregen: Plötzlich hören Sie, dass jemand ganz leise ins Haus kommt (Singer et al., 1977).
Abbildung 4: Schematische Darstellung von dendritischen Dornen
Anmerkungen: Dendritische Dornen (Spines) machen innerhalb von Minuten bzw. Stunden lernabhängige morphologische Veränderungen durch, die die Eigenschaften der synaptischen Verbindung erheblich beeinflussen können. Hier sind schematisch die gleichen Dornen vor (a) und nach einem Lernprozess (b) dargestellt. Der linke Dorn und damit die gesamte synaptische Verbindung wurden eliminiert. Der pilzförmige Dorn in der Mitte hat einen dickeren Stamm bekommen. Durch den somit reduzierten elektrischen Widerstand ist die Synapse effektiver. Der rechte Dorn wurde geteilt und bietet nun Platz für zwei Präsynapsen vom gleichen Axon. Die Effektivität ist somit erheblich größer.
Vor allem im Cortex und im Kleinhirn bilden Dendriten Tausende von kleinen Dornen (häufig auch Spines genannt) aus (vgl. Abb. 2). Dornen können wie kleine Fädchen, wie Pilze oder wie kleine Erhebungen aus|21|sehen (vgl. Abb. 4). Auf diesen Dornen befinden sich immer Synapsen mit Axonen anderer Nervenzellen. Abhängig vom Grad der Aktivität der Synapse können diese Dornen größer werden oder verschwinden. Die Formveränderung von Dornen passiert innerhalb weniger Minuten und hat einen Einfluss auf die Effektivität der Synapse. Wenn pilzförmige Dornen einen dickeren Stamm bekommen, sinkt der elektrische Widerstand, den die synaptische Erregung überwinden muss, um durch den Dornenstamm zum Dendriten zu gelangen. Dadurch bekommt diese Synapse eine höhere Wirkung auf das Neuron. Umgekehrt können Dornen ihren Stamm dünner machen, um die Effektivität einer Synapse zu reduzieren. Dornen können sich auch teilen, sodass mehrere Präsynapsen darauf Platz haben. Dies ist ein Teil der synaptischenPlastizität, von der in den folgenden Kapiteln die Rede sein wird und die die Grundlage unseres Lernens und unseres Gedächtnisses darstellt (Kasai et al., 2010). Wenn Sie dies hier aufmerksam gelesen haben, verändern in diesem Augenblick Millionen von Dornen Ihres Gehirns ihre Gestalt. Dadurch verändert sich die Effektivität der auf ihnen sitzenden Synapsen. In der Gesamtheit dieser somit veränderten Synapsen ist Ihr Gedächtnis für dieses Kapitel enthalten (Hayashi-Takagi et al., 2015). Ich habe hoffentlich gerade erfolgreich die Gestalt Ihres Gehirns verändert.
1.1.3 Das Axon
Vom Soma geht in der Regel ein einzelnes Axon ab. Ein Axon ist ein langer Zellfortsatz, der die Erregung des Neurons auf andere Nervenzellen überträgt. Immer dann, wenn die elektrische Erregung eines Neurons einen Schwellenwert überschreitet, wird an der Anfangsstelle des Axons ein kurzer elektrischer Impuls gebildet (Aktionspotenzial), der dann das Axon entlang weiterläuft. Axone haben häufig einen Durchmesser von nur ca. 1 µm und sind meist nur wenige Hundert Mikrometer oder Millimeter lang. Die Dicke der Axone ist über eine weite Distanz nahezu konstant. Teilweise durchziehen sie aber auch Strecken von über einem Meter. Bei großen Säugetieren wie Walen wachsen Axone auf Längen von bis zu 15 Metern. Trotz dieser langen Strecke nimmt die Stärke des entlang des Axons weitergeleiteten Erregungsimpulses nicht ab. Das ist ein wichtiger Unterschied zu Dendriten. Warum Axone die Stärke des Aktionspotenzials konstant halten können, wird im zweiten Kapitel erklärt. Wenn Axone lange Distanzen überwinden müssen, ist es wichtig, dass das weitergeleitete Signal nicht zu langsam wandert. Ansonsten könnte es z. B. passieren, dass wir erst mehrere Sekunden nachdem wir auf einen Nagel getreten sind merken würden, dass wir uns verletzt haben. Schnelle Reaktionen wären dann unmöglich.
|22|Die Geschwindigkeit der Signalweiterleitung eines Axons ist direkt proportional zu seinem Durchmesser. Je dicker ein Axon ist, desto schneller leitet es. Deshalb sind Axone, die lange Wege zurücklegen müssen, häufig ziemlich dick (Wang, 2008). Die Leitungsgeschwindigkeit kann noch weiter gesteigert werden, wenn das Axon mit Myelinscheiden umwickelt wird. Myelinscheiden sind Ausstülpungen von Gliazellen, die sich vielfach um Axone wickeln und diese elektrisch isolieren (vgl. Kapitel 2.2.3). Myelinisierte Axone von großem Durchmesser erreichen die größten Leitungsgeschwindigkeiten. Zum Beispiel sind die Axone, die das Rückenmark mit dem Kleinhirn des Menschen verbinden, ca. 400 km/h schnell (Grottel et al., 1999)! Mit wenigen Ausnahmen besitzen nur Axone Myelinscheiden.
Signalweiterleitung
Bei myelinisierten Axonen kann die Leitgeschwindigkeit mehrere Hundert Stundenkilometer betragen. Nicht myelinisierte Axone sind zwar langsam, nehmen aber weniger Platz weg.
Warum besitzt unser Gehirn überhaupt dünne, unmyelinisierte Axone, die sehr langsam leiten? Wäre es nicht besser, wenn alle Fasern schnell wären? Diese Frage kann man sehr einfach beantworten, wenn man sich die Axonzusammensetzung des Corpus callosums anschaut. Das Corpus callosum ist die größte Commissur des menschlichen Gehirns und verbindet die linke und die rechte Großhirnhälfte. Fast 500 Millionen Axone kreuzen über das Corpus callosum (Aboitiz & Montiel, 2003). Die allermeisten davon sind dünn und unmyelinisiert. Nur ein ganz kleiner Anteil der Fasern des callosums ist dick und myelinisiert. Diese schnellen Fasern verbinden vor allem die sensorischen und motorischen Areale des Großhirns, während die kognitiven Regionen der beiden Hirnhälften mit dünnen Axonen kommunizieren. Ein dickes, myelinisiertes Axon nimmt die Querfläche von 40 dünnen, unmyelinisierten Fasern ein (Lamantia & Rakic, 1990). Wenn alle Axone des Corpus callosums vom schnellen Typ wären, würde diese Commissur entweder nur wenige Fasern enthalten können (wenn die Commissur ihren Durchmesser nicht verändern dürfte) oder sie würde das gesamte Volumen unseres Schädels einnehmen (wenn die Commissur nach wie vor 500 Millionen Fasern enthalten müsste). Das bedeutet, dass die Zusammensetzung des Corpus callosums einen Kompromiss zwischen den Erfordernissen an Axonzahl und Geschwindigkeit darstellt. Die von der Natur gewählte Lösung besteht darin, dass die Hirnsysteme, die dringend auf schnelle Signalübermittlung angewiesen sind, eine kleine Anzahl von sehr dicken, myelinisierten Axonen besit|23|zen, während alle anderen Systeme mit langsamen, dünnen Fasern auskommen müssen. Das bedeutet, dass sensorische Informationen oder motorische Befehle in 2 bis 3 Millisekunden von einer Hirnhälfte in die andere übertragen werden können. Kognitive Informationen brauchen dafür 30 bis 80 Millisekunden (Ringo et al., 1994).
Sowohl myelinisierte als auch unmyelinisierte Axone verzweigen sich in ihrem Zielgebiet häufig in Tausende von kleineren Endstücken. An jedem einzelnen dieser Endstücke befinden sich Synapsen, mit denen das Signal auf das nächste Neuron übermittelt wird. Die Funktionsmechanismen von Synapsen werden im Kapitel 3 besprochen.
1.2 Gliazellen
Das Wort glia bedeutet im Griechischen „Leim“. Tatsächlich ging man lange davon aus, dass Gliazellen das Gehirn zusammenkleben bzw. stützen, sodass es seine Form behält. Das Stützen der Neurone ist aber nur eine ihrer vielen Funktionen (Allen & Barres, 2009). Welche weiteren Aufgaben dazukommen wird klar, wenn man sich die verschiedenen Gliazelltypen anschaut (vgl. Abb. 5). Alle Lebewesen mit einem Nervensystem besitzen Gliazellen. Aber mit der Größe und Komplexität von Gehirnen scheint sich ihr relativer Anteil an den Zellen des Gehirns zu erhöhen. So besitzt der winzige Fadenwurm Caenorhabditis elegans 302 Neurone, aber nur ungefähr ein Dutzend Gliazellen. 25 % der Zellen im Gehirn der Fruchtfliege sind Glia. Bei Mäusen beträgt diese Zahl 35 %, beim Menschen etwa 50 % und bei der Giraffe sogar 66 % (Herculano-Houzel et al., 2015).
Der häufigste Typus von Gliazelle ist die Mikroglia. Diese lösen tote oder sterbende Nervenzellen auf und verdauen die Reste. Die Mikroglia dient gleichzeitig der Immunabwehr des Gehirns und schützt somit das Nervensystem vor eindringenden Fremdkörpern. Die Mikroglia trägt somit die Hauptlast der internen Gesundheitskontrolle unseres Gehirns (Graeber, 2010).
Die größten Gliazellen unseres Gehirns heißen Astroglia (oder Astrocyten). Das Wort astron bedeutet im Griechischen „Stern“ und so sehen diese Zellen auch aus. Astrocyten haben eine große Bandbreite an Funktionen. Sie bilden z. B. eine Brücke zwischen den Neuronen und den Kapillaren der Blutversorgung. Über diese Astroglia-Brücke läuft die Versorgung der Nervenzellen mit Nährstoffen aus dem Blut und auch, in umgekehrter Richtung, die Entsorgung der Abfallstoffe der Neurone. Die Gesamtlänge der Kapillaren in unserem Gehirn beträgt |24|ca. 600 km und 99 % der Fläche dieser Kapillaren sind mit den Endfüßchen der Astrocyten bedeckt (Neuhaus et al., 1991). Astrocyten sondern Botenstoffe ab, die die Durchlässigkeit der Wandung der Kapillaren modulieren. Somit übernehmen diese Gliazellen eine entscheidende Rolle in der menschlichen Blut-Hirn-Schranke.
Abbildung 5: Gliatypen des Zentralnervensystems
Anmerkung: Oben ist eine Astroglia dargestellt, die mit ihren Fortsätzen eine Brücke zwischen einer Kapillare (am oberen Bildrand verlaufend) und einem Neuron (in hellgrau dargestellt) herstellt. Über diese Brücke wird das Neuron mit Nährstoffen versorgt. Gleichzeitig werden Abfallprodukte des neuronalen Stoffwechsels in die Kapillare entsorgt. Dieser bidirektionale Transport ist mit gepunkteten Doppelpfeilen dargestellt. Links unten im Bild befinden sich drei Mikrogliazellen, die die Immunabwehr des Gehirns realisieren und totes Gewebe verdauen. Rechts in der Mitte des Bildes befindet sich eine Oligodendrogliazelle. Mit ihren Fortsätzen umwickelt sie Teile des Axons des Neurons. Die frei bleibenden axonalen Bereiche werden von anderen Oligodendrogliazellen umwickelt.
Die zweite Funktion von Astrocyten ist es, das biochemische Milieu um die Nervenzellen konstant zu halten. Dies spielt besonders im Bereich der Synapsen eine wichtige Rolle, wo Astrocyten die Synapsen von der Umgebung isolieren und dadurch ein biochemisches Mikroklima schaffen, in das Neurotransmitter von benachbarten Synapsen nicht eindiffundieren können. Drittens werden Astrocyten ihrem Namen als „Leim“ gerecht, indem sie die Neurone in ihrer Position stabilisieren. Bei großen Hirnverletzungen wandern Astrocyten wie Amöben durch das Nervensystem, teilen sich millionenfach im Bereich der Läsion und füllen die entstandene Lücke aus (Renault-Mihara et al., 2008).
|25|Ein weiterer häufiger Typus von Gliazellen im Gehirn ist der Oligodendrocyt. Dieser bildet lange paddelförmige Fortsätze, die sich um die Axone der Nervenzellen wickeln. Diese Fortsätze bestehen aus Myelinscheiden, die die Axone schützen und die Signalübertragung erheblich beschleunigen (dies wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben werden). Nur eine Minderheit von Nervenzellen im Gehirn ist myelinisiert (besitzt also die Umwickelung ihrer Axone durch Oligodendrocyten).
Im peripheren Nervensystem (also außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks) sind die meisten Axone myelinisiert, da sie oft große Distanzen überbrücken müssen und deshalb ohne Myelinscheiden viel zu langsam wären. Diese Myelinscheiden des peripheren Nervensystems werden von engen Verwandten der Oligodendrocyten gebildet, den Schwann’schenZellen. Diese beiden Gliazelltypen sind nahezu identisch, unterscheiden sich aber in einem Punkt sehr deutlich: Die Schwann’schen Zellen können bei Verletzungen von Axonen das Nachwachsen von neuen axonalen Fortsätzen anregen. Darum können wir z. B. nach einer Armverletzung, bei der die peripheren Nerven verletzt wurden, nach einer Weile wieder die vorübergehend gelähmten Muskeln nutzen und auch wieder Berührungen empfinden (Taveggia et al., 2010).
Zusammenfassung
Das Gehirn besteht im Wesentlichen aus zwei Zelltypen: Nervenzellen (diese werden auch als Neurone bezeichnet) und Gliazellen. Neurone können extrem unterschiedlich aussehen, besitzen aber trotzdem fast immer die gleichen Grundkomponenten: Soma, Dendrit, Axon und Synapse. Das Soma ist der Zellkörper eines Neurons und beherbergt das Genom sowie viele Organellen, die den Stoffwechsel der Zelle gewährleisten. Mit den Dendriten nehmen Nervenzellen Informationen von anderen Neuronen auf. Neurone haben in der Regel viele Dendriten. Die dabei entstehende Erregung wandert den Dendriten bis zum Soma entlang, wobei die Erregung mit der Länge der Strecke an Stärke verliert. Dendriten besitzen häufig kleine Dornen, auf denen Synapsen von anderen Neuronen sitzen. Dornen können innerhalb weniger Minuten ihre Form und dadurch die Effizienz des synaptischen Kontaktes verändern. Dies ist ein wichtiger Baustein der neuralen Grundlage des Lernens und der Gedächtnisbildung.
Ein Neuron besitzt nur ein Axon. Wenn die Nervenzelle überschwellig erregt wird, entsteht eine abrupte Spannungsänderung, die als Aktionspotenzial das Axon mit großer Geschwindigkeit entlang läuft. Die Geschwindigkeit der Weiterleitung hängt davon ab, wie |26|dick das Axon ist und ob es myelinisiert ist. Das Aktionspotenzial wird nicht kleiner, egal wie lang das Axon ist. Axone teilen sich im Zielgebiet in Hunderte oder Tausende von Terminalien, an deren Ende sich Synapsen befinden.
Eine Synapse ist eine Kontaktstelle zwischen zwei Neuronen. Die Präsynapse wird vom Axon gebildet und enthält zumeist Vesikel mit Neurotransmittern, die sich beim Eintreffen eines Aktionspotenzials in den synaptischen Spalt entleeren und zur Postsynapse diffundieren. Wenn die Transmittermoleküle dort an die Rezeptoren binden, kommt es zu einer Spannungsänderung auf der Seite der Postsynapse. Dadurch kann der Impuls von einem Neuron an das nächste weitergegeben werden.
Die Hälfte der Zellen unseres Gehirns sind nicht Neurone, sondern Gliazellen. Es gibt verschiedene Typen von Gliazellen (Mikroglia, Astroglia, Oligodendroglia, Schwann’sche Zellen), die sehr unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die Immunabwehr des Gehirns, die Ernährung und biochemische Abschirmung von Neuronen sowie das Bilden von Myelinhüllen um schnellleitende Axone.
Fragen
Benennen Sie die Hauptbestandteile einer Nervenzelle.
Welche Gliazelltypen gibt es und welche Funktionen haben sie?
Welche Eigenschaften bestimmen die Geschwindigkeit der Signalweiterleitung entlang eines Axons?
Was ist der Unterschied zwischen der Signalweiterleitung entlang eines Dendriten und eines Axons?
Was passiert, wenn ein Aktionspotenzial in eine Präsynapse einläuft?
Was ist ein dendritischer Dorn?
Wieso haben wir in unserem Gehirn so viele langsam leitende Axone, wenn doch schnell leitende viel effizienter wären?
Lösungshinweise finden Sie unter www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus
|27|Kapitel 2Die Funktionsmechanismen von Nervenzellen
|28|Das Examen war endlich geschafft und Shinichi hatte das Gefühl, dass heute etwas Besonderes passieren musste, um den Tag würdig zu Ende zu bringen. Also lud er seine Freundin Yokota in ein Fugu-Restaurant ein. Fugu ist ein Kugelfisch, der sehr giftig ist und in Japan nur in speziell lizenzierten Restaurants serviert wird. Die Köche sind trainiert, das Fleisch des Fisches vorsichtig herauszutrennen, sodass es nicht mit dem hochkonzentrierten Gift der Haut und der inneren Organe in Berührung kommt. Auch das Fleisch ist giftig, aber die Dosis in den Muskeln ist so gering, dass man es nur als Brennen im Mund verspürt. Wegen strenger Kontrollen sind Todesfälle nur selten.
Das Menü für beide sollte umgerechnet über 200 Euro kosten, aber das war es Shinichi wert. Bald kam der Teller mit hauchfein geschnittenem Fugu auf den Tisch. Yokota hatte etwas Angst, wollte ihm aber nicht den Abend verderben. Schon beim ersten Biss verspürten sie das Prickeln auf den Lippen und das Brennen im Mund. Die Stimmung war ausgelassen. Shinichi hatte immer auf sicher gelebt und nun genoss er die leichte Gefahr. Nach einer halben Stunde lallten sie ein bisschen, weil die Zunge steif und gefühllos wurde. Das war wahrscheinlich der Schnaps, aber eigentlich hatte Yokota bei dem bisschen, das sie wog, vorsichtshalber nur wenig getrunken. Nach dem Essen fuhren sie mit dem Taxi nach Hause. Dort angekommen, konnte Shinichi die Münzen nicht mehr aus dem Portmonee greifen und drängte dem Fahrer einen zu großen Geldschein auf. Im Wohnzimmer wankte Yokota, fiel plötzlich hin und erbrach sich. Shinichi wollte zu ihr hin, aber auch seine Beine waren plötzlich gelähmt. Er schwitzte und merkte, wie viel Anstrengung ihn das Atmen kostete. Kriechend erreichte er das Telefon und berichtete einem Arzt, dass sie eine Fugu-Vergiftung hätten. Dann wurde er bewegungslos und konzentrierte sich ganz auf das Atmen. Eine tonnenschwere Last lag auf seiner Brust und es kostete übermenschliche Kraft, die Atemmuskulatur zu bewegen. Bei vollem Bewusstsein wurde ihm klar, dass er diese Kraft bald nicht mehr aufbringen konnte. Dann würde er seinen eigenen Erstickungstod in allen Details erleben. Hätte er die Kraft zum Weinen gehabt, er wäre wohl in Tränen ausgebrochen über das grausame Schicksal. Sein Leben lang hatte er alle Risiken vermieden. Und nun tötete ihn eine scheinbar harmlose Extravaganz. Plötzlich hörte er, wie die Tür aufgebrochen wurde und die Sanitäter hereinstürmten. Er wurde an ein Atemgerät angeschlossen und heraustransportiert.
Zwei Tage später war er schlapp, aber weitestgehend normal. Der Arzt erklärte ihm, dass das Gift ein ganz kleines Molekül namens Tetrodotoxin war, das die Natrium-Kanäle seiner Nervenzellen verschließt. Er sagte, dass Nervenzellen elektrisch arbeiten und dass dafür elektrisch geladene Atome ständig die Außenhülle der Zelle durch spezielle Poren pas|29|sieren müssten. Das Natrium-Ion war eines dieser Atome. Ohne das Eindringen von Natrium durch spezielle Kanäle in das Neuron waren Nervenzellen nicht aktivierbar. Ein kleines Molekül, das eine winzige Öffnung in der Außenhaut von Nervenzellen verschließen konnte, hätte ihn also beinahe getötet, und seiner Freundin Yokota hatte es das Leben geraubt.
Nervenzellen kommunizieren über Aktionspotenziale, also kurze elektrische Impulse, die das Axon entlang wandern, bis sie eine Synapse am Ende des Axons erreichen. Aktionspotenziale sind die Träger der Information im Nervensystem. Durchschnittlich befinden sich auf der Außenhülle einer Nervenzelle in unserem Cortex etwa 20.000 Synapsen, die mit anderen Neuronen verbunden sind (Braitenberg & Schüz, 1998). Wenn jede dieser anderen Zellen ungefähr zweimal in der Sekunde ein Aktionspotenzial generiert, bekommt das empfangende Cortexneuron ungefähr 40.000 synaptische Aktivierungen pro Sekunde. Dies ist wahrscheinlich sogar eine eher konservative Schätzung. Das bedeutet, dass Neurone ununterbrochen mit Aktionspotenzialen bombardiert werden. Da unser Beispielneuron aus dem Cortex selber vielleicht nur zweimal pro Sekunde ein Aktionspotenzial erzeugt, bedeutet dies, dass es durchschnittlich sehr viele Aktionspotenziale erhalten muss, um selber ein Aktionspotenzial auszulösen. Die Art und Weise, wie Nervenzellen einkommende synaptische Signale verrechnen, bis sie selber ein Aktionspotenzial erzeugen, ist der Schlüssel zum Verständnis aller Basisfunktionen des Gehirns. Diese Verrechnungsleistung eines einzelnen Neurons hängt von vielen Faktoren ab und kann durch Lernprozesse verändert werden. Das bedeutet, dass Erfahrungen, die das Individuum macht, darüber bestimmen, ob ein Neuron auf bestimmte synaptische Eingänge mit einem Aktionspotenzial reagiert oder nicht.
Warum das so ist, wollen wir in Kapitel 3 genauer kennenlernen. Dazu müssen wir in diesem Kapitel aber zuerst einmal lernen, dass die neuronale Zellmembran, also die das Neuron umgebende Hülle, eine elektrische Spannung aufweist: das Membranpotenzial. Die Entstehung des Membranpotenzials ist einfach zu verstehen, wenn man die zwei gegensätzlichen Kräfte kennenlernt, die zu seiner Entstehung beitragen: der Konzentrationsgradient sowie die elektrostatische Kraft. Wir wollen also im Folgenden diese zwei Faktoren behandeln. Zuerst müssen wir aber die Schlüsselakteure dieses Spiels vorstellen, nämlich die Ionen und die Ionenkanäle, durch die die Ionen durch die Zellmembran wandern können.
|30|2.1 Die Entstehung des neuronalen Signals
2.1.1 Die Ionen innerhalb und außerhalb der Zelle
Ionen sind elektrisch geladene Atome oder Moleküle. Sie sind durch Elektronenmangel positiv oder durch Elektronenüberschuss negativ geladen. Salz (NaCl) z. B. besteht aus den zwei positiv bzw. negativ geladenen Ionen Natrium (Na+) und Chlorid (Cl–), die durch ihre gegensätzliche Ladung elektrisch angezogen werden und somit das Salzmolekül bilden. Wird ein Teelöffel Salz in ein Glas Wasser verrührt, löst es sich sehr schnell auf. Dadurch trennt sich das positiv geladene Na+-Atom vom negativ geladenen Cl–-Atom. Beide Ionen sind für die Funktion von Nervenzellen sehr wichtig. Ein drittes Ion, das für die elektrische Aktivität von Neuronen eine wichtige Rolle spielt, ist das positiv geladene Kalium (K+). Ein vierter für die Physiologie von Neuronen wichtiger Faktor sind große Eiweiße, die sich im Inneren der Zelle befinden und eine negative elektrische Ladung aufweisen. Diese Eiweiße können die Zelle nicht verlassen und ihre negative Ladung erzeugt somit einen Überschuss an Elektronen im Intrazellulärraum. Diese Ungleichverteilung von elektrisch geladenen Partikeln zwischen dem Intra- und dem Extrazellulärraum gilt auch für Na+, Cl– und K+. Zum Beispiel gibt es mehr Na+-Ionen außerhalb der Zelle als innen. Normalerweise würde Na+ so lange in die Zelle einwandern, bis der Häufigkeitsunterschied ausgeglichen wäre. Das kann Na+ aber nicht ohne Weiteres, da das Neuron sich mit einer Hülle umgibt, die als Barriere wirkt. Diese Hülle ist die neuronale Zellmembran (vgl. Abb. 6).
Membranpotenzial
Das Membranpotenzial ist die elektrische Spannung auf der Außenhülle eines Neurons. Es wird durch negativ geladene Eiweiße im Zellinneren sowie die ungleiche Verteilung von Na+-, Cl–- und K+-Ionen erzeugt und beträgt im Ruhezustand ca. –68 mV (vgl. Kapitel 2.1.5).





























