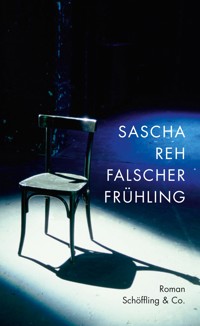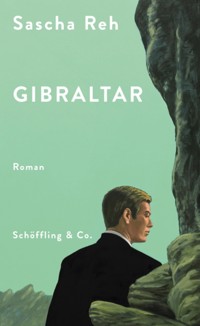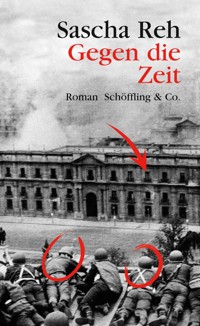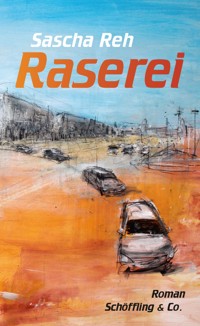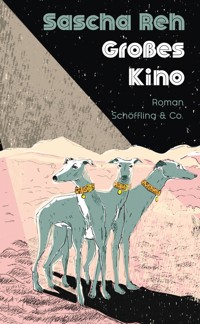19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein packender Roman über eine Familie zwischen individueller Freiheit, zukunftsfähiger Gesellschaft und Profit. Ein eigenartiger Zufall, dass ausgerechnet Malu Jacobsen damit beauftragt wird, die Menschenrechtslage in Biotopia, der hochmodernen Vertikalfarm auf dem Tempelhofer Feld, zu untersuchen. Denn hier lebt ihre Tochter Golda, die sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, den Traum von der gemeinwohlorientierten Agrarproduktion. Biotopia versorgt seit den 2020er Jahren ganz Berlin mit ökologisch produzierten Lebensmitteln, und doch ist sich Malu sicher: Die Farm ist nicht nur der hippe Gemeinschaftsgarten, wie es auf den ersten Blick und in den Instagram-Reels scheint. Schließlich halten sich seit Jahren hartnäckig Gerüchte, hier würden Geflüchtete und Staatenlose gegen ihren Willen als unbezahlte Arbeitskräfte festgehalten. Welche Rolle spielen dabei die Betreiberfirma Sulaco oder der Tech-Konzern Ping, dessen digitaler Assistent Watson mittlerweile allgegenwärtig ist? Als Malus Nachforschungen immer deutlicher ihre Tochter Golda belasten, wird ihr klar, dass ihre Mission in Biotopia womöglich nicht die der Aufklärung ist ... In einem spannungsgeladenen dystopischen Szenario denkt Sascha Reh Entwicklungen unserer Gegenwart und die Auswirkungen der technologischen Fremdsteuerung auf den einzelnen Menschen konsequent zu Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sascha Reh
BIOTOPIA
Roman
Schöffling & Co.
Inhalt
Motto
Erster Teil: Slave City
1 Das Essen
2 Die Störung
3 Das Feld
4 Der Fall
5 Der Senat
6 Der Partner
7 Der Hub
8 Die Gegnerin
Zweiter Teil: Sonderverwaltungszone
9 Die Suche
10 Die Intrige
11 Der Freund
12 Der Sohn
13 Die Opfer
14 Die Verteidigung
15 Der Sprecher
16 Die Abholung
Dritter Teil: Farm
17 Der Aufbruch
18 Der See
19 Die Kolonie
20 Das Fest
21 Die Tochter
22 Der Weg
23 Der Bunker
24 Der Zug
Vierter Teil: Biotopia
25 Die Nähe
26 Das Versprechen
27 Die Verhaftung
28 Die Beratung
29 Der Komplize
30 Die Vergangenheit
31 Die Gegenwart
32 Die Zukunft
Wir werden Unsterblichkeit erreichen um den Preis des Lebens.
Byung-Chul Han
Erster Teil: Slave City
1 Das Essen
Natürlich hatte Malu von der Störung gehört, immerhin war sie der Grund, weswegen die letzte Lieferung der Farm ausgeblieben war und sie das geplante Abendessen eine Nummer kleiner ausfallen lassen musste. Absagen kam nicht infrage, es war schließlich ihr Freitag; der Wein war kalt gestellt, und Idi hatte aus den Lebensmitteln, die noch im Schrank waren, ein paar Kanapees gezaubert.
Sie hatte vorgehabt, Watsons Newsticker den ganzen Abend ausgeschaltet zu lassen, doch ihr wurde schnell klar, dass das angesichts der Ereignisse unrealistisch war. Nach der Rauchsäule, die sie bei Sonnenuntergang am Himmel gesehen hatte, war es erleichternd gewesen zu hören, dass die Ursache lediglich ein technischer Zwischenfall in einer der Vertikalfarmen gewesen sein sollte, der umgehend behoben werde. Aber sie wusste, dass die Sache von einem anderen Benutzerprofil aus ganz anders klingen konnte.
»Ich habe gehört, es kommen jetzt Leute raus«, sagte Vanessa. Malu bemerkte, wie Niklas angesichts ihrer Sensationslust unruhig auf seinem Barhocker nach vorn rutschte und sein halbvolles Glas abermals füllte.
Vanessa sprach unbeirrt weiter. »Watson!« Das akustische Signal zeigte an, dass er ihre Stimme erkannt und ihren Account freigeschaltet hatte.
»Ich weiß nicht, ob Malu das recht ist«, versuchte Niklas leise einzuwenden, so als würde Malu es nicht mitbekommen, wenn er nur die Stimme genug senkte.
»Aber sie muss das doch auch wissen«, beharrte Vanessa und wies Watson an, die neuesten Meldungen zusammenzustellen. »Gerade sie!«
Malu nahm die Servierteller aus dem Kühlschrank und tat so, als würden die beiden sich nicht in ihrer Anwesenheit über sie unterhalten. Eine Möwe kreischte. Sie hatte die Leinwände des Landschaftssimulators heruntergelassen und Cornwall eingestellt, mit gleichbleibender Abendröte und tosender Brandung jenseits der schroffen Klippen – strömungsmechanisch total übertrieben, aber eindrucksvoll.
Watson öffnete einen Bildrahmen zwischen den Wolken. Vor den Toren des Tempelhofer Feldes hatten Freiwillige ein improvisiertes Erstversorgungszelt errichtet, mit Decken und Thermoskannen und einem Topf Suppe. Die Temperatur war in den letzten Nächten bereits unter null gefallen. Die Bilder zeigten bangende und in Solidarität geeinte Gesichter; die anrührende Musik, die Watson unterlegte, ließ keinen Zweifel daran, dass denjenigen, die Biotopia verlassen wollten, ein warmer Empfang bereitet würde.
»Lasst uns essen«, sagte Malu. »Auch wenn es leider kein frisches Gemüse gibt. Aber Idi hat ein paar Dips gemacht.«
»Wieder dieses köstliche Hummus?«
»Ja, und irgendwas aus Linsen und Bohnen, das aussieht wie …« Malu stellte die Schale auf den Tresen und nahm das Wachstuch herunter. Die Masse duftete nach Thymian und Zitrone, war aber von einer Farbe und Konsistenz, die sie von einer näheren Beschreibung absehen ließen.
Vanessa konnte es nicht lassen. »Watson, kannst du ein paar Bilder von drinnen zeigen? Drohnenaufnahmen oder so was?«
»Es sind leider keine Drohnenaufnahmen verfügbar«, sagte Watson. Vanessa war enttäuscht und drängte Niklas, sich seinerseits einzuloggen. Malu ahnte, dass auch Niklas keine Freigabe für Drohnenbilder hatte. Sie alle verfügten über solide Rücklagen aus ihren früheren Beschäftigungen und verdienten sich hier und dort sogar ein kleines Zubrot – Vanessa gab Geigenstunden, Niklas Kurse in fraktalem Holzschnitt –, doch die Auswahl an medialen Informationen, zu denen sie Zugang hatten, war beschränkt.
Niklas wehrte ab. »Ich will jetzt keine Nachrichten. Wir wollen Wein trinken und Kanapees essen!«
»Du trinkst doch schon. Willst du nicht wissen, was da auf uns zukommt?«
»Wenn du mich so fragst … nein.«
Schließlich gab er doch nach. Gemäß seiner Präferenzen präsentierte Watson die Explosion, die der Rauchsäule vorausgegangen war, aufgezeichnet mit wackligen Bildern von Anwohnern, die er mit einem selbstgenerierten Kommentar versah, angelehnt an den nüchternen Sprachgestus eines Nachrichtensprechers: Einsatzkräfte der Sicherheitsfirma Konterbauer zögen sich vor den Zufahrten zusammen, Drohnen platzierten medizinische Ausrüstung im Innenhof des ehemaligen Abfertigungsgebäudes. Ein verletzter Sicherheitsmann mit einem blutigen Verband um den Kopf wurde gezeigt. »Beobachterinnen befürchten, dass es auf dem Gelände von Biotopia unter spirituellen Anhängern des geistigen Führers Ambrosius van Aa zu einem Massenselbstmord kommen könnte wie zuletzt in …«
»Genug, Watson!« Niklas schrie beinahe, er wirkte geschockt. »Malu, es tut mir leid, ich wusste, dass das eine ganz beschissene … Das muss ja jetzt schrecklich für dich sein.«
Malu stellte Teller und Besteck auf dem Tresen ab. Sie war ganz ruhig. Statt zu antworten, rief sie nun selber Watson auf. Das akustische Signal ertönte. »Watson, was muss ich über Biotopia wissen, Stand jetzt?«
Watsons Bericht – nüchtern und sachlich, wie sie es am liebsten hatte – beschränkte sich auf die Stellungnahmen der drei für Biotopia verantwortlichen Parteien: der Betreiberfirma Sulaco, des Sicherheitsdienstes Konterbauer sowie des Berliner Senats für Wirtschaft und Soziales, der die Aufsicht über Biotopia hatte. Ihre jeweiligen Kommentare waren kurz und wolkig und nichtssagend. Man beschränkte sich auf die Definitionsfrage, ob es sich um eine technische Betriebsstörung oder einen Störfall handle, was hinsichtlich der Haftungsfrage vielleicht bedeutsam, aber auch ziemlich langweilig klang.
»Danke, Watson. Ich denke, das reicht.« Watson gab dem südenglischen Abend wieder seinen Himmel zurück. Malu wandte sich an ihre beiden Gäste.
»So viel zu Watsons Dreifaltigkeit. Immerhin wissen wir jetzt, dass wir nichts wissen.« Sie zwang sich zu einem Lächeln und hob ihr Glas. »Darauf trinke ich.«
»Ich bewundere, dass du so ruhig bleiben kannst, Malu. Wirklich.«
»Ist ja gut jetzt, Vanessa«, sagte Niklas.
»Ich glaube nicht an diesen Slave-City-Mist. Und an einen Bombenanschlag von Fanatikern glaube ich auch nicht. Wie schmeckt euch der Wein?«
Alle tranken pflichtschuldig bis bereitwillig.
»Diese Frau vom Senat«, sagte Vanessa. »Sander. Warst du nicht mit der auf der Uni?«
»Ja, Elena. Die habe ich ewig nicht mehr gesehen.«
Vanessa schien die Sache keine Ruhe zu lassen. »Die weiß doch bestimmt, was da vor sich geht. Willst du die nicht mal …«
»Warum kannst du nicht endlich Ruhe geben damit«, sagte Niklas.
»Ihr könnt von Glück reden, dass ihr nicht mehr zusammen seid«, sagte Malu.
»Wo ist eigentlich Konrad?« Niklas versuchte verzweifelt, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. »Hat er noch diesen Haartick?«
»Darüber möchte ich lieber nicht reden.« Malus Sohn rasierte sich seit ein paar Monaten sämtliche Haare inklusive der Augenbrauen. Er sah aus wie ein Alien, war aber nicht von der Überzeugung abzubringen, dass er damit einen Trend ins Leben rief, dem in Kürze alle hinterherlaufen würden. Er war seit drei Tagen volljährig. Schon an seinem Geburtstag hatte er versucht, im Kaleidoskop eingelassen zu werden, dem angesagtesten Club der Stadt, dem Club mit der härtesten Tür. Er war abgewiesen worden. Trotzdem war er die ganze Nacht weggeblieben und am Morgen zugedröhnt nach Hause gekommen. Den ganzen nächsten Tag war er in seinem Zimmer geblieben und hatte geschlafen. Offenbar nahm er heute Abend Anlauf für einen weiteren Versuch.
Es blieben genügend andere Themen. Niklas erzählte von einer neuen Ausstellung im Gropiusbau, in der es keine Exponate gab. Gar keine.
»Genau genommen sind die Besucher die Exponate.«
Malu verstand es so, dass die Besucher sich gegenseitig betrachten und dabei kontemplative Erlebnisse haben sollten. Niklas erzählte ausgiebig von einer sehr eleganten Frau mit einem Kind, die beide in Zeichensprache miteinander kommunizierten. Außerdem sei da dieser Bodybuilder mit dem Muscleshirt aus Spitze gewesen. Und die offenbar bewusstlose Person in dem selbstfahrenden Rollstuhl. Niklas war begeistert vom »Minimalismus« des kuratorischen Ansatzes.
»Ich wurde auch rezipiert«, fügte er hinzu.
»Es hat wohl keinen Sinn zu fragen, welche Bedeutung du dir zuschreiben würdest?«, fragte Malu.
»Das Konzept ist von irgendeinem Kollektiv«, sagte Niklas.
Vanessa hatte kürzlich ihre erste Demissionsberatung gehabt. Sie war weniger eingeschüchtert als vielmehr beeindruckt von dem geräumigen, nobel eingerichteten Büro, in dem sie dazu überredet werden sollte, vorzeitig »den goldenen Löffel abzugeben«, wie sie es nannte.
»Den schwarzen Humor kannst du dir nur leisten, weil sie noch nicht ernst machen«, sagte Niklas.
»Ich wundere mich sowieso, dass da noch richtige Menschen sitzen«, sagte Malu. »Ist das eigentlich ein Ausbildungsberuf? Demissionsberaterin?«
»Es ist eine zertifizierte Weiterbildung«, sagte Vanessa ernst.
»Watson könnte das sicher genauso gut«, sagte Niklas.
»Es gibt extra Institute dafür«, sagte Vanessa.
»Kann sein«, sagte Malu und goss sich Wein nach, »aber sich von einem Computer, der nie gelebt hat, zum Sterben überreden zu lassen, ist infam.«
»Was den Tod angeht«, sagte Niklas, »schwätzen wir doch alle daher wie Männer von der Steißgeburt, egal ob Mensch oder Maschine.«
»Ist das ein originaler Satz von dir?«
»Und zweitens«, sagte Niklas, indem er Vanessa ignorierte, »was heißt überhaupt infam?«
Das weinselige Geplänkel konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die schweren Themen so wenig verschwanden, wie die Sonne über Cornwall unterging. Als Malu die dritte Flasche öffnete, war sie der Brandung überdrüssig und bat Watson, einen menschenleeren Petersplatz zu generieren, lediglich beleuchtet von Tausenden Kerzen.
»Am Petersplatz gibt es elektrische Kandelaber«, sagte Watson.
»Ich mag lieber Kerzen.«
»Das ungleichmäßige Flackern so vieler Kerzen erfordert außergewöhnlich viel Rechenkapazität. Dein Konto wird mit drei zusätzlichen Kreditpunkten belastet.«
»Mir egal.«
Sie spürte bereits eine gewisse gedankliche Schwere, um nicht zu sagen den Vorgeschmack morgendlichen Kopfschmerzes, als Watson einen Anruf meldete. Es war kurz vor neun, nicht spät, aber doch eine Zeit, zu der sie niemals Anrufe erhielt.
»Es ist Elena Sander«, sagte Watson. Niklas und Vanessa drehten in perfekter Choreografie die Köpfe. Vanessa bedeutete ihr mit weit aufgerissenen Augen, das Gespräch sofort anzunehmen und sie mithören zu lassen.
Malu fühlte sich überrumpelt. »Watson, leg sie nach nebenan.«
Sie ging ins Schlafzimmer und schloss die Tür. Auf dem Bildschirm, der bis eben im dreiminütigen Wechsel Mondrians querformatige Werke gezeigt hatte, erschien Elena. Sie saß an einem offiziell aussehenden Arbeitsplatz und sah aus, als würde sie noch immer mindestens dreimal die Woche Sport machen. Irgendwas war mit ihrem Gesicht; vielleicht ein Filter, der die vergangenen Jahre verbarg und dabei ein wenig das Maß verloren hatte.
»Malu! Hier ist Elena. Erinnerst du dich? Eli? Von vor hundert Jahren?«
»Ja, verrückt: Wir haben gerade von dir gesprochen.«
»Ah, du hast Besuch. Ich störe bestimmt!«
»Ja … nein. Alles bestens.«
»Geht’s dir gut?«
»Schon.«
»Freut mich sehr, wirklich! Vielen in unserem Alter geht’s nicht gut.« Der Klang ihrer Stimme reichte, um Malu eine vertraute Wärme spüren zu lassen. Das war Elena, eine ältere Version zwar, aber dieser verschmitzte, selbstgewisse Zug um die Augen, wenn sie lächelte, war doch vollkommen unverändert, so als sei kaum Zeit vergangen, und als komme es darauf im übrigen auch gar nicht an.
»Ich mach’s kurz. Kommt dir bestimmt komisch vor, wenn ich nach so langer Zeit direkt lospoltere. Aber vielleicht hast du davon gehört, was in Biotopia los ist.«
»Na ja. Ich habe gehört, dass etwas los ist. Aber ich weiß nicht, was.«
»Da geht’s dir wie mir.«
»Wie denn das?«
Kurzes Schweigen. »Längere Geschichte.«
»Ich habe …«
»Ich weiß, ich weiß, du hast keine Zeit. Es tut mir echt leid, dass ich dich damit überfalle. Es ist nur so, Malu: ich brauche jemanden, um ein Audit zu machen. Noch heute.«
»Ein Audit? In Biotopia?« Malu spürte, wie sich ihr Puls beschleunigte. »Aber … ich bin seit fünfzehn Jahren raus aus dem …« Geschäft, wollte sie sagen. Genau aus diesem Grund war sie damals ausgestiegen: weil sie ihre Arbeit nicht als Geschäft betreiben wollte. Und daran hatte sich bis heute nichts geändert. Kein Grund also, wieder damit anzufangen.
»Dreizehn Jahre«, korrigierte Elena sie.
»Wieso denn ich, um Himmels willen?«
»Wir brauchen jemanden, der uns nicht zu nahe steht. Jemand mit einem gewissen Ruf, was die … professionelle Unabhängigkeit angeht.«
Malu räusperte sich und richtete den verrutschten Kragen ihrer Bluse. »Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber aus meinem letzten Job haben sie mich rausgekantet.«
»Ja. Deswegen wollen wir dich ja.« Elena ließ eine Pause eintreten. Malu sagte nichts. »Du warst ganz klar im Recht damals. Aber für das Ministerium warst du die Fliege im Honig. Eine richtige Korinthenkackerin.«
»Sehr schmeichelhaft.«
Es war nicht als Beleidigung gemeint gewesen. Elena sprach mit ihr wie mit einer Freundin; sie musste Malu nicht von ihrer Wertschätzung überzeugen. Aber es waren immerhin mehr als zwei Jahrzehnte vergangen, seit sie sich das letzte Mal gesehen hatten, nur unterbrochen durch kurze Geburtstagsgrüße und die gegenseitigen Beteuerungen, sich auf jeden Fall mal wieder zu treffen, sobald ein bisschen weniger los sei. Deswegen hielt Elena es jetzt offenbar für ratsam, lieber doch auf Nummer sicher zu gehen.
»Ich habe das nie gedacht. Aus meiner Sicht hast du einfach deinen Job gemacht.«
»Ich kann nicht.« Malu versuchte, es endgültig klingen zu lassen, bemerkte aber sofort, dass ihr das nicht ganz gelang. Nur eine kleine Unsicherheit, aber eine Lücke, in die Elena sofort hineinstieß.
»Warum nicht?«
Sie suchte nach einem überzeugenden Grund, fand aber nur einen Vorwand. »Ich habe getrunken.«
»Dann schlaf dich aus. Ich schicke dir morgen früh um sieben einen Kopter.«
An Schlaf war allerdings nicht zu denken. Nachdem sie die zudringlichen Fragen Vanessas abgewehrt und die beiden nach Hause geschickt hatte, um sie auf nächsten Freitag zu vertrösten – nicht ohne Vanessa schwören zu müssen, diesem »Wink des Schicksals« unbedingt zu folgen –, suchte sie mit Unterstützung des restlichen Weins verbissen nach einem Grund, Elenas Offerte doch noch abzusagen. Aber ihr Herz hämmerte wie verrückt bei dem Gedanken, exklusiven Zugang zu der Farm zu erhalten, nach all den Jahren, in denen sie diesen Gedanken als aussichtslos verdrängt hatte. Sie tigerte aufgeregt und ziellos von einem Zimmer ins andere, ohne sich auf irgendetwas fokussieren zu können.
Sie ließ sich von Watson verfügbares Material aus den letzten zwanzig Jahren Biotopia zusammenstellen, und noch um drei saß sie – der Wein war längst alle – mit halb geschlossenen Augen vor dem Bildschirm und sah sich altes Werbematerial von Sulaco an.
Sie erinnerte sich noch gut an das Erscheinen dieser Videos auf Instagram und YouTube. Sie waren Teil einer Imagekampagne nach den Coronajahren gewesen, denen schleichend die völlige Abschottung von Biotopia gefolgt war. Van Aa, zu dieser Zeit bereits weniger Start-up-Unternehmer als Lichtgestalt, war mit großem Tamtam in die Farm eingezogen, nachdem er jahrelang als Ökoprophet um die Welt gereist war, um für das Franchise – denn das war Biotopia – weitere Investoren anzufüttern und vergleichbare, wenn auch weitaus kleinere Ableger in Island und Indonesien zu gründen. Er war noch keine 25, charmant und blitzgescheit, ohne auch nur im Ansatz arrogant zu wirken. Es gab damals viele junge CEOs mehr oder weniger erfolgreicher Start-ups, für die Berlin die Hauptstadt Europas war, und sie alle beherrschten – mehr oder weniger – die Kunst der federnden Schritte und Sätze. Bei den meisten schimmerte früher oder später der Ehrgeiz durch, den sie gebraucht hatten, um so weit zu kommen, und von dort war es nur noch ein kleiner Schritt zu genau jener Karrieregeilheit, von der ihre betonte Lockerheit nur ablenken sollte. Bei van Aa war davon nichts zu spüren. Er sprach über Biotopia, das damals noch The Green Ark hieß, mit so unverstellt wirkender Begeisterung, dass man sich weder missioniert noch als Teil einer Werbemaschinerie fühlte. Und nun hatte er vor laufenden Kameras die Kameras hinter sich gelassen und wollte als Gleicher unter Gleichen leben, mit all den Entbehrungen, die er ein ums andere Mal als den wahren Fortschritt gepredigt hatte: Arbeit, Sesshaftigkeit und mediale Askese.
In den ersten Videos trugen die Produzenten noch blitzsaubere Overalls mit dem Sulaco-Emblem. Kopf, Mund und Nase wurden von einer Kapuze mit Atemschutz bedeckt. Auf Malu hatte das schon damals einen eher entmenschlichenden Eindruck gemacht, auch wenn die Pandemie diesen Anblick hatte alltäglich werden lassen. Die klinisch wirkende Umgebung der vielgeschossigen Gewächshäuser stand in krassem Kontrast zur Ackerschollenrhetorik van Aas, und der Audiokommentar musste der sterilen Uniformierung nach Kräften positive Attribute zuschreiben, damit das gewünschte Bild erdiger Hingabe sich nicht im Assoziationsraum zwischen Hygiene und Effizienz auflöste. Natürlich half dabei die subtile Inszenierung von Gleichberechtigung und der Aufhebung sozialer Unterschiede. Der Text dazu war unprätentiös und aufrichtig, im Ton wie eine Naturdoku über kleine Polarfüchse, zugleich vertrauenerweckend wie subtil mahnend. »Aquaponische Vertikalfarmen der Firma Sulaco produzieren deutlich mehr und gesündere Nahrungsmittel als konventionelle Erzeuger – auf einem Bruchteil der Fläche, mit einem Bruchteil des benötigten Wassers, zu einem Bruchteil der Kosten.«
Man spürte, dass bei der Produktion der Filme Profis am Werk gewesen waren, Menschen, die vermarkten konnten, was eigentlich nicht zu vermarkten war: Strategen echter Gefühle.
»Angesichts der Endlichkeit fruchtbaren Ackerlandes, der Schwerfälligkeit traditioneller Landwirtschaft und den unbegrenzten Möglichkeiten des modernen Bioengineering erscheinen der Bauer und sein Trecker, der seine Scholle pflügt, heute wie Relikte aus längst vergangener Zeit.«
Auf dem Gelände von Biotopia standen 33 transparente bzw. halbtransparente Vertikalfarmen mit 20 bis 25 Stockwerken, die im Sommer mit natürlichem Licht, im Winter und nachts künstlich beleuchtet wurden. Bevor die Arbeiter die Farmen betreten durften, durchliefen sie eine Schleuse zur Dekontamination. Das war mit Überbelichtung und Lens-Flare-Effekten gefilmt wie eine rituelle Waschung und griff so durchaus van Aas Vorliebe für spirituelle Bezüge auf, wie sie sich auch schon bei früheren Projekten von ihm gezeigt hatte. Zum Begriffsfeld der Reinigung passte, dass die Atemluft wie auch das Wasser jeder Vertikalfarm innerhalb eines geschlossenen Systems zirkulierte. Aus feinen Düsen wurde es als Aerosol über den Pflanzen verteilt und perlte zum Boden hin ab, wo es durch Kieselsteine und Lehmsedimente gefiltert wurde. An keiner Stelle berührte dieses Wasser mehr die keimträchtige Außenwelt. Biotopia war eine Arkologie, eine hermetisch abgeschlossene Biosphäre.
Malu erinnerte sich, dass die Begriffe bio und natürlich in den ersten beiden Jahrzehnten des Milleniums beinahe allgegenwärtig gewesen waren, ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Verkaufsargument für ein Produkt. In jenen Videos aber, wenige Jahre später entstanden, kamen diese Begriffe überhaupt nicht mehr vor. Sie hätten auch nur die Frage aufgeworfen, was bio und natürlich in diesem Zusammenhang noch bedeuten sollte. Die Tomaten und Rondini, Avocados und Kiwanos, Zuckerschoten und Lupinen verbrachten ihre kurze, behütete, wachstumsoptimierte Entwicklung in aseptischer Sauberkeit. Ihre Genese war minutiös geplant vom Molekulardesign ihrer Saat bis zur Resorption ihrer Nährstoffe im menschlichen Darm. Ihr Wachstum war ein prädestinierter und gesteuerter Prozess, der nur einem einzigen Ziel entgegenwuchs, nämlich der fristgerechten Auslieferung.
3D-Animationen zeigten, wie die Luft gefiltert und temperiert, wie das Brauchwasser aus den Fischtanks tief unter dem Feld vom Ammoniak befreit, mit Nitrat angereichert und wieder zu den Farmen hinaufgepumpt wurde, wie der Computer den ph-Wert anglich, die Nährstoffe dosierte und das Gemisch schließlich durch das Steinwolle-Substrat leitete, in das die Pflanzen anstelle von Humus griffen, wenn sie nicht, wie Kräuter und Kresse, in gesättigtem Nebel hingen.
Die Wachstumsraten der Pflanzen waren enorm. Mit der Kundenanfrage wurde ohne Verzögerung die Produktion in Gang gesetzt, im Zeitraffer weniger Tage entstanden sie wie aus dem Nichts. Die Produzenten verteilten palettenweise neue Stecklinge, topften um, beschnitten und ernteten, sie verluden die reifen Tomaten oder Auberginen mit abgezählt erscheinenden Schritten in die Transportaufzüge und in die mehrstöckigen Elektrowagen, mit denen sie zu den Hangars gefahren wurden, wo Fahrradkuriere, Drohnen oder die Verbraucher selbst sie in Empfang nahmen. Drinnen wurde schon das Grün der Stängel und Blätter entsorgt und zur Vergärungsanlage transportiert, wurden die Armaturen gesäubert und Platz geschaffen für die bereits startbereite neue Saat: Ein nie stillstehender Kreislauf des Lebens, der sich unablässig erneuerte.
Die Präzision, mit der hier Aufzucht und Ernte all dessen besorgt wurde, was seit Jahren und Jahrzehnten ihr Frühstück und Abendessen gewesen war, sollte als leichthändig und opferfrei erscheinen. Doch in den ästhetisierten Aufnahmen dieser Videos spürte Malu eine eisige Erwartung auf den Pflanzen lasten – binnen Tagen reif und auslieferungsbereit zu sein. Und auch die Produzenten waren unablässig und bedingungslos ihrer Aufgabe verschrieben, ob bei der Produktion oder in den Versuchslaboren der Forschungsabteilung. Heerscharen von Bioingenieuren feilten daran, die guten Ideen der Natur zur Marktreife zu perfektionieren. Sie kultivierten Rinderstammzellen in Aminosäuren und erhielten bratfertige Burgerpattys, gewannen molekülidentisches Hühnereiweiß aus Hefeextrakten und bauten Shrimps aus den Erbinformationen der Rotalge nach, immer unterstützt von den neuesten Errungenschaften der digitalen Intelligenz.
Die PR-Profis lernten mit der Zeit, dass sie keine Identifikationserfolge erzielten, wenn sie ein Menschenballett zeigten, das nach den Regeln einer Maschine tanzte. In den späteren Videos gab es keinerlei sichtbare Server, Leitungen oder Schnittstellen mehr, weder Bildschirme noch Sprachassistenz, nicht einmal ein rotes Kameraauge. Stattdessen verwandelten die stilisierten Bilder die Technik in reinen Geist und erhoben ihren Gebrauch zum Kult.
Und als Malu jetzt dieses anthropogene Wunder betrachtete, fragte sie sich in einem letzten sich wellenförmig auftürmenden Gedanken, bevor sie voller Erschöpfung und Unbehagen das Bewusstsein verlor, ob wohl auch ihre Tochter Golda sich diesem oktroyierten Rhythmus hatte unterwerfen müssen.
2 Die Störung
Vom Sonnenaufgang war noch nichts zu sehen. Regenschlieren wehten träge über das Areal hinweg, auf dem fast unsichtbar die Vertikalfarmen von Biotopia in die Dunkelheit aufragten.
Wann immer Malu in den letzten zwanzig Jahren von einer Reise nach Berlin zurückgekehrt war, hatte sie die gläsernen Türme bereits aus der Ferne sehen können, gerade im Dunkeln, wenn der Magentaschimmer der Wachstumslampen umso besser zu erkennen war. Sogar in der gesamten langen Krisenzeit des Großen Einsatzes war dieses sich scheinbar selbst erzeugende Licht nie erloschen, und so lange es leuchtete, durfte Malu und jede andere solvente Person in der Stadt überzeugt sein, dass die Dinge so schlimm noch nicht stehen konnten. Doch nun waren all diese Lichter erloschen.
Watson hatte ihr davon abgeraten, eine Taxidrohne zu nehmen, da sie innerhalb der Anlage nicht würde landen können. Allerdings hätte ihr auch ein Wagen keinen Vorteil verschafft, wie sie von hier oben sehen konnte: Der Zugang Columbiadamm war durch Menschenmassen sowie Einsatzfahrzeuge des Sicherheitsdienstes unpassierbar geworden.
»Watson, wir landen vor dem ehemaligen Besuchereingang.«
Sofort parierte Watson mit einer Antwort, die klang wie die einzig mögliche. »Wir haben dafür leider keine Erlaubnis, Malu.«
»Da hat mir Elena aber etwas anderes gesagt.«
»Der Senat hat auf dem Gelände keine Befugnisse.«
Sie wusste, dass die Rechtslage verwickelt war. Der Senat hatte bei der Errichtung von Biotopia Mitte der Zehnerjahre zunächst die Rolle des Antreibers gespielt und sich dann aus der Verantwortung gezogen, indem er den Amerikanern die Farm als Sonderwirtschaftszone überließ. Lediglich der Sicherheitsdienst Konterbauer wahrte noch die Form behördlicher Aufsicht.
Aus welchem Grund protestierten diese Leute, die die Uniformierten offenbar nur mit Mühe zurückdrängen konnten? Malu vermutete weniger humanitäre Anteilnahme als vielmehr ein drohendes Versorgungsproblem. Biotopia hielt die Lieferverträge mit der Stadtverwaltung bereits seit achtundvierzig Stunden nicht mehr ein, und jede weitere Stunde kostete Vertrauen, das sich die Farm über zwanzig Jahre erarbeitet hatte. Es würde nicht über Nacht zurückkommen, wenn nicht alles sehr schnell wieder in normalen Bahnen lief.
Bei ihrem Gespräch mit Elena hatte Malu gespürt, wie die exzellenten Gründe für ihren Rückzug ins Private, die sie in jahrelanger Fleißarbeit immer resistenter gegen Widerspruch und Zweifel gemacht hatte, zu zerbröseln begannen wie billiger Mörtel – viel, viel schneller, als sie es für möglich gehalten hätte. Das unerwartete Gefühl, noch einmal gebraucht zu werden, hatte alle möglichen Glückshormone durch ihren Körper gepumpt, nur das gute Zeug. Leider vernebelte das gleichzeitig ihre Fähigkeit zu klarer Analyse.
Die war inzwischen zumindest so weit wieder intakt, dass Malu auf die Idee kam, sich die Landeerlaubnis direkt von Konterbauer zu holen. Watson stellte eine Verbindung her.
»Mein Name ist Marieluise Jacobson, ich soll im Auftrag von Senatorin Elena Sander ein Audit bei Ihnen durchführen. Wo kann ich landen.«
Sie bemerkte, dass die Frage, die sie hatte stellen wollen, zu einer etwas übermotivierten Aufforderung geworden war, so als hätte sie nach einem verlängerten Sabbatical nun wieder das ultimative Kommando inne. Was allerdings in keiner einzigen Hinsicht zutraf.
»Hier ist nichts angemeldet. Der Kennung Ihrer Drohne nach sind Sie eine Privatperson. Sie werden hier auf keinen Fall landen, da kann ja jeder kommen.«
Der Columbiadamm war in beide Richtungen von dichtem Gewimmel bevölkert. Autos waren in der Menschenmenge stecken geblieben. Was aus zweihundert Metern Höhe noch ausgesehen hatte wie ein Protestzug, entpuppte sich bei genauerer Betrachtung als eine Art lebende Barrikade, als gälte es, Personen, die von dem umzäunten Gelände herkamen, am Durchgang stadteinwärts zu hindern. Es sah aus, als hätten die Protestierenden die ganze Nacht dort untergehakt verbracht. Auf den Großaufnahmen, die Watson anzeigte, konnte Malu vereinzelt Prügeleien ausmachen, allerdings war völlig unklar, wer sich prügelte und warum. Der Kleidung nach waren es Anwohner, solvente Bürger, die sich zum Teil mit Holzlatten oder Knüppeln bewaffnet hatten, als wollten sie jene zurückdrängen, die aus der Farm zu fliehen versuchten. So viel also zu Vanessas Willkommenskultur.
Allerdings war es unwahrscheinlich, dass überhaupt jemand herauskam. Zum einen war da der meterhohe beleuchtete und, wie Malu oft genug gehört hatte, mit allerhand Sensorik gesicherte Zaun. Zum anderen hatte Konterbauer sämtliche Zufahrten, die hinein- oder hinausführten, mit Wachleuten besetzt und abgeriegelt.
Malu fand die Annahme, es handle sich bei der Störung um einen großangelegten Fluchtversuch, wenig überzeugend. Warum sollten die Produzenten Biotopia verlassen wollen? Wenn das der Fall wäre, dann hätte Golda es schon lange getan.
Malu bat Watson, eine Verbindung zu Elena herzustellen. Es war kurz nach acht Uhr früh.
»Die Senatorin ist leider nicht zu erreichen, Malu.«
»Watson, wir müssen da landen, es gibt keine andere Möglichkeit. Dort unten vor dem Besuchereingang ist Platz genug.«
»Wir haben keine Landeerlaubnis, Malu.«
»Gib mir das Steuer.«
»Ich muss dich darauf aufmerksam machen, dass bei manueller Steuerung der Versicherungsschutz dieser Drohne erlischt.«
»Danke, Watson. Gib mir das Steuer.«
Malu ergriff den Stick, den Watson nun freigab, und manövrierte die Drohne über die historische Abfertigungshalle des ehemaligen Tempelhofer Flughafens. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatte sie ein- oder zweimal an Führungen teilgenommen. Später war hier jahrelang die Ausstellungs- und Markthalle von Biotopia Berlin untergebracht gewesen, wo die Erzeugnisse der Farm – frischer Salat und Gemüse, Fisch, später auch Fleischsubstitute und Arzneien – verkauft und nebenher neue Produzenten angeworben wurden. Welchem Zweck dieser Gebäudeteil jetzt diente, wusste Malu nicht. Biotopia war seit mehr als zehn Jahren von der Außenwelt abgeschottet, Informationen über die Vorgänge im Inneren gelangten nur in zweierlei Form an die Öffentlichkeit: Durch offizielles Werbematerial von Sulaco oder durch Gerüchte. Als zuverlässige Informationsquellen konnte man beides schwerlich bezeichnen.
Als sie die Flughöhe über dem vorgesehenen Landeplatz immer weiter verringerte, erfasste ein Lichtkegel die Drohne. Eine lautsprecherverstärkte Stimme wies sie darauf hin, dass das Gelände Sperrgebiet und die Landung strengstens verboten sei. Wie aus dem Nichts erschienen vier Uniformierte am Boden und gestikulierten, als versuchten sie einen Schwarm Hornissen zu verscheuchen.
»Man wird die Landung als Übergriff werten. Eine Sanktion als Folge ist sehr wahrscheinlich«, warnte Watson.
Malu ignorierte die Warnung. Die Drohne verlor immer mehr an Höhe, und die Uniformierten stoben, nun ihrerseits gleich einem Schwarm, auseinander. Malu zog am Stick, wodurch die Drohne wieder aufstieg, korrigierte die Steuerbewegung dann viel zu heftig in die entgegengesetzte Richtung und setzte das Fluggerät so hart auf, dass sie nur um ein Haar einem Schleudertrauma entkam. Irgendwo hatte es ein lautes Krachen gegeben, die Rotoren schalteten sich ab.
Schon riss einer der Wächter die Tür von außen auf und brachte seinen Taser in Anschlag. »Aussteigen!«
Malu blieb ruhig. »Erst wollen Sie mich verscheuchen, und jetzt können Sie es kaum erwarten, mich in Empfang zu nehmen«, sagte sie und stieg auf wackeligen Beinen aus dem Fluggerät.
Als die Männer sie sahen, wirkten sie geradezu verunsichert. Da stand eine in Jeans und Filzmantel gekleidete Frau in ihren fortgeschrittenen Fünfzigern, auf dem Kopf eine Lesebrille, die als Haarreif diente, freundlich und zugewandt und selbstredend schon ihr ganzes Leben lang unbewaffnet. Man hätte sie ebenso für eine Kunstlehrerin wie für eine Psychologin oder Entwicklungshelferin auf Vortragsreise halten können. In ihr eine Bedrohung zu sehen, fiel offenkundig selbst den übertölpelten Wachleuten schwer.
»Sie dürfen hier nicht landen!«, blaffte einer der vier trotzdem pflichtschuldig. Sein Gesicht wurde von einem Helm mit dunklem Visier verhüllt, aber seine junge Stimme klang für Malu nicht einschüchternd, sondern eher hilflos.
Der Nieselregen überzog Haut und Kleidung mit unangenehmer Feuchtigkeit, ein vager Brandgeruch sowie die undefinierbare Geräuschkulisse – unverständliches Skandieren gemischt mit einem dumpfen, ratternden Grollen – machte die Anwesenheit hier draußen ausgesprochen unwirtlich.
»Lassen Sie uns das doch drinnen bereden!«, sagte Malu einladend und ging Richtung Eingang, als sei sie hier zu Hause.
Die Tür der leeren Drohne schloss sich selbsttätig, die vier Rotoren setzten sich simultan wieder in Bewegung, und das Gerät erhob sich taumelnd wie ein benommenes Insekt zur nächsten Tour.
Die vier Uniformierten begleiteten Malu in misstrauischer Distanz zum Eingang. Einer sprach eine Statusmeldung in sein Funkgerät und erhielt umgehend Antwort, die Malu nicht verstand. Sie versuchte die Eingangstür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Wie um ihre Forderung zu wiederholen, stemmte sie wartend und ein wenig forsch die Hände in die Hüften. Einen Moment lang geschah überhaupt nichts, die Szene wirkte wie eingefroren. Dann erklang der Türsummer.
Sie gelangten in eine kleine Empfangshalle. Die Wände waren von einem bioluminiszierenden Pilz bedeckt, der ständig die Farben wechselte, von gelb über violett zu grün und wieder zurück. Durch die großen Panoramafenster waren die Schatten der lichtlosen Türme zu sehen. Auf dem beleuchteten ehemaligen Vorfeld waren zwei Zelte errichtet worden.
»Du musst Marieluise sein!«
Eine junge, androgyn wirkende Person mit weißgefärbten Haaren kam sicheren Schrittes auf Malu zu und streckte ihr die Hand zur Begrüßung hin. Sie trug eine dunkelblaue Uniform mit Stehkragen und Konterbauer-Logo, streng und doch auf eine taillierte Art feminin. Ihre Pupillen waren vom blaustichigen Silizium einer AR-Linse bedeckt, wenn nicht sogar die Hornhaut selbst implantiert war – eine Annahme, für die die geröteten Lider ein starkes Indiz zu liefern schienen. Sie hatte irgendwie abstrakte und vielleicht gerade deswegen spöttisch wirkende Gesichtszüge. Vor der flachen Brust hielt sie ein altertümliches Klemmbrett.
»Elena hat mich schon vorgewarnt, dass du kommst«, sagte sie mit verschlagenem Lächeln und unerwartet tiefer Stimme. »Oh, deine Hand fühlt sich aber nicht gut an. Hier, dein Backstageausweis.«
Etwas überrumpelt nahm Malu eine Chipkarte entgegen. »Haben Sie hier … das Kommando?«
»Ich? Oh, nein.« Sie nestelte mit gespielter Verlegenheit an ihrem Kragen. »Ich bin Jules.« Sie sagte das, als sei es eine geläufige Berufsbeschreibung.
»Und weiter?«
»Nichts weiter.« Sie tippte auf ihr Namensschild: »Jules« stand darauf, darunter befand sich ein blasser Fettfleck mit den Umrissen Neuseelands.
»Ich bin hier, um den Störfall zu untersuchen«, sagte Malu. In alle Richtungen eilten Uniformierte mit Kisten und Ausrüstungsteilen an ihnen vorüber. Sie stand im Weg. Als Jules nicht reagierte, sagte sie: »Oder die Störung.«
Aber Jules schien irgendwie mit den Gedanken woanders zu sein.
»Im Sinne der Störfallverordnung«, ergänzte Malu mit einem gewissen Nachdruck, um ihrem Auftrag noch mehr professionelle Substanz zu verleihen.
»Klar, logisch«, sagte Jules zerstreut. »Wo ist denn da eigentlich der Unterschied?«
Malu lächelte unverbindlich. In ihrer aktiven Zeit hatten die Verantwortlichen sie auf alle nur denkbaren Arten auf die Probe gestellt oder zu verunsichern versucht. Am besten blieb man sachlich. »Ein Störfall ist ernster als eine Störung.«
»Aber nicht so ernst wie ein ernster Störfall, richtig?« Jules grinste wie über ein besonders feinsinniges Aperçu.
Malu blieb sachlich. »Kann ich jetzt bitte mit den Verantwortlichen sprechen?«
»Na sicher, Marie – ich darf doch Marie sagen? –, aber erst mal gehen wir zwei beide zum Medizincheck.«
»Wie bitte?«
»Hinter der Tür da vorne. Ich begleite dich ein Stückchen.«
»Warum? Ich bin nicht krank.«
»Du wirst nur kurz durchgecheckt. Das ist Standard, du musst dich nicht ausziehen oder so was. Keine Sorge!« Sie lächelte mit leiser Herablassung, so als läse sie eine diesbezügliche, übertrieben verklemmte Sorge in Malus Gesicht. »Wenn du dort fertig bist, haben wir noch ein bisschen formellen Kram vor uns. Danach führe ich dich rum und erzähle dir, was wir wissen.«
Malu erhaschte einen kurzen Blick auf das Papierdisplay, das auf Jules’ Klemmbrett eingespannt war. Darauf befanden sich nichts als Kritzeleien, Krakel, aus untätigem Warten geborene Striche und Kreise. Als Jules ihren Blick bemerkte, lächelte sie ein wenig verlegen und löschte die Kritzeleien mit einem Fingertipp. »Kann ich sonst noch etwas für dich tun, Marie?«
Sie überlegte, ob sie Jules den enervierenden Gebrauch ihres halben Vornamens ausreden sollte, vergaß es aber gleich wieder. »Wann kann ich in die Anlage?«
Jules’ Gesicht nahm einen bekümmerten Ausdruck an, der zwar falsch, aber dennoch vollendet wohlerzogen wirkte. »In die Anlage? Ja, also … hat Elena dir denn nichts gesagt?«
Malu verschränkte als Antwort nun ihrerseits die Arme vor der Brust.
»Die gesamte Anlage ist im Moment Sperrgebiet«, sagte Jules.
»Und das heißt?«
»Gesperrt. Für den Zutritt von Unbefugten. Zu denen, soweit ich das in meinen Unterlagen sehen kann« – sie deutete einen Blick auf ihr leeres Klemmbrett an – »leider auch du gehörst. Generell alle Privatpersonen.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Senat hat euch über mein Kommen informiert. Konterbauer untersteht dem Senat. Das ist eine offizielle Weisung.«
»Sorry, das ist ja bestimmt alles korrekt und richtig und so weiter, aber die Frau Senatorin sollte sich bei Gelegenheit vielleicht noch mal das Sicherheitskonzept von Konterbauer durchlesen, vor dem Hintergrund, dass hier gerade Holland in Not ist und so.«
Malu wechselte wohl oder übel schon jetzt in den Erbsenzählmodus, für den sie offenbar so bekannt war, dass eine Senatorin sie dafür extra aus dem vorzeitigen Ruhestand geholt hatte. »Von wem genau kommt diese Anweisung?«
»Ich kann dir das im Moment leider nicht weiter aufdröseln, Marie.«
»Aufdröseln? Ich möchte wissen, wer das angeordnet hat. Kann ich mit dieser Person sprechen?«
»Jetzt erst mal Medizincheck, ja? Und lass die auch mal einen Blick auf deine Hände werfen!«
Das Medicamp war eine kleine Arztpraxis, die in die ehemaligen Büroräume des Flughafenpersonals eingebaut worden war, und diente offensichtlich nur der Erstversorgung des Konterbauer-Personals. Ob es momentan auch dazu genutzt wurde, Produzenten aus der Farm zu behandeln, war schwer zu sagen; es sah aber nicht danach aus, schließlich standen vor den Hangars die großen Zelte. Doch auch dort herrschte wenig Betrieb, außer einigen Sicherheitsleuten und medizinischem Personal war niemand zu sehen. Obwohl der Morgen inzwischen dämmerte, waren die Strahler noch eingeschaltet und tauchten alles in ein unnatürliches Licht, das die weißen Einwegoveralls des Personals geisterhaft gleißen ließ.
Eine junge Ärztin trat Malu in den Weg. Während sie sich Latexhandschuhe überzog, führt sie Malu in einen Behandlungsraum mit Dekontaminationskabine, Umkleide, Display und Liege.
»Du bist die vom Senat?«, fragte sie über die Schulter. Ihr Ausweis baumelte lässig aus ihrer Hosentasche. »Ramona« stand darauf.
»So ungefähr«, sagte Malu.
»Wir müssen deine medizinischen Daten checken. Hast du dich schon eingeloggt?«
Eine zweite Frau betrat den Raum. Sie wirkte kräftig und blieb wie unentschlossen beim Durchgang stehen. Es sah aus, als hätte sie gar nicht die Absicht, hereinzukommen. Wollte sie Malu vielmehr am Hinausgehen hindern?
»Watson braucht deinen Login«, sagte Ramona und deutete auf den Fingerabdruck-Scanner.
»Wozu braucht Ihr meine Gesundheitsdaten?«
Ramona wechselte einen Blick mit der Frau bei der Tür. »Das ist nur zur Vorsicht. Watson gleicht ein paar Unverträglichkeiten ab. Nichts Weltbewegendes.«
»Unverträglichkeiten? Wogegen?«
»Bestimmte chemische Verbindungen.« Ramona vermied es, Malu direkt anzusehen. Stattdessen kramte sie eine kleine Ampulle aus einem Kühlbehälter und zog eine Spritze zur Hälfte mit Serum auf.
»Wenn Sie mir nicht sagen, wozu meine Daten gebraucht werden, gebe ich sie Ihnen nicht. Das ist doch wohl ganz logisch.«
Ramona lächelte nachsichtig. Sie ging – noch immer mit der Spritze in der Hand – zu einem Bildschirm und verlas aufreizend monoton eine lange Reihe chemischer Abkürzungen für Molekülverbindungen, bis Malu sie unterbrach.
»Was soll das? Es ist doch wohl klar, was ich gemeint habe.«
Die Frau bei der Tür sah Malu ausdruckslos an und begann, ihre Ärmel hochzukrempeln.
Ramona sagte: »In der Anlage wird mit allergenen Substanzen gearbeitet. Wir wollen das nur mal schnell abgleichen.«
»Ich verstehe immer bloß abgleichen. Was für Substanzen sind das? Wird da drinnen mit Kampfstoffen experimentiert?«
»Ich bitte dich, Malu: Kampfstoffe!« Dabei kam sie mit erhobener Spritze auf sie zu.
»Was ist das für eine Spritze?«
Sie ging an Malu vorbei; statt ihrer bekam die Frau bei der Tür eine Injektion. Sie bedankte sich freundlich und ging weg. Ramona kehrte an das Display zurück und entsorgte die Spritze in einen kleinen Desinfektionsbehälter.
»Entspann dich, Malu. Dieser Check ist obligatorisch, und deine Aufregung darüber ist … na ja.«
Malu sah sie prüfend an. Schließlich legte sie einen Finger auf den Sensor und erteilte die Freigabe.
»Soll ich mir das mal ansehen?«, fragte Ramona mit Blick auf ihre Hände.
»Nicht nötig.«
»Es gibt mittlerweile wirksame Therapien gegen … ist das Arthrose?«
Malu sah sie einen Moment lang ruhig an und deutete dann mit einem Kopfnicken nach draußen, dorthin, wo die Türme ihr dunkles Geheimnis über den Tagesanbruch zu retten versuchten. »Was ist da drinnen passiert?«
Ramona lächelte. »Das willst du sicher lieber selbst herausfinden.«
Malu imitierte ihr Lächeln in einer plötzlichen Aufwallung von Ärger. »Was ist eigentlich aus dem guten alten Sie geworden?«
Ramona streifte mit einem schnappenden Geräusch ihre Latexhandschuhe ab. »Ich denke, wir sind hier fertig.«
Sie hatte Malu kein einziges Mal angefasst.
3 Das Feld
Das Areal der Hightech-Farm Biotopia, das zwischen den Berliner Ortsteilen Schöneberg und Tempelhof im Südwesten sowie Kreuzberg und Neukölln im Nordosten lag, hatte eine bewegte Geschichte. Schon im 18. Jahrhundert war es von Schöneberger Bauern als Ackerfläche genutzt worden. 1828 kaufte das preußische Militär das Große Feld, wie der Volksmund es nannte, für Geländeübungen, doch die Berlinerinnen und Berliner nutzten es in ihrer Unverbesserlichkeit weiterhin zu Naherholung und Sport.
Im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die kommerzielle Luftfahrt rasant und prägte den Charakter des Feldes. Bis 1927 widmeten die Firmen Junkers und Aero Lloyd das Gelände schrittweise zu einem Flughafen um – als weltweit erster verfügte Tempelhof sogar über eine eigene U-Bahn-Station. Der zunehmende Luftverkehr erschöpfte schnell die Kapazitäten des Flugfeldes, sodass es in den 2030er-Jahren auf 400 Quadratmeter vergrößert und um ein monumentales, von Ernst Sagebiel entworfenes Abfertigungsterminal erweitert wurde. Bei seiner Eröffnung galt es als größtes Gebäude der Welt.
Nach dem Machtantritt der NSDAP beherbergte das Gelände eines der ersten Konzentrationslager des Regimes und wurde nach Beginn des Zweiten Weltkrieges von der nazideutschen Rüstungsindustrie zur Herstellung und Wartung des berüchtigten Sturzkampfbombers Ju 87, genannt »Stuka«, benutzt. Tausende Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter aus ganz Europa wurden hierher verschleppt, viele kamen aufgrund der menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen ums Leben. Der technische Fortschritt machte aus dem Feld eine tödliche Falle.
Welthistorische Aufmerksamkeit erlangte der Flughafen nach dem Ende des Krieges während der Berlin-Blockade, mit der die Sowjetunion von Juni 1948 bis Mai 1949 – fast ein Jahr lang – die westdeutsche Exklave von jeglicher Versorgung abschneiden wollte. Über die Luftbrücke landeten die sogenannten Rosinenbomber der Amerikaner teilweise im 90-Sekunden-Takt und sicherten so die Versorgung West-Berlins, was dann jene Nachkriegs-Weltordnung einläuten sollte, in der auch Malu aufgewachsen war.
Nach dem Bau des Flughafens Tegel wurde der Flugbetrieb in Tempelhof zunächst heruntergefahren und 2008 – dem Jahr, in dem Malus Berufsleben begann – endgültig eingestellt. Als im Mai 2010 der Erholungspark »Tempelhofer Freiheit« eröffnete, hatte Malu gerade ihr Büro im Bergmannkiez ganz in der Nähe der Terminals bezogen. Es war ein ehemaliges Ladenlokal von der Sorte, wie sie in dieser Zeit als Workspaces in Mode waren und die von außen ein wenig aussahen wie eine Bühne, auf der inspirierte junge Menschen ihre beginnende Karriere in Szene setzten. Immer, wenn es ihre Zeit zuließ, ging sie auf dem Feld joggen, gegen den Uhrzeigersinn, vorbei an den Hangars und dem Tower, entlang der Stadtautobahn auf der westlichen Seite, vorbei an dem kleinen rot-weiß karierten Kiosk, den selbstgezimmerten Gemüsebeeten des Gemeinschaftsgartens »Allmende Kontor«, entlang der Friedhofsmauer zum Biergarten und von dort am Baseballfeld wieder zum Ausgangspunkt. Die äußere Runde war fast sieben Kilometer lang, und Malu schaffte sie stets in einer Zeit unter 30 Minuten. Im Sommer, wenn sie und ihre Kolleginnen früh mit der Arbeit fertig waren oder, wie meistens, die Arbeit ohnehin mit nach Hause nehmen mussten, fuhren sie gemeinsam mit ihren Rädern über eine der beiden Landebahnen Richtung Süden, setzten sich auf eine der Wiesen unterhalb der Neuköllner Promenade und palaverten in der langsam sinkenden Sonne über steigende Mieten und Menschenrechte in China, bevor Malu Golda vom Karatetraining abholte, oder von der Gitarrenstunde oder wo sie den Nachmittag sonst verbracht hatte: Malus Tochter war mit zehn, elf Jahren schon fast so beschäftigt gewesen wie ihre Mutter.
Die Tempelhofer Freiheit war in diesen Jahren eine Oase unschuldiger Leere inmitten des kaputtgehypten Molochs Berlin. Es gab keinen See, keinen Springbrunnen und sehr wenig Schatten. Das Feld war eine Mischung aus Grasland und Parkplatz, sein auffälligstes Merkmal die Abwesenheit von fast allem. Doch wann immer Malu es betrat, ob früh am Morgen, wenn noch die Stadtreinigung die überfüllten Container vom Vorabend leerte, oder am späten Nachmittag, wenn auf den Grillwiesen vollbepackte Großfamilien mit Kind und Kegel und ganzen Sitzgarnituren in Stellung gingen, dann ergriff sie das Gefühl, ein zugleich privates wie öffentliches Refugium aufgeschlossen zu haben, einen Ort zwischen Civitas und Naturzustand, wo man all das sein konnte, was man noch nicht war und vielleicht auch nie werden würde. Gleichzeitig hatte Malu ihr Ziel fest im Blick, wenn sie sich klarmachte, dass das Leben, das sie sich erträumte, nicht irgendwo jenseits des Sonnenuntergangs lag, sondern in ihrem Büro, auf das die beiden Landebahnen zuzulaufen schienen.
Sie hatte fast das gesamte letzte Jahrzehnt an der Uni verbracht – erst als Studentin, die ihren Abschluss in Rekordzeit schaffte, dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin und schließlich als Doktorandin. Als ihre Konzepte zu Qualitätsmanagement und Sicherheitsauditing für Zulieferfirmen im außereuropäischen Ausland endlich auf Interesse stießen, schaffte Damian es, Tag und Nacht in der Requisite zu sein und Malu dennoch das Gefühl zu geben, er kümmere sich im Alleingang um Goldas Erziehung. Sie führten ein Leben zwischen unvereinbaren Polen und schafften es sogar nach Goldas Geburt erstaunlich lange, das offensichtliche Ablaufdatum ihrer Beziehung zu ignorieren. Weder Damian noch sie war wirklich bereit gewesen für ein Leben zu dritt – aber wie sich gezeigt hatte, war Damian es noch weitaus weniger gewesen als sie. Was dazu führte, dass Golda, wenn sie nicht beim Probetraining eines Schwimmvereins oder in der Zeichen-AG ihrer Schule war, entweder mit ihren Hausaufgaben oder einem Buch neben Malu in ihrem Büro oder ohne beides in Damians Werkstatt saß, wo sie ihm fasziniert, aber unbeteiligt dabei zusah, wie er Kulissenteile schliff oder Replikate von mythischen Schwertern anfertigte.
Golda schien sich gern alleine zu beschäftigen, und auch wenn sie zu allen offen und freundlich war und Freundschaften hatte, war sie doch auch oft in sich gekehrt und sogar grüblerisch. Sie schien sich für alle Arten von Vorgängen – technischer, aber auch zwischenmenschlicher Art – mehr zu interessieren als für die Menschen selbst. Sie war durchaus empathisch, aber Malu hatte nie erlebt, dass sie mal besonders viel von jemandem gesprochen oder sogar geschwärmt hatte. Wenn sie jetzt darüber nachdachte, fragte sie sich sogar, was sie überhaupt vom Innenleben ihrer Tochter wusste.
Jedenfalls vergingen so die Jahre. Genau wie Malu war auch die Stadt hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. In rasender Geschwindigkeit veränderte sich das Leben in Berlin von Grund auf: Kreuzberg wurde von russischen Oligarchen und reichen Schweden aufgekauft, in Neukölln die Verkehrssprache von Türkisch auf Englisch umgestellt, und in Friedrichshain zeichneten die Anwohner Petitionen für ein Verbot von Rollkoffern. Berlin war lange ein belächeltes Start-up gewesen, und als die Marke endlich Geld einbrachte, war sie nicht mehr wiederzuerkennen. Scheinbar war es nur eine Frage der Zeit, bis die Heuschrecken auch über das Tempelhofer Feld herfallen würden.
Doch es kam anders. Nachdem noch ein Jahr zuvor ein Volksentscheid, an dem Malus Büro sich geschlossen beteiligt hatte, zum bejubelten Stopp aller öffentlichen oder privaten Bebauungspläne geführt hatte, machte der Senat zu Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 eine Kehrtwende, indem er Pläne vorantrieb, auf dem Tempelhofer Feld ein Willkommenszentrum für Asylsuchende zu errichten. Man begründete das damals mit »administrativem Notstand«. Gegner des Vorhabens sprachen, je nach Gesinnung, entweder von einem Frontalangriff auf »die Demokratie« oder »das deutsche Volk«.
Etwa zur gleichen Zeit – niemand konnte sagen, in welcher kausalen Reihenfolge – reichte ein in Indonesien aufgewachsener niederländischer Umweltaktivist und Unternehmer mit dem unrealistischen Namen Ambrosius van Aa beim Berliner Senat das Konzept zu einem Urban-Gardening-Projekt ein, für das er lange Zeit weder einen Standort noch eine Finanzierungsmöglichkeit gefunden hatte: Die Green Ark, wie er das Projekt zunächst nannte, war eine aus aquaponischen Vertikalfarmen bestehende selbstverwaltete und selbstversorgende Anlage zur Herstellung von biologischen Nahrungsmitteln. Sie sollte das gesamte Areal des Tempelhofer Feldes bedecken, das mit seinen knapp 400 Hektar immerhin fast doppelt so groß war wie das Fürstentum Monaco.
Van Aa war Mitte zwanzig und wurde besonders von der Speerspitze des Berliner Bio-Klientels hymnisch verehrt, seit er 2013 als Student der Luft- und Raumfahrttechnik in Delft mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne sein Projekt »The Ocean Cleansing« auf den Weg und in die Weltmeere gebracht hatte: Riesige schwimmende Reinigungsanlagen, die völlig selbsttätig Plastikmüll aus dem Wasser filterten und ihn einem Recyclingsystem zuführten. Van Aa trat auf TED-Konferenzen und Tech-Messen als barfüßiger Zausel von nebenan auf, aber mit so viel Charisma und messianischer Überzeugungskraft, dass er für The Ocean Cleansing ebenso wie für die Green Ark den Tech-Investor Sulaco aus dem legendären Valley an Land ziehen konnte.
Mit seinem Nimbus als designierter Weltenretter sowie dem Argument, dass die Flüchtlingskrise nur eine von vielen künftigen Herausforderungen für Deutschland und Europa sei und mit epochalen sozioökonomischen Umbrüchen einhergehe, legte van Aa dem Senat ein richtungsweisendes Konzept vor. Darin fanden sowohl die historische Bedeutung des Geländes als auch die großen praktischen Anforderungen an ein Willkommens- und Integrationszentrum Berücksichtigung: Kein innerstädtisches Flüchtlingsghetto sollte entstehen, sondern ein Ort zum Leben und Arbeiten in einer interkulturellen Gemeinschaft und im Einklang mit den Erfordernissen nachhaltiger und ressourcenschonender Nahrungsmittelerzeugung. Die vertikalen Farmen der Green Ark würden nicht nur Wasser-, Energie- und Transportkosten der dort hergestellten Lebensmittel radikal senken, sondern auch Verpackungsmüll reduzieren und gleichzeitig den hart umkämpften Wohnungs- und Arbeitsmarkt Berlins entlasten.
Van Aas integrativer Ansatz stieß sowohl beim Senat als auch in der Öffentlichkeit auf größtenteils begeisterten Zuspruch, zumal diejenigen, die den Verlust ihrer innig geliebten »Tempelhofer Freiheit« beklagten, zufälligerweise dieselben waren, die in van Aa den Heilsbringer des 21. Jahrhunderts sahen. So gesehen gab es nur Gewinner.
Gleichwohl hagelte es von Beginn an auch massive Kritik an der gesetzwidrigen Umnutzung einer öffentlichen Liegenschaft. Gruppen verschiedenster Provenienz protestierten vehement gegen den Zuschlag des Geländes an Sulaco und versuchten immer wieder, die Bauarbeiten zu sabotieren. Der Protest richtete sich gegen das Ignorieren des Volksentscheids, gegen den Zuzug Asylsuchender, gegen den Verlust von Entfaltungsmöglichkeiten und städtischer Identität, aber auch gegen die Zerstörung der Artenvielfalt – immerhin hatten sich auf dem Feld bedrohte Pflanzenarten und Brutvögel wie Feldlerche, Steinschmätzer und Neuntöter angesiedelt.
Auch Malu hatte dem Bau erst skeptisch gegenübergestanden, dann aber gemerkt, dass er irgendwie zu ihrem wachsenden Gefühl passte, dass die Jugend für sie endgültig vorbei war. Denn auch ihr Leben befand sich nicht nur im Auf-, sondern bereits im Umbau. Sie hatte geerbtes und geliehenes Geld in eine schicke Eigentumswohnung auf Stralau investiert, in die sie mit der inzwischen pubertierenden Golda und Damian einzuziehen im Begriff war, obwohl der sich aus prinzipiellen und, wie sich zeigen sollte, unüberwindlichen Gründen dagegen wehrte. Sie spürte, dass die Dinge, die ihr schon jetzt so unendlich kompliziert vorkamen, ihr Widrigkeitspotenzial noch lange nicht voll entfaltet hatten.
Aber im Gegensatz zum Protest der Linksautonomen – nicht zu vergessen dem der Investoren – war der ihre lahm und handzahm gewesen und verdankte sich im Grunde nur einer formalen Empörung darüber, dass der Senat einen demokratischen Volksentscheid einfach im Handstreich übergangen hatte. Van Aas Vision bewunderte sie insgeheim. So einzigartig das Feld auch war: van Aa hatte die richtige Idee zur richtigen Zeit gehabt, und ihr schien es wie seine Bestimmung, dass das Feld sich diesem unbezweifelbar guten Zweck nun zu unterwerfen hatte. An dieses Gefühl erinnerte sie sich noch, als sie Golda längst an Biotopia verloren hatte: eine Art verquerer Stolz, so als hätte sie ein großes persönliches Opfer für eine noch weitaus größere gute Sache erbracht.
Die Baustelle freilich war jahrelang eine klaffende Wunde im ohnehin entstellten Gesicht der Stadt, schlimmer als der Potsdamer Platz nach der Wende: die Wiesen umgepflügt und planiert, der Asphalt aufgerissen, das gesamte Areal wie zerbombt – eine trostlose Marslandschaft bis zum Horizont, auf der die Bagger scheinbar ziellos Gräben zogen und die Betonmischer kubikkilometerweise Fundamente in den Untergrund pumpten, als hätten die Maschinen das ganze Leben übernommen.
Dass der Bau der Farm langsamer voranschritt als geplant, lag indes nicht nur an der notorischen Wurstigkeit der Berliner Behörden, sondern an van Aas Perfektionismus. Seine gigantische Pflanzenfabrik sollte auf dem letzten Stand der technischen Möglichkeiten sein, und da sich die Möglichkeiten in diesen Jahren beinahe stündlich weiterentwickelten, mussten auch die Baupläne ständig angepasst werden. In der entstehenden Kompetenzverwirrung schaffte Sulaco Fakten: Mit dem Energiekonzept des Wärmetauschs, der Solarzellen und der Biogaserzeugung stellte das Unternehmen schon früh sicher, dass die Farm energieunabhängig sein würde – womit die spätere Abschottung bereits vorprogrammiert war.
Malus Sentimentalität über den Verlust eines Stücks ihrer Geschichte wich ziemlich schnell ihrer moralischen Überzeugung, dass ihr ehemaliger Fitnessparcours einer bedeutenden Mission geopfert wurde – für Menschen, die ihre Heimat an den Bombenkrieg verloren hatten. In naher Zukunft würde dort, wo sie mit ihren Freundinnen Club-Mate getrunken und ihre profunden Einschätzungen zur Weltpolitik geteilt hatte, etwas wirklich Sinnvolles entstehen, gleichermaßen Ort der Teilhabe wie auch Manifestation einer neuen Weltmentalität, die in jedem einzelnen Aspekt des Lebens das große Ganze verbessern wollte.
Bei der Einweihung der Farm Anfang 2019 hatte sich gegenüber der Manifestation dieses Willens eine wohlwollende Akzeptanz durchgesetzt, die Biotopia zum weltberühmten Franchise machen sollte.
Aus ökonomischer Sicht war für Malu (und ohne Zweifel auch für die Investoren) klar, dass die Anlage ohne massive Subventionen nicht dauerhaft würde betrieben werden können, zumindest noch nicht zu Beginn, da die Gewinnmargen für Alltagslebensmittel wie Kräuter, Gemüse und Salat selbst im Biosegment kaum kostendeckend waren; angesichts der horrenden Bau- und Betriebskosten einer solchen Anlage würden sie ruinös ausfallen. Biotopia war also darauf angewiesen, dass der Senat die Unternehmung großzügig bezuschusste und die Arbeitskräfte aus Freiwilligen rekrutiert werden konnten. Für die Erfordernisse des Launches war die historische Situation in Berlin ein Glücksfall: verfügbares Bauland im Zentrum einer europäischen Metropole und eine schier unüberschaubare Anzahl Heimatvertriebener, die außer Sicherheit und einem Dach über dem Kopf zunächst keinerlei Ansprüche stellten.
Sulaco wusste, dass die Firma anfangs Geld verlieren würde, dafür aber Pionier eines einzigartigen weltgeschichtlichen Experiments und Innovator einer neuen Art menschlichen Wirtschaftens werden würde. Die späteren Standorte in Reykjavík, Nusantara und Neom bewiesen, dass der Erfolg durchaus wiederholbar war.
Auch für Malu fügten sich die Dinge. Aus einem Memorandum ihrer Firma zur Arbeitssicherheit im Niedriglohnsektor entwickelte sich die Zusammenarbeit mit der NGO Worth It Worldwide, die Standards der Arbeitssicherheit in Sweatshops definierte und umsetzte. Nachdem die rot-rot-grüne Regierung alle Berliner Unternehmen auf Einhaltung der Standards verpflichtet hatte, saß Malu quasi über Nacht mit den Großen am Tisch, denn sie hatte die Prüfroutinen für die Audits entwickelt.
Arbeiterinnen in Sweatshops waren nicht für ihre bereitwillige Kooperation mit Inspektorinnen bekannt – immerhin wurden sie von ihren Vorarbeitern strengstens beobachtet und hart bestraft, wenn sie zu leutselig über ihre Arbeitsbedingungen plauderten. Gleichzeitig waren alle, inklusive der Vorarbeiter, auf ihre Arbeit angewiesen, denn sie ernährte ihre Familien bis in die Elterngeneration.
Malus Idee, die nicht unumstritten war, beruhte auf Täuschung. Die Auditorinnen ließen sich einen Arbeitsplatz zuteilen und absolvierten einige Tage lang reguläre Schichten. Natürlich erlebten sie keine Normalbedingungen: Arbeitszeitbeschränkungen, Mindestalter der Arbeiter und Pausen wurden penibel eingehalten, solange sie anwesend waren, sodass sie am Ende einen hohen Score vergaben. Aber der Arbeitseinsatz hatte in Wirklichkeit auch nur dazu gedient, ungestört versteckte Kameras zu installieren.
»Das soll wohl ein Witz sein«, hatte ein Referent des Ministeriums Malu am Tag ihres Pitches gesagt, und alle Anwesenden hatten sich auf ihren Konferenzsesseln schon halb zur Mittagspause erhoben.
»Keineswegs«, hatte Malu geantwortet. Sie war ganz ruhig gewesen, weil sie wusste, dass ihr Konzept juristisch wasserdicht war. »Der avancierte Datenschutz der EU existiert weder in Bangladesch noch in Myanmar oder Vietnam. Wenn sie sich weiter auf die lauwarmen Beteuerungen und dreisten Lügen der Herren Vorstände verlassen wollen, dann müssen Sie sich mit meiner List nicht die Hände schmutzig machen. Aber wenn Sie wie ich die Nase voll davon haben, dass diese Abzocker sämtliche Rechte ihrer Arbeiterinnen missachten, dann werden Sie sowohl den Schergen wie auch den Drahtziehern auf einen Streich das Handwerk legen können.«
Ihre Laufbahn als aktive Auditorin bedeutete ihr viel: Es entsprach einfach ihrem Naturell, sich gegen bornierte Autoritäten durchzusetzen, Menschen ohne Lobby zu unterstützen und nicht zuletzt – zu reisen. Aber 2021 endete diese Laufbahn für sie aus zwei Gründen. Der erste war erfreulich: Sie stieg zur Projektleiterin von Worth it Worldwide auf, das im gleichen Zuge dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angegliedert wurde. Der zweite war Konrads Geburt. Doch statt zwei oder drei Monate in Elternzeit zu verbringen und dann mit zunächst halber Stundenzahl, mehr Kompetenzen und viel größerem Budget durchzustarten, saß sie zu Hause im Lockdown fest und fürchtete um das Leben ihres Kindes. Ihre Schwangerschaft mit Konrad war beinahe schwerelos verlaufen, immer an der Grenze eines unerklärlichen euphorischen Stimmungshochs. Aber unter der Geburt war Konrads Sauerstoffversorgung plötzlich abgefallen. Für ein paar Minuten mussten Alex, mit dem sie nach der Trennung von Damian zusammengekommen war, und sie um das Leben ihres Sohnes bangen. Seine ersten Tage auf dieser Welt verbrachte er in künstlicher Unterkühlung, wodurch sein Stoffwechsel so verlangsamt wurde, dass er kaum ein Lebenszeichen von sich zu geben fähig war. Sie brauchte Monate, um sich von dem Schock zu erholen, und obwohl Konrad sich normal zu entwickeln schien, richtete Malus ängstliche Aufmerksamkeit sich auf jedes Detail seines Verhaltens, das auf eine schwere Hirnschädigung hätte hindeuten können. Bis heute pendelte Konrads Verhalten zwischen unauffälligem Phlegma und Hyperaktivität, und es war und blieb quälend, nicht zu wissen, was davon ein unumkehrbarer Geburtsfehler war und was nicht.
Auch nach dem Ende der Pandemie blieb sie mehr oder weniger freiwillig im heimischen Innendienst, bis 2023 das von ihr entwickelte Audit Teil eines Bundesgesetzes mit dem erzdeutschen Namen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz wurde und Malu nach einer unerwarteten Beförderung zur Referentin plötzlich an der Schwelle einer Ministerialkarriere stand, als deren prädisponierter Schlusspunkt eigentlich nur der Posten der Staatssekretärin infrage kam. Sie war am Höhepunkt ihrer beruflichen Laufbahn angekommen, zweifache Mutter, Eigentümerin einer Immobilieneinheit und frisch von ihrem ersten Mann geschieden. Doch dann entdeckte sie, dass die Prüfberichte, mit denen Malus Mitarbeiterinnen von den Audits zurückkehrten und die ausgedruckt ganze Regalmeter gefüllt hätten, routinemäßig in dem Augenblick vergessen wurden, in dem die Staatssekretärin sie auf ihrer Festplatte abgespeichert hatte. Niemand interessierte sich jemals wieder für sie, nicht einmal Assistenten oder Praktikanten. Und selbst die Unternehmen, deren Regelverletzungen darin minutiös aufgeführt waren, würdigten sie keines Blickes. Sie brauchten sich nicht die Mühe zu machen, die Vorwürfe im Einzelnen zu prüfen, um dann ihre Juristinnen auszuschicken, sie zu widerlegen. Denn für sie ging es in diesem Spiel gar nicht darum, ein positives Image aufrecht zu erhalten. Stattdessen kauften sie sich mit ihrer Strafzahlung einfach die Erlaubnis, ihre Praktiken bis zum nächsten Audit fortzusetzen. Das Ministerium spielte dieses Spiel nicht nur mit, sondern holte sich mit dem Geld das zurück, was es durch die Abwanderung der Zulieferer in Niedriglohnländer verloren hatte. Aus Malus Herzensprojekt war hinter ihrem Rücken ein Nullsummenspiel geworden. Seitens des Ministeriums hatte es dann nur noch einer kurzen, ganz gewöhnlichen Bürointrige bedurft, um Malu, kraft ihrer plötzlichen Erleuchtung untragbar geworden, aus dem Dienst zu entfernen.
In der Folge hatte sie mehr als ein Jahrzehnt lang Gelegenheit, den Gemeinplatz »wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen« mit Leben zu füllen. Nachdem Alex und sie zunächst ein gutes Team abgegeben hatten, beendeten die Umstände ihres unfreiwilligen Rücktritts neben ihrer Karriere auch diese Beziehung. Sie gab Onlinekurse für Selbstständige, bis Watson auch das übernahm, schulte auf Vipassana-Meditation und Yoga um, engagierte sich in den Elternbeiräten von Konrads diversen Bildungsinstitutionen und versuchte jeden Tag, keine überbehütende Mutter zu sein. Leicht war das nicht, doch sie vermied das Attribut »schwierig«, wo es nur ging, zumal sie es im Umfeld von Konrads Erzieherinnen und Sozialarbeitern oft genug hörte. Sie akzeptierte, dass er ein besonderes Kind war, selbst dann, wenn es gerade keine Schwierigkeiten gab. Sie hatte keinen Grund, enttäuscht zu sein, weil sie niemals den Fehler begangen hatte, sich ein Bild von ihren Kindern zu machen.
Ihre Beziehung zu Konrad wurde von den verschiedenen Berichten und Gutachten als wahlweise symbiotisch oder Münchhausen-by-proxy eingeschätzt. Da Malu aber in einer Zeit lebte, die jegliche Art von Zuschreibungen als bevormundend und chauvinistisch ablehnte, nahm auch sie sich diese Freiheit. Ihr einziger Glaube bestand darin, dass man sein Kind lieben musste, erst recht und besonders dann, wenn niemand sonst es tat.
4 Der Fall
Beim Verlassen der Krankenstation passierte Malu einen nicht ganz geschlossenen Vorhang und warf einen vorsichtigen Blick hindurch. Abrupt blieb sie stehen. Ein Elektrokardiogramm piepte charakteristische, gleichmäßige Herztöne in einen kleinen abgedunkelten Raum hinein. Kalt hallten sie zwischen den gekachelten Wänden wider und verloren sich in der Erwartung des nächsten.
Im Bett des kleinen Einzelzimmers lag ein schwer verletzter Mann, dessen Gesicht von blau bis grüngelb verfärbten Prellungen grotesk aufgequollen war. Ein Arm lag in Gips, der Rest des Körpers war von einer Decke verhüllt. Malu warf einen schnellen Blick hinter sich. Der Flur war leer; sie ging hinein.
Der Mann war bei Bewusstsein. Seine Augen folgten ihrer Bewegung, doch er machte keine Anstalten, irgendwie zu reagieren.
»Ich bin im Auftrag des Senats hier«, sagte sie leise. »Was ist mit Ihnen passiert?«
Der Mann sah sie lange und durchdringend an, als gehe er mit sich in Zwiesprache, ob er sich der fremden Frau anvertrauen dürfe oder nicht.
Malu streckte eine Hand nach der Decke aus. »Darf ich?« Sie zögerte einen Moment, und als der Mann sich nicht regte, ja nicht einmal versuchte, eine Antwort zu geben, hob Malu die Decke einige Zentimeter an – und zuckte zurück.
Sie hatte damit gerechnet, ein Krankenhemd mit weiteren sich darunter abzeichnenden Verbänden zu sehen, Verletzungen einer Prügelei, aus der sie irgendwelche Anhaltspunkte gewinnen könnte, etwa auf die verwendeten Schlagwerkzeuge und damit die Täter. Sie fand auch einen Anhaltspunkt, allerdings einen, mit dem sie nicht gerechnet hatte: Der linke Arm des Mannes war vom Bizeps abwärts amputiert.
Sie senkte die Decke so vorsichtig, wie sie sie gehoben hatte. »Wie ist das passiert?«
Der Mann sah sie nur an, flehentlich, wie Malu glaubte, und sagte schließlich: »Water«. Auf dem Nachttisch stand ein halb gefülltes Glas bereit, und da sie den Hebemechanismus des Bettes nicht finden konnte, versuchte sie, den Nacken des Mannes zu stützen, damit er leichter aus dem Glas trinken könne, das sie ihm hinhielt. Dadurch erst bemerkte sie den Verband an seinem Hals. Bei der Berührung seines Nackens zuckte er vor Schmerz zusammen wie von einer Verletzung, die er an dieser Stelle hatte.
»Was tun Sie hier?« Das war Ramonas Stimme.
»Wie ist das passiert?«, fragte Malu, ohne sich umzudrehen oder auch nur den Blick von dem Mann zu wenden. Wasser, von ihr verschüttet, durchtränkte die Decke. Mit dem letzten Rest benetzte Malu seine Lippen, und als der Mann die Tropfen mit sichtbarer Dankbarkeit aufgeleckt hatte, bewegte er die Lippen, um etwas zu sagen.
»He, ich habe dich etwas gefragt!«, insistierte Ramona hinter ihr mit einer Aggressivität, die Malu zwar überraschte, aber nicht einschüchterte.
»Noch mal«, flüsterte sie dem Mann zu und beugte sich tiefer zu ihm herunter. Seine Lippen waren aufgeplatzt, Schneide- und Eckzahn oben fehlten, abgestandener Atem drang aus seinem Mund. Ramona legte ihr von hinten die – jetzt unbehandschuhte – Hand auf die Schulter.
»Switch … off«, flüsterte der Mann.
Was meinte er? Ausschalten? Was sollte sie ausschalten?
»Raus jetzt!«, befahl Ramona.
Endlich drehte Malu sich um und schüttelte zugleich unwirsch die Hand ab. »Was ist mit dem Mann passiert?«
»Er hat sich verletzt«, sagte Ramona abweisend. »Du musst gehen.«
Malu blieb hartnäckig. »Ist das einer der Produzenten?«
Doch sie bekam keine Antwort. Ramona wies ihr den Weg zur Tür, wobei sie sie nicht berührte, allerdings ihre Hand bereithielt, um mit festem Griff zuzupacken, falls dies nötig werden sollte.
»Dann können wir ja loslegen, nicht wahr, Malu? Alles in Ordnung mit dir?«