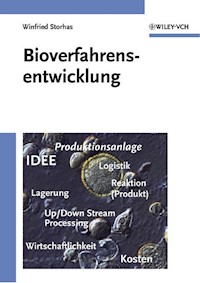
109,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bioverfahren haben sich in vielen Bereichen als überlegene Alternativen zu klassischen Produktionsverfahren etabliert, und ihre Bandbreite wird immer größer. Die Biotechnologie, insbesondere unter Einbezug der Gentechnik, hat zweifellos Zukunft. Die schnelle und effiziente Umsetzung von Forschungsergebnissen in wirtschaftliche Anwendungen birgt ein enormes wirtschaftliches Potential - und kaum eine andere Branche wächst derzeit so schnell wie die Biotechnologie. Wo sonst gibt es so viele Firmenneugründungen? Doch wie schafft man es, sich schnell zu orientieren? Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über die systematische Entwicklung von Bioverfahren. Einer Zusammenstellung der unterschiedlichen Varianten der einzelnen Verfahrensschritte folgen die Beschreibung integrierter Gesamtprozesse, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Verfahrensbeispiele. Im Vordergrund stehen dabei Verfahren, die bereits eine wichtige Rolle in der Industrie spielen. Biotechnologie bedeutet Zukunftstechnologie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 988
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Vorwort
Formelzeichenerklärung
Indexerklärung
Abkürzungsverzeichnis
1 Leistungsfähigkeit der Bioverfahrenstechnik
1.1 Allgemeine Betrachtungen
1.2 Einsatzfelder und Produktgruppen
1.3 Voraussetzungen für den Einsatz der Bioverfahrenstechnik
1.4 Märkte und Marktanteile biotechnologischer Produkte
2 Arbeitsgebiete der Bioverfahrenstechnik
2.1 Einführende Betrachtungen
2.2 Stellung und Aufgaben der Mikrobiologie
2.3 Stellung und Aufgaben der Molekularbiologie
2.4 Stellung und Aufgaben der Zellkulturtechnik
2.5 Stellung und Aufgaben der Biochemie
2.6 Informatik – Messen, Regeln und Steuern von Prozessen
2.7 Stellung und Aufgaben der Verfahrenstechnik
3 Mosaik der Bioverfahrensentwicklung
3.1 Verknüpfung aller Aufgabengebiete
3.2 Logistik
3.3 Einfluß auf die Ökologie
3.4 Ringschluß
3.5 Behördenengineering: GMP-Richtlinien, Genehmigungsgrundlagen, Gesetze und Verordnungen
3.6 Wichtige Internetadressen
4 Bioreaktionstechnik in Laborgefäßen
4.1 Allgemeine Betrachtungen
4.2 Beschreibung des kleinsten Bioreaktors
4.3 Leistungseintrag in Kolbenreaktoren
4.4 Sauerstofftransferraten (OTR) in Kolbenreaktoren
5 Up-Stream-Processing
5.1 Lagerung und Logistik
5.2 Anmaischprozesse
5.3 Konditionierungsprozesse
5.4 Reinigungsprozesse (Cleaning In Place, CIP)
5.5 Sterilisationsprozesse (Sterilization In Place, SIP)
5.6 Virusinaktivierung bei Pharmazeutika
6 Stoffumwandlung
6.1 Bildung der Biokatalysatoren (Zellwachstum)
6.2 Beschreibung der Produktbildung
6.3 Enzymkatalysierte biotechnologische Reaktionen
6.4 Sauerstoffversorgung eines Mycel-Pellets
6.5 Modellierung und Simulation
7 Down-Stream-Processing
7.1 Mechanische Trennung
7.2 Zerteilung von Stoffen
7.3 Vereinigung von Stoffen
7.4 Wärmeübertragung
7.5 Thermische Trennung – Destillation, Rektifikation
7.6 Absorption
7.7 Adsorption
7.8 Extraktion
7.9 Kristallisation
7.10 Trocknung
7.11 In vitro Refolding
7.12 Proteinaufreinigung und Chromatographie
8 Integrierte Prozesse und Verfahrensentwicklung
8.1 Aufbau und Darstellung eines Prozesses
8.2 Vorgehensweise bei der Verfahrensentwicklung
8.3 Sicherheitsaspekte bei der Verfahrensentwicklung
8.4 Prozeßintegrierter Umweltschutz
9 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
9.1 Methoden zur Kostenanalyse eines Verfahrens
9.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mittels Short-cut-Methoden
10 Verfahrensbeispiele
10.1 Einleitung
10.2 Allgemeine Prozeßschemata
10.3 Auslegungsbeispiel: β-Galactosidase
Literatur
Stichwortverzeichnis
Winfried Storhas
Fachhochschule Mannheim – Hochschule für Technik und Gestaltung
Fachbereich Biotechnologie und Verfahrenstechnik
Windeckstraße 110
68163 Mannheim
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Ergänzungen zum vorliegenden Text finden Sie unter:<www.fh-mannheim.de/c_mib_62.html>
Bibliografische Information Der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internetüber <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© 2003 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
ISBN 3-527-28866-X
Gedruckt auf säurefreiem Papier.
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
All rights reserved (including those of translation in other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this book, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law.
Print ISBN 9783527288663
Epdf ISBN 978-3-527-66367-5
Epub ISBN 978-3-527-66366-8
Mobi ISBN 978-3-527-66365-1
Dank für besondere Unterstützung
Das Thema dieses Buches erforderte ein sehr interdisziplinäres Zusammenspiel vieler Fachgebiete, die ein einziger Autor allein nicht abdecken kann. Deshalb sei an dieser Stelle mein besonderer Dank ausgesprochen an
Prof. Dr. rer. nat. Günter Claus Fachhochschule Mannheim Technische Mikrobiologie Windeckstraße 110 68163 Mannheim <
>
für die Bearbeitung von
Abschnitt 2.2 „Mikrobiologie“
Prof. Dr. rer. nat. Matthias Mack Fachhochschule Mannheim Technische Mikrobiologie Windeckstraße 110 68163 Mannheim <
>
für die Unterstützung zu
Abschnitt 2.3 und 2.4 „Molekularbiologie und Zellkultur-technologie“
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Trasch Fachhochschule Mannheim Biochemie Windeckstraße 110 68163 Mannheim <
>
für die Bearbeitung von
Abschnitt 2.5 „Biochemie“
Prof. Dipl.-Ing. Michael H. Kopf Pieralisi Deutschland GmbH Ochsenfurter Straße 2 97246 Eibelstadt <
>
für die Unterstützung zu
Abschnitt 2.6, 7.2, 7.11, 7.12 und 10.3.3 „Mechanische Flüssigtrennung, Zentrifugen-technologie, Querstromfiltration, Down-Stream-Processing“
Prof. Dr.-Ing. Werner Liedy Fachhochschule Frankfurt/Main FB2 Informatik- und Ingenieurwissenschaften Privatadresse: Schifferstadter Straße 4 67126 Hochdorf-Assenheim 1 <
>
für die Bearbeitung von
Abschnitt 7.10 „Trocknung“
Vorwort
Die Bioverfahrensentwicklung greift als interdisziplinäres Arbeitsgebiet auf mehrere in ihrem Wesen sehr unterschiedliche Wissensgebiete zurück. Naturwissenschaftliche Wissensgebiete wie die Mikrobiologie, die Molekularbiologie, die Zellbiologie, die Biochemie und auch die Chemie müssen zusammen mit ingenieurtechnischem Fachwissen aus den Bereichen der Elektrotechnik, der Informatik, der Steuerungstechnik, des Maschinenbaus (Werkstoffkunde) und der Verfahrenstechnik mit all den Varianten (Reaktion, Aufarbeitung, Energietechnik, Sicherheitstechnik, Behördenengineering) kooperieren, um der Prozeßentwicklung zum Erfolg zu verhelfen. Nennen wir diese Wissensgebiete „Kulturen“, so ist eine Symbiose im Projektteam erforderlich.
In der Praxis tun sich die „Mischkulturen“ erfahrungsgemäß dann doch sehr schwer, diese Symbiose zu erreichen. Das liegt in der nahezu berührungslosen und strikt kulturbezogenen Ausbildung. Im höchsten Fall sind in der ein oder anderen Ausbildungsrichtung Schnittstellen, sogenannte Übergabestellen, definiert.
Es lag also nahe, ein Werk zu planen, das Symbiosewirkung ausüben kann, indem es tief in die „Kulturen“ hinein auch Inhalte anderer „Kulturen“ treibt, um Impulse auszulösen. So ist es das Anliegen dieses Buchprojektes, sowohl den naturwissenschaftlich ausgerichteten als auch den ingenieurwissenschaftlichen „Kulturen“ ein Werk zur Hand zu geben, das die Chance bietet, sich mit den Blickrichtung der jeweils anderen zu beschäftigen und die eigene Position im Gesamtverbund einer Prozeßentwicklung optimal einzubringen.
Nach dem einleitenden Kapitel, das auf die Potentiale von Bioverfahren hinweist, stellen sich im umfangreichen zweiten Kapitel die einzelnen Wissensgebiete („Kulturen“) wie einzelne Mosaiksteinchen vor, wobei der Blickwinkel auf die Verfahrensentwicklung gerichtet ist. Im folgenden Kapitel soll dann dieser zunächst lose Verbund durch verbindende Elemente vereint (verfugt) werden. Schließlich wird in den letzten Kapiteln noch dem Aspekt Rechnung getragen, daß bereits während der Stammentwicklung die Fragen nach dem möglichen und erforderlichen späteren Maßstab (Reaktor- und Anlagengröße), nach der Sensitivität der Wirtschaftlichkeitsfaktoren und nach den Aufarbeitungswegen, -verfahren und -operationen gestellt werden, weil danach wesentliche Entwicklungsziele (-forderungen) auszurichten sind.
Dieses Buch richtet sich somit an alle, die an irgend einer Stelle einen Beitrag zur Entwicklung eines biotechnologischen Prozesses leisten möchten. Das beginnt an den Hochschulen, wo in allen Fächern der berühmte Blick über den Tellerrand hinaus gewagt und so manche Frage zur eignen Entwicklung gestellt werden kann, und setzt sich in der Industrie in allen Bereichen der Bioverfahrensentwicklung fort.
Zielsetzung diese Buches ist es, allen beteiligten Arbeitsgruppen, die an der Entwicklung eines biotechnologischen Prozesses beteiligt sind, und allen, die sich über die Bioverfahrensentwicklung informieren wollen, die Gelegenheit zu geben, sich ein Gesamtbild zu verschaffen und sich dabei auch in „fremde“ Wissensgebiete ein wenig einlesen zu können. Besondere Anregungen sollen dabei die Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit der Prozesse vermitteln. Weiterführende Literaturhinweise helfen zur Vertiefung in das jeweilige Wissensgebiet.
Für die Unterstützung in vielen Details möchte ich mich bei Herrn Peter Kalinic, Herrn Dr. Bryan Cooper, Herrn Dipl.-Ing. Ralf Gengenbach, Herrn Dipl.-Ing. (FH) Michael Reuter und Herrn Dipl.-Ing. (FH) Dirk Hoffmann bedanken. Die WILEY-VCH Verlag GmbH sorgte in vorzüglicher Weise für alle mögliche Unterstützung, wofür ich dem Team, allen voran Frau Dr. Barbara Böck und Herrn Peter Biel, danken möchte. Nicht zuletzt bedanke ich mich noch bei meiner Frau Anna für ihr Verständnis und ihre unendliche Geduld während der gesamten Projektphase.
Winfried Storhas
Formelzeichenerklärung
Indexerklärung
Abkürzungsverzeichnis
0
Anfangswert/bedingung
ADP
Adenosindiphosphat
AEX
Anion Exchange (Chromatographie)
AMP
Adenosinmonophosphat
AS-
Aminosäure-/Antischaum-
ASA
Abwassersterilisationsanlage
AT
Antithrombin
ATCC
American Type Culture Collection
ATP
Adenosintriphosphat
BG
Berufsgenossenschaft
BimSchG
Bundes-Immisionsschutz-Gesetz
BIR
Bioreaktor
BLS
Betriebs-Leit-System
BP
Bottomphase
BSB
Biologischer Sauerstoffbedarf
Bti
Bazillus thuringensis isrealgensis
BTM
Biotrockenmasse
CAE
Computer Aided Engineering
CEN
European Committee for Standardization
CFF
Cross Flow Filtration
CHO
Chinese Hamster Ovary
CIP
Cleaning In Place
CMC
Carboxymethylcellulose
CO
2
Kohlendioxid
CPR
Kohlenstoffproduktionsrate
CBS
Centraalbureau voor Schimmelcultures
CSB
Chemischer Sauerstoffbedarf
D
Dampf
DEAE
Diethylaminoethyl
DGMK
Deutsche Gesellschaft für Mineralöl- und Kohlewirtschaft
DIN
Deutsche Industrie Norm
DKFZ
Deutsches Krebsforschungszentrum
DKG
Diketo-gluconsäure
DNA
Desoxyribonukleinsäure
DO
Dissolved Oxygen
DSMZ
Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen
DV
Datenverarbeitung
E. coli
Escherichia coli
EBA
Expanded Bed Adsorption
EBI
European Bioinformatics Institute
ED
Elektrodialyse
EDTA
Ethylendinitrilotetraessigsäure
EPO
Erythropoietin
ETH
Eidgenössische Technische Hochschule
EtOH
Ethanol
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
F&E
Forschung und Entwicklung
FDA
Food and Drug Administration
FDP
Fructosediphosphat
FIA
Flow Injectiojn Analyser
FID
Flammen-Ionisations-Detektor
FKS
fötales Kälberserum
FSD
Fluidized Spry Drier
FTU
Formazin Trübungsstandard
Fuzzy
„flaumig – gestückelte Modellierung“
GC
Gaschromatoraphie
GenTG
Gentechnik-Gesetz
GenTSV
Gentechniksicherheitsverordnung
GewO
Gewerbeordnung
GMP
Good Manufacturing Practice
GS
Grenzschicht (laminare)
GVO
Genetisch veränderte Organismen
GU
Gigaunits
HBS
Hydroxy-Butter-Säure
HBV
Hepatitis B Virus
HCV
Hepatitis C Virus
HEK
Human Embryonic Kidney
HEPES
4-(2-
H
ydroxy
e
thyl)-1-
p
iperazin
e
than-
s
ulfonsäure
HIC
Hydrophoben Interaktionschromatographie
HIV
Immonodeficiency Virus
HOSCH
Hochleistungsschwebstoffilter (engl. HEPA)
HPDC
Hoch-Druck-Dünnschicht-Chromatographie
HPLC
Hoch-Druck-Flüssigkeits-Chromatographie
Hsp
Hitzeschockprotein
IB
Inclusion body
ICI
ICI-Group Billingham GB, Imperial Chemical Industries
idem
der-, die-, dasselbe
IL
Interleukin
InterMIG
Interferenz-Mehrstufen-Impuls-Gegenstromrührer
in-vitro
im Reagenzglas durchgeführt
in-vivo
am lebenden Organismus beobachtet
IPTG
Isopropyl-
ß
-D-1-thiogalactopyranosid
IQ
Installation Qualification
ISO
Interational Organization of Standardization
ISPE-Guide
International Society for Pharmacoepidemiology
K
Kondensat
kb
Kilobasen
kbp
tausend Basenpaare
KLG
Keto-L-gluconsäure
KS
Kälberserum
KW
Temperier/Kühlmedium (Wasser)
Labis
hitzelabile Keime
LAG
Länderausschuß Gentechnik
LCR
Locus-Control-Region
LDH
Lactat-Dehydrogenase
LKW
Lastkraftwagen
LP
Lipoproteine
LPS
Lipopolysaccharide
Mac
Macintosh
MAC
Macintosh Computer
MAK
Monoklonaler Antikörper
MAR
Matrix Attachment Regions
MCB
Master Cell Bank
MDCK
Madin und Darbin, Cockerspaniel, Konti
MES
Manager Execution System
MF
Mikrofiltration
MG
Molten globule
MIG
Mehrstufen-Impuls-Gegenstromrührer
MQW
Maisquellwasser
mRNA
membrangebundene RNA
MU
Millionen Units
Mz
Mehrzahl
NAD
Nicotinamidadenindinucleotid
NADH
reduziertes NAD
NCTC
National Collection of Type Cultures
NH
3
Ammoniak
NMR
Nuklear Resonanz Spektroskopie
OD
Optische Dichte
ODR
Sauerstoffbedarfsrate
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development
OQ
Operational Qualification
OTR
Sauerstofftransferrate, Oxygen Transfer Rate
OUR
Sauerstoffaufnahmerate
PBS
Phosphate Buffered Saline
PC
Personal Computer
pCO
2
Kohlendioxidpartialdruck
PDI
Protein-Disulfid-Isomerase
PEC
Predicted Environmental Concentration
PEG
Poly-Ethylenglycol
PG
Phasengrenze
PIC
Pressure Indication Control
PIC
Pharmaceutical Inspection Convention
PK
Phasenkern
PKW
Personenkraftwagen
PLT
Prozeß-Leit-Technik
PNEC
Predicted Non Effective Concentration
PNK
Prozeßnahe Komponente
pO
2
Sauerstoffpartialdruck
PP
Polypropylen
PPI
Peptiyl-Prolyl-
cis-trans
-Isomerase
PQ
Performance Qualification
PS
Pferdeserum
PSG
subgenomischer Promotor
PV
Pervaporation
PVC
Polyvinylchlorid
rER
rauhes Endoplasmatisches Retikulum
Resis
hitzeresistente Keime
RNA
Ribonukleinsäure
RO
Umker(Reverse)Osmose
ROP
Repressor of Primer
RPC
Reverse-Phasen-Chromatographie
rpm
rounds per minute
RQ
Respirationsquotient
RZA
Raum-Zeit-Ausbeute
SAD
Sterilisationsarbeitsdiagramm
SAR
scaffold attachment regions
SCP
Single Cell Protein, Einzellerprotein
SDS
Sodium Dodecyl Sulfat
SEC
Sice Exclusion Chrom./Gelfiltration
SIP
Sterilisation In Place
SPS
Speicherprogrammierbare Steuerung
SWKI
Schweizer Verein von Wärme- und Klimaingenieuren
T,H-
Temperatur, Enthalpie- (Diagramm)
TA
Technische Arbeitsregeln (Luft etc.)
TCC
Tricarbonsäurezyklus
TFH
temperaturaktivierte Flüssigphasenhydrolyse
TIC
Temperature Indication Control
TIS
Temperature Indication Switch
TNF
Tumor Necrosis Factor
TP
Topphase
TPA
Tissue Plaminogen Activator
tRNA
Transfer-Ribonukleinsäure
TüV
Technischer Überwachungsverein
UF
Ultrafiltration
ULS
Unternehmen-Leit-System
UTR
untranslatierte Region
UVG
Unvorhergesehenes
UV-
Ultraviolettes (Licht)
UVV
Unfallverhütungsvorschriften
VDI
Verein Deutscher Ingenieure
VE-
vollentsalztes (Wasser)
VWZ
Verweilzeit
W(A)T
Wärme(Aus)tauscher
WCB
Working Cell Bank
WTW
Weilheimer Technologie Werke
ZKBS
Zentrale Kommission für Biologische Sicherheit
1
Leistungsfähigkeit der Bioverfahrenstechnik
1.1 Allgemeine Betrachtungen
Die Biotechnologie wird seit Jahrzehnten, auch aus Sicht der Verfahrensentwicklung, als die Technologie der Zukunft gehandelt. Ursprünglich glaubte man, sie als Ergänzung oder sogar als Ersatz zur Chemie etablieren zu können, doch frühere Euphorien wichen schnell zugunsten realistischer, wirtschaftlicher Einschätzungen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























