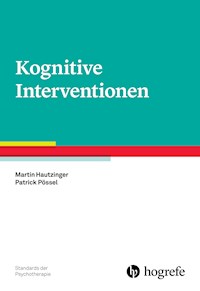16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bei einer bipolaren Störung handelt es sich um eine chronische psychische Erkrankung, die meist früh im Leben beginnt und das gesamte Erwachsenenalter über episodisch auftritt. Sie zeichnet sich durch wechselnde, depressive und (hypo-)manische Krankheitsepisoden aus. Neben der Medikation mit sogenannten Stimmungsstabilisierern empfehlen die Behandlungsleitlinien eine psychotherapeutische Begleitbehandlung. Dabei hat die Psychotherapie vor allem das Ziel, auf das Verhalten und die Alltagsstruktur stabilisierend einzuwirken, die Medikamenteneinnahme zu fördern und damit neue Erkrankungsepisoden zu verhindern. Die Neubearbeitung des Buches beschreibt die Symptomatik Bipolarer Störungen und geht dabei auch auf Diagnosekriterien und -einteilungen nach ICD-11 (u. a. Bipolar-I- und Bipolar-II-Störungskriterien) ein. Zudem wird aktuelles Wissen zur Entstehung der Störung und zu diagnostischen Verfahren vermittelt. Im Zentrum des Buches steht ein flexibel einsetzbares kognitiv-verhaltenstherapeutisches Programm, das um therapeutische Materialien ergänzt wird. Dieses Programm besteht aus mehreren Modulen und kann sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting sowie unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen (stationär, ambulant, wöchentlich, ganztägig) erfolgreich eingesetzt werden. In den Modulen geht es unter anderem um Psychoedukation und Selbstbeobachtung, das Erkennen von Frühwarnsymptomen, die Erarbeitung einer Alltagsstruktur, die Problembewältigung und die Notfallplanung. Schließlich werden aktuelle Befunde zur Wirksamkeit von Psychotherapie dargestellt, die den rückfallprophylaktischen Nutzen der Behandlung verdeutlichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Martin Hautzinger
Thomas D. Meyer
Bipolare Störungen
2., überarbeitete Auflage
Fortschritte der Psychotherapie
Band 43
Bipolare Störungen
Prof. Dr. Martin Hautzinger, Prof. Dr. Thomas D. Meyer
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Martin Hautzinger, Prof. Dr. Tania Lincoln, Prof. Dr. Jürgen Margraf, Prof. Dr. Winfried Rief, Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffier
Die Reihe wurde begründet von:
Dietmar Schulte, Klaus Grawe, Kurt Hahlweg, Dieter Vaitl
Prof. Dr. Martin Hautzinger, geb. 1950. 1971 – 1976 Studium der Psychologie in Bochum und Berlin. 1976 – 1984 Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Assistent am Institut für Psychologie der Freien Universität Berlin. 1980 Promotion. 1981 – 1983 Gastwissenschaftler an der University of Oregon, Eugene. 1984 – 1990 Wissenschaftlicher Assistent und Hochschuldozent an der Fachgruppe Psychologie der Universität Konstanz. 1987 Habilitation. 1990 – 1996 Professor für Klinische Psychologie an der Johann-Gutenberg-Universität Mainz. 1996 – 2019 Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Seit 2019 Seniorprofessor an der Universität in Tübingen.
Dr. Thomas D. Meyer, geb. 1968. 1987 – 1993 Studium der Psychologie in Mainz. 1997 Promotion. 1997 – 2006 Wissenschaftlicher Assistent in der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie am Psychologischen Institut der Universität Tübingen. 2003 Habilitation. 2006 apl-Professur an der Universität Tübingen. 2006 – 2014 Senior Lecturer in Clinical Psychology an der Newcastle University, Großbritannien. Seit 2014 Associate professor am Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at McGovern Medical School in Houston, Texas, dort Direktor des Psychological Intervention & Research Program on Mood Spectrum Disorders und Co-Direktor der UT Brain Collection.
Die erste Auflage des Bandes ist unter dem Titel „Bipolar affektive Störungen“ erschienen.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
2., überarbeitete Auflage 2025
© 2011 und 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3231-1; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3231-2)
ISBN 978-3-8017-3231-8
https://doi.org/10.1026/03231-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Die Inhalte dürfen nicht zur Entwicklung, zum Training und/oder zur Anreicherung von KI-Systemen, insbesondere von generativen KI-Systemen, verwendet werden. Das Verbot gilt nicht, soweit eine gesetzliche Ausnahme vorliegt.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Über die Autor:innen
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Kompetenzziele und Lernkontrollfragen
VInhaltsverzeichnis
Bipolare Störungen
1
Beschreibung der bipolaren Störungen
1.1
Erscheinungsbild
1.2
Diagnose und Differenzialdiagnose
1.2.1
Diagnosekriterien
1.2.2
Differenzialdiagnostische Überlegungen
1.2.2.1
Abgrenzung zur Schizophrenie und zum Wahn
1.2.2.2
Abgrenzung zu Persönlichkeitsstörungen
1.3
Komorbiditäten
1.4
Epidemiologie
1.5
Verlauf und Prognose
1.6
Suizidalität
2
Störungswissen und Störungsmodelle
2.1
Genetik
2.2
Neurobiologie
2.3
Neuropsychologie
2.4
Verhaltensaktivierungssystem
2.5
Biorhythmus und soziale Zeitgeber
2.6
Integration von Verhaltensaktivierung und Biorhythmus
2.7
Temperament und Persönlichkeit
2.8
Kognitionen und Informationsverarbeitung
2.9
Multifaktorielle (Diathese-Stress-)Modelle
3
Diagnostischer Prozess
3.1
Verfahren zur Vorauswahl (Screening)
3.2
Interviews zur syndromalen Diagnostik
3.3
Akute Symptomatik
3.3.1
Selbstbeurteilungsinstrumente
3.3.2
Fremdbeurteilungsinstrumente
3.4
Therapiebezogene Diagnostik und praktische Empfehlungen
4
Behandlung und Rückfallprophylaxe
4.1
Psychopharmaka in Akutbehandlung und Phasenprophylaxe
4.2
Psychoedukation
4.3
Psychotherapien zur Rückfallprophylaxe
4.3.1
Familienfokussierte Therapie (FFT)
4.3.2
Interpersonelle und Soziale Rhythmus-Therapie (IPSRT)
4.3.3
Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)
4.4
Besonderheiten einer Psychotherapie bei bipolaren Störungen
4.5
Elemente einer wirksamen Psychotherapie
4.5.1
Motivation, Psychoedukation und Selbstbeobachtung
4.5.2
Selbstbeobachtung, Normalität und Warnsignale
4.5.3
Alltagsstruktur, Aktivitäten und Kognitionen
4.5.4
Problembewältigung, Achtsamkeit und interpersonelle Kompetenzen erwerben
4.5.5
Notfallplanung und Krisenmanagement
4.6
Remediationstraining
5
Effektivität und empirische Evidenz
6
Weiterführende Literatur
7
Literatur
8
Kompetenzziele und Lernkontrollfragen
Kompetenzziele
Lernkontrollfragen
9
Anhang
Young Mania Rating Scale (YMRS)
Stimmungstagebuch
Arbeitsblatt: „Was ist, wenn …“
Arbeitsblatt: Wochenplan zur Alltagsgestaltung und zum Aufbau angenehmer Tätigkeiten
Arbeitsblatt: Besser planen
Karte
Kurzleitfaden für eine therapiebezogene Diagnostik
Hinweise zu den Karten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Stimmungsverläufe bei Bipolar-I-Störung, Bipolar-II-Störung und Zyklothymer Störung laut ICD-11
Abbildung 2: Differenzialdiagnostischer Entscheidungsbaum für bipolare Störungen
Abbildung 3: Modellvorstellungen bipolarer Störungen
Abbildung 4: Integriertes Modell zur Hypersensitivität des Verhaltensaktivierungssystems (BAS) und des sozialen, zirkadianen Biorhythmus bei bipolaren Störungen (nach Alloy et al., 2015)
Abbildung 5: Kognitiv-behaviorale Aufschaukelung hin zu einem manischen Zustand (SORC-Modell)
Abbildung 6: Vereinfachte Heuristik zum Verständnis der Entstehung und des Verlaufs bipolarer Störungen
Abbildung 7: Beispiel einer Fallkonzeption bei einem Patienten mit manischen Symptomen
Abbildung 8: „Arbeitsblatt: Depression“ zur Veranschaulichung der Kriterien einer Depression
Abbildung 9: „Arbeitsblatt: Manie“ zur Veranschaulichung der Kriterien einer (Hypo-)Manie
Abbildung 10: Integratives, multifaktorielles Störungsmodell der bipolaren Störung
Abbildung 11: Arbeitsblatt: Life Chart (eigene Krankengeschichte)
Abbildung 12: Arbeitsblatt: Realitätstesten – Beispiel
Abbildung 13: Kommunikationsmodell
Abbildung 14: Notfallplanung
Abbildung 15: Verlauf (geglättete Überlebenskurven) einer Psychotherapiegruppe (PET plus Medikation) und einer Kontrollgruppe (TAU, Medikation plus übliche psychiatrische Behandlung) über fünf Jahre (Colom et al., 2009)
Abbildung 16: Kaplan-Meier-Überlebenskurven nach den Daten von Hautzinger und A2 BipoLife Consortium (2024) zu KVT
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Kriterien für eine manische Episode nach ICD-11 (WHO, 2019) und DSM-5 (APA, 2018)
Tabelle 2: Kriterien für eine hypomanische Episode nach ICD-11 (WHO, 2019) und DSM-5 (APA, 2018)
Tabelle 3: Kategorisierung „bipolarer“ Verhaltensdimensionen bezogen auf das „Behavioral Activation System“
Tabelle 4: Psychopharmaka bei bipolaren Störungen
Tabelle 5: Typische depressive und hypomanische Denkfehler
Tabelle 6: Probleme richtig angehen
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
11 Beschreibung der bipolaren Störungen
Affektive Störungen lassen sich in uni- bzw. monopolar verlaufende Depressionen und bipolare Störungen unterteilen, wobei letztere früher unter dem Begriff „manisch-depressiv“ bekannt waren. Der Hauptunterschied zwischen unipolaren und bipolaren Störungen ist die Abwesenheit bzw. das Vorliegen von Phasen maniformer Symptomatik, also von Manien oder Hypomanien (leichter ausgeprägten Manien). Obwohl manche Patienten mit bipolaren Störungen ausschließlich Manien erleben, dominieren depressive Episoden im Verlauf bipolarer Störungen.
Historisches Beispiel: Der Komponist Robert Schumann
Robert Schumann (1810 – 1856), ein weltberühmter Komponist und Dirigent, sagte über sich, dass er sich „oft sehr wohl fühle, aber noch viel öfter zum Erschießen melancholisch“ und erfand in seinen Tagebüchern die Figuren „Florestan“ (entschieden, aktiv, impulsiv) und „Eusebius“ (melancholisch, ängstlich, selbstzweifelnd), die seine unterschiedlichen Gemütszustände repräsentierten.
In Schumanns Familie sind Depressionen (Vater, Schwester, Sohn) und Impulsivität (Mutter, Sohn), Suizide (Schwester) und Drogenprobleme (Sohn, er selbst) bekannt sowie zahlreiche belastende Lebensereignisse (Tod des Vaters mit 14, Tod der Schwägerin mit 19, Tod des Bruders, Tod eines Sohnes, Verweigerung der Heirat der ersten Geliebten, Lähmung der rechten Hand, Mobbing im Beruf, Arbeitsplatz- und Wohnortwechsel). Hinzu kam, dass Robert Schumann eine begabte und beliebte Ehefrau hatte, die selbst Pianistin war und die in der damaligen Zeit zum Unmut ihres Ehemannes viel erfolgreicher war als er. Ihr wird außerdem ein Liebesverhältnis zu einem ebenfalls weltberühmten Komponisten und Hausfreund der Familie Schumann nachgesagt, was allerdings nie belegt wurde.
Robert Schumanns Krankheit begann mit allmählich zunehmender depressiver Symptomatik („Eusebius“) im Alter von 14 Jahren. Mit 19 Jahren ist eine erste und mit 23 Jahren eine zweite depressive Episode belegt. Mit 24 Jahren ist eine erste hypomanische Episode („Florestan“) mit gesteigerter Produktivität belegt, die über ein Jahr anhielt. Mit 28 Jahren erlitt er dann eine dritte depressive Episode mit einer langanhaltenden Schaffenskrise. Mit 30 Jahren trat eine zweite, länger anhaltende hypomanische Phase auf. Mit 34 Jahren und erneut mit 44 Jahren sind wei2tere schwere depressive Episoden, zum Teil mit psychotischen Symptomen, und ein Suizidversuch belegt. Dazwischen, im Alter von 39 Jahren, lässt sich eine (hypo-)manische Episode nachweisen. Die verschiedenen Erkrankungsepisoden wechseln sich ab mit Phasen des Normalbefindens, das jedoch von Impulsivität, Reizbarkeit, Ängstlichkeit und Empfindlichkeit gekennzeichnet ist.
1.1 Erscheinungsbild
Depressionen sind gekennzeichnet durch niedergeschlagene, dysphorische Stimmung gepaart mit Antriebslosigkeit, Interessenverlust sowie Veränderungen im Appetit sowie im Schlaf- und Konzentrationsvermögen. Dies geht einher mit Selbstwertproblemen bis hin zu Überzeugungen der Wertlosigkeit, Schuldgefühlen und tiefer Hoffnungslosigkeit, was dann oft in Suizidgedanken und Suizidhandlungen gipfelt. Manien fallen dadurch auf, dass der Antrieb, der Selbstwert und das Aktivitätsniveau gesteigert und die Stimmung gehoben ist. Es werden Pläne gemacht und hohe und weitreichende Ziele formuliert. Dies geht einher mit einer deutlich gehobenen, ja euphorischen Stimmung. In manchen Fällen sind Betroffene jedoch eher reizbar, ärgerlich und ungeduldig. Als typisch wird zudem ein gesteigertes Selbstwertgefühl angesehen, das bis zu grandiosen Wahnvorstellungen expandieren kann. Ein verringertes Schlafbedürfnis wird ebenfalls sehr oft berichtet. Betroffene sind nach vier bis fünf Stunden Schlaf bereits ausgeruht und fit, obwohl dieselbe Person sonst meist sieben bis acht Stunden Schlaf zur Erholung benötigt. Manche Betroffene schlafen auch so gut wie gar nicht mehr, was dann oft sehr schnell zum physischen und psychischen (psychotischen) Zusammenbruch führt.
Wenn man einer Person gegenübersitzt, die von depressiven Symptomen berichtet, erlaubt dies noch keine Aussage darüber, um welche Form der affektiven Störung es sich handelt. Erst wenn Hinweise auf maniforme Episoden, also Phasen mit manischen oder hypomanischen Symptomen vorliegen bzw. fehlen, lässt sich entscheiden, ob es sich bei der affektiven Störung um eine unipolare Depression oder um eine bipolare Störung handelt.
Beispiel: Manie mit psychotischen Symptomen, mögliche Bipolar-I-Störung
Eine Patientin, Mutter von zwei Kindern, berichtete: „Wenn alles beginnt, fühle ich mich gut, bin nicht mehr so schüchtern und gehe von mir aus auf Leute zu (z. B. bei Partys oder Elternabenden). Das erleben die anderen und selbst mein Mann als positiv. Ich bin nicht mehr so darauf aus, den Haushalt zu schaffen und alles richtig zu machen. Ich fühle mich frei von all den Lasten auf meinen Schultern. Ich will ins Kino oder Theater 3gehen, ich möchte Wochenendausflüge machen. Alles erscheint so leicht und lebendig. Dieser gute Zustand kann Wochen anhalten. Alles wird dann jedoch zur Katastrophe, wenn ich gar keinen Schlaf mehr brauche. Dann bin ich nicht mehr ich selbst. Ich werde zur ‚Mutter Gottes‘ oder zu ‚Harry Potter‘ und muss meine Kinder vor dem Teufel oder ‚Voldemort‘ schützen. Das letzte Mal wollte ich mit meinen Kindern zum Bahnhof und nach dem Bahnsteig suchen, der uns – wie in den Büchern von Rowling – ins sichere Hogwarts bringen sollte. Das war mitten in der Nacht, meine Kinder bekamen Angst vor mir, sie verstanden mich nicht. Zum Glück hat mich mein Mann davon abgehalten und mich in die Klinik gebracht.“
Bei der Patientin im Beispiel liegt eindeutig eine „Manie mit psychotischen Merkmalen“ vor. Wobei dies nicht unbedingt typisch ist. Sich für Jesus, Napoleon oder die Mutter Gottes zu halten, ist kein notwendiges Kriterium für eine Manie. Entscheidend ist, dass die Konsequenzen, die sich aus der Symptomatik ergeben, für die Person bzw. die Familie deutlich negativ und für andere meist unmittelbar ersichtlich negativ sind, etwa ungezügeltes Einkaufen bis hin zum finanziellen Ruin, hoch riskante geschäftliche bzw. berufliche Entscheidungen (z. B. spontane Kündigung eines Arbeitsverhältnisses) oder auch ungeschützte bzw. gesteigerte sexuelle Kontakte, eventuell mit verschiedenen Partnern. Negative Folgen des eigenen Verhaltens werden oft nicht mehr berücksichtigt, ignoriert oder falsch eingeschätzt. So sind Menschen mit einer bipolaren Störung gehäuft unter der Personengruppe zu finden, die Verkehrsdelikte unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss begehen.
Während eine Manie durch das „grenzüberschreitende Verhalten“ auch für Außenstehende meistens leicht erkennbar ist, wird eine Hypomanie oft nur von Angehörigen und engeren Freunden als „abnorm“ und untypisch für die jeweilige Person wahrgenommen. Er oder sie zeigt Verhaltensweisen, die enge Vertraute als „untypisch“ erleben. Dies wird auch im vorherigen Beispiel deutlich, denn bevor die Patientin manisch wurde, erlebte sie einen hypomanischen Zustand und ging im vertrauten Kontext (z. B. beim Elternabend in der Schule) auf andere zu, beteiligte sich von sich aus an Gesprächen oder zeigte mehr Interesse an kulturellen Aktivitäten. Dies entspricht nicht dem, was ihre Eltern oder ihr Ehemann als ihr typisches Verhalten beschreiben würden, auch wenn Dritte dies nicht unbedingt als auffällig bewerten würden.
Beispiel: Hypomanische Symptomatik, mögliche Bipolar-II-Störung
Herr M. (25 Jahre) wurde von seiner Partnerin und seinen Freunden als „zuverlässiger und umgänglicher Typ“ beschrieben, „wenn er nicht seine Phasen hat“. Das Wort „Phasen“ war dabei nicht im klinischen Sinn gemeint, sondern bezeichnete einfach nur einen Zeitraum von einigen Tagen bis einer Woche, in denen Herr M. aus Sicht seiner Partnerin und 4seiner Freunde zu einem „selbstbezogenen Kotzbrocken mutierte“. Sie führten dies meistens auf vermehrten Stress im Studium und in seinem Job als wissenschaftliche Hilfskraft zurück, da er in diesen Zeiten vermehrt an der Universität arbeitete und oft bis spät abends Überstunden machte. Wenn er dann am Wochenende mit ihnen unterwegs war, wirkte er ständig auf dem Sprung, amüsierte sich gern auf Kosten anderer (z. B. mit Witzen, Seitenhieben), flirtete aus Spaß mit anderen Frauen und manchmal auch Männern und war in Unterhaltungen sehr selbstbezogen und bewertend. Alle wussten, dass Herr M. seit seiner Jugend schon mindestens zwei- oder dreimal eine Depression hatte, aber dass diese kaum erträglichen Phasen hypomanische Phasen sind und es sich klinisch betrachtet um eine Bipolar-II-Störung handelt, hatte niemand in Betracht gezogen.
1.2 Diagnose und Differenzialdiagnose
Der Hauptunterschied zwischen unipolaren Depressionen und bipolaren Störungen liegt in der Abwesenheit bzw. dem Vorliegen von Phasen maniformer Symptomatik. Obwohl Depressionen im Verlauf bipolarer Störungen hinsichtlich Häufigkeit und Dauer dominieren (z. B. Baldessarini et al., 2020; Judd et al., 2003), wird im Folgenden primär auf die Diagnostik maniformer Zustände eingegangen. Hinsichtlich der Diagnostik depressiver Symptome und depressiver Episoden wird auf Hautzinger (2021) verwiesen.
Wie bereits erwähnt, ist bei bipolaren Störungen die erste Krankheitsepisode nur in 50 % der Fälle maniform und erlaubt somit eine unmittelbare Diagnose einer bipolaren Störung (Goodwin & Jamison, 2007). Wenn die erste Episode eine Depression ist, kann es sich um eine einzelne depressive Phase, um den Beginn einer rezidivierenden unipolaren Depression oder um die Erstmanifestation einer bipolaren Störung handeln. Deswegen wird nach Indikatoren gesucht, die eine zuverlässige Unterscheidung in unipolare Depressionen und bipolare Störungen erlauben.
Oft wird berichtet, dass sogenannte „atypische depressive Symptome“ für bipolare Störungen typisch seien. Dazu zählen unter anderem vermehrter Appetit, vermehrter Schlaf, emotionale Reagibilität und interpersonelle Sensitivität.
Außerdem wird immer wieder hervorgehoben, dass Depressionen im Rahmen bipolarer Verläufe von der Empfindung her abrupter beginnen, während sich Depressionen im Rahmen einer unipolaren Störung langsamer entwickeln und allmählich intensivieren. Dies könnte allerdings mehr eine Folge der klinischen Beobachtung sein, wenn direkte Wechsel von einer Manie oder 5Hypomanie in eine Depression passieren, und trifft eventuell nicht zu, wenn die Depression unabhängig von einer maniformen Episode auftritt.
Merkmale zur Unterscheidung unipolarer und bipolarer Depression
Als Indikatoren für die Differenzierung zwischen unipolaren Depressionen und Depressionen im Rahmen einer bipolaren Störung gelten folgende Symptome (z. B. Leonpacher et al., 2015; Leseur et al., 2024):
Schlafstörungen: Ein- und Durchschlafstörungen und frühmorgendliches Erwachen werden häufiger von Patienten mit unipolaren Depressionen berichtet, während vermehrter Schlaf und vermehrtes Schlafbedürfnis eher Depressionen im Rahmen einer bipolaren Störung kennzeichnen.
Psychomotorik: Hierbei geht es um spontane oder bewusst herbeigeführte zielgerichtete motorische Tätigkeiten, wobei zwischen psychomotorischer Unruhe (Agitiertheit) und psychomotorischer Verlangsamung (Hemmung) unterschieden wird. Anzeichen für psychomotorische Unruhe sind z. B., wenn jemand nicht stillsitzen kann bzw. im Extremfall ständig auf und ab gehen muss. Psychomotorische Verlangsamung zeigt sich z. B. in Form von verzögerten Reaktionen, einer verlangsamten Sprache und insgesamt langsameren Bewegungen. Unipolare Depressionen gehen verstärkt mit Unruhe einher, die oft auch nur unterschwellig als innere Unruhe berichtet wird. Bei Depressionen im Rahmen einer bipolaren Störung steht oft die Verlangsamung und Verhaltenshemmung im Vordergrund.
Appetit: Appetitmangel und reduzierte Nahrungsaufnahme (Gewichtsverlust) gelten als typisch für unipolare Depressionen, während bei Depressionen im Rahmen einer bipolaren Störung oft vermehrter Appetit und gesteigerte Nahrungsaufnahme berichtet werden.
Psychotische Symptome: Halluzinationen und Wahnvorstellungen treten häufiger bei bipolaren Depressionen als bei unipolaren Depressionen auf.
Obwohl klinische Erfahrungen diese Unterschiede zu bestätigen scheinen, sind die empirischen Belege nicht überzeugend und die Unterschiede zwischen unipolaren und bipolaren Depressionen nicht so ausgeprägt, dass sie ohne genaue Anamnese der Krankengeschichte eine Differenzialdiagnose erlauben.