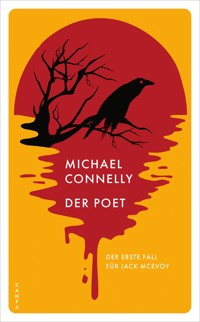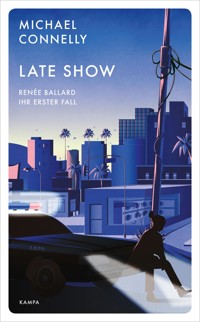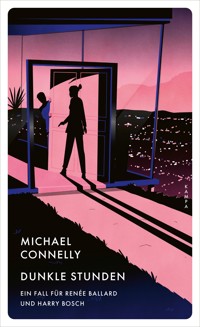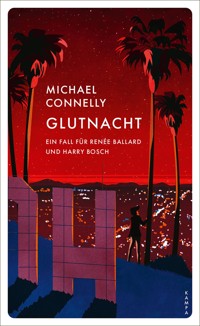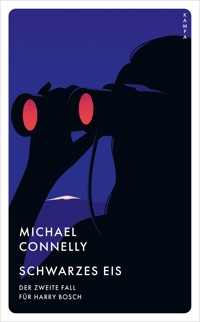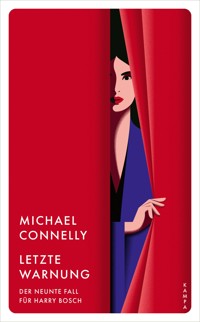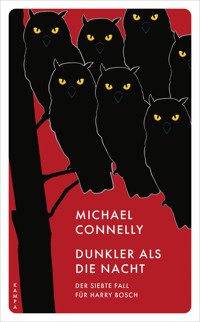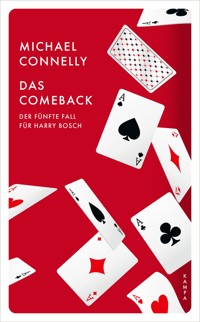12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Harry Bosch
- Sprache: Deutsch
1992 eskalieren Proteste in den Straßen von Los Angeles, die Stadt versinkt im Chaos. In einer abgeschiedenen Gasse wird die Leiche der dänischen Kriegsberichterstatterin Anneke Jespersen gefunden. Todesursache: ein Kopfschuss aus nächster Nähe. Detective Harry Bosch sichert den Tatort inmitten der Aufstände. Die Indizien sind rar, einzig eine Patronenhülse hat der Täter zurückgelassen. Der Fall bleibt ungelöst, doch an Bosch nagt ein Gedanke, der zur Überzeugung wird: Jespersen war kein zufälliges Opfer. Zwanzig Jahre stehen die Ermittlungen still, dann führen Hülsen an einem anderen Tatort Bosch zu der Waffe, mit der auch Jespersen ermordet wurde: eine Pistole des US-Militärs aus dem Zweiten Golfkrieg. Bosch nimmt den Fall wieder auf, denn er weiß: Irgendwo muss sie sein, die Spur, die alle losen Fäden verbindet, das fehlende Puzzleteil, die »Black Box«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michael Connelly
Black Box
Der 16. Fall für Harry Bosch
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Für alle Leser, die Harry Bosch
zwanzig Jahre lang am Leben gehalten haben.
Vielen, vielen Dank.
Und für die Männer, die an jenem Tag des Jahres 1992
die Menge geteilt und mich durchgelassen haben.
Auch ihnen vielen Dank.
Schneewittchen
1992
In der dritten Nacht stieg die Zahl der Toten so massiv und so rasch an, dass viele Mordermittlerteams der jeweiligen Polizeireviere aus den vordersten Linien der Unruhenbekämpfung abgezogen und nach dem Rotationsprinzip bei Notfällen in South Central eingesetzt wurden.
Detective Harry Bosch und sein Partner Jerry Edgar wurden von der Hollywood Division abgestellt und einem mobilen B-Schicht-Team zugeteilt, zu dem aus Sicherheitsgründen auch zwei mit Schrotflinten bewaffnete Streifenpolizisten gehörten. Sie wurden überall dorthin geschickt, wo Not am Mann war – wo eine Leiche auftauchte. Das Vier-Mann-Team war in einem schwarz-weißen Streifenwagen unterwegs und fuhr von Tatort zu Tatort, ohne sich lange an einem aufzuhalten. Das war zwar nicht die korrekte Art, Mordermittlungen durchzuführen, nicht einmal annähernd, aber mehr war angesichts der unwirklichen Verhältnisse einer aus den Fugen geratenen Stadt nicht machbar.
South Central war ein Kriegsgebiet. Überall brannte es. Horden von Plünderern zogen von Geschäft zu Geschäft, und mit dem über der Stadt aufsteigenden Rauch verflüchtigten sich auch noch die letzten Reste von Moral und Anstand. Die Gangs von South L.A. waren angetreten, die Herrschaft über die Dunkelheit an sich zu reißen, und hatten ihre internen Streitigkeiten beigelegt, um eine Einheitsfront gegen die Polizei zu bilden.
Bereits über fünfzig Menschen waren ums Leben gekommen. Ladenbesitzer hatten Plünderer erschossen, Nationalgardisten hatten Plünderer erschossen, Plünderer hatten Plünderer erschossen, und dann waren da noch die anderen – Mörder, die das Chaos der Unruhen nutzten, um alte Rechnungen zu begleichen, die nichts mit den aktuell hochschlagenden Emotionen und den auf der Straße ausgetragenen Kämpfen zu tun hatten.
Zwei Tage zuvor waren die rassischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen, die unter der Stadt verliefen, mit seismischer Wucht an die Oberfläche gebrochen. Der Prozess gegen vier LAPD-Officer, die beschuldigt worden waren, einen schwarzen Autofahrer nach einer wilden Verfolgungsjagd brutal verprügelt zu haben, war mit Freisprüchen für die Angeklagten zu Ende gegangen. Die Bekanntgabe der Entscheidung der ausschließlich aus Weißen bestehenden Jury in einem siebzig Kilometer entfernten Vorstadtgericht hatte in South Los Angeles sofortige Wirkung gezeigt. Kleine Gruppen aufgebrachter Menschen versammelten sich an Straßenecken, um die Ungerechtigkeit des Urteils anzuprangern. Und rasch nahmen die Proteste gewalttätige Züge an. Die stets wachsamen Medien berichteten live aus der Luft und übertrugen die Bilder in jeden Haushalt der Stadt und bald auch der Welt.
Die Polizei wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Als das Urteil publik wurde, war der Polizeichef nicht im Parker Center, sondern auf einer politischen Veranstaltung. Auch andere Mitglieder des Führungsstabs waren nicht auf ihrem Posten. Niemand übernahm in jenem Moment die Verantwortung, und, noch wichtiger, niemand schritt ein. Die ganze Polizei verfiel in Schockstarre, und die Bilder ungezügelter Gewalt verbreiteten sich wie ein Lauffeuer über die Fernsehschirme der Stadt. Bald herrschte Chaos in Los Angeles, und die Stadt stand in Flammen.
Auch zwei Nächte später noch war der beißende Gestank von brennendem Gummi und schwelenden Träumen allgegenwärtig. Flammen von tausend Feuern flackerten über den Dächern der Stadt, als tanzte der Teufel über den dunklen Himmel. Pausenlos gellten Schüsse und wütende Schreie hinter dem Streifenwagen her. Doch die vier Männer in 6-King-16 hielten wegen keinem von ihnen an. Sie hielten nur für Morde an.
Es war Freitag, der 1. Mai. Als B-Schicht wurde in Notstandssituationen die von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens dauernde Nachtschicht bezeichnet. Bosch und Edgar saßen hinten, die Streifenpolizisten Robleto und Delwyn vorn. Delwyn hatte auf dem Beifahrersitz seine Flinte so im Schoß liegen, dass ihr Lauf aus dem offenen Seitenfenster zeigte.
Sie waren zu einer Leiche unterwegs, die in einer Durchfahrt am Crenshaw Boulevard gefunden worden war. Der Anruf war von der California National Guard, die wegen der Unruhen in die Stadt beordert war, an die Kommunikationszentrale des Notstandskrisenstabs weitergeleitet worden. Es war erst halb elf Uhr abends, aber die Meldungen häuften sich. Einen Mordfall hatte King-16 seit Schichtbeginn bereits übernommen – ein Plünderer, der im Eingangsbereich eines Schuhgeschäfts erschossen worden war. Vom Inhaber des Ladens.
Da sich dieser Tatort in den Geschäftsräumen befunden hatte, hatten Bosch und Edgar in relativer Sicherheit arbeiten können, zumal Robleto und Delwyn mit ihren Flinten und in kompletter Schutzausrüstung vor dem Eingang Wache hielten. Das verschaffte den Ermittlern die nötige Zeit, Beweise zu sammeln, eine Skizze des Tatorts anzufertigen und Fotos zu machen. Sie hatten die Aussage des Ladenbesitzers zu Protokoll genommen und sich die Videoaufnahme der Überwachungskamera angesehen, auf der zu sehen war, wie der Plünderer mit einem Alu-Baseballschläger die Glastür des Geschäfts einschlug. Als sich der Mann darauf durch die so entstandene Öffnung zwängte, wurde er vom Inhaber des Ladens, der hinter dem Ladentisch auf der Lauer lag, prompt mit zwei Schüssen niedergestreckt.
Weil die Rechtsmediziner die zahlreichen Todesfälle nicht mehr bewältigen konnten, hatten die Rettungssanitäter den Toten ins County-USC Medical Center gebracht. Dort sollte er bleiben, bis sich die Lage – wenn überhaupt – beruhigte und die Pathologen mit der Arbeit nachkamen.
Was den Todesschützen anging, verzichteten Bosch und Edgar auf eine Festnahme. Ob es nun Notwehr oder ein Mord aus dem Hinterhalt war, musste später die Staatsanwaltschaft klären.
Das war zwar nicht die vorschriftsmäßige Vorgehensweise, aber es musste genügen. Angesichts des aktuellen Chaos war ihre Aufgabe sehr simpel: die Beweismittel sichern, so gut und so schnell wie möglich den Tatort dokumentieren und die Toten einsammeln.
Rein und wieder raus. Und keine Risiken eingehen. Die richtigen Ermittlungen kamen später. Vielleicht.
Als sie auf dem Crenshaw nach Süden fuhren, kamen sie immer wieder an Menschengruppen vorbei, hauptsächlich junge Männer, die an Ecken standen oder durch die Straßen zogen. An der Ecke Crenshaw und Slauson johlte eine Gruppe in den Farben der Crips lautstark los, als der Streifenwagen ohne Sirene und Blaulicht vorbeiraste. Es flogen Flaschen und Steine, aber das Auto fuhr zu schnell, und die Wurfgeschosse landeten hinter ihm, ohne Schaden anzurichten.
»Keine Angst, ihr Arschlöcher! Wir kommen zurück.«
Es war Robleto, der das gerufen hatte, und Bosch konnte nur annehmen, dass es metaphorisch gemeint war. Die Drohung des jungen Streifenpolizisten war so hohl, wie es die ganze Reaktion der Polizei gewesen war, seit die Urteilsverkündung am Mittwochnachmittag live im Fernsehen übertragen worden war.
Robleto, der am Steuer saß, ging erst wieder vom Gas, als sie sich einer Straßensperre aus Fahrzeugen und Soldaten der Nationalgarde näherten. Die Strategie, auf die man sich am Tag zuvor beim Eintreffen der National Guard geeinigt hatte, sah vor, die wichtigsten Straßenkreuzungen in South L.A. wieder unter Kontrolle zu bekommen und dann von dort auszuschwärmen und nach und nach alle Krisenherde einzunehmen. Sie waren weniger als eine Meile von einer dieser Schlüsselkreuzungen, Crenshaw und Florence, entfernt, und die Soldaten und Fahrzeuge der Nationalgarde hatten sich bereits mehrere Häuserblocks weit den Crenshaw Boulevard hinauf und hinunter verteilt. Als sie die Straßensperre in der 62nd Street erreichten, ließ Robleto das Fenster herunter.
Ein Nationalgardist mit Sergeantstreifen am Ärmel kam an die Tür und beugte sich vor, um einen Blick auf die Insassen des Wagens zu werfen.
»Sergeant Burstin, San Luis Obispo. Was kann ich für euch tun, Leute?«
»Mordkommission«, sagte Robleto. Er deutete mit dem Daumen auf Bosch und Edgar im Fond. Burstin richtete sich auf und signalisierte seinen Leuten mit einer Armbewegung, Platz zu machen und sie durchfahren zu lassen.
»Also.« Der Nationalgardist beugte sich wieder zum Fenster des Streifenwagens herab. »Sie ist in einer Durchfahrt zwischen 66th Place und 67th Street. Auf der Ostseite. Einfach immer geradeaus weiter, dann zeigen es euch meine Leute. Wir werden einen engen Kreis um euch bilden und die umliegenden Dächer im Auge behalten. Uns liegen unbestätigte Meldungen von Scharfschützenfeuer in dieser Gegend vor.«
Robleto kurbelte das Fenster wieder hoch, als sie weiterfuhren. »›Meine Leute‹«, äffte er den Nationalgardisten nach. »Im richtigen Leben ist der Typ wahrscheinlich Lehrer oder so was. Ich hab gehört, dass keiner von den Pfeifen, die sie hier angekarrt haben, aus L.A. ist. Von überall aus dem Staat, aber nicht aus L.A. Ohne Stadtplan würden die wahrscheinlich nicht mal den Leimert Park finden.«
»Das hättest du vor zwei Jahren auch noch nicht«, sagte Delwyn.
»Trotzdem. Dieser Typ hat doch von Tuten und Blasen keine Ahnung, und so jemand will hier nach dem Rechten sehen? Ein lächerlicher Wochenendkrieger wie der? Damit will ich nur sagen, dass wir diese Heinis nicht gebraucht hätten. Lässt uns nur schlecht dastehen. Als ob wir das nicht allein geregelt bekämen und auf diese Pfeifen aus scheiß San Luis Obispo angewiesen wären.«
Edgar auf dem Rücksitz räusperte sich und sagte: »Nur für den Fall, dass du es nicht mitbekommen haben solltest. Wir haben es nicht geregelt gekriegt und könnten kaum noch schlechter dastehen, als wir das seit Mittwochabend tun. Wir haben Däumchen drehend zugeschaut, wie die Stadt abgefackelt wurde, Mann. Du hast doch das ganze Chaos sicher in der Glotze gesehen. Was du dort allerdings bestimmt nicht gesehen hast, war irgendeiner von uns, der mal richtig dazwischengegangen ist. Mach also diesen Lehrern aus ’bispo keinen Vorwurf. Das haben wir uns alles ganz allein eingebrockt, Mann.«
Robleto murmelte etwas Unverständliches.
»Auf unserer Wagentür steht Schützen und Dienen«, fügte Edgar hinzu. »Und wir haben weder das eine noch das andere getan.«
Bosch blieb still. Nicht, dass er anderer Meinung war als sein Partner. Die Polizei hatte sich mit ihrer laschen Reaktion auf den Ausbruch der Gewalt gründlich blamiert. Aber das beschäftigte Bosch jetzt nicht. Er machte sich darüber Gedanken, was der Sergeant der Nationalgarde über das Opfer gesagt hatte: dass es eine Sie war. Es war das erste Mal, dass dieser Punkt zur Sprache kam, und seines Wissens hatte es bisher keine weiblichen Mordopfer gegeben. Was nicht heißen sollte, dass keine Frauen an der Gewalt beteiligt waren, die durch die Stadt fegte. Bei Plünderung und Brandstiftung herrschte Chancengleichheit, und Bosch hatte Frauen bei beidem beobachtet. Als er am Abend zuvor zur Unruhebekämpfung im Hollywood Boulevard eingesetzt worden war, hatte er gesehen, wie Frederick’s of Hollywood, das berühmte Kaufhaus für Damenunterwäsche, gestürmt worden war. Die Hälfte der Plünderer waren Frauen gewesen.
Trotzdem hatte ihn der Hinweis des Sergeant nachdenklich gemacht. In dem Chaos war eine Frau unterwegs gewesen, und es hatte sie das Leben gekostet.
Robleto fuhr durch die Öffnung in der Sperre und den Crenshaw Boulevard hinunter. Vier Straßen weiter schwenkte ein Soldat eine Taschenlampe so, dass ihr Strahl auf eine Lücke zwischen zwei Geschäften auf der Ostseite der Straße fiel.
Abgesehen von den in fünfundzwanzig Meter Abstand postierten Nationalgardisten war die Straße menschenleer. Es herrschte eine ungute, unheimliche Ruhe. In keinem der Geschäfte auf beiden Seiten der Straße brannte Licht. Einige waren von Plünderern und Brandstiftern heimgesucht worden. Andere waren wie durch ein Wunder verschont geblieben. Auf die mit Brettern verrammelten Fassaden wieder anderer war Schwarzer Besitzer gesprayt, ein kläglicher Versuch, das Geschäft vor dem Mob zu schützen.
Die Durchfahrt war zwischen einem geplünderten Felgen- und Reifenladen, der sich Dream Rims nannte, und einem vollständig ausgebrannten Haushaltsgerätegeschäft, das Used, Not Abused hieß. Das niedergebrannte Gebäude war von gelbem Absperrband umgeben und von städtischen Inspektoren mit roten Aufklebern als unbewohnbar gekennzeichnet worden.
Bosch vermutete, dass diese Gegend schon sehr bald nach Ausbruch der Unruhen gebrandschatzt worden war. Sie war nur ungefähr zwanzig Häuserblocks von der Kreuzung Florence und Normandie entfernt, wo die Gewalt zuerst ausgebrochen war und Menschen aus ihren Autos und Lkws gezerrt und verprügelt worden waren, während die Welt von oben zugesehen hatte.
Der Nationalgardist mit der Taschenlampe begann vor 6-King-16 herzugehen und lotste den Streifenwagen in die Durchfahrt. Nach etwa zehn Metern blieb der Nationalgardist stehen und hob seine zur Faust geballte Hand, als befänden sie sich auf einem Aufklärungseinsatz hinter feindlichen Linien. Zeit, auszusteigen. Edgar schlug Bosch mit dem Handrücken gegen den Arm.
»Und nicht vergessen, Harry: immer schön Abstand halten. Mindestens zwei Meter.«
Es war ein Scherz, der dazu beitragen sollte, die Spannung abzubauen. Von den vier Männern im Auto war nur Bosch weiß. Er war mit hoher Wahrscheinlichkeit das erste Ziel eines Heckenschützen. Eigentlich jedes Schützen.
»Ich werde es mir merken«, sagte Bosch.
Edgar knuffte ihn erneut in die Schulter.
»Und setz deinen Hut auf.«
Bosch nahm den Schutzhelm, den er bei der Einsatzbesprechung ausgehändigt bekommen hatte. Die Anweisung lautete, ihn beim Einsatz ständig zu tragen. Bosch fand allerdings, dass einen das glänzende weiße Plastik mehr als alles andere zu einem hervorragenden Ziel machte.
Edgar und er mussten warten, bis Robleto und Delwyn ausstiegen und ihnen die hinteren Türen des Streifenwagens öffneten. Erst dann konnte Bosch in die Nacht hinaus aussteigen. Den Helm setzte er widerwillig auf, aber den Kinnriemen schloss er nicht. Er hätte gern eine Zigarette geraucht, aber sie durften keine Zeit verlieren. Außerdem hatte er nur noch eine in dem Päckchen, das in der linken Brusttasche seines Uniformhemds steckte. Er musste sie sich aufheben, denn er wusste nicht, wann oder wo er dazu käme, seine Vorräte aufzufüllen.
Bosch blickte sich um. Eine Leiche war nirgendwo zu sehen. Die Durchfahrt war mit altem und neuem Gerümpel zugemüllt. An der Wand von Used, Not Abused stapelten sich alte Haushaltsgeräte, die wiederzuverkaufen sich offensichtlich nicht mehr lohnte. Überall lag Müll, und infolge des Brands waren Teile der Dachtraufe herabgestürzt.
»Wo ist sie?«, fragte Bosch.
»Hier drüben«, sagte der Nationalgardist. »An der Wand.«
Die Durchfahrt wurde nur von den Scheinwerfern des Streifenwagens und der Lampe des Nationalgardisten beleuchtet. Die Haushaltsgeräte und anderes Gerümpel warfen Schatten auf Wand und Boden. Bosch schaltete seine Maglite ein und richtete ihren Strahl in die Richtung, in die der Nationalgardist gezeigt hatte. Die Wand des Haushaltsgeräteladens war von Gang-Graffiti übersät. Namen, R.I.P.s, Drohungen – die Wand diente den Rolling Sixties, der lokalen Crips-Fraktion, als Schwarzes Brett.
Bosch ging drei Schritte hinter dem Nationalgardisten, und dann sah er sie. Eine zierliche Frau, die direkt an der Mauer auf der Seite lag. Sie war vom Schatten einer rostigen Waschmaschine verdeckt worden.
Bevor Bosch weiterging, leuchtete er mit seiner Lampe über den Boden. Früher war der Boden der Durchfahrt glatt betoniert gewesen, aber jetzt war er rissig, überall Kies und Erde. Bosch sah weder Fußabdrücke noch Blutspuren. Er ging langsam weiter und kauerte sich nieder, stützte den schweren Zylinder der mit sechs Batterien bestückten Stablampe auf seiner Schulter ab und ließ ihren Strahl über die Tote gleiten. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit Leichen schätzte er, dass die Frau zwischen zwölf und vierundzwanzig Stunden tot war. Die Beine waren an den Knien stark abgewinkelt, und er wusste, dass das entweder eine Folge der Totenstarre war oder ein Hinweis darauf, dass sie in den letzten Momenten vor ihrem Tod auf dem Boden gekniet hatte. Was an Hals und Armen von ihrer Haut zu sehen war, war bleich und an den Stellen, die von geronnenem Blut bedeckt waren, dunkel. Ihre Hände waren fast schwarz, und in der Luft hingen erste Ansätze von Verwesungsgeruch.
Das Gesicht der Frau war fast ganz von ihrem langen blonden Haar verdeckt. Die dichten Strähnen über ihrem Gesicht und an ihrem Hinterkopf waren von getrocknetem Blut verklebt. Bosch führte den Lichtstrahl die Wand hinter der Toten hinauf und entdeckte ein Muster aus Blutspritzern und -tropfen, das darauf hindeutete, dass sie an dieser Stelle getötet und nicht erst später hier abgeladen worden war.
Bosch nahm einen Stift aus seiner Tasche und lüpfte damit das Haar vom Gesicht des Opfers. Um die rechte Augenhöhle waren Schmauchspuren zu erkennen, der Augapfel war beim Einschuss zerplatzt. Die Frau war aus wenigen Zentimetern Entfernung erschossen worden. Von vorn, aus nächster Nähe. Bosch steckte den Stift wieder ein und beugte sich weiter vor. Er richtete die Lampe auf den Hinterkopf der Toten. Die Austrittswunde, groß und gezackt, war deutlich zu sehen. Der Tod war zweifellos sofort eingetreten.
»Sag bloß! Ist das etwa eine Weiße?«
Edgar war hinter Bosch stehen geblieben und spähte wie ein hinter dem Catcher stehender Baseballschiedsrichter über dessen Schulter.
»Sieht ganz so aus«, sagte Bosch.
Er bewegte den Lichtstrahl über den Körper des Opfers.
»Was hat eine Weiße hier unten zu suchen, verdammte Scheiße noch mal?«
Bosch antwortete nicht. Ein Gegenstand unter dem rechten Arm der Toten hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Er legte die Taschenlampe beiseite, um sich Handschuhe anzuziehen. »Leuchte mal auf ihre Brust«, forderte er Edgar auf.
Sobald er sich die Handschuhe übergestreift hatte, beugte er sich über die Leiche. Sie lag auf der linken Seite. Ihr rechter Arm war über ihre Brust gefallen und verdeckte etwas, das an einer Schnur um ihren Hals hing. Bosch zog es behutsam hervor.
Es war ein orangefarbener LAPD-Presseausweis. Bosch hatte im Lauf der Jahre einige dieser Dinger gesehen. Dieser sah neu aus. Seine Laminierung war noch klar und nicht verkratzt. Das Foto der blonden Frau, das auf dem Ausweis war, sah aus wie aus einer Verbrecherkartei. Darunter standen ihr Name und die Zeitung, für die sie arbeitete.
Anneke Jespersen
Berlingske Tidende
»Sie ist von einer ausländischen Zeitung«, sagte Bosch. »Anneke Jespersen.«
»Von wo?«, fragte Edgar.
»Keine Ahnung. Aus Deutschland vielleicht. Hier steht Berlin… Berlin irgendwas. Keine Ahnung, wie man das ausspricht.«
»Wieso schicken die jemanden wegen so was aus Deutschland her? Können die sich nicht um ihren eigenen Kram kümmern?«
»Ich bin ja gar nicht sicher, ob sie überhaupt aus Deutschland ist. War nur so eine Vermutung.«
Bosch blendete Edgars Gequatsche aus und betrachtete das Foto auf dem Presseausweis. Selbst bei dessen schlechter Qualität war zu erkennen, dass die Frau attraktiv gewesen war. Kein Lächeln, kein Make-up, ganz sachlich, das Haar hinter die Ohren gestrichen, ihre Haut so blass, dass sie fast durchscheinend war. In ihrem Blick war eine bestimmte Art von Distanziertheit, wie sie Bosch von Polizisten und Soldaten kannte, die zu früh zu viel gesehen hatten.
Bosch drehte den Presseausweis um. Er sah echt aus. Presseausweise mussten jährlich erneuert werden, und um zu Pressekonferenzen der Polizei Zugang zu erhalten oder an einem Tatort durch die Sperre gelassen zu werden, brauchte jeder Journalist eine gültige Jahresmarke. Auf diesem Ausweis war eine Marke für 1992. Das hieß, dass ihn das Opfer im Lauf der letzten hundertzwanzig Tage bekommen hatte. Aus dem tadellosen Zustand des Ausweises schloss Bosch jedoch, dass er erst vor Kurzem ausgestellt worden war.
Er machte sich wieder daran, die Leiche zu untersuchen. Das Opfer trug eine Bluejeans und eine weiße Bluse und darüber eine Ausrüstungsweste mit stark gewölbten Taschen. Daraus schloss Bosch, dass die Frau wahrscheinlich Fotografin gewesen war. Aber es waren keine Kameras an ihrem Körper oder in ihrer Umgebung. Sie waren gestohlen worden, und möglicherweise waren sie sogar das Mordmotiv gewesen. Die meisten Fotoreporter, die Bosch gesehen hatte, hatten immer mehrere hochwertige Kameras und einiges andere an Ausrüstung dabei gehabt.
Bosch öffnete eine der Brusttaschen der Weste. Normalerweise hätte er das einen Rechtsmediziner machen lassen, da für die Leiche eigentlich der Coroner des County zuständig war. Aber er wusste nicht, ob überhaupt ein Team der Rechtsmedizin an den Tatort käme, und er wollte sich sofort Klarheit verschaffen.
Die Tasche enthielt vier schwarze Filmdosen. Er wusste nicht, ob die Filme bereits belichtet waren. Als er die Tasche wieder zuknöpfte, spürte er etwas Hartes darunter. Er wusste, dass sich die Totenstarre nach einem Tag löste und eine Leiche danach wieder weich und beweglich wurde. Er zog die Ausrüstungsweste zur Seite und klopfte mit der Faust auf die Brust der Toten. Sie fühlte sich hart an, und das Geräusch, das dabei entstand, bestätigte ihm: Das Opfer trug eine kugelsichere Weste.
»Schau dir mal diese Strichliste an«, sagte Edgar.
Bosch blickte von der Toten auf. Edgars Taschenlampe war auf die Wand über ihr gerichtet. Das Graffiti direkt über dem Opfer war eine 187er-Liste von Gang-Mitgliedern, die bei Straßenschlachten ums Leben gekommen waren. Ken Dog, G-Dog, OG Nasty, Neckbone und noch einige mehr. Der Tatort lag auf Rolling-Sixties-Territorium. Die Sixties waren eine Untergruppierung der Crips. Sie befanden sich in einem endlosen Krieg mit den benachbarten Seven-Treys, einer anderen Crips-Fraktion.
In der Öffentlichkeit herrschte weitgehend die Ansicht, dass die Bandenkriege, die den größten Teil von South L.A. überzogen und jede Nacht der Woche ihre Opfer forderten, die Folge eines erbitterten Machtkampfs waren, in dem Bloods und Crips um die Vorherrschaft in einem Viertel kämpften. In Wirklichkeit waren es jedoch die Rivalitäten zwischen Untergruppen derselben Gang, die mit der größten Brutalität ausgetragen wurden und Woche für Woche die meisten Todesopfer forderten. Ganz besonders taten sich in dieser Hinsicht die Rolling Sixties und die Seven-Treys hervor. Beide Crips-Gruppen handelten nach dem Motto »Kill on sight« – sprich, sie brachten jedes feindliche Gang-Mitglied um, wenn sie es nur sahen –, und anschließend fand der neueste Tabellenstand prompt in den Graffiti des Viertels seinen Niederschlag. In einer R.I.P.-Liste wurde der Homies gedacht, die in dem nie endenden Bandenkrieg gefallen waren; in einer 187er-Liste wurden die getöteten Gegner aufgeführt.
»Sieht ganz so aus, als hätten wir es hier mit Schneewittchen und den Seven-Trey Crips zu tun«, brummte Edgar.
Bosch schüttelte verärgert den Kopf. Die Stadt war aus den Fugen geraten, und hier, direkt vor ihrer Nase, war das Ergebnis zu sehen: eine Frau, die an die Wand gestellt und hingerichtet worden war. Und sein Partner schien das alles nicht weiter ernst zu nehmen.
Edgar musste Boschs Körpersprache richtig gedeutet haben. »War doch nur ein blöder Spruch, Harry«, sagte er rasch. »Ist doch kein Grund, gleich sauer zu werden. Ein bisschen Galgenhumor kann im Moment sicher nicht schaden.«
»Okay«, sagte Bosch. »Ich werde nicht sauer, und du hängst dich an den Funk. Gib durch, was wir hier haben, und mach ihnen vor allem klar, dass es eine ausländische Journalistin ist. Sieh zu, dass du ein komplettes Team bekommst. Und wenn nicht, dann wenigstens einen Fotografen und ein paar Lampen. Sag ihnen, wir könnten hier dringend etwas Zeit und Unterstützung brauchen.«
»Warum? Weil es eine Weiße ist?«
Bosch ließ sich Zeit, bevor er darauf antwortete. Was Edgar gerade gesagt hatte, war geschmacklos. Er hatte es Bosch heimzahlen wollen, dass er auf die Schneewittchenanspielung so empfindlich reagiert hatte. »Nein, nicht weil es eine Weiße ist«, antwortete Bosch ruhig. »Sondern weil sie kein Plünderer und kein Gang-Mitglied ist, und weil wir uns lieber darauf gefasst machen sollten, dass sich die Medien auf einen Fall stürzen werden, in den eine von ihnen verwickelt ist. Zufrieden jetzt? Reicht dir das als Erklärung?«
»Klar.«
»Gut.«
Edgar ging zum Auto zurück, um ins Funkgerät zu sprechen, und Bosch wandte sich wieder dem Tatort zu. Als Erstes steckte er das Areal ab. Er schickte mehrere Nationalgardisten die Durchfahrt hinunter, um einen Bereich abzusperren, der so groß war, dass auf beiden Seiten der Leiche fünf Meter Platz blieben. Die anderen beiden Seiten dieses Rechtecks bildeten die Wände des Haushaltsgeräteladens auf der einen Seite und des Felgen-Shops auf der anderen.
Beim Abstecken des Tatorts stellte Bosch fest, dass die Durchfahrt zu einer Reihe von Wohnhäusern führte, die direkt hinter den Geschäften am Crenshaw Boulevard lagen. Die einzelnen Grundstücke waren nicht einheitlich eingezäunt. Einige waren von Betonmauern umgeben, andere von Latten- oder Maschendrahtzäunen.
In einer perfekten Welt, wusste Bosch, hätte er jedes dieser Grundstücke durchsucht und an jeder dieser Türen geklingelt, aber das käme, wenn überhaupt, später. Im Moment musste er sich auf den unmittelbaren Tatort konzentrieren. Er konnte von Glück reden, wenn er überhaupt dazu kam, sich in der Umgebung umzuhören und umzuschauen.
Bosch sah, dass sich Robleto und Delwyn mit ihren Flinten an der Mündung der Durchfahrt postiert hatten. Sie standen nebeneinander und unterhielten sich. Wahrscheinlich stänkerten sie über irgendetwas. Als Bosch in Vietnam gewesen war, hatten sie so etwas ein Nimm-zwei-zahl-eins-Angebot an die Scharfschützen genannt.
Um den Tatort selbst hatten sich acht Nationalgardisten aufgestellt. Bosch bemerkte, dass sich am anderen Ende der Durchfahrt ein kleiner Menschenauflauf bildete und das Geschehen neugierig verfolgte. Er winkte den Nationalgardisten, der sie in die Durchfahrt geführt hatte, zu sich.
»Wie heißen Sie, Soldat?«
»Drummond, aber alle nennen mich Drummer.«
»Okay, Drummer, ich bin Detective Bosch. Wer hat sie gefunden?«
»Die Leiche? Dowler. Er ist zum Pinkeln hier hinten hin gegangen, und da hat er sie gefunden. Zuerst hat er sie aber gerochen, hat er gesagt. Der Geruch kam ihm bekannt vor.«
»Wo ist Dowler jetzt?«
»An der südlichen Sperre, glaube ich.«
»Ich muss mit ihm reden. Könnten Sie ihn herholen?«
»Selbstverständlich, Sir.«
Drummond begann, sich in Richtung Crenshaw zu entfernen.
»Augenblick noch, Drummer. Ich bin noch nicht fertig.«
Drummond drehte sich um.
»Wann sind Sie hier postiert worden?«
»Wir sind seit gestern achtzehn Uhr hier, Sir.«
»Dann haben Sie dieses Areal also seitdem unter Kontrolle? Auch diese Durchfahrt?«
»Nicht ganz, Sir. Wir haben gestern Abend an der Ecke Crenshaw und Florence angefangen und uns auf der Florence nach Osten und auf dem Crenshaw nach Norden vorgearbeitet. Straße für Straße.«
»Und wann sind Sie zu dieser Durchfahrt hier gekommen?«
»Genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber ich schätze, wir haben sie heute bei Tagesanbruch unter unsere Kontrolle gebracht.«
»Und die Plünderungen und Brandstiftungen in der unmittelbaren Umgebung, hatten die schon aufgehört?«
»Wie ich hörte, war das alles nur am ersten Abend.«
»Okay, Drummer, noch ein Letztes. Wir brauchen hier hinten mehr Licht. Können Sie eins dieser Fahrzeuge mit den ganzen Lichtern obendrauf nach hier hinten kommen lassen?«
»Meinen Sie einen Humvee, Sir?«
»Ja, er soll von diesem Ende dort, an den ganzen Neugierigen vorbei, in die Durchfahrt fahren und die Scheinwerfer genau auf meinen Tatort richten. Wissen Sie, was ich meine?«
»Ja, Sir.«
Bosch deutete auf das dem Streifenwagen gegenüberliegende Ende der Durchfahrt.
»Gut. Ich möchte eine Kreuzschraffurbeleuchtung haben, verstehen Sie? Mehr dürfte sich hier unter diesen Umständen nicht machen lassen.«
»Ja, Sir.«
Der Nationalgardist begann sich zu entfernen.
»Noch was, Drummer.«
Drummond drehte sich ein weiteres Mal um und kam zu Bosch zurück.
»Ja, Sir.«
Jetzt flüsterte Bosch.
»Ihre Männer, sie sehen alle mich an. Sollten sie nicht andersrum stehen, mit Blickrichtung nach außen?«
Drummond machte einen Schritt zurück und beschrieb mit dem Zeigefinger einen Kreis über seinem Kopf.
»Hey! Alle umdrehen, Blick nach außen. Wir sind nicht zum Vergnügen hier. Umgebung im Auge behalten.«
Er deutete auf den Menschenauflauf am anderen Ende der Durchfahrt.
»Und dass diese Leute auch bleiben, wo sie sind.«
Die Nationalgardisten kamen den Anweisungen nach, und Drummond entfernte sich in Richtung Crenshaw, um Dowler anzufunken und den Humvee mit den Scheinwerfern herzubeordern.
Der Pager an Boschs Hüfte begann zu summen. Er fasste an seinen Gürtel und nahm das Gerät aus seiner Halterung. Auf dem Display war die Nummer der Einsatzzentrale, und er wusste, dass er und Edgar einen neuen Fall zugeteilt bekamen. Sie hatten hier noch nicht mal angefangen und wurden bereits wieder abgezogen. Das wollte er nicht. Er hängte den Pager wieder an seinen Gürtel.
Bosch ging zur ersten Umzäunung, die an der hinteren Ecke des Haushaltsgerätegeschäfts begann. Der Bretterzaun war zu hoch, um über ihn schauen zu können. Aber Bosch fiel auf, dass er frisch gestrichen war. Es waren keine Graffiti darauf, nicht einmal auf der Seite, die an die Durchfahrt grenzte. Das nahm er deshalb zur Kenntnis, weil es darauf hindeutete, dass hinter diesem Zaun ein Hausbesitzer wohnte, dem noch nicht alles völlig egal war. Vielleicht war es jemand, der auf sein Eigentum aufpasste und deshalb möglicherweise etwas gehört oder gesehen hatte.
Als Nächstes überquerte Bosch die Durchfahrt und ging in der hinteren Ecke des Tatorts in die Hocke; wie ein Boxer in seiner Ecke, der darauf wartete, wieder loszulegen. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe über den rissigen Beton und die Erde der Durchfahrt. Schon nach Kurzem sah er in dem extrem flach einfallenden Licht, das die zahlreichen Bodenunebenheiten sehr deutlich hervorhob, einen glänzenden Gegenstand aufblitzen. Er richtete den Lichtstrahl direkt auf die Stelle und ging darauf zu. Auf dem Kies lag eine Patronenhülse aus Messing.
Er ließ sich auf alle viere nieder, um sich die Patronenhülse genauer ansehen zu können, ohne sie anfassen zu müssen. Er führte die Lampe ganz nah an sie heran und erkannte, dass es eine Neun-Millimeter-Patronenhülse aus Messing war, in deren flachen Boden das bekannte Remington-Logo gestanzt war. Das Zündhütchen hatte vom Schlagbolzen eine Vertiefung. Außerdem fiel Bosch auf, dass die Hülse vollkommen unbeschädigt auf dem Kies lag. Niemand war in der vermutlich stark frequentierten Durchfahrt auf sie getreten oder über sie gefahren. Das hieß, lange konnte die Hülse noch nicht da liegen.
Bosch suchte gerade nach etwas, um den Fundort der Hülse zu markieren, als Edgar an den Tatort zurückkam. Er hatte einen Metallkoffer dabei. Das verriet Bosch, dass sie keine Unterstützung bekämen.
»Was hast du gefunden, Harry?«
»Eine Neun-Millimeter-Remington. Sieht frisch aus.«
»Na, wenigstens etwas Brauchbares.«
»Vielleicht. Hast du die Zentrale erreicht?«
Edgar stellte den Koffer ab. Er war schwer. Er enthielt die Ausrüstung, die sie in der Hollywood Station hastig zusammengesucht hatten, als sich abzeichnete, dass sie bei ihrem Einsatz mit keiner forensischen Unterstützung rechnen könnten. »Ja, durchgekommen bin ich schon, aber sie sagen, sie können nichts für uns tun. Sind alle schon anderweitig im Einsatz. Wir sind hier auf uns allein gestellt, Brother.«
»Auch niemand aus der Rechtsmedizin?«
»Auch niemand aus der Rechtsmedizin. Die Nationalgarde holt die Leiche mit einem Lkw ab. Mit einem Truppentransporter.«
»Soll das ein Witz sein? Sie wollen sie in einem Laster wegbringen?«
»Nicht nur das, wir werden auch schon zu unserem nächsten Einsatz gerufen. Ein Knusperkrosser. Die Feuerwehr hat ihn in einem ausgebrannten Taco-Laden beim Martin Luther King Hospital gefunden.«
»Was denken die sich eigentlich? Wir haben hier doch noch nicht mal richtig angefangen.«
»Klar, schon, aber wir müssen weiter. Wir sind diejenigen, die am nächsten beim Hospital sind. Deshalb wollen sie, dass wir hier zum Ende kommen und sofort losfahren.«
»Bloß sind wir hier noch nicht fertig. Nicht mal annähernd.«
»Trotzdem, Harry. Da lässt sich nichts machen.«
Bosch blieb stur.
»Ich fahre noch nicht los. Es gibt hier noch zu viel zu tun, und wenn wir es bis nächste Woche oder was weiß ich wann aufschieben, können wir den Tatort ganz vergessen. Das geht nicht.«
»Wir haben aber keine Wahl, Partner. Wir haben die Regeln nicht gemacht.«
»Quatsch.«
»Na schön, was hältst du dann davon? Wir bleiben noch fünfzehn Minuten. Machen ein paar Fotos, tüten die Hülse ein, schaffen die Leiche auf den Laster und fahren dann los. Am Montag – oder wenn das hier alles vorbei ist – ist es schon gar nicht mehr unser Fall. Wenn sich die Lage beruhigt hat, sind wir wieder zurück in Hollywood, und das Ganze geht uns nichts mehr an. Dann darf sich jemand anderer damit herumschlagen. Hier ist das 77th zuständig. Dann ist es deren Sache.«
Bosch interessierte nicht, was später passierte und ob der Fall an die Ermittler der 77th Street Division oder sonst jemanden ging. Für ihn zählte nur, was in diesem Moment anstand. Eine Frau, die Anneke hieß und von irgendwo weither kam, lag tot vor ihm, und er wollte wissen, wer es getan hatte und warum.
»Ist doch völlig egal, dass es dann nicht mehr unser Fall ist«, sagte er. »Das ist nicht der Punkt.«
»Harry, das spielt doch im Moment keine Rolle«, sagte Edgar. »Nicht in dem Chaos, das gerade herrscht. Im Moment spielt nichts eine Rolle, Mann. Die Stadt ist vollkommen außer Kontrolle. Da kannst du nicht erwarten …«
Das plötzliche Rattern von automatischem Gewehrfeuer zerfetzte die Luft. Edgar warf sich zu Boden, und Bosch hechtete instinktiv auf die Wand des Haushaltsgeräteladens zu. Sein Helm flog durch die Luft. Nach einer Weile wurden die daraufhin einsetzenden Gewehrsalven der Nationalgardisten von lauten Rufen beendet.
»Feuer einstellen! Feuer einstellen! Feuer einstellen!«
Die Schüsse verstummten, und Burstin, der Sergeant von der Sperre, kam in die Durchfahrt gerannt. Bosch sah Edgar langsam aufstehen. Er schien unverletzt, aber er bedachte Bosch mit einem seltsamen Blick.
»Wer hat das Feuer eröffnet?«, brüllte der Sergeant. »Wer hat damit angefangen?«
»Ich«, sagte einer der Männer in der Durchfahrt. »Ich habe geglaubt, einen Gewehrlauf über das Dach ragen zu sehen.«
»Wo, Soldat? Auf welchem Dach? Wo war der Scharfschütze?«
»Dort drüben.«
Der Schütze deutete auf die Traufe des Felgen-Shops.
»Herrgott noch mal!«, tobte der Sergeant. »Was soll der Scheiß? Dieses Dach haben wir längst geräumt. Außer uns ist dort oben niemand! Nur unsere eigenen Leute!«
»Sorry, Sir. Ich habe gesehen, wie …«
»Ist mir scheißegal, was Sie gesehen haben, Mann. Bringen Sie mir einen meiner Leute um, und ich reiße Ihnen persönlich den Arsch auf.«
»Ja, Sir. Sorry, Sir.«
Bosch stand auf. Seine Ohren rauschten, seine Nerven sirrten. Das plötzliche Krachen von automatischem Gewehrfeuer war nichts Neues für ihn. Aber es war fast fünfundzwanzig Jahre her, dass es ein fester Bestandteil seines Lebens gewesen war. Er hob seinen Helm auf und setzte ihn wieder auf.
Sergeant Burstin kam zu ihm.
»Sie können jetzt weitermachen, Detectives. Ich bin auf der Nordseite, wenn Sie mich brauchen. Wir haben einen Lkw angefordert; er wird die Tote wegbringen. Außerdem sollen wir Ihnen ein Team zur Verfügung stellen, das Ihr Auto zu einem anderen Tatort und einer anderen Leiche begleitet.«
Dann lief er aus der Durchfahrt.
»Also wirklich, Mann«, brummte Edgar. »Der komplette Wahnsinn. Wie bei Desert Storm. Oder in Vietnam. Was sollen wir hier eigentlich, Mann?«
»Jetzt quatsch hier nicht lange«, sagte Bosch. »Mach dich lieber an die Arbeit. Du übernimmst den Tatort, und ich kümmere mich um die Leiche und mache Fotos. Los.«
Bosch ging in die Hocke und öffnete den Ausrüstungskoffer. Bevor er die Patronenhülse in eine Beweismitteltüte steckte, wollte er sie an der Fundstelle fotografieren. Edgar redete weiter. Der Adrenalinschub, den die Schüsse bei ihm ausgelöst hatten, war noch nicht abgeklungen. Er redete ziemlich viel, wenn er überdreht war. Manchmal zu viel.
»Harry, hast du eigentlich gemerkt, was du getan hast, als dieser Trottel angefangen hat, loszuballern?«
»Klar. Ich bin wie alle anderen in Deckung gegangen.«
»Nein, Harry, du hast dich auf die Leiche geworfen. Ich hab’s genau gesehen. Du hast dich schützend auf Schneewittchen dort drüben gelegt, so, als ob sie noch am Leben wäre.«
Bosch antwortete nicht. Er hob das oberste Fach aus dem Koffer und nahm die Polaroidkamera heraus. Er merkte, dass sie nur noch zwei Packungen Film hatten. Sechzehn Aufnahmen und das, was noch in der Kamera war. Insgesamt vielleicht zwanzig Fotos, und sie hatten diesen Tatort und den beim MLK, zu dem sie anschließend fahren mussten. Das würde nicht reichen. Seine Frustration wuchs.
»Wieso hast du das gemacht, Harry?« Edgar ließ nicht locker.
Jetzt platzte Bosch der Kragen, und er schnauzte seinen Partner an.
»Keine Ahnung! Zufrieden? Ich weiß es nicht. Deshalb lass uns endlich an die Arbeit gehen und versuchen, etwas für sie zu tun, damit vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, irgendjemand irgendwann in der Lage ist, daraus eine Anklage zu stricken.«
Boschs Wutausbruch hatte die Aufmerksamkeit der meisten Nationalgardisten in der Durchfahrt auf ihn gelenkt. Der Soldat, der kurz zuvor die Schießerei ausgelöst hatte, starrte ihn finster an. Er war sichtlich froh, den Mantel unerwünschter Aufmerksamkeit weiterreichen zu können.
»Ist ja gut, Harry«, sagte Edgar ruhig. »Dann mal an die Arbeit. Wir tun, was wir können. Fünfzehn Minuten, und dann geht es weiter zum Nächsten.«
Bosch sah auf die tote Frau hinab und nickte. Fünfzehn Minuten, dachte er. Er hatte resigniert. Ihm war klar, dass dieser Fall verloren war, bevor er überhaupt begonnen hatte.
»Tut mir leid«, flüsterte er.
Teil 1Der Weg der Waffe
2012
1
Sie ließen ihn warten. Die Begründung war, dass Coleman gerade beim Essen war und dass es zu Problemen führen konnte, wenn sie ihn dort einfach herausholten, weil sie ihn dann nach der Vernehmung durch Bosch im zweiten Mahlzeitenblock unterbringen müssten, in dem er möglicherweise Feinde hatte, von denen das Aufsichtspersonal nichts wusste. Und wenn ihn dann ein Mitgefangener angriff, wären die Wärter nicht darauf gefasst. Das wollten sie nicht, und deshalb legten sie Bosch nahe, die vierzig Minuten totzuschlagen, in denen Coleman an einem Picknicktisch in Hof D, wo er bereits durch die schiere Menge an Menschen geschützt war, seinen Hackbraten mit grünen Bohnen verdrückte. Alle in San Quentin einsitzenden Rolling Sixties waren denselben Mahlzeiten- und Freizeitblocks zugeteilt.
Bosch vertrieb sich die Zeit damit, seine Requisiten zu studieren und seinen Auftritt zu proben. Alles hing von ihm ab. Keine Hilfe von einem Partner. Er war auf sich allein gestellt. Wegen der Kürzungen im Reisebudget der Polizei waren inzwischen beinahe alle Gefängnisbesuche Soloveranstaltungen.
Bosch hatte am Morgen die erste Maschine nach San Francisco genommen und sich keine Gedanken über das Timing seines Besuchs gemacht. Aber die Verzögerung spielte keine Rolle. Sein Rückflug ging erst um achtzehn Uhr, und aller Voraussicht nach würde das Gespräch mit Rufus Coleman nicht lange dauern. Entweder ging Coleman auf Boschs Angebot ein oder nicht. In beiden Fällen bräuchte Bosch nicht lange mit ihm.
Das Vernehmungszimmer war eine Stahlzelle, die von einem fest installierten Tisch in zwei Hälften geteilt wurde. Bosch saß auf der einen Seite, eine Tür direkt hinter ihm. Auf der anderen Seite des Tischs war eine gleich große Fläche mit einer ähnlichen Tür, durch die Coleman hereingebracht würde.
Bosch befasste sich gerade mit dem zwanzig Jahre zurückliegenden Mord an der Fotojournalistin Anneke Jespersen, die bei den Unruhen von 1992 erschossen worden war. Es war eine irrwitzige Nacht voller Gewalt gewesen, in der er die Fälle im Schnelldurchlauf hatte abwickeln müssen. Deshalb hatte er sich damals nicht einmal eine Stunde mit dem Fall und dem Tatort beschäftigen können, bevor er zum nächsten Mordfall gerufen worden war.
Nach Beendigung der Unruhen rief die Polizei die Riot Crimes Task Force ins Leben, die sich mit der Aufarbeitung der während der Unruhen begangenen Straftaten befasste, und diese Einheit übernahm auch die Ermittlungen im Fall Jespersen. Der Mord wurde nie aufgeklärt, und nachdem der Fall zehn Jahre lang als offen und aktuell eingestuft gewesen war, wurden die Ermittlungen und das wenige, was es dazu an Beweismaterial gab, in aller Stille in eine Schachtel gepackt und ins Archiv gebracht. Erst als der zwanzigste Jahrestag der Unruhen näher rückte, schickte der im Umgang mit den Medien äußerst geschickte Polizeichef eine Direktive an den Leiter der Abteilung Offen-Ungelöst, sich noch einmal alle ungelösten Mordfälle vorzunehmen, die sich bei den Unruhen von 1992 ereignet hatten. Der Chief wollte gerüstet sein, wenn die Medien für die Berichte zum zwanzigsten Jahrestag bei der Presseabteilung anfragten. 1992 mochte die Polizei auf dem falschen Fuß erwischt worden sein, 2012 würde ihr das nicht noch einmal passieren. Der Polizeichef wollte in der Lage sein, vor die Presse treten und sagen zu können, dass alle ungelösten Morde von damals noch Gegenstand aktiver Ermittlungen waren.
Bosch hatte ausdrücklich um den Fall Anneke Jespersen gebeten und befasste sich nun nach zwanzig Jahren erneut damit. Nicht ohne Vorbehalte. Er wusste, dass die meisten Fälle in den ersten achtundvierzig Stunden gelöst wurden und die Chancen auf ihre Aufklärung danach drastisch sanken. Im Jespersen-Fall war selbst während dieser ersten achtundvierzig Stunden kaum etwas unternommen worden. Er war infolge der chaotischen Zustände vernachlässigt worden, und Bosch hatte deswegen immer ein schlechtes Gewissen gehabt, fast so, als ob er Anneke Jespersen im Stich gelassen hätte.
Kein Mordermittler legt einen Fall gern ungelöst zu den Akten, aber angesichts der damaligen Verhältnisse hatte Bosch keine andere Wahl gehabt. Der Fall war ihm entzogen worden. Er hätte also die Schuld ohne Weiteres auf die Ermittler schieben können, die den Fall übernommen hatten; trotzdem fühlte er sich mitverantwortlich. Das Ermittlungsverfahren hatte mit ihm am Tatort begonnen. Er konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er ungeachtet der kurzen Zeit, die er sich dort aufgehalten hatte, irgendetwas übersehen haben musste.
Jetzt bekam er zwanzig Jahre später eine zweite Chance. Eine kleine Chance allerdings. Er glaubte, dass jeder Fall seine Black Box hatte. Das konnten ein Beweisstück, eine Person oder eine Kombination von Fakten sein, die zu einem besseren Verständnis des Tathergangs führten und erklären halfen, was warum passiert war. Aber bei Anneke Jespersen gab es keine Black Box. Nur zwei modrige Pappschachteln aus dem Archiv, die Bosch wenig Hilfe oder Hoffnung versprachen. In den Schachteln befanden sich die Kleidung und die kugelsichere Weste des Opfers, ihr Pass und andere persönliche Gegenstände sowie ein Rucksack und die Fotoausrüstung, die nach den Unruhen in ihrem Hotelzimmer gefunden worden waren. Des Weiteren enthielten sie die Neun-Millimeter-Patronenhülse vom Tatort und die dünne Ermittlungsakte, die von der Riot Crimes Task Force zusammengestellt worden war. Das sogenannte Mordbuch.
Dieses Mordbuch war in erster Linie ein Dokument für die Untätigkeit der RCTF im Fall Jespersen. Die Task Force war für die Dauer eines Jahres eingerichtet worden und hatte in Hunderten von Straftaten, darunter Dutzenden Morden, ermitteln müssen. Sie war fast genauso sehr überfordert gewesen, wie es die Ermittler während der Unruhen gewesen waren.
Die RCTF hatte in South L.A. Plakatwände angebracht, auf denen eine Nummer für telefonische Hinweise angegeben war und Belohnungen für Informationen ausgesetzt wurden, die bei Straftaten in Zusammenhang mit den Unruhen zu einer Festnahme und Verurteilung führten. Auf diesen Plakaten waren Fotos von Verdächtigen, Tatorten oder Opfern. Auf dreien davon war ein Foto von Anneke Jespersen gewesen, zusammen mit der Bitte um Hinweise auf die Gründe ihres Aufenthalts in L.A. und auf die Umstände ihrer Ermordung.
Die Einheit stützte sich bei ihrer Arbeit hauptsächlich auf Informationen, die infolge der Plakataktion und sonstiger Aufrufe an die Öffentlichkeit eingingen, und ermittelte nur in Fällen, für die ihnen konkrete Hinweise vorlagen. Da über Anneke Jespersen nie etwas Brauchbares hereinkam, ging bei den Ermittlungen nichts voran. Der Fall erwies sich als Sackgasse. Selbst das einzige vom Tatort stammende Beweismittel – die Patronenhülse – war ohne eine dazu passende Schusswaffe von keinerlei Wert.
Bei der Durchsicht der archivierten Unterlagen und Beweisstücke stellte Bosch fest, dass sich die relevantesten Informationen, die im Zuge des ersten Ermittlungsverfahrens gesammelt worden waren, auf die Person des Opfers bezogen. Jespersen war eine zweiunddreißig Jahre alte Dänin gewesen, keine Deutsche, wie Bosch zwanzig Jahre lang angenommen hatte. Sie war im wahrsten Sinn des Wortes Fotojournalistin gewesen, denn sie hatte nicht nur Fotos gemacht, sondern auch Reportagen geschrieben. Sie hatte für die Kopenhagener Zeitung Berlingske Tidende als Kriegsberichterstatterin in Wort und Bild über gewaltsame Auseinandersetzungen in aller Welt berichtet.
Sie war am Morgen nach dem Ausbruch der Unruhen in Los Angeles eingetroffen. Und am nächsten Morgen war sie tot. In den folgenden Wochen erschienen in der Los Angeles Times Kurzbiographien all derer, die bei den Unruhen ums Leben gekommen waren. Im Beitrag über Jespersen, in dem auch ihr Redakteur und ihr Bruder aus Kopenhagen zu Wort kamen, wurde die Journalistin als eine Frau dargestellt, die keine Risiken gescheut und sich immer freiwillig und ohne Zögern für Einsätze in den Krisengebieten der Welt gemeldet hatte. In den vier Jahren vor ihrem Tod hatte sie über gewaltsame Konflikte im Irak, Libanon, Senegal, in Kuwait und El Salvador berichtet.
Die Unruhen in Los Angeles waren zwar kaum auf der gleichen Stufe anzusiedeln wie die Kriege und sonstigen bewaffneten Konflikte, über die Jespersen in ihren Reportagen geschrieben hatte, aber da sie der Times zufolge gerade auf einer Urlaubsreise durch die Vereinigten Staaten war, als die Unruhen in der Stadt der Engel eskalierten, rief sie prompt in der Bildredaktion der Berlingske Tidende an und hinterließ ihrem Redakteur eine Nachricht, dass sie von San Francisco nach L.A. unterwegs sei. Bevor sie jedoch irgendwelche Fotos oder Berichte an die Zeitung schicken konnte, war sie tot. Ihr Redakteur hatte nach Erhalt ihrer Nachricht nicht mehr mit ihr gesprochen.
Nach Auflösung der RCTF wurde der ungelöste Jespersen-Fall der Mordkommission der 77th Street Division zugeteilt, in deren Zuständigkeitsbereich sich der Mord ereignet hatte. Dort wurde er neuen Ermittlern übergeben, die mehr als genug eigene offene Fälle aufzuarbeiten hatten; in der Folge war er einfach auf Eis gelegt worden. Die Einträge in der Ermittlungschronologie waren spärlich und sehr sporadisch und dokumentierten im Wesentlichen lediglich das Interesse, das dem Fall seitens der Öffentlichkeit entgegengebracht wurde. Das LAPD betrieb die Ermittlungen nicht gerade mit großem Nachdruck, aber Jespersens Angehörige und alle, die sie aus der internationalen Journalistenszene persönlich kannten, gaben die Hoffnung nicht auf. Die Chronologie enthielt zahlreiche Vermerke von ihren Anfragen zum Stand der Ermittlungen. Sie waren bis zu dem Zeitpunkt, als die Fallakten und Beweismittel ins Archiv kamen, mehr oder weniger die einzigen Einträge. Danach wurden alle, die sich nach Anneke Jespersen erkundigten, höchstwahrscheinlich genauso ignoriert wie der Fall, dessentwegen sie anriefen. Seltsamerweise waren die Habseligkeiten des Opfers nie an ihre Angehörigen geschickt worden. Die Archivboxen enthielten Jespersens Rucksack und die persönlichen Dinge, die der Polizei mehrere Tage nach dem Mord überstellt worden waren, als der Geschäftsführer des Travelodge am Santa Monica Boulevard den ungewöhnlichen Namen in seinem Gästeregister auf einer in der Times veröffentlichten Liste von Opfern der Unruhen entdeckt hatte. Bis dahin hatte man angenommen, Anneke Jespersen hätte das Motel verlassen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Die Habseligkeiten, die sie zurückgelassen hatte, waren in einer abschließ-baren Kammer des Motels aufbewahrt worden. Sobald dem Geschäftsführer klar wurde, dass Jespersen nicht zurückkommen würde, weil sie tot war, wurde der Rucksack mit ihren persönlichen Dingen an die RCTF geschickt, die während der kurzen Zeit ihres Bestehens in der Central Division in Downtown untergebracht war.
Der Rucksack war in einer der Archivboxen, die Bosch aus der Asservatenkammer angefordert hatte. Er enthielt zwei Jeans und vier weiße Baumwollblusen sowie Unterwäsche und Socken. Offensichtlich war Jespersen immer mit leichtem Gepäck gereist und hatte, typisch Kriegsberichterstatterin, auch im Urlaub wenig dabeigehabt. Das lag vermutlich daran, dass sie vorgehabt hatte, nach ihrem USA-Urlaub direkt in ein Krisengebiet zu fliegen. Ihr Redakteur in Dänemark hatte der Times erzählt, dass die Zeitung Jespersen aus den Vereinigten Staaten direkt nach Sarajewo im ehemaligen Jugoslawien hatte schicken wollen, wo wenige Wochen zuvor der Krieg ausgebrochen war. In den Medien waren erste Berichte über Massenvergewaltigungen und ethnische Säuberungen erschienen, und um sofort ins Zentrum des Geschehens zu gelangen, hatte Jespersen für den Montag nach dem Ausbruch der Unruhen in Los Angeles bereits einen Flug gebucht. Wahrscheinlich hatte sie den kurzen Zwischenstopp in L.A., bei dem sie vielleicht ein paar Randalierer vor die Linse bekommen hätte, lediglich als Aufwärmübung für das betrachtet, was sie in Bosnien erwartete.
Außerdem waren in den Außentaschen des Rucksacks Jespersens dänischer Pass sowie mehrere unbelichtete Kleinbildfilme. Der Pass war sechs Tage vor Jespersens Tod bei ihrer Einreise am John F. Kennedy International Airport in New York abgestempelt worden. Laut Ermittlungsunterlagen und Zeitungsmeldungen war sie allein gereist und exakt zu dem Zeitpunkt in San Francisco eingetroffen, als in Los Angeles die Freisprüche bekannt wurden und die Unruhen ausbrachen.
Aus keiner der Ermittlungsunterlagen oder Zeitungsmeldungen ging hervor, wo in den USA sich Jespersen in den fünf Tagen vor den Unruhen aufgehalten hatte. Dieser Frage war für die Mordermittlungen anscheinend keine Bedeutung beigemessen worden.
Kein Zweifel schien jedoch daran zu bestehen, dass die in Los Angeles explodierende Gewalt eine starke Anziehung auf Jespersen ausgeübt hatte. Sie warf ihre Reisepläne unverzüglich um und fuhr wahrscheinlich noch in derselben Nacht mit einem Leihwagen, den sie sich zwei Tage zuvor am San Francisco International gemietet hatte, nach Los Angeles. Am 30. April, einem Donnerstagmorgen, legte sie in der Pressestelle des LAPD ihren Pass und ihre dänischen Pressedokumente vor, um einen Presseausweis zu beantragen.
Bosch hatte die Jahre 1969 und 1970 größtenteils in Vietnam verbracht. Dort war er sowohl in den Base Camps als auch in den Feuerzonen zahlreichen Journalisten und Fotografen begegnet. An allen von ihnen war ihm eine ganz spezielle Art von Furchtlosigkeit aufgefallen. Nicht die Furchtlosigkeit eines Kämpfers, sondern ein fast naiver Glaube an die eigene Unverwundbarkeit. Es war, als hielten sie ihre Kameras und Presseausweise für Schilde, die sie vor allem schützten, was um sie herum passierte.
Einen dieser Fotografen hatte er näher kennengelernt. Er hieß Hank Zinn und arbeitete für Associated Press. Einmal begleitete er Bosch in Cu Chi bei einem Einsatz in einem unterirdischen Gang. Zinn war einer von denen, die sich keine Gelegenheit entgehen ließen, in Gebiete vorzudringen, wo es »richtig zur Sache ging«, wie er sich ausdrückte. Er kam Anfang 1970 ums Leben, als ein Huey, in dem er an die Front mitgeflogen war, abgeschossen wurde. Eine seiner Kameras wurde an der Absturzstelle unbeschädigt gefunden, und jemand im Base Camp entwickelte den Film. Es stellte sich heraus, dass Zinn unablässig weiter fotografiert hatte, als der Hubschrauber beschossen wurde und schließlich abstürzte. Ob er tapfer seinen eigenen Tod dokumentiert oder geglaubt hatte, spektakuläre Fotos mitzubringen, wenn er ins Base Camp zurückkehrte, ließ sich nicht mehr feststellen. Aber wie er Zinn kannte, vermutete Bosch, dass er geglaubt hatte, er wäre unverwundbar und der Hubschrauberabsturz wäre nicht das Ende.
Als Bosch nach all den Jahren den Jespersen-Fall wieder aufrollte, fragte er sich, ob Anneke Jespersen wie Zinn gewesen war. Felsenfest davon überzeugt, dass ihr nichts geschehen konnte und sie durch Kamera und Presseausweis vor jedem Beschuss geschützt wäre. Zweifellos hatte sie sich selbst in Gefahr gebracht. Er fragte sich, was ihr letzter Gedanke gewesen sein mochte, als ihr Mörder seine Pistole auf ihr Auge gerichtet hatte. War sie wie Zinn gewesen? Hatte sie ein Foto von ihm gemacht?
Laut einer in der RCTF-Akte enthaltenen Liste, die von Jespersens Redakteur in Kopenhagen stammte, hatte sie zwei Nikon 4s und mehrere Objektive bei sich gehabt. Natürlich war ihre Ausrüstung gestohlen worden und nicht wieder aufgetaucht. Jegliche fotografischen Hinweise, die ihre Kameras enthalten haben mochten, waren verloren gegangen.
Die Filme, die in den Taschen ihrer Weste gefunden worden waren, hatten die RCTF-Ermittler entwickeln und vergrößern lassen. Die vier Kontaktabzugbögen mit sämtlichen sechsundneunzig Aufnahmen befanden sich zusammen mit einigen großformatigen Schwarz-Weiß-Abzügen im Mordbuch. Sie lieferten jedoch keinerlei Beweise oder Anhaltspunkte, sondern zeigten lediglich, wie die in das Chaos von Los Angeles beorderte California National Guard am Coliseum zusammengezogen wurde. Auf anderen Fotos waren Nationalgardisten an den Barrikaden zu sehen, die sie an verschiedenen Kreuzungen des Unruhegebiets errichtet hatten. Es waren keine Aufnahmen von Gewalttaten, Brandstiftungen oder Plünderungen dabei, aber einige Aufnahmen zeigten geplünderte oder ausgebrannte Geschäfte, vor denen Nationalgardisten postiert waren. Offensichtlich hatte Jespersen die Fotos am Tag ihrer Ankunft in L.A. gemacht, nachdem sie vom LAPD ihren Presseausweis erhalten hatte. Die Aufnahmen mochten einen historischen Wert für die Dokumentation der Unruhen von 1992 haben, doch für die Mordermittlungen waren sie als wertlos erachtet worden, eine Einschätzung, der sich Bosch auch zwanzig Jahre später anschließen musste.
Außerdem enthielt die RCTF-Akte eine am 11. Mai 1992 erstellte Liste, die dokumentierte, was vom Avis-Leihwagen übrig geblieben war, den Jespersen vor Ausbruch der Unruhen am San Francisco International Airport gemietet hatte. Das Auto war im Crenshaw Boulevard gefunden worden, sieben Häuserblocks von der Durchfahrt entfernt, in der Jespersens Leiche entdeckt worden war. In den zehn Tagen, die der Wagen dort gestanden hatte, war er aufgebrochen und komplett ausgeschlachtet worden. Dem Bericht zufolge waren das Auto und sein Inhalt, beziehungsweise dessen Fehlen, für die Ermittlungen von keinerlei Wert.
Das alles lief darauf hinaus, dass die Hoffnungen auf eine Lösung des Falls auf dem einzigen Beweisstück ruhten, das Bosch in der ersten Stunde des Ermittlungsverfahrens gefunden hatte. Die Patronenhülse. Im Laufe der letzten zwanzig Jahre hatte die Kriminaltechnik eine rasante Entwicklung durchlaufen. Dinge, die man sich damals nicht einmal hätte träumen lassen, waren inzwischen selbstverständlich. Neue technologische Methoden zur Beweismittelanalyse und Verbrechensaufklärung hatten weltweit zu einer Wiederaufnahme alter unaufgeklärter Strafverfahren geführt. Inzwischen hatte jede größere Polizeidienststelle ein Dezernat, das sich ausschließlich mit der Aufklärung kalter Fälle befasste. Dank des Einsatzes neuer Technologien waren die Ermittlungen in solchen alten Fällen manchmal ein Kinderspiel, und nicht selten führten die Vergleiche von DNA-Spuren, Fingerabdrücken und ballistischen Daten bei Straftätern, die lange geglaubt hatten, ungeschoren davonzukommen, zu sofortigen Erfolgen.
Manchmal war die Sache allerdings komplizierter.
Als Bosch den Fall Nummer 9212–00346 neu öffnete, war eine seiner ersten Maßnahmen, die Patronenhülse in der Ballistikabteilung untersuchen und auswerten zu lassen. Aufgrund der Arbeitsüberlastung und wegen des niedrigen Dringlichkeitsstatus der von Offen-Ungelöst eingereichten kalten Fälle vergingen drei Monate, bis Bosch das Ergebnis erhielt. Es war kein Allheilmittel und keine Antwort, die den Fall schlagartig löste, aber es war ein Wegweiser. Nach zwanzig Jahren ohne Gerechtigkeit für Anneke Jespersen war das schon einmal etwas.
Der Ballistikbefund verhalf Bosch zu dem Namen Rufus Coleman, einem einundvierzig Jahre alten Mitglied des harten Kerns der Rolling Sixties, einer Untergruppierung der Crips. Aktuell saß Coleman wegen Mordes im California State Penitentiary in San Quentin ein.
2
Es war fast Mittag, als die Tür aufging und Colemanvon zwei Gefängniswärtern hereingeführt wurde. Er wurde mit den Armen hinter dem Rücken an den Stuhl gekettet, der Bosch am Tisch gegenüberstand. Die Wärter wiesen Coleman darauf hin, dass sie ihn beobachten würden. Dann gingen sie und ließen die beiden Männer allein.
Coleman starrte Bosch finster an. »Sie sind ’n Cop, oder? Dann wissen Sie wahrscheinlich auch, was passieren kann, wenn ich mit einem Cop in einen Raum gesperrt werde – jedenfalls, wenn einer von diesen Presseheinis was über die Sache geschrieben hat.«
Bosch antwortete nicht. Er studierte den Mann, der ihm gegenübersaß. Er hatte Karteifotos von ihm gesehen, aber darauf war nur Colemans Gesicht zu sehen gewesen. Er hatte gewusst, dass Coleman groß war – nicht umsonst war er bei den Rolling Sixties der Mann fürs Grobe gewesen –, aber nicht, dass er so groß war. Er hatte eine extrem muskulöse, wie aus Stein gemeißelte Statur und einen Hals, der breiter war als sein Kopf – einschließlich der Ohren. Sechzehn Jahre Liegestütze und Sit-ups und was sich sonst noch an Übungen in einer Gefängniszelle machen ließ, hatten ihm zu einem Brustkorb verholfen, der locker weiter vorstand als sein Kinn, und seine Oberarmmuskeln sahen aus, als ließen sich damit Walnüsse knacken. Auf den Karteifotos hatte er jedes Mal einen sehr speziellen Haarschnitt. Jetzt war sein Schädel glatt rasiert, und er hatte seine Glatze Gott als Plakatwand zur Verfügung gestellt: Er hatte sich auf beide Seiten ein von Stacheldraht umschlungenes Kreuz tätowieren lassen. Bosch fragte sich, ob er damit beim Bewährungsausschuss Eindruck schinden wollte. Ich bin geläutert. Steht auch auf meinem Kranium.
»Ja, ich bin ein Cop«, antwortete er schließlich. »Aus L.A.«
»Sheriff oder PD?«
»LAPD. Ich heiße Bosch. Und, Rufus, das wird heute der große Glücks- oder Pechtag Ihres Lebens. Das Gute daran ist, dass Sie selbst entscheiden können, was von beidem es werden soll. Die meisten von uns erhalten nie die Gelegenheit, zwischen Glück und Pech zu wählen. Uns passiert das eine oder das andere einfach. Das nennt man Schicksal. Aber diesmal können Sie es, Rufus. Sie können selbst entscheiden. Jetzt gleich.«
»Ach ja, wie das? Sind Sie der Typ mit dem ganzen Glück im Gepäck?«
Bosch nickte.
»Heute schon.«
Schon bevor Coleman hereingebracht worden war, hatte Bosch einen Aktenordner auf den Tisch gelegt. Den öffnete er jetzt und nahm zwei Schreiben heraus. Einen Umschlag, der bereits adressiert und frankiert war, ließ er im Ordner. Er war gerade weit genug von Coleman entfernt, dass dieser die Anschrift darauf nicht lesen konnte.
»Wie ich höre, erhalten Sie nächsten Monat Ihre zweite Chance auf Bewährung«, sagte Bosch.
»Richtig.« In Colemans Stimme schwang ein Anflug von Neugier und Besorgnis mit.
»Ich weiß zwar nicht, ob Sie wissen, wie so etwas läuft, aber dieselben zwei Ausschussmitglieder, die vor zwei Jahren Ihren ersten Antrag geprüft haben, kommen jetzt wegen Ihres zweiten wieder her. Sie werden also von zwei Typen begutachtet, die Sie schon mal abgelehnt haben. Das heißt, Sie brauchen Hilfe, Rufus.«
»Ich habe bereits Gott auf meiner Seite.«
Er beugte sich vor und drehte den Kopf von einer Seite auf die andere, damit Bosch die tätowierten Kreuze besser sehen konnte. Sie erinnerten Bosch an das Vereinsabzeichen auf den Seiten eines Footballhelms.
»Also, wenn Sie mich fragen, werden Sie etwas mehr brauchen als Ihre zwei Tattoos.«
»Ich frage Sie aber nicht, Fünf-Null. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Ich habe meine Anträge alle beisammen und dazu den Seelsorger von Block D und meine gute Führung. Sogar einen Brief, in dem mir Regis’ Familie verzeiht, habe ich.«
Walter Regis war der Mann, den Coleman kaltblütig ermordet hatte.
»Ach ja, und wie viel haben Sie ihnen dafür bezahlt?«
»Gar nichts habe ich dafür gezahlt. Gebetet habe ich, und Gott hat meine Gebete erhört. Die Familie kennt mich und weiß, wie ich inzwischen drauf bin. Sie vergeben mir meine Sünden genauso wie Gott.«
Bosch nickte und blickte eine Weile auf die zwei Briefe auf dem Tisch, bevor er fortfuhr.
»Na schön, Sie haben also bereits alles geregelt. Sie haben den Brief, und Sie haben Gott. Dann sind Sie vielleicht nicht mehr darauf angewiesen, dass ich mich für Sie einsetze, Rufus, aber Sie wollen doch sicher nicht, dass ich gegen Sie arbeite. Genau das ist nämlich der Punkt. Das wollen Sie doch sicher nicht.«
»Jetzt rücken Sie schon raus damit. Was wollen Sie?«
Bosch nickte. Jetzt kamen sie der Sache näher. Er zog den Umschlag aus dem Ordner.
»Sehen Sie diesen Umschlag? Hier unten in der Ecke steht Ihre Häftlingsnummer. Er ist an den Bewährungsausschuss in Sacramento adressiert und bereits frankiert, sodass er umgehend aufgegeben werden kann.«
Bosch legte den Umschlag auf den Tisch und nahm die zwei Schreiben, mit jeder Hand eines. Er hielt sie so nebeneinander hoch, dass Coleman sie lesen konnte.
»Ich werde eins dieser zwei Schreiben in diesen Umschlag stecken und in einen Briefkasten werfen, sobald ich heute hier wegfahre. Welches, entscheiden allein Sie.«
Coleman beugte sich vor, und Bosch hörte die Kette gegen den Metallstuhl schlagen. Coleman war so muskulös, dass es aussah, als trüge er den Schulterschutz eines Linebackers unter seinem grauen Gefängnisoverall.
»Was quatschen Sie da, Fünf-Null? Ich kann diesen Scheiß nicht entziffern.«
Bosch lehnte sich zurück und drehte die zwei Briefe so herum, dass er sie lesen konnte.
»Also, diese beiden Schreiben sind an den Bewährungsausschuss adressiert. Eines äußert sich sehr lobend über Sie. Dort steht zum Beispiel, dass Sie die Taten, die Sie begangen haben, bereuen und mit mir kooperiert haben, um zur Aufklärung eines lange ungelösten Mordfalls beizutragen. Es endet damit …«
»Einen Scheiß werde ich mit Ihnen kooperieren, Mann. Ich verpfeife niemand. Passen Sie also auf, was Sie sagen.«
»Es endet mit einer Empfehlung von mir, Ihrem Antrag auf Bewährung stattzugeben.«
Bosch legte das Schreiben auf den Tisch und wandte seine Aufmerksamkeit dem anderen zu.
»Das zweite hier ist nicht so vorteilhaft für Sie. Hier steht nichts von Reue. Hier steht, dass Sie sich geweigert haben, bei den Ermittlungen zu einem Mord, zu dem Sie wichtige Informationen beisteuern könnten, zu kooperieren. Und schließlich steht hier, dass der Gang Intelligence Unit des LAPD, also der LAPD-Einheit für Bandenkriminalität, Informationen vorliegen, denen zufolge die Rolling Sixties bereits auf Ihre Haftentlassung warten, damit Sie ihnen wieder als Mann fürs Grobe zur Verfügung …«
»Stimmt doch überhaupt nicht! Alles erstunken und erlogen! So einen Scheiß können Sie denen nicht schicken!«
Bosch legte das Schreiben seelenruhig auf den Tisch und begann es zu falten, um es in den Umschlag schieben zu können. Er sah Coleman ausdruckslos an.
»Sie glauben also, Sie können mir erzählen, was ich tun kann und was nicht? Ah-ah, Rufus, so läuft das hier nicht. Sie geben mir, was ich will, und ich gebe Ihnen, was Sie wollen. So läuft das hier.«
Bosch strich mit dem Finger über die Falten des Schreibens und machte sich daran, es in den Umschlag zu stecken.
»Welchen Mord meinen Sie überhaupt?«
Bosch schaute zu Coleman auf. Das war das erste Einlenken. Bosch fasste in die Innentasche seines Jacketts und zog das Foto von Jespersen heraus, das er sich von ihrem Presseausweis kopiert hatte. Er hielt es so, dass Coleman es sehen konnte.
»Eine Weiße? Über eine ermordete Weiße weiß ich nichts.«
»Habe ich ja auch nicht behauptet.«
»Was soll dann das Ganze? Wann ist sie umgebracht worden?«
»Am 1. Mai 1992.«
Coleman rechnete nach, schüttelte den Kopf und grinste, als hätte er einen Behinderten vor sich.
»Da sind Sie an der falschen Adresse. 1992 habe ich meine fünf Jahre in Corcoran abgesessen. Also, was soll der Scheiß, Dee-tective?«
»Ich weiß sehr genau, wo Sie ’92 waren. Glauben Sie, ich würde extra herkommen, ohne alles über Sie zu wissen?«
»Ich kann nur sagen, dass ich absolut nichts mit dem Mord an einer Weißen zu tun habe.«
Bosch schüttelte den Kopf, als wollte er zum Ausdruck bringen, dass er das ja gar nicht bestritt.
»Dürfte ich es Ihnen vielleicht kurz erklären, Rufus? Es gibt hier nämlich noch jemanden, mit dem ich sprechen möchte, und anschließend muss ich es rechtzeitig zum Flughafen schaffen. Hören Sie mir also zu?«
»Ich höre zu, Mann. Rücken Sie endlich raus damit.«
Bosch hielt das Foto erneut hoch.
»Wie gesagt reden wir hier von einem Vorfall, der zwanzig Jahre zurückliegt. Er hat sich in der Nacht vom 30