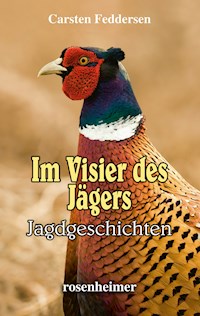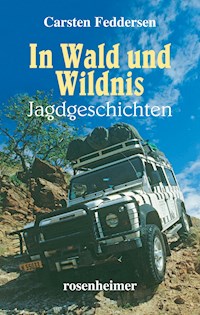13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Von Jagdglück und Stoßgebeten, von Beute, die sich wehrt, und Jägern, die nicht immer ganz Herr des Reviers sind: Der Autor, dessen Jagdfieber bereits in der Kindheit erwachte, hat aus seinem Jägerleben eine solche Fülle von überaus vergnüglichen Jagdgeschichten zu erzählen, dass auch jeder Nicht-Jäger daran seine helle Freude hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dieses Buch ist meinem Großvater Ewald Kiel und meinem Bruder Kai-Bossen gewidmet.
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2011
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Bearbeitung, Lektorat und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger und Karl Schaumann GmbH, Heimstetten Titelfoto: Bernd Römmelt, München eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN 978-3-475-54539-9 (epub)
Worum geht es im Buch?
Carsten Feddersen
Blattschüsse
Von Jagdglück und Stoßgebeten, von Beute, die sich wehrt, und Jägern, die nicht immer ganz Herr des Reviers sind: Der Autor, dessen Jagdfieber bereits in der Kindheit erwachte, hat aus seinem Jägerleben eine solche Fülle von überaus vergnüglichen Jagdgeschichten zu erzählen, dass auch jeder Nicht-Jäger daran seine helle Freude hat. Der Autor ist Banker, Landwirt, Jäger und Familienvater von sechs Töchtern. „Buchautor war etwas, an das ich nie gedacht hatte“, sagte Carsten-Broder Feddersen nach dem Erscheinen seines ersten Buchs. Carsten-Broder Feddersen wurde 1961 in Kiel geboren. Schon früh entdeckte er seine Liebe zur Jagd und legte bereits im Alter von 23 Jahren seine Jagdscheinprüfung ab. Bereits sein erstes Buch „Blattschüsse“ wurde auf Anhieb ein großer Erfolg.
Inhalt
Vorwort
Von Kindesbeinen an
Erste Schritte
Und weit ist das Revier
Die Wildgänse kommen
Sicherheit geht vor!
Geschichten um den Rehbock
Ein alter Spießer
Noch ein alter Spießer
Zwei Geringe
Aus nächster Nähe
Kampf bis aufs Messer
Wenn der Sohne mit dem Vater
Allerhand Kahles
Ein Schonzeitvergehen?
Auf Tauchstation
Die Hagelpirsch
Mutterliebe
Von Sauen und anderen Nachtgespenstern
Fuchs und Fußsack
Achtung Flugalarm
Fuchs und Katze
Fuchs und Sau
Verkämpft, verheddert, verloren
Meine Hirsche
Ein Abnormer
Durch den Knick
Der Drückjagdhirsch
Zwei Laufkranke
Hirsch bleibt Hirsch
Auf den Hund gekommen
Cliff von der Hochantenne
Keck von der Rethwisch
Wenn einer eine Reise tut ...
Kurioses
Eine Mardergeschichte
Eine Treibjagdgeschichte
Eine Dachsgeschichte
Eine Hirschgeschichte
Eine Krähengeschichte
Eine Hasengeschichte
Zum Ausklang
Vorwort
In diesem Buch geht es um die Jagd. Trotzdem kann und will es kein Jagdbuch im engeren Sinne sein, kein Buch, das nur vom Erlegen bestimmter Wildarten handelt.
Es ist auch und vor allem ein Rückblick auf die Zeit meiner Jugend. Leider habe ich nie ein persönliches Tagebuch geführt, in dem ich all die großen und kleinen Ereignisse festgehalten hätte, die mein Leben prägten. Umso größer waren meine Überraschung und Freude, als beim Schreiben dieses Buches immer mehr dieser Kindheits- und Jugenderlebnisse vor meinem inneren Auge wieder lebendig wurden.
Und jetzt, Jahrzehnte später, begreife ich erst richtig, wie reich diese Zeit doch war, und ich empfinde eine große Dankbarkeit gegenüber meinen Eltern und Großeltern, die mir diese unbeschwerte und sorgenfreie Jugend ermöglicht haben. Dabei blicke ich nicht wehmütig oder gar traurig auf diese vergangenen, unwiederbringlichen Jahre zurück, sondern freue mich an der Erinnerung.
Und ich hoffe, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, an all den kleinen Geschichten, die sich um meine großen Passionen Natur, Tiere und – last but not least – um die Jagd drehen, beim Lesen genauso viel Spaß haben wie ich beim Schreiben. Und wenn ich den einen Nicht- oder Noch-nicht-Waidmann für die Jagd interessieren oder zumindest dafür Verständnis wecken könnte, hätte dieses Buch seine Aufgabe erfüllt.
Bothkamp, im Frühjahr 2003 Carsten Feddersen
Von Kindesbeinen an
Wenn man als Kind schon sehr frühzeitig mit der Jagd konfrontiert wird, stellt sich ebenso frühzeitig heraus, ob man dieser Passion dauerhaft verfällt oder nicht.
Ferien und Wochenenden – das bedeutete für mich häufig einen Aufenthalt auf dem Land bei meinen Großeltern, die ein »landwirtschaftliches Lohnunternehmen« betrieben. Sowohl Großvater als auch Onkel waren aktive Jäger, sodass ich den Anblick von erlegten Hasen, Fasanen, Kaninchen, Füchsen oder Rehen durchaus gewohnt war. Großes Interesse und ständiges Drängeln meinerseits veranlassten meinen Großvater, dem passionierten Enkel die Funktions- und Wirkungsweise eines Luftgewehres zu demonstrieren.
Von diesem Moment an war das kleine Knicklaufgewehr der Marke Diana mein ständiger Begleiter, wobei der Begriff »klein« genau genommen nur meine heutige Sicht widerspiegelt. Denn damals bestand zwischen dem zehnjährigen Jungjäger und der »Diana« kaum ein Größenunterschied.
Bald war sich Großvater sicher, dass mein Umgang mit der Waffe und meine Treffsicherheit, die ich zunächst an unbeweglichen Zielen wie Dosen und Flaschen erprobte, selbstständiges Pirschen erlaubten. Damit dehnte sich mein Aktionsradius auf interessantere Gefilde des weitläufigen Geländes aus.
Bevorzugte Anstände waren das Gehege für die Hühner mit seiner aus meiner Sicht weit überhöhten Spatzenpopulation und die großen Kirschbäume, die vor allem in den frühen Morgenstunden von riesigen Starenschwärmen heimgesucht wurden.
In die Blechwand des an den Hühnerfreilauf angrenzenden Schuppens, in dem sich die große Blocksäge befand, schnitt ich mir ein faustgroßes Guckloch und verbrachte dort, auf der Laufschiene der Blocksäge sitzend, so manchen Ansitztag. Neben den zahlreichen Spatzen konnte ich auch Mäuse und Ratten der abendlichen Stöckenmeldung hinzufügen. Da insbesondere Ratten als »hartes Wild« den Schuss mit Flucht quittierten, sammelte ich in dieser Zeit erste Erfahrungen im Nachsuchen. Leider führte ich zu dieser Zeit noch kein Schussbuch, sodass genaue Aussagen über Strecken und verbrauchte Munition nicht mehr mit letzter Sicherheit zu treffen sind.
Ein Ereignis möchte ich diesem Bericht über diese ersten Schritte noch beifügen. Es ist mir detailgetreu im Gedächtnis geblieben und bis heute prägend für meine jagdliche Verhaltensweise: Es war ein kalter und regnerischer Morgen. Sowohl Spatzen als auch Stare schienen ihre behaglicheren Einstände vorzuziehen, anstatt tschilpend und krächzend auf Futtersuche zu gehen. Entsprechend trost- und erfolglos gestaltete sich die Morgenpirsch.
Als ich vorsichtig um die Ecke des Wohnhauses blickte, saß etwa zehn Meter entfernt ein brauner Vogel unter der Regenrinne und blickte aufgeplustert von seiner trockenen Warte aus in den Regen.
Ein schneller Schritt nach vorn, Waffe hoch, Kimme und Korn fanden das Ziel, und raus war der Schuss.
Mit aufkeimendem schlechten Gewissen eilte ich zu meiner Beute, einem Fliegenschnäpper.
Wie aus dem Boden gewachsen stand plötzlich Opa neben mir. Er verschränkte die Arme vor der Brust, schaute mich an und sagte: »Und ich dachte, du wärst ein richtiger Jäger!« Sprachs und wandte sich ab.
Keine körperliche Züchtigung hätte mehr schmerzen können. Ich bin meinem Großvater noch heute dankbar für diese Lehre.
Mein Onkel jagte damals, mit einem Begehungsschein ausgestattet, in der ortseigenen, etwa 300 Hektar großen Gemeindejagd. Diese grenzte an einer Seite an den Staatswald und bestand aus Ackerflächen, Wiesen und den in Schleswig-Holstein obligatorischen Knicks, den Hecken zur Begrenzung der Felder. Es gab in diesem Revier zahlreiche Hasen und Kaninchen, einen guten Rehwildbestand sowie Dam- und Schwarzwild als Wechselwild. Insbesondere die Knicks hatten es im wahrsten Sinne des Wortes in sich – Fasane nämlich. Im Herbst dann stöberte Groll, ein wunderschöner Kleiner Münsterländer, vor der Flinte die Hecken ab.
Wenn sich mein Onkel dann dem Betteln seines kleinen Neffen nicht mehr zu entziehen wusste, durfte ich gnadenhalber als Träger fungieren. Die geschossenen Fasane wurden auf den Schultern immer schwerer, und der Lehm an den Füßen tat ein Übriges, um mich an die Grenzen meiner körperlichen Leistungsfähigkeit zu bringen. Doch auch solche Gewaltmärsche konnten die einmal entfachte Passion nicht bremsen.
In dieser Zeit wurde auch die Fallenjagd mit Eisen und Durchlauffalle intensiv betrieben, sicherlich ein wesentlicher Grund für die hohen Niederwildstrecken. Dass ich den zuständigen Jäger Karl, wann möglich, bei der täglichen Kontrolle begleitete, war Ehrensache.
Eines Tages konnte diese, aus welchen Gründen auch immer, erst in der bereits einsetzenden Dämmerung erfolgen. Schon von weitem war erkennbar, dass die auf einem Zwangswechsel über einen Wasserlauf fängisch gestellte hölzerne Durchlauffalle geschlossen war. Erwartungsvoll eilten wir dorthin, während am Himmel schon die ersten Sterne standen. Die Falle wies nur einen schmalen Schlitz an der Oberseite auf, von dem aus man den Durchlauf einsehen konnte. Karl blickte hinein, interpretierte den Fang als schweren Hauskater und streckte ihn mit einem Schuss aus der Pistole, Kaliber 22 nieder. Kräftig und zuversichtlich wurde der vermeintliche Niederwildräuber herausgeschüttelt und entpuppte sich als starker Rammler, sicherlich der Stammvater eines großen Geschlechtes.
Karl kommentierte diesen Zufallserfolg ein wenig fassungslos mit den Worten: »Na ja, den können wir zumindest essen.«
Auch das bald darauf folgende Ereignis war kaum dazu angetan, das leicht angeknackste jagdliche Selbstvertrauen Karls wieder dauerhaft ins Lot zu bringen: Ich saß mit meinen Großeltern in der Küche. Diese wurde damals noch von einem alten Holzherd mit wohliger Wärme erfüllt, in dessen Backofen man die kalten Füße wärmen konnte, während in der Schüre die Holzscheite knackten. Da betrat Karl mit schweren Schritten den Raum. Mit schnellem Griff entledigte er sich des, wie ich mit aufsteigender Spannung erkennen konnte, nur wenig gefüllten Rucksacks und schüttelte daraus einen eben erlegten Steinmarder auf den Terrazzoboden der Küche.
Während ich »Waidmannsheil« rief und auf das Tier zueilte, blickte mein Großvater auf das Opfer des abendlichen Ansitzes und sprach: »Der lebt ja noch!« Dabei deutete er auf die zuckenden Pranken des angeblich Gemeuchelten.
»Ach was!«, war von Karl im Brustton der Überzeugung zu vernehmen. »Das sind doch nur noch die Nerven!«
Im selben Moment öffnete der für tot Erklärte seine Lichter, ein Ruck ging durch den Körper bis hin zur buschigen Rute, und in panischem Schrecken durchfloh der wieder Auferstandene die Küche. Das Entsetzen war aber nicht nur auf seiner Seite. Ängstliche Schreie meiner Großmutter und das ruckartige Zusammenraffen von Röcken und Hosenbeinen veranlassten den Marder zu immer schnelleren Runden an den Wänden des Raumes entlang. Flaschen, Gläser, Milch- und Marmeladentöpfe krachten scheppernd zu Boden. Opa stürzte zum Fenster, riss es auf und der Marder stürzte, dem frischen Luftzug wie einem Lichtstrahl folgend, auf Nimmerwiedersehen in die Freiheit.
Für einen Moment herrschte atemlose Stille, nur das Ticken der Küchenuhr und die sich leicht bewegenden Vorhänge beherrschten die Szenerie. Dann ein erstes Glucksen, schließlich brüllendes Gelächter. Solche Szenen vergisst man für sein ganzes Leben nicht.
Lassen Sie mich an dieser Stelle ein anderes Erlebnis mit einem Marder erzählen, das sich einige Jahre später auf dem elterlichen Besitz abspielte und ebenfalls die Härte dieser ebenso possierlichen wie rücksichtslosen Räuber zeigt.
Das elterliche Wohnhaus wird von einem etwa 600 Quadratmeter großen Teich von dem Hühnerfreilauf getrennt, einem Areal, in dem sich neben dem namengebenden Geflügel auch Enten und Gänse befanden.
Ich war gerade damit beschäftigt, zwecks Vorbereitung des jährlichen Abfischens an der dem Haus zugewandten Seite des Teiches das Schilf abzumähen. Meine Eltern arbeiteten auf der anderen Seite in Höhe des Hühnerfreilaufs mit zweizinkiger Gabel und Spaten.
Dann auf einmal ein Aufschrei. Ich sah meine Mutter wild gestikulieren. Der über den Teich schallende Ausruf »Marder, Marder« löste in mir eine Folge instinktiver Reaktionen aus: Sense fallen lassen, Spurt um den Teich und Erfassen der Situation. Ein Steinmarder befand sich zwischen dem sichtlich erregten Federvieh und suchte, da erkannt, sein Heil in der Flucht. Geistesgegenwärtig zielte mein Vater mit der zweizinkigen Gabel nach dem Eindringling und heftete ihn mit dieser Waffe am Erdboden fest. Erkennbar waren die Zinken jedoch rechts und links am Körper des Marders vorbeigeglitten und hinderten ihn, obgleich er unverletzt war, an der weiteren Flucht.
So weit der Stand der Ereignisse, als ich am Ort des Geschehens eintraf. Die einzige aus meiner Sicht taugliche Waffe war für mich der Spaten, den meine Mutter in der Hand hielt. Vom Jagdeifer gepackt und beseelt von dem Wunsch, unsere wild schnatternde Enten- und Gänseschar nach Kräften zu verteidigen, entriss ich ihr diese Schlagwaffe derartig ruckartig, dass sie der Stiel ziemlich hart am Kinn traf. Es zeugt von der Standfestigkeit meiner Mutter, dass sie, sichtlich benommen, doch immerhin auf den Beinen blieb.
Ich stürmte inzwischen, ohne die Notwendigkeit etwaiger Erste-Hilfe-Leistungen zu prüfen, auf den potenziellen Geflügeldieb zu und schlug ihm mit einem wuchtigen Hieb den Spatenstiel auf den Kopf.
Augenblicklich streckte sich der Marder, und Vater lockerte den eisernen Griff in der Annahme, dass wir das Tier nunmehr erledigt hätten. Sofort ergriff der Marder die Flucht. Wir sahen uns an und dem Tier nach wie Bauer und Bäuerin dem flüchtenden Fuchs bei Wilhelm Busch.
Noch heute beschäftigt mich die Frage, ob der Marder wirklich für einen Moment betäubt war oder ob er bewusst toter Mann spielte. Ich hoffe jedoch, dass nicht nur meine Mutter Blessuren auszukurieren hatte.
In den immer schneeärmeren Wintern unserer Tage gelingt es immer seltener, diesem heimlichen Kobold der Nacht erfolgreich nachzustellen. So nimmt auch die Strecke der erlegten Marder einen vergleichsweisen geringen Umfang in meinem Schussbuch ein. Doch davon zurück in die Zeit jagdlicher Anfänge.
Mit »Und könnt’ es Herbst im ganzen Jahre bleiben« betitelte Frevert eines seiner hervorragenden Bücher über Wild und Jagd in Rominten. Trotz Unkenntnis dieses erst viele Jahre später erschienenen Werkes empfand ich doch in meinen Jugendjahren ähnlich. In gespannter Erwartung beobachtete ich jeweils im Herbst die sich verstärkenden jagdlichen Aktivitäten meines Onkels, zu denen auch der Entenstrich zählte.
In Ermangelung größerer Gewässer im Revier wählte Onkel Hans einen der im Oktober entstandenen Überschwemmungsbereiche in den so genannten Lünken auf Acker- oder Wiesenflächen aus. Hier wurden die Enten mit altem Brot und Weizen »gekirrt«. Schnell sprach sich in Entenkreisen herum, wo es diese Köstlichkeiten gab, und so erfreute sich der Ort allgemeiner Beliebtheit. Selbstverständlich war ich, wann immer ich durfte, bei der Beschickung und Beköstigung der Langschnäbel mit dabei.
Eines Abends, der Jagdschrank knarrte und die Patronentasche klapperte, erschien mein Onkel in der Wohnstube und fragte: »Na Carsten, willst du mit zum Ententeich?« Und ob ich wollte!
Schnell Gummistiefel und Tarnkleidung angezogen, den Hund ins Auto und ab ins Revier.
Mit Verwunderung fiel mein Blick auf den mitgeführten Drilling samt Zielfernrohr. Doch jetzt nur keine dummen Fragen stellen – am Ende schickt man dich wieder nach Hause.
An der Überschwemmungsfläche angekommen, schoben wir uns hinter einige von der Ernte verbliebene Maisstängel, die zusätzlich mit Fichtenreisig verblendet waren, und harrten der Dinge.
Der Abend war kühl, kaum ein Windhauch war zu spüren, und die Sonne senkte sich mehr und mehr hinter dem Horizont. Heute genießt man die bezaubernde Stimmung, das Innehalten der Natur, damals kreisten meine Gedanken nur um die Enten, die da kommen sollten. Dann, im Zwielicht zwischen Tag und Nacht, ein Klingeln in der Luft, ein Rauschen und Platschen. Es waren Enten eingefallen. Leise wies mich mein Onkel ein. Ja, da waren sie. Ein Erpel hob sich deutlich vom Wasser ab. Vorsichtig gab mir mein Onkel den Drilling und sprach: »Den kannst du schießen.«
Eine heiße Welle durchpulste meinen Körper, dann wurde mir kalt. Die Waffe entsichert, erhoben, die Ente auf dem Zielstachel aufsitzen lassend, brach der Schuss – und ich dachte, mir bräche die Schulter. Doch was war der Schmerz gegen das Bewusstsein, die erste Ente erlegt zu haben. Vor Aufregung verlor ich einen Stiefel, als ich dem apportierenden Hund entgegenlief. Doch Grolli ignorierte den mit Socken im knöcheltiefen Matsch stehenden, vor Aufregung zitternden zwölfjährigen Jungen und brachte den Erpel seinem Herrn.
Die Erpelfedern hatten über lange Jahre einen Ehrenplatz in meinem Zimmer, während die geschwollene, mit blauen Flecken übersäte Schulter alsbald ihre ursprüngliche Form und Farbe wieder annahm.
Durch diese jagdlich so reiche Jugendzeit war die Ablegung der Jagdscheinprüfung das Ende der geschilderten und der Anfang der weiteren jagdlichen Entwicklung. Ich bin Großvater, Eltern und Onkel noch heute dankbar für die behutsame und dabei konsequente Hinführung zur Jagd, die ich genießen durfte.
Erste Schritte
Im Jahr 1983 war es dann so weit. Nach unzähligen Übungsstunden, Schießübungen mit Büchse und Flinte, gemeinsamen Abfrageabenden und zermürbendem Büffeln hielt ich meine Prüfungsurkunde in den Händen, verbunden mit den herzlichen Glückwünschen und dem Waidmannsheil der Prüfungskommission.
Alles Glück der Welt war in meiner Seele und spiegelte sich auf dem Antlitz des frisch gebackenen Jungjägers wieder. Auf der Rückfahrt nach Hause erschollen statt Radiomusik raue Jägerlieder aus nunmehr berufenem Munde.
Nach Schulterklopfen und gehörigen Glückwünschen durch Eltern, Großeltern, Onkel, Freunde und Bekannte führte mich der nächste Tag schnurstracks zum Jagdwaffenhändler, bei dem ich einen gebrauchten Suhler Drilling im Kaliber 7 x 65 R erstand, der mir bis zum heutigen Tag die Treue hält.
Mit allen nötigen jagdlichen Utensilien ausgestattet und voller Tatendrang fuhr ich zu einem der Jagdpächter unserer fast 1000 Hektar großen Gemeindejagd und meldete das positive Ergebnis der Jagdscheinprüfung.
Meine Eltern waren 1981 in dieses kleine Dorf gezogen, und ich konnte von Anfang an durch landwirtschaftliche Ernteeinsätze, Aushilfe im Kuhstall sowie meine zweite große Leidenschaft, die Reiterei, schnell Kontakte in diesem neuen Umfeld knüpfen.
Mit Herrn B., Altbauer, Mitpächter oben genannter Dorfjagd und selbst passionierter Reiter in früheren Jahren, verband mich vom ersten Tag unseres Kennenlernens eine tief gehende Seelenverwandtschaft. Wie selbstverständlich durfte ich ihn bei seinen häufigen Reviergängen begleiten.
Nicht einmal ansatzweise entstand das Gefühl, der Jagdherr unterweise seinen Eleven, sondern stets stand das kameradschaftliche Miteinander im Vordergrund. Sensibilität und Feingefühl prägten diesen jagdlich abgeklärten Mann, seine ganze Liebe hing an seinem Revier, dem Wild und vor allem am Wald. Schon lange deckt ihn, der mir den waidmännischen Feinschliff angedeihen ließ, der grüne Rasen. Ich werde ihn nie vergessen.
Doch nun zurück in die Zeit jagdlicher Gemeinsamkeit. Den ersten Jahresjagdschein wohlwollend in Händen haltend und fachmännisch meinen Drilling prüfend, sprach er das Zauberwort: »Na, dann wollen wir mal!«
An diesem trockenen, heißen Tag Anfang August führte uns der Pirschgang kreuz und quer durch das Revier. Trotz Blattzeit bot sich außer einigen hoffnungsvollen jüngeren Semestern kein nennenswerter Anblick. Der fast windstille Tag neigte sich langsam dem Ende zu. In der aufsteigenden, angenehmen Kühle näherten wir uns dem eigentlichen Ziel, einem großen, im Altholzbestand gelegenen und gut frequentierte Dachsbau. Seit vielen Jahrzehnten wuchs hier Jahr für Jahr eine neue Dachsgeneration heran und sorgte für eine vergleichsweise hohe Bestandsdichte, sehr zur Sorge des Jagdherrn, der missmutig registrierte, dass der Bestand an Rebhühnern und Fasanen Jahr für Jahr weiter zurückging.
Schritt für Schritt, jeden trockenen Ast meidend, pirschten wir uns bis auf 60 Schritt an das Domizil derer von Grimbart heran. Diese genossen gerade die letzten Sonnenstrahlen und widmeten sich intensiv und wohlig brummend dem Staubbad, um lästige Untermieter und Blutsauger zur Zwangsräumung zu drängen.
Ein Jungdachs begann fünf Meter vor dem Bau nach Untermast zu stechen und zog breit. Mich beutelte bereits ganz gehörig das Jagdfieber. Nochmals tief durchgeatmet, den Zielstachel aufs Blatt gesetzt – ein greller Knall brachte das vielstimmige Vogelkonzert zum Schweigen. Wippende, feiste Pürzel stürzten sich in die Löcher der vielstöckigen unterirdischen Villa. Doch da, wo mein erster Dachs im Feuer liegen sollte, lag er erkennbar und zu unser beider Verdruss nichts. »Du hast vorbeigeschossen!«, lautete die niederschmetternde, vorwurfsvolle Feststellung.
Daraufhin marschierten wir zum Anschuss, an dem wir Lungenschweiß vorfanden. Das Stimmungsbarometer stieg. Einem Schweißhund alle Ehre machend, arbeitete ich mich auf der Wundfährte bis zu der Röhre vor, die der Jungdachs in seiner Todesflucht angenommen hatte. Zu sehen war allerdings nichts.
In Ermangelung einer Taschenlampe also selbst hinein in die dunkle Behausung. Stück für Stück mich weiter vortastend und rutschend, stieß ich dann auf etwas Warmes, Haariges. Es war mir gerade gelungen, den Dachs am Pürzel zu packen, da fühlte ich einen festen Griff an meinen noch aus der Röhre herausragenden Extremitäten. Herrn B. war beim Anblick des noch außerhalb des Baues befindlichen, nicht gerade unterproportionierten Hinterteiles und der daranhängenden, zuckenden Beine seines Jagdbegleiters doch etwas mulmig geworden und er hatte sich zur ersten Hilfe entschlossen. Leider wurde dieser sicherlich einmalige Anblick durch keine Kamera festgehalten und ist daher der Nachwelt nicht erhalten geblieben. Noch am selben Abend schwartete ich meine erste offizielle Jagdbeute ab – sehr zum Verdruss meiner Eltern, da das gesamte Haus dabei wie ein viel befahrener Dachsbau roch.
Nach dieser ersten Ruhmestat erhielt ich meinen ersten Begehungsschein und damit die Erlaubnis, meinen ersten Bock selbstständig zu erpirschen und, so Sankt Hubertus wollte, auch zu erlegen. Ist dieses Erlebnis es auch nicht wert, hier explizit literarisch festgehalten zu werden, ist es die am Vortag vorangegangene erste Pirsch umso mehr.
Um zu einer kleinen, am Bestandesrand liegenden, viel versprechenden Waldwiese zu gelangen, entschloss ich mich aus einer gewissen Trägheit heraus, die strapaziöse Umgehung zu vermeiden und den direkten Weg über eine Viehweide einzuschlagen. Vorab identifizierte ich mit schnellem – allzu schnellem – Blick durch das Jagdglas den vermeintlichen Viehbestand: Färsen und Pferde. Den Drilling über den Rücken, die rechte Hand lässig über den nach vorn weisenden Lauf gelegt, marschierte ich selbstbewusst über die Weide.
Im Galopp näherten sich die Pferde, um den Neuling zu begrüßen. Für einen aktiven Reiter ist es immer wieder ein wunderbares Schauspiel, Pferde im gestreckten Lauf mit wehender Mähne, aufgerichtetem Schweif und geblähten Nüstern beobachten zu können.
Gemessenen Schrittes, fasziniert auf die Pferde blickend und das weitere Umfeld missachtend, erreichte ich die Mitte der Wiese. Ein abgrundtiefes, aufsteigende Wut signalisierendes Brummen in einer rechts neben mir befindlichen Senke ließ mich aus meinen Träumereien auffahren.
Aus einer Entfernung von vielleicht 50 Metern starrte mich ein Bulle von erheblichen Ausmaßen mit gesenktem Kopf, Grasbüschel und Erde hinter sich werfend, aus bösartig blitzenden Augen an.
Keinen Moment zweifelnd, wer hier der Stärkere und damit der Chef im Ring war, veränderte sich mein gemessener Schritt ansatzlos zu einem extremen Spurt. Doch auch mein Kontrahent verlor keine Zeit mit weiteren Betrachtungen und kam Meter um Meter heran. Es ist kaum vorstellbar, welche Geschwindigkeit ein derart plump und schwerfällig wirkendes Tier entwickeln kann.
Hier nun lag mein Heil augenscheinlich nicht in der Flucht, denn mit jedem Augenblick näherte sich zwar der rettende Knick, verringerte sich aber auch die Distanz zu dem auf mich zustürmenden Fleischberg.
Da nahte die Rettung in buchstäblich letzter Sekunde. Die Pferde nämlich begriffen die Attacke scheinbar als neues, den tristen Weidealltag unterbrechendes lustiges Gesellschaftsspiel und sprangen nun wiehernd zwischen mir und dem schwarzbunten Prachtvererber herum.
Dadurch reduzierte sich dessen Angriffsgeschwindigkeit zumindest so weit, dass ich den Knick erreichte, kurz bevor der Vater künftiger Milchquoten den laufstarken Jungjäger auf die Hörner nehmen konnte. Der Drilling flog in hohem Bogen in die Büsche, das Fernglas schlug mir beim olympiareifen Sprung in dieselben gegen Nase und Auge. So endete meine erste Pirsch: von Dornen an allen möglichen und unmöglichen Stellen gepeinigt, aus der Nase blutend, mit blauem Auge, mit Schürfwunden übersät und etlichen Kratzern auf dem vormals makellosen Schaft des Drillings.
Für die nächsten Wochen befand sich diese Bullenpirsch auf der Bestsellerliste der dörflichen Gesprächszirkel. Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Am nächsten Tag schoss ich übrigens dann – zwar mit einem leicht zugeschwollenen Auge, aber mit sicherer Hand – meinen ersten Knopfbock.
Und weit ist das Revier
Fast 1000 Hektar mit Acker und Grünflächen, Teichen und Knicks, Hochwald und Dickungen, fast 1000 Hektar mit Schwarz-, Dam- und Rehwild, Dachsen und Füchsen, Hasen und Kaninchen, Fasanen und Enten, fast 1000 Hektar zum Durchstreifen und Durchpirschen mit Büchse und Flinte – fast zu viel für einen jungen und unruhigen Jäger!
An langer Leine, jedoch konsequent geführt von meinem Jagdherrn durchstreifte ich dieses prachtvolle Revier so oft es die damals noch reichlicher zur Verfügung stehende Zeit erlaubte, sehr zur Sorge meiner Eltern, befand ich mich doch eben in der Berufsausbildung.
Diese Besorgnis spürend, wurde ich mir des in mich gesetzten Vertrauens sehr bewusst, und häufig lag neben dem Fernglas das eine oder andere Lehrbuch über Wirtschafts- oder Bankbetriebswirtschaftslehre mit auf dem Hochstand, um die anblickslose Zeit zu überbrücken. Da sage noch einer, die Jagd habe nicht auch pädagogische Qualitäten.
Eine der ersten gern übernommenen Pflichten des Jungjägers bestand in der Ausübung der Fallenjagd, sprich dem Auskundschaften der bevorzugten Marderwechsel, der Auswahl und Vorbereitung der Fangplätze sowie der Bestückung der Fallen mit Eiern. Wurde dann das Ei beständig angenommen, platzierte man ein Abzugseisen.
Dabei wählte ich mit Vorliebe Knicks und Wälle aus, versenkte in diesen eine abgesägte, ausgediente Plastikmülltonne, deckte das Ganze von oben wieder ab und versah den so entstandenen Fangbunker mit einem beidseitigen Durchlass. Für mich faszinierend war immer wieder die Vorsicht und, man muss schon sagen, die Schläue dieser Jäger der Nacht. Denn häufig konnte ich beobachten, wie das »ungesicherte« Ei ungeniert jede Nacht entwendet, ja teilweise genussvoll noch am Ort des Geschehens verspeist wurde. War jedoch das Abzugseisen mit, wie ich dachte, aller Raffinesse fängisch gestellt und der Trapper bereits mit Überlegungen beschäftigt, ob das begehrte Pelztier nun ausgestopft oder gestreift werden sollte, folgte am nächsten Tag regelmäßig eine Enttäuschung. Entweder fand ich das so sorgsam präparierte Ei samt Falle am Morgen jungfräulich und unberührt vor oder der Marder hatte das Eisen rundherum freigelegt, um seinem Verfolger die Klassenunterschiede zwischen Jäger und Gejagtem in aller Deutlichkeit aufzuzeigen. Welche Frustration und welche Schmach! Gleichzeitig musste ich die Herausforderung annehmen.
Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas über die oft unterschätzte Gefahr sagen, die von den Fangeisen ausgeht.
Ein Bauer in der Nachbargemeinde klagte über einen Steinmarder, der anscheinend die separat liegende Scheune als Ausgangspunkt für seine nächtlichen Exkursionen benutzte. In der nicht ganz unbegründeten Befürchtung, selbiger könnte auch den Hühnerstall heimsuchen, bat Klaus S. um Hilfe. Da die Scheune abschließbar war und es auf dem Hof keine Kinder oder Katzen gab, verzichtete ich auf eine weiter reichende Abdeckung und stellte das Abzugseisen in einer verborgenen, durch Strohballen kaum einsehbaren Ecke fängisch. Klaus wurde eingeweiht, und mit ruhigem Gewissen trat ich den Heimweg an. Als ich am nächsten Morgen zur Routinekontrolle erschien, hatte das Schicksal bereits seinen Lauf genommen. Denn Opa Hermann, leider nicht eingeweiht, hatte abends seinen obligatorischen Haus- und Hofrundgang unternommen und sofort mit geschultem Blick das vereinsamte Ei entdeckt. Über die vermaledeiten, ständig weglegenden Hühner schimpfend, umfasste er mit schnellem Griff das Ei und fühlte sich ebenso schnell von den Eisenbügeln erfasst, was heftige Schmerzen im Unterarm zur Folge hatte. Mit schmerzverzerrter Stimme und unter wüsten Flüchen rief er seinen Sohn herbei, der ihn aus der misslichen Situation befreite. Glücklicherweise beschränkten sich die Verletzungen auf eine starke Quetschung. Nicht auszudenken, wenn statt seiner ein Kind den Weg in die Scheune gefunden hätte!
Seitdem gab es kein offen liegendes Eisen mehr. Übrigens war anscheinend auch der Marder von den Vorfällen außerordentlich beeindruckt. Zumindest ließ er sich nicht mehr sehen.
Übrigens fanden alle meine gefangenen Marder mit sauberem Genickfang Eingang ins Schussbuch. Aus meiner Sicht stellt die Jagd mit dem Fangeisen die schmerzloseste Tötungsart dar, wenn sie richtig angewandt wird. Insofern sind praxisbezogene Seminare für Aus- und Weiterbildungszwecke nur zu begrüßen. Auch setzt eine erfolgreiche Fallenbejagung und die Suche nach geeigneten Fangplätzen eine intensive Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den Lebensgewohnheiten des Raubwildes voraus. Zudem gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, das Revier mit all seinen Eigenheiten kennen zu lernen.
Ein weiteres Mardererlebnis erhob mich endgültig in den Ruf, zu den treffsicheren und abgeklärten Jägern des Dorfes zu zählen.
Schon länger klagte ein Bauer über nächtliche Ruhestörung, da ihn randalierende Steinmarder auf dem Dachboden, direkt über seinem Schlafzimmer, Nacht für Nacht um den Schlaf brachten. Den Einsatz von Fallen lehnte er eingedenk zahlreicher Hauskatzen kategorisch ab. Verstänkerungsmittel waren zu damaliger Zeit noch nicht bekannt, sodass er, durch zahlreiche schlaflose Nächte ziemlich entnervt, zu einem anderen wirkungsvollen Mittel griff. Zwei alte, ausgediente Milchkannen wurden aneinander gebunden und auf dem Dachboden befestigt. Das Verbindungstau führte dann, durch ein eigens dafür gebohrtes Loch, zum Bettpfosten in der Schlafkammer. Als nun das Spektakel oberhalb der Schlafstatt losging, riss er die »Rettungsleine«, was einen ohrenbetäubenden »Glockenschlag« zur Folge hatte. Einer der Steinmarder erlitt allem Anschein nach ein derartiges Gehörtrauma, dass er stante pede den Ort des Grauens zu verlassen trachtete und sich in das Efeugeränk des Hauses stürzte. Genau zur selben Zeit kam die Tochter des Hauses von einer abendlichen Exkursion zurück und entdeckte den Marder. Sofort wurde der nächste Jäger, nämlich ich, zur Hilfe gerufen.
Sowohl das durchaus anziehende Äußere der schönen Nachbarin als auch die Aussicht auf jagdliche Beute ließen mich, mit einem Kleinkaliber bewaffnet, flugs zum Ort des Geschehens eilen. Dort konnte auch ich den erkennbar orientierungslosen Delinquenten im Efeu sitzen sehen. Das Zielen über Kimme und Korn gestaltete sich jedoch aufgrund der Dunkelheit außerordentlich schwierig. Wie bestellt riss jedoch für einen Moment die Wolkendecke auf und gab den Mond frei. Die Waffe glitt an die Wange, Kimme und Korn versenkten sich zwischen den Lichtern des Nachtgespenstes, und noch im Knall landete der Marder zu meiner Überraschung vor meinen Füßen. Dieser Schuss nötigte allen Respekt ab und ließ mein Ansehen als Jäger, wie schon erwähnt, beträchtlich steigen.
Eine weitere Wildart, die wie ich Jagd und Beute suchend das weite Revier durchpirscht, sodass Begegnungen – zumindest aus meiner Sicht auch wünschenswerter Weise – zwangsläufig programmiert sind, ist natürlich der Fuchs. Schon mein Großvater war von diesem Raubwild fasziniert und widmete ihm einen Großteil der Nächte bei Eis und Schnee. Lassen Sie mich daher mit einer kurzen Episode aus »der guten alten Zeit« beginnen.
Großvaters Besitz thronte auf der höchsten Erhebung der Ortschaft, während der größte landwirtschaftliche Betrieb des Ortes, dessen Inhaber gleichzeitig Pächter der Gemeindejagd war, durch eine ungefähr 500 Meter breite Wiese getrennt, genau vor seinen Füßen lag.
Dort inspizierte nun ein Fuchs, wie aus diversen Spuren im Schnee deutlich erkennbar war, allabendlich den Hühnerstall, um mögliche Schwachstellen dieses Bollwerkes zu erspähen und gegebenenfalls daraus Nutzen zu ziehen. Obwohl der Bauer dies mit Skepsis und Sorge betrachtete, zog er dennoch die heimelige Stube dem kalten abendlichen Ansitz vor und bat Opa um Unterstützung. Dieser, vom Fuchsfieber erfasst, ließ sich das nicht zweimal sagen und rüstete sich zwischen seinen Schutzbefohlenen zum nächtlichen Ansitz. Dazu öffnete er ein Fenster des Hühnerstalles und harrte, den eisigen Nordost im Gesicht, der Dinge. Allerdings hatten die Scharniere des Fensters lange Zeit kein Öl mehr gesehen, und so ächzte der Fensterflügel leicht quietschend im kalten Wind. Opa, ärgerlich über dieses wirklich störende Geräusch und in Mutmaßungen über den Standort der nächstgelegenen Ölkanne versunken, erstarrte plötzlich zur Salzsäule. Saß dort nicht auf 80 Meter Entfernung – leider zu weit für die mitgeführte Schrotflinte – ein Rotrock und beäugte gierig das potenzielle Abendessen. Doch sein Instinkt und sicherlich auch das knarrende Fenster mahnten ihn zur Vorsicht und bewogen ihn zum Rückzug, wobei er sich aber mehrmals umwandte.
Opa setzte alles auf eine Karte und griff sich ein Huhn, das, den Suppentopf vor Augen, ein Mordsgeschrei ausstieß. Dieses Angstgezeter ließ den Fuchs nicht unberührt, und er schnürte, abrupt die Richtung wechselnd, wieder in Richtung Hühnerstall. Doch, obwohl die gierigen Seher und der Geifer, der in den Schnee tropfte, keinen Zweifel an seinem Wunsch ließen, war er nicht zu bewegen, sich auf Schrotschussentfernung zu nähern.
Opa, mittlerweile schwer vom Jagdfieber gepackt, warf daraufhin mit kühnem Schwung den krakeelenden Eierproduzenten aus dem Fenster, der flatternd und gackernd nach unten entschwand. Dies lockte nun den Fuchs vollends aus der Reserve, er stürzte sich auf die vermeintliche Beute und sank im gleichen Augenblick mit zuckender Rute in den Schnee. Da sich zu diesem Zeitpunkt im Bauernhaus nichts mehr regte, trug Opa den erbeuteten Rotrock, einen imposanten Rüden im dichtesten Winterpelz, stolz nach Haus.
Am nächsten Morgen erstattete er dem Bauern Bericht, wobei die Gratulation äußerst spärlich ausfiel und sich sofort die Frage anschloss: »Und wo ist die Henne?«
Die hatte Opa in der Aufregung ganz vergessen. Eine Besichtigung der Örtlichkeiten bei Tageslicht ergab, dass ein ehemaliger Brunnenschacht nicht abgedeckt direkt unterhalb des Fensters lag. Die Vermutung lag also nahe, dass das Huhn nach dem Hinauswurf direkt in die Kelleretage gefallen war, was einige Federn am Grunde des Schachtes auch zu bestätigen schienen. Das Huhn blieb jedoch verschwunden, ein unausgesprochener Vorwurf stand im Raum. Eine weitere Einladung zur abendlichen Fuchsjagd erfolgte nicht.
Die sprichwörtliche Vorsicht des Fuchses, verbunden mit einer enormen Reaktionsschnelligkeit, hat auch mich in unzähligen nächtlichen Ansitzen immer wieder fasziniert. Das leiseste metallische Geräusch, ein kaum hörbares Kratzen der Jacke, und in Bruchteilen von Sekunden ist nur noch die hochgestellte, sich schnell entfernende Lunte erkennbar. Derartige Erlebnisse zieren sicherlich so manches jagdliche Tagebuch, sodass ich an dieser Stelle von zwei ganz anderen Erfahrungen berichten möchte, nämlich der Begegnung mit schlafenden Füchsen.
Am Morgen des 10. Oktober 1985 befand ich mich, eher wandernd als pirschend, auf einem ca. 10 Hektar großen Schlag, auf dem die Rapssaat eben aufgelaufen war, und spürte auf Sauen. Das Feld wies von der Bodenbeschaffenheit leichte, flach auslaufende Hügel auf, und ich befand mich etwa 30 Meter vom nächsten Knick entfernt. Die wärmende Morgensonne im Gesicht und der schwere Lehmboden unter den Füßen ließen meine Schritte immer schwerer werden. Als ich eben einen Hügel überquerte und den Hut vom Kopf nahm, um die Schweißperlen vom Gesicht zu wischen, fing mein Blick eine Art roten, runden Stein auf, der etwa 10 Meter von mir entfernt auf dem Boden lag. Die Augen weiteten sich, der Mund klappte vor Verwunderung auf, als das Gehirn statt des Steins einen Fuchs meldete. Zusammengerollt, mit geschlossenen Lichtern, die Lunte um den Körper gewickelt, lag dort im hellen Sonnenschein tief schlafend ein Rotrock, als gäbe es keine Jäger auf dieser Welt.
Während ich diesen idyllischen Anblick in mich aufnahm, schlich ich Schritt für Schritt, fast über den Lehm schwebend, zurück, da mir die Entfernung für einen Schrotschuss zu gering vorkam. Dabei glitt der Drilling im Zeitlupentempo von der Schulter. All dies beeindruckte den Fuchs, der allem Anschein nach weltentrückt in anderen Sphären weilte, keineswegs. In dem Moment jedoch, in dem der Drilling an der Wange lag und ich leise die Sicherung löste, vernahm er – scheinbar aus der Tiefe seines Unterbewusstseins – dieses metallische Geräusch. Die Lichter öffneten sich, weiteten sich in jähem Entsetzen. Für die Flucht blieb ihm keine Zeit.
Jahre später im Altholzbestand. Dort lag ein großer, bereits im vorherigen Kapitel beschriebener Mutterbau derer von Grimbart und Malepartus. Ungefähr 30 Meter davon entfernt befand sich eine einfache Leiter, von der man sowohl den Bau als auch das umliegende, vorwiegend mit Buche bestockte Altholz einsehen konnte.
Mein Streben an diesem klaren, kalten Wintermorgen mit leichter Schneedecke galt jedoch nicht den pelzigen Räubern. Nahe am Bau führte ein sowohl von Reh- als auch Damwild lebhaft frequentierter Wechsel vorbei.
Da der Abschussplan für beide Wildarten noch starke Lücken aufwies, fand mich dieser Wintermorgen trotz eisiger Kälte voller Tatendrang. Wie ein roter Feuerball erschien die Morgensonne und schickte erste wärmende Strahlen auf den vor mir liegenden Bau. Eine winzige Bewegung, mehr aus dem Augenwinkel wahrgenommen, ließ meinen Blick an einem der zahlreichen Löcher verharren. Tatsächlich! Schoben sich doch zwei rötliche Gehörspitzen, an den Enden schwarz auslaufend, aus dem Schnee.
Erste zögerliche Vogelstimmen ließen sich vernehmen, als sich ein spitzbübischer Kopf, mit Gehör und Sehern die Umgebung prüfend, aus dem Bau schob. Ich wagte kaum zu atmen, geschweige denn mich zu bewegen, fühlte ich mich doch auf meiner Leiter bei bestem Licht und damit guter Sicht wie auf dem Präsentierteller. Doch schien ich für den starken Fuchsrüden Luft zu sein. Denn mit aller Ruhe dieser Welt reckte und streckte er sich genüsslich, ein herzhaftes Gähnen folgte. Der Herr dieses Baus schnürte einige Meter von der Ausfuhrt weg, verhoffte auf einer kleineren Erhebung, die von der Morgensonne beschienen wurde und, kaum zu glauben, begab sich erneut zur Ruhe.
Eingerollt, den Fang in der buschigen Lunte verborgen, schloss er die Seher. Ein Bild des Friedens. Heute würde ich es sicherlich nicht mehr übers Herz bringen, in einer solchen Situation finstere Mordpläne zu hegen. Damals jedoch fühlte ich mich in meiner Ehre als Fuchsjäger herausgefordert. Im Zeitlupentempo hob ich den Drilling und stellte den Schieber auf Schrot um. Im selben Moment stand der Fuchs auf den Läufen und sicherte misstrauisch. Doch die Chance zur Flucht hatte er damit bereits verspielt, und der Knall des Schrotschusses zerriss die morgendliche Idylle. Der Fuchs sank in den Schnee zurück und zuckte nur noch ein wenig mit der Lunte. Mit neun Kilogramm blieb er bis heute mein schwerster Fuchs.
Die Wildgänse kommen
Welchen Jäger fasziniert diese Wildart nicht? Schon häufig bewunderte ich mit sehnsuchtsvollem Blick die pfeilförmigen Formationen am Himmel, die vor allem im Frühjahr und Herbst mit heiseren, durchdringenden Schreien, unterbrochen vom aufgeregten Geschnatter, in großen Höhen unser Revier überqueren. Da jedoch der Geestrücken Schleswig-Holsteins und insbesondere unser Revier keine größeren Wasserflächen aufweist, befand sich dieses scharfäugige Wildgeflügel immer nur auf der Durchreise. Aberhunderte von Gänsen, wie ich sie später in Mecklenburg-Vorpommern auf den riesigen Schlägen beobachten konnte, wie sie Äsung aufnahmen und für den nächsten großen Flug rüsteten, gab es bei uns leider nicht. So waren die Graugänse für mich stets unerreichbar. So schien es zumindest, bis zum November 1988.
Trotz leichtem Regen und kaltem, stürmischem Wind, für uns Schleswig-Holsteiner durchaus nichts Außergewöhnliches, pirschte ich an diesem Vormittag durch das Revier. Mit dem Fernglas suchte ich die umliegenden Felder nach Rehen ab, die sich bei diesem Wetter bevorzugt an den windabgewandten Seiten der Knicks aufhielten. Dann fiel mein Blick auf ein Rapsfeld. Unfassbar! Drei Graugänse, wahre Prachtexemplare, befanden sich etwa 30 Meter vom nächsten Knick entfernt und äugten aufgeregt und unruhig in die Umgebung. Ich konnte nicht der Grund sein, war ich doch noch zu weit von der verlockenden Beute entfernt.
Ein Kriegsplan war schnell erdacht: an der anderen Seite des Knicks heranpirschen und auf Schrotschussnähe herankommen. Gut gedacht, aber wie hieß es in der Jagdausbildung? »Gänse haben auf jeder Feder ein Auge!«
Doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Den Drilling in der »Vorhalte«, kroch und robbte ich auf allen vieren an das begehrte Wild heran. Zwischendurch einmal die Lage zu peilen, traute ich mich nicht. Zu groß war die Gefahr des Entdecktwerdens, und damit wäre die vielleicht einmalige Chance vertan gewesen. Also weiter durch Matsch und Schlamm. Karl May hätte mir sicherlich einige exklusive Seiten in seinen Winnetou- Romanen gewidmet, hätte er mich in Aktion beobachten können.
Als ich mich dann auf der Höhe der Gänse wähnte, schob ich den Kopf in Zeitlupentempo an einer lückigen Stelle des Knicks empor. Ja, da waren sie und äugten mich bereits misstrauisch an. Den Drilling an die Schulter gerissen und raus waren die Vier-Millimeter-Schrote. Eine Gans lag, während die beiden anderen schleunigst das Weite suchten.
Mit einem ungeheuren Glücksgefühl setzte ich über den Knick und eilte zu meiner Beute, die unverkennbar einen Ring am Ständer auswies. Erste Zweifel, noch unausgesprochen und kaum prüfbar, stiegen in der Jägerseele empor, wurden jedoch über die Freude der sicherlich ersten in diesem Revier gestreckten Graugans unterdrückt.
Mit stolzgeschwellter Brust fuhr ich zum Jagdherrn, um die Beute zu präsentieren und das Abenteuer zu schildern. Das Gesicht meines Gönners verzog sich immer mehr zu einem Schmunzeln, während meines immer mehr einem Fragezeichen ähnelte.
»So schwere Wildgänse habe ich ja noch nie gesehen«, sagte er lachend. »Im Nachbardorf hat ein Bauer übrigens wildfarbene Hausgänse. Die sind ihm vorgestern weggeflogen. Na ja, eine haben wir ja wieder.«
Mir schoss die Schamesröte ins Gesicht, und noch nach Wochen geisterte das Wort vom »Gänse-Mörder« durch die dörflichen Haushalte. Mit Ruhm hatte ich mich wahrhaftig nicht bekleckert.
Sicherheit geht vor!
Das sollte man zumindest meinen, werden einem doch vom ersten Tag der Jagdausbildung so wohlgemeinte Sätze wie »Jeder ist für seinen Schuss verantwortlich« oder »Achtet auf den Kugelfang« oder »Erst hundertprozentig ansprechen, dann schießen« wie der kleine Katechismus eingebläut. Und das sicherlich zu Recht, wenn man sich die ständig wiederkehrenden Berichte über Jagdunfälle vor Augen führt. Und doch sind auch Jäger nur Menschen mit menschlichen Schwächen, seelischen Schwankungen, mal ruhig und mal nervös. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein großes Spektrum an möglichen Fehlerquellen. Von einigen möchte ich hier berichten, die alle das Prädikat »Nicht zur Nachahmung empfohlen« tragen. Vielleicht helfen sie auch an anderer Stelle, Schlimmeres zu verhüten.
Beginnen wir mit einer Treibjagdepisode. Hier wird die Forderung der Jagdherren, die Flinte beim Überwinden von Hindernissen wie Gräben, Knicks oder Koppeleinfriedungen grundsätzlich zu brechen, von einigen bewaffneten Zeitgenossen eher belächelt.
Während so einer Treibjagd setzte ich mit einem großen Sprung über einen Graben hinweg und landete vorläufig wohlbehalten auf der anderen Seite. Mein vorheriger Standnachbar wählte denselben Absprungspunkt unmittelbar nach mir. Dabei hielt er jedoch sein Bockdoppelgewehr fest in beiden Händen, um auch ja keine Schussgelegenheit zu verpassen. Durch seine Ambitionen vom Überwinden des Grabens abgelenkt, rutschte er aus und landete unsanft und durchnässt im Graben, während im selben Moment eine Schrotgarbe aus seiner Waffe hinter mir in die Grabenkante einschlug und eine wahre Fontäne aus Matsch und Wasser hochschleuderte.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?
Weitere E-Books rund um die Jagd
Sein bester FreundeISBN 978-3-475-54514-6 (epub)
Carsten Feddersen berichtet über die unvergängliche Freundschaft zwischen dem Jäger und seinem Hund. Der Vierbeiner ist unerlässlich für das Aufspüren der Beute und damit für den Jagderfolg. Wir lesen von der Rettung eines liebestollen Hausschweins und von einem Hirsch, der wieder zum Leben erwacht. Die enge Bindung wird deutlich spürbar, als die Dackeldame Daisy ihre Familie gegen Fremde verteidigt, selbst wenn es sich dabei um den Weihnachtsmann handelt. Der erfahrene Hundeführer bringt uns die Jagd in bewegenden und amüsanten Geschichten näher.
Frische FährteeISBN 978-3-475-54541-2 (epub)
Der zweite Band des beliebten Autors norddeutscher Jagderlebnisse entführt uns nach Vorpommern. Auf höchst vergnügliche Weise erfahren wir, wie ein Rehbock zweimal starb und zwei Rinder als Jagdhunde erfolgreich waren, wir lesen die Geschichte vom erlegten Ziegenbock und dem Jäger, der durch den morschen Hochsitz brach. Außerdem widmet sich Carsten Feddersen mit besonderer Liebe den Menschen dieses Landstrichs, ihrer auf den ersten Blick rauen, aber immer kameradschaftlichen und hilfsbereiten Art.
Im Visier des JägerseISBN 978-3-475-54396-8 (epub)
Der beliebte Autor deutscher Jagderlebnisse entführt uns mit seinen spannenden Geschichten nach Schleswig-Holstein. Auf höchst vergnügliche Weise erfahren wir, was der Jagdalltag mit sich bringen kann. Sei es das Heranpirschen an eine Rotte Sauen im tiefen Schnee, der Ansitz auf den treibenden Bock oder die Jagd auf Hasen mit der treuen Drahthaarhündin Anka. Sowohl lustige, aufregende, aber auch nachdenklich stimmende Geschehnisse aus seinem privaten Umfeld weiß Feddersen geschickt in seine jagdlichen Erlebnisse einzubinden. So berichtet er beispielsweise von der berührenden Handaufzucht eines verwaisten Rehkitzes zusammen mit seinen Kindern.
In Wald und WildniseISBN 978-3-475-54540-5 (epub)
Carsten Feddersen, erfolgreicher Jagdbuch- und Krimiautor, bekennt sich hier zu seiner dritten Leidenschaft neben dem Jagen und dem Schreiben: zum Reisen. Und wer Carsten Feddersen kennt, kann erraten, dass es dabei nicht nur um Sightseeing, sondern auch um exotisches Wild geht. Höchst amüsant zu lesen sind nicht nur die Erzählungen von seinen Jugenderlebnissen im Outback, sondern auch von späteren Reisen: wiederum nach Australien und ins südliche Afrika. Doch der Verfasser beweist ebenfalls, dass man nicht notwendigerweise in die Ferne schweifen muss und dass auch für den Jäger das Gute oft sehr nah liegt – zum Beispiel in den schönen Wäldern und Bergen Österreichs. Ein Buch, das für Jäger und Nichtjäger gleichermaßen unterhaltsam zu lesen ist!
Auf der PirscheISBN 978-3-475-54542-9 (epub)
In diesem Buch begegnet der Leser dem geheimnisvollen Abenteuer Jagd, als der Jäger noch das erlegte Wild auf dem Rücken zu Tal befördern musste und dies noch nicht der geländegängige Jeep besorgte. Durch diese Seiten weht noch der Harzduft des Bergwaldes, der Hauch des Geheimnisvollen, Abenteuerlichen. Josef Gehrer zeichnet mit seinen Geschichten eine Welt, in der heißblütige und wagemutige Wilderer wachsamen Jägern im Kampf auf Leben und Tod gegenüberstehen. Jeder, der mit der Natur verbunden ist, ob Jäger, Bergwanderer oder Heimatfreund, wird seine Freude an diesen Erzählungen haben.
Das Revier rufteISBN 978-3-475-54543-6 (epub)
Einfühlsam und fesselnd berichtet hier ein Jäger aus eigenem Erleben, erzählt von den Höhen und Tiefen, von Hege und Pflege, von heiteren und spannenden Momenten und lässt seine Leidenschaft für die Jagd spüren. Aus seinen Zeilen spricht die hohe Achtung vor der Natur und eine große Liebe zur Jagd. Mit der Nähe zum jagdlichen Alltag gelang es Alfred Walter ein unterhaltsames Buch für alle Jagdbegeisterten und Naturfreunde zu schreiben.
Auf dem JägerstandeISBN 978-3-475-54397-5 (epub)
Kurt J. Jaeger erzählt heitere und spannende Jagdgeschichten. Er hat als Revierpächter und Jagdaufseher schon viel erlebt. Aus diesem reichen Erfahrungsschatz berichtet er in seinem Buch. Etwa wie nach einem erfolgreichen Pirschgang das erlegte Bockkitz aus einer Felsspalte befreit werden muss. Von der Jagd mit Flinten auf Wildschweine in Afrika, die nicht nur wegen des unbekannten Geländes zu einem echten Abenteuer wird. Von einer Drückjagd, mit ihren strengen Regeln und wie dabei ein Rucksack verloren geht, der später unverhofft wieder auftaucht. Kurt J. Jaegers Geschichten sind teils komisch, teils bewegend, aber immer authentisch.
Und immer lockt das WildeISBN 978-3-475-54398-2 (epub)
Als langjähriger Revierpächter und Jagdaufseher hat Kurt J. Jaeger viel erlebt in Wald und Wiese. Er erzählt humorvoll von den Tücken des Jägerlebens sowie von lustigen Erlebnissen aus seinem Bekanntenkreis. Ein Geißbock irrt durch die Wälder, vertreibt das Wild und sorgt sogar nach seinem Abschuss für Aufregung. Empörung geht durch eine ländliche Gemeinde, als ein Gast ihren Steinbock erlegt. Besserwisserische Jagdgäste und Leichtsinn unter den Kollegen führen zu kleinen und größeren Pannen. Ebenso erfährt man von den Folgen des Abschusses eines Steinadlers. Kurt J. Jaegers Geschichten sind voller Frohsinn und Witz und vermitteln dennoch die Ernsthaftigkeit der Jagd.