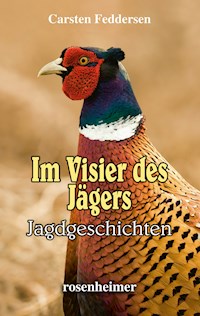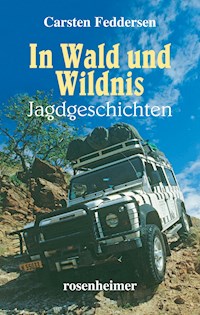
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Carsten Feddersen, erfolgreicher Jagdbuch- und Krimiautor, bekennt sich hier zu seiner dritten Leidenschaft neben dem Jagen und dem Schreiben: zum Reisen. Alles begann mit einer Australienreise - und man kann leicht erraten, dass es dabei nicht nur um Sightseeing, sondern auch um exotisches Wild ging. Höchst amüsant zu lesen sind nicht nur die Erzählungen von diesen Jagderlebnissen, sondern auch von späteren Reisen nach Australien und ins südliche Afrika. Doch Feddersen beweist auch, dass man nicht notwendigerweise in die Ferne schweifen muss und dass auch für den Jäger das Gute oft ganz nah liegt. Zum Beispiel in den Wäldern und Bergen Österreichs, aus denen er ebenfalls manche schöne Erinnerung mit nach Hause genommen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Für Mareike, Annika, Freya, Henrike, Inga und Levke
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2009
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Satz: Dagmer Becker-Göthel, München Titelfoto: Klaus G. Förg, Rosenheim eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN 978-3-475-54540-5 (epub)
Worum geht es im Buch?
Carsten Feddersen
In Wald und Wildnis
Carsten Feddersen, erfolgreicher Jagdbuch- und Krimiautor, bekennt sich hier zu seiner dritten Leidenschaft neben dem Jagen und dem Schreiben: zum Reisen. Alles begann gleich nach dem Abitur: Das gesamte ersparte Geld wird in eine Australienreise investiert. Und wer Carsten Feddersen kennt, kann erraten, dass es dabei nicht nur um Sightseeing, sondern auch um exotisches Wild geht. Höchst amüsant zu lesen sind nicht nur die Erzählungen von diesen Jugenderlebnissen, sondern auch von späteren Reisen: wiederum nach Australien und ins südliche Afrika. Doch der Verfasser beweist auch, dass man nicht notwendigerweise in die Ferne schweifen muss und dass auch für den Jäger das Gute oft sehr nah liegt. Zum Beispiel in den Wäldern und Bergen Österreichs, aus denen der Norddeutsche ebenfalls manche schöne Erinnerung mit nach Hause genommen hat. Ein Buch, das für Jäger und Nichtjäger gleichermaßen unterhaltsam zu lesen ist!
Inhalt
Vorwort
AUSTRALIENAbenteuer am anderen Ende der Welt
Wenn einer eine Reise tut
Eine Bahnfahrt, die ist lustig
Am Grenzzaun entlang
Auf nächtlicher Pirsch
In der Großstadt
Unter Schafzüchtern
Auf der Pirsch
Auf den Spuren von Crocodile Dundee
Sau auf australisch
Auf den großen Weißen
Im Outback
Am Ayers Rock
Abschied
AFRIKA Der schwarze Kontinent
Namibia lockt
Auf der Pad
Eine verhängnisvolle Pirsch
Ein erfolgreicher Ansitz
Farmleben
Ein Springbockabenteuer
Nachsuche auf afrikanisch
Strauchdiebe
Knickhorn
Zu Besuch in einer Wüstenstadt
Der Große Kudu
Am Luderplatz
Von Raubtieren umzingelt
»Überall fliegt und kriecht und krabbelt es«
Von Zitrusschweinen terrorisiert
Das Reich der wilden Tiere
Nachwuchssorgen
Ein gewitzter Bursche
Ohne Gnade
Buntes Treiben
Ebony and Ivory …
ÖSTERREICH Inmitten des alten Kontinents
Eine zweite Heimat
In den Bergen Tirols
Vorwort
Vorwort
Fremde Länder und Kontinente, fremde Menschen und Kulturen, fremde Tiere und Pflanzen … Wer von uns träumte nicht schon von Kindesbeinen an, als Forscher und Entdecker all das Neuartige, Unbekannte zu erkunden und zu erleben, was die große, weite Welt uns bietet!
Auch mich erfasste das Fernweh bereits in jungen Jahren. Jeder Natur- und Tierfilm wurde mit großen Augen und offenem Mund bestaunt, besonders Afrika übte eine ernorme Anziehungskraft aus. Hinzu kam ein reger Schriftwechsel mit Verwandten und Brieffreunden im fernen Australien, der mich nachts von Koalabären und Kängurus träumen ließ.
Da mir zwischen Abitur und Grundwehrdienst drei Monate Schonfrist zur freien Verfügung standen, nutzte ich kurzentschlossen die mühsam für das erste Auto angesparte Kriegskasse für einen ersten Besuch in Australien – Afrika, genauer gesagt Namibia, musste damals noch einige Jahre warten. Österreich allerdings, nahe gelegener Nachbar und Heimat meiner Großmutter, bildete schon damals einen weiteren Schwerpunkt meiner Reisen.
Da mich, wie in meinem ersten Buch »Blattschüsse« ausführlich beschrieben, die Jagdpassion schon sehr frühzeitig packte, sind die folgenden Geschichten und Berichte natürlich stark jagdlich geprägt.
Folgen Sie mir also quer durch die Kontinente in große faszinierende Städte, in die atemberaubende Wildnis von Australien und Afrika und in die Bergwelt Tirols. Durchleben Sie mit mir Anstrengungen und Mühsal, aber auch Glück und Bestätigung. Lernen Sie mit mir fremde Menschen und Kulturen kennen, und pirschen Sie mit mir auf der Fährte des Wildes durch Dornen und Gestrüpp oder auf schroffem Gestein dem Himmel entgegen.
Viel Freude beim Lesen wünscht
Carsten Feddersen
Bothkamp, im Juli 2008
Australien
AUSTRALIENAbenteuer am anderen Ende der Welt
Wenn einer eine Reise tut
Die Abiturprüfung lag mit einem trotz aller Unkenrufe doch recht passablen Ergebnis hinter mir; der Dienst fürs Vaterland, damals noch fünfzehn Monate, mit dem legendären Grundwehrdienst und beschaulichen Kasernenleben noch unendliche drei Monate vor mir. Damit bot sich die wohl einmalige Gelegenheit, die umfangreiche Verwandtschaft, bis dato nur von Briefen und Fotografien bekannt, im fernen Australien heimzusuchen.
Ich weiß heute nicht mehr, welche Vorstellungen ich mit dem fünften Kontinent konkret verknüpfte, doch übte allein der Gedanke, an das andere Ende der Welt zu fliegen, eine ungeheure Faszination auf mich aus.
Das über lange Jahre eigentlich für das erste Auto mühsam Ersparte wurde kurzerhand einem neuen, abenteuerlichen Verwendungszweck zugeführt und in den Kauf von Flugtickets und Reiseschecks investiert. Das Sparbuch blieb wie nach dem Frühjahrsputz blitzblank zurück. Tickets und Geld verschwanden in den Tiefen eines ledernen Brustbeutels, von dem ich mich während der ganzen Reise weder bei Tag noch bei Nacht trennte und der mir trotz allem noch einige kummervolle Momente bereiten sollte. Doch davon später.
Erst einmal begann ich voller Vorfreude mit dem Kofferpacken und meldete bereits nach kurzer Zeit intensiven Stopfens und Drückens Vollzug bei meiner Mutter. Die rekordverdächtige Kürze der Aktion, die doch eigentlich von Bedachtsamkeit sowie einem gewissen Maß an Beschaulichkeit geprägt sein sollte, erweckte offensichtlich ihr Misstrauen, denn sie bat augenblicklich um eine persönliche Inaugenscheinnahme.
Der Anblick des deformierten Koffers und der ballonartig aufgeblähten Reisetasche entlockte meiner sonst so nervenstarken Mutter einige unmissverständliche Verbesserungsvorschläge, deren Umsetzung mir mehr als geraten schienen und auf ein sofortiges »Und jetzt noch einmal alles von vorn« hinausliefen.
Einige Tage später dann stand ich mit meinen nunmehr sorgsam verpackten Reiseutensilien in der großen Abfertigungshalle des Frankfurter Flughafens. Mit intensivem Händedruck, einem herzlichen Schulterklopfen und einem letzten Winken verabschiedeten meine Eltern den jungen Globetrotter, der seinerseits mit lachendem Gesicht aber tränenden Augen, mit festem Schritt, aber weichen Knien seinem Flugzeug zustrebte.
36 Stunden dauerte der Flug mit dem Jumbo der Quantas Airlines. Welch lange Zeit! Gewaltige Flüsse, schroffe Gebirge, unendliche Wüsten und die weite See glitten zwergenhaft klein unter meinen staunenden Blicken dahin. Interessante Gespräche mit den Sitznachbarn über das Woher und Wohin bahnten sich an. Wenn auch die ersten Versuche, das so mühevoll erlernte Schulenglisch endlich einmal an den Mann oder die Frau zu bringen sich eher stümperhaft ausnahmen, ich atmete schon hier ein wenig die Fremde, ahnte die Weite und war einfach glücklich.
Dieses erhabene Gefühl verlor sich jedoch mehr und mehr; denn im Dunkeln lässt sich nichts erkennen und der Sternenhimmel ist irgendwann auch ermüdend. Auch die aufmunternden Gespräche wurden weniger. Müdigkeit verdrängte das anfangs heftige Reisefieber. Licht um Licht erlosch. Der flehentlich herbeigesehnte Schlaf wollte sich aber partout nicht einstellen, denn wie ich mich auch drehte oder wendete, immer stieß ich an irgendeiner Ecke oder Kante an. Andere Fluggäste schienen sich mit den Verrenkungen zu arrangieren, denn sie schnarchten, was das Zeug hielt. Ebenfalls ein Umstand, der nicht dazu angetan war, auch mich in sanfte Träume versinken zu lassen.
Der erste Zwischenstopp in Bahrain auf der arabischen Halbinsel brachte keine wirkliche Abwechslung in den tristen Flugalltag, da wir den Jumbo nicht verlassen durften.
Interessanter gestaltete sich die zweite Zwischenlandung in Singapur, die für mich fast das vorzeitige Ende meiner ersten Expedition in die große, weite Welt bedeutet hätte. Denn diesmal gestattete man den noch nicht in Tiefschlaf gefallenen Passagieren einen Kurztrip nach dem Motto »Singapore by night«. Allerdings beschränkte sich die nächtliche Exkursion auf den zollfreien und damit abgesperrten Teil des Flughafens. Die strahlende, prunkvolle Silhouette der asiatischen Metropole und die verlockende Möglichkeit, endlich einmal das verrenkte Knochengestell wieder in die richtige Anordnung zu bringen, ließen mich diese Chance natürlich nutzen.
Fasziniert betrachtete ich die im Flughafen vorherrschende bezaubernde Kombination zwischen asiatischem Pomp und Detailverliebtheit sowie moderner westlicher Lebensart, als ich unversehens in eine Reisegruppe geriet, die schnurstracks und zielstrebig der Passkontrolle und damit dem Ausgang entgegenstrebte. Ehe ich mich versah, enthielt mein Reisepass einen schicken Einreisestempel und ich konnte mich mit Fug und Recht als Gast dieser turbulenten Stadt betrachten. Jedoch: Mit dieser Feststellung war schlagartig klar, dass ich mich gefährlich weit von meinem Flieger und damit von Australien entfernt hatte. Jetzt konnten weder die dezente, orientalisch klingende Hintergrundmusik noch die leicht bekleideten Mädchen mit ihrem verführerischen Lächeln meine Sinne bezaubern und ich bahnte mir hektisch einen Weg zurück zur Passkontrolle. Aber leider auch nur bis dort, denn ein diensteifriger, streng blickender Zollbeamter versperrte mir beharrlich den Weg. Ich versuchte, ihm meinen Irrtum begreiflich zu machen, doch da es mit den Englischkenntnissen auf beiden Seiten nicht zum Besten bestellt war (so kam es mir zumindest vor, da der Mann so gar nicht meinen Argumenten zu folgen gewillt war), gerieten wir in eine Sackgasse. Die Fronten verhärteten sich zusehends. Vor der drohenden Festnahme schritt dann glücklicherweise einer seiner Kollegen ein, der den erregten Disput mit stoischer Ruhe verfolgt hatte. »Deutsches Mann, du nicht wollen schönes Stadt und schöne Frauen?«, sprach er mich an. Ich schüttelte heftig den Kopf. »Australien!«, flehte ich. Der Beamte musterte mich eindringlich, zuckte mitleidig mit den Schultern, setzte den Ausreisestempel in meinen Reisepass und winkte mich durch. Mir fiel ein Riesenstein vom Herzen. Noch heute betrachte ich manchmal lächelnd dieses Dokument, kann ich mich doch rühmen, einen der kürzesten Kurztrips der Weltgeschichte nach Singapur unternommen zu haben.
Ohne weitere Zwischenfälle verlief schließlich die letzte Etappe des Fluges und irgendwann, nach unzähligen Stunden, landete ich endlich in Sydney. Ein wenig übernächtigt, jedoch voller Tatendrang und Erwartung betrat ich zum ersten Mal in meinem Leben den roten Kontinent. In diese Hochstimmung mischte sich ein wenig Ungeduld, als ich auf meine Koffer wartete, galt es doch, mit einem Anschlussflug das nächste Etappenziel, Brisbane, zu erreichen. Doch ich konnte noch so ungeduldig von einem Bein auf das andere treten. Während sich die Zahl der Gepäckstücke auf dem Laufband kontinuierlich verringerte, ließen sich meine erst gar nicht blicken. Daran sollte sich auch nichts mehr ändern. Das Gepäck war weg.
Ein Mitarbeiter des Flughafens, dem ich mein Leid klagte, nahm die ganze Misere eher von der praktischen Seite, indem er freundlich ausführte, dass ich nun nicht mehr so viel zu schleppen hätte. Diesem Argument konnte ich in dem Moment rein gar nichts abgewinnen und ließ meinem Unmut, so gut es mir auf Englisch möglich war, erst einmal freien Lauf. Sichtlich pikiert und kurz angebunden schickte er mich zum Fundbüro, das mir bereits innerhalb kürzester Zeit die erfreuliche Tatsache eröffnete, mein Koffer wäre nicht weg, sondern nur auf dem Weiterflug nach Melbourne. Ich sollte doch eine Nachsendeadresse hinterlassen, und innerhalb der nächsten sieben Tage würde sich dann mein Gepäck dort einfinden.
Da stand ich nun, zig Tausende Kilometer von zu Hause entfernt in einem fremden Land ohne Ausrüstung und Gepäck, doch zum Glück mit gefülltem Brustbeutel. Konnte es einen vielsagenderen Start geben im Land der Beuteltiere?
Eine Bahnfahrt, die ist lustig
Denke ich an all die lustigen Skatrunden, die wir als Schüler während der Hin- und Rückfahrt zur Schule in der guten alten Eisenbahn absolvierten, kann ich den abgewandelten Text dieses Liedes nur bestätigen. Ob im Einzelabteil oder Großraumwagen – sobald die allernötigsten Hausaufgaben ausgetauscht oder abgeschrieben waren, lehnten wir uns genüsslich in die gepolsterten Bänke zurück und frönten unserer Spielleidenschaft.
Augrund dieser rundum positiven Erfahrungen mit der Eisenbahn, der Biologe spricht von Vorprägung, zögerte ich während der Reisevorbereitungen keine Sekunde lang, für die Fahrt von Brisbane nach Toowoomba, meinem ersten echten Ziel in Australien, die Reise mit dem Zug zu wählen. Eine Entscheidung mit ungeahnten Folgen, wie wir noch sehen werden!
Ich freute mich so richtig darauf, nach der vorerst letzten Flugetappe von Sydney nach Brisbane endlich einmal meine Beine in einem komfortablen Eisenbahncoupé ausstrecken zu können, mich in den Sitz zu kuscheln und den Zauber Australiens intensiv auf mich wirken zu lassen.
Ohne belastendes Gepäck und mit beflügeltem Schritt eilte ich zu dem bereitstehenden Zug. Schon von Weitem registrierte ich eher unbewusst die gähnende Leere in den hübsch lackierten Waggons, doch als ich eintrat, dachte ich, mich träfe der Schlag. Einfache Holzbänke ohne irgendeine Polsterung, dafür überzogen mit glänzendem Lack, blitzten in der gleißenden Sonne. Die spartanische Einrichtung ergab mit der infernalischen Hitze, die im Abteil herrschte, ein Ambiente, das ich mir in meinen kühnsten Gedanken nicht hätte träumen lassen. Und – wie konnte es auch anders sein – die Fenster ließen sich nicht öffnen.
Ich bin gewiss nicht empfindlich, aber ich möchte denjenigen kennenlernen, der nach 36-stündigem Flug ohne Gepäck und völlig übermüdet dieser Situation noch eine humoristische Seite abgewinnen kann. Ich konnte es nicht.
Nur am Rande sei bemerkt, dass sich während der mehrstündigen Fahrt weder ein Schaffner noch ein weiterer Fahrgast blicken ließen. Im Tempo der ersten Dampflokomotiven ruckelte und zuckelte die antiquierte Bimmelbahn mit mir durch die Gegend; und bereits nach kurzer Zeit ignorierten Körper und Geist sowohl die ungefederten Stöße als auch den harten Sitz und ich fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
So waren die so ersehnten ersten Eindrücke des von mir gerade in Besitz genommenen neuen Kontinents eher bescheiden. Ehrlich gesagt kann ich mich an gar nichts erinnern, denn erst, als wir Toowoomba erreicht hatten, sorgte ein besorgter Eisenbahnangestellter in Ehrfurcht gebietender Uniform mit konsequentem Rütteln und Schütteln für das Aufflammen meiner Lebensgeister.
Nach erfolgreicher Weckaktion und dem fluchtartigen Verlassen des Folterfahrzeugs stand ich nun etwas verloren und mutterseelenallein auf einem weitläufigen Bahnhof und fragte mich, ob in diesem Teil der Erde überhaupt einmal die Sonne schiene, denn es dämmerte bereits. Auch hielt ich ein wenig sorgenvoll Ausschau nach meiner Tante dritten oder vierten Grades, mit der eigentlich die Abholung an eben diesem Bahnhof vereinbart worden war. Immer wieder verglich ich die Gesichter der wenigen Menschen, die an mir vorbeigingen, mit dem Foto, das ich bei mir trug, doch niemand ähnelte ihr auch nur ansatzweise. Leider hatte ich ihre Anschrift nicht im Kopf, und die ausführliche Korrespondenz befand sich sinnigerweise in dem Koffer, der auf dem Weg nach Melbourne war.
Nach einer knappen Stunde intensiver, aber erfolgloser Personenbetrachtung zwang mich der fortschreitende Abend zu weiterem Handeln, denn übernachten wollte ich hier nun wirklich nicht, zumal mich der eine oder andere Mitarbeiter der australischen Eisenbahngesellschaft bereits skeptisch musterte. Ich entschloss mich also, in die hell erleuchtete Stadt hinunterzuschlendern und mir eine gemütliche Unterkunft für die Nacht zu suchen, während ich innerlich mit der vermeintlichen Unzuverlässigkeit meiner Tante haderte.
Gleichzeitig kam Trotz auf. Einem erprobten und erfahrenen Globetrotter wie mir sollte es ja wohl gelingen, eine Bleibe für die Nacht zu finden! Ich atmete jedoch schon ein wenig erleichterter auf, als ich von Weitem das Wort »Hotel« in übergroßen Neonbuchstaben an der Wand eines Hauses prangen sah. Große Fensterfronten boten einen guten Einblick in die Empfangshalle. Sie war ganz in altem englischem Stil eingerichtet und ich betrat sie zielstrebig. Ein freundlicher älterer Herr an der Rezeption begrüßte mich zwar liebenswürdig, doch seine prüfenden Augen ließen unschwer erkennen, dass er sich gerade fragte, was dieser junge Spund zu nachtschlafender Zeit wohl in einem Hotel zu suchen hatte. Daher erläuterte ich ihm, so gut es auf Englisch eben ging, den Ablauf der Geschehnisse, die allem Anschein nach seine Bedenken zerstreuten, denn er schob mir, ohne weiter zu zögern, die Anmeldeformulare über den Tresen. Bevor ich das sorgfältig ausgefüllte Formblatt unterzeichnete, fragte ich, einer plötzlichen inneren Eingebung folgend, nach den Übernachtungspreisen. Deren Höhe verschlug mir glatt den Atem, denn umgerechnet 250,00 DM sind für einen Abiturienten, der noch einen Monat vorher mit 50,00 DM Taschengeld im Monat wirtschaftete, schlichtweg undenkbar.
Also bedankte ich mich höflich für die Auskunft und setzte als sparsamer Mensch meine Suche nach einer günstigeren Unterkunft fort. Anfragen in zwei weiteren Hotels ließen mich Vermutungen über ein Preiskartell in Toowoomba anstellen, denn überall forderte man dasselbe.
Aber ich dachte gar nicht daran, die für australische Verhältnisse übrigens durchaus üblichen Preise zu zahlen und meine Reisekasse bereits am ersten Abend empfindlich zu schmälern.
Weiter ging also die Suche, bis ich in eine etwas finstere Seitengasse geriet, in der eine »Luna Bar« residierte. Sie warb in kleineren, nicht beleuchteten Buchstaben mit dem Zusatz »beds also«. Also, hinein in die Höhle des Löwen – der Ausdruck »Höhle« war durchaus vertretbar. Das gedämpfte Licht beleuchtete vier oder fünf getrennte Sitzecken, die mit gemütlichen, mit rotem Samt bezogenen Sesseln und Sofas bestückt waren. An der Stirnseite des Raumes befand sich ein kleiner Tresenbereich. Kaum schloss sich die schwere fensterlose Holztür hinter mir, winkte mir ein freundlich lächelnder Mann zu und bot mir einen Platz am Tresen an. Bereits nach den ersten wenigen Worten, die wir wechselten, fragte er mich, ob ich aus Deutschland käme, was bei meinem spärlichen Wortschatz wohl auch unschwer zu erkennen war. Mit dem Hinweis, er liebe alle Deutschen, spendierte er mir ein Bier und nannte mir den Preis für eine Übernachtung, im Vergleich zu den vorherigen Erfahrungen ein wahres Schnäppchen.
Noch in Unkenntnis der eigentlichen Sachlage trank ich zufrieden mein Bier, freute mich über mein günstiges Quartier und lobte mich für meine Standfestigkeit in Sachen Reisekasse. Kaum stand die erste Flasche »Foster« leer neben mir, offerierte mir der aufmerksame Wirt bereits die zweite, selbstverständlich auch auf Kosten des Hauses. Diese Freigiebigkeit erregte nun aber langsam mein Misstrauen, und ich lehnte erst einmal freundlich ab. Plötzlich erschienen wie aus dem Nichts zwei attraktive junge Damen, die sich mit »Diana« und »Eve« vorstellten und sich meiner in liebevollster Art und Weise annahmen.
Nun wurde selbst mir klar, in welche Art von Etablissement ich hier geraten war und entschloss mich erst einmal zum strategischen Rückzug in mein Zimmer. Eine nähere Untersuchung des Türschlosses ergab ein zur Sorge berechtigendes Ergebnis, denn es war nicht verschließbar. So ließ ich mich erst einmal auf dem Bett nieder und setzte mich mit meiner prekären Lage auseinander. In eines der großen Hotels wollte ich nicht zurückkehren, denn das ließ mein Geiz nicht zu. Hier in der »Luna Bar« fürchtete ich jedoch um meine Barschaft, die ich ja samt und sonders in meinem Brustbeutel trug. Was also tun?
Vorsichtig schlich ich die schmale Holztreppe hinunter und, oh Wunder, keine knarrende Stiege verriet meinen leisen Abgang in Richtung Hintertür. Allerdings: Diese war im Gegensatz zu meiner Zimmertür fest verriegelt. Also blieb mir nur die offizielle Verabschiedung. Mit einem flauen Gefühl in der Magengegend betrat ich die Wirkungsstätte von Diana und Eve, wo sich glücklicherweise bereits weitere Gäste eingefunden hatten. Ich stammelte etwas wie »am Bahnhof einen Koffer vergessen« und schickte mich an, eine Dollarnote aus meinem Brustbeutel zu fingern. Der Barkeeper lachte mich an (oder aus?), klopfte mir aufmunternd auf die Schulter, stopfte das Geld zurück in die Tasche meines Hemdes und wünschte mir einen schönen Aufenthalt in Australien. Ob ich mich damals wirklich in einer derartig bedrohlichen Lage befand, wie ich sie in dem Moment verspürte, vermag ich noch heute nicht so recht zu beurteilen. Unbegreiflich ist mir jedoch, mit welcher Naivität ich seinerzeit durch die Weltgeschichte ging.
Und was wurde aus meiner Nachtruhe an diesem ersten Tag in Australien? Alles wandte sich zum Besten, denn kaum hatte ich die Außentür geöffnet und erleichtert die kühle Nachtluft eingeatmet, stieß ich förmlich mit meiner Tante zusammen, die mich schon überall in Toowoomba gesucht hatte.
So endete meine erste Berührung mit dem australischen Nachtleben; ich genoss einige wundervoll behütete Tage in einer wundervollen Stadt, die nicht von ungefähr den Beinamen »Garden City« trägt.
Am Grenzzaun entlang
Nach einigen schönen und abwechslungsreichen Tagen in Toowoomba sah der weitere Reiseplan einen längeren Aufenthalt in der alten Rindermetropole Rockhampton vor, in der meine Verwandten seinerzeit zuerst gesiedelt hatten und dementsprechend zahlreich vertreten waren.
Meine Tante beabsichtigte ebenfalls, ihren dort lebenden Eltern einen Besuch abzustatten und so begaben wir uns gemeinsam auf die mehrstündige Tour. Mittlerweile hielt ich auch meinen Koffer wieder wohlbehalten in Händen und genoss die Fahrt im angenehm klimatisierten Auto in vollen Zügen. Während der rote Sonnenball am wolkenlosen Himmel schnell emporstieg, nahm ich ein wenig wehmütig Abschied von den sanften Hügeln Toowoombas. Beim Anblick dieser grünen Stadt wunderte mich erneut die ursprüngliche Bedeutung ihres Namens, nämlich Sumpfland. Er stammt von den Aborigines, den Ureinwohnern Australiens.
Immer weiter ging die Fahrt dicht an der Küste entlang. Während ich angestrengt versuchte, den Erklärungen und Geschichten meiner auskunftsfreudigen Tante zu folgen, nahmen mich die Eindrücke der faszinierenden und fremdartigen Landschaft gefangen. An den Straßenrändern erblickte ich – sehr zu meinem Leidwesen – immer wieder totgefahrene Kängurus. Ich hatte mir die erste Begegnung mit diesem für mich so exotischem Wild doch romantischer und lebensfroher vorgestellt.
Irgendwann erreichten wir dann Rockhampton, und aus großen starren Augen blickte mich die riesige bronzene Statue eines Brahmanbullen an (Das sind die mit den Schlappohren und dem großen Höcker auf dem Rücken). Immerhin grasen rund um Rockhampton an die zwei Millionen Rinder, sodass dieses Wahrzeichen zu Recht an exponierter Stelle postiert ist.
Dann begrüßte mich der australische Zweig der Familie Feddersen so offen und herzlich, dass ich mich heimischer gar nicht hätte fühlen können.
Die erste eigenständige Expedition führte mich am träge dahinfließenden Fitzroy-River entlang, an dessen Ufer sich Scharen von Ibissen und Löfflern tummelten wie bei uns Enten und Gänse. Eine von langen Zweigen gut beschattete und direkt am Fluss aufgestellte Parkbank lud geradezu zum Verweilen ein und bot mir zudem einen herrlichen Blick auf die Altstadt, die noch aus der Gründerzeit stammt. Ich schlenderte am Fluss entlang und genoss die geruhsame Idylle nach der langen Reise.
Für australische Verhältnisse quasi um die Ecke befand sich die zig Tausende von Hektar umfassende Rinderfarm eines Onkels, der nebst Familie ebenfalls den fernen Verwandten aus Old Germany in Augenschein nehmen wollte. Bereits nach drei kurzen Stunden Autofahrt quer durch endloses Farmland hielten wir vor den gepflegten, weiß angestrichenen Gebäuden, vor denen sich bereits die ganze Familie erwartungsvoll postiert hatte. Nach kräftigem Händeschütteln und herzlichen Umarmungen präsentierten mein Onkel und seine Söhne stolz das prachtvolle Anwesen mit den großen, Schatten spendenden Bäumen sowie dem mächtigen Holzhaus, das von einer breiten, überdachten Veranda umfasst wurde.
Der Rundgang führte uns auch an einer kleinen, mit Holzplanken eingezäunten Koppel vorbei, in der einige Pferde in der schattigsten Ecke die Hitze des Tages verdösten und dabei ab und zu behaglich gähnten. Von uns nahmen sie vorsichtshalber keinerlei Notiz, vermutlich um der Gefahr jeder unnötigen und schweißtreibenden Bewegung von vornherein zu begegnen.
Ich nahm die Pferde zum Anlass, über meine eigenen, damals noch sehr ausgeprägten Reitkenntnisse zu berichten. Es folgte, was folgen musste: Innerhalb kürzester Zeit stand ein gesatteltes Pferd vor mir und alle, mit Ausnahme des Pferdes, warteten begeistert auf meine reiterlichen Darbietungen.
Zu meiner aktiven Zeit, die immerhin 20 Jahre zurückliegt, war das heute so populäre Westernreiten noch ein Fremdwort. Das korrekte dressurmäßige Durchreiten des Pferdes, also das vorgeschriebene »am Zügel gehen« und der Einsatz der Unterschenkel als Hilfestellung für das vierbeinige Fortbewegungsmittel standen damals im Vordergrund. Da sich die Anforderungen an Ross und Reiter im australischen Busch ein wenig anders darstellten als in einer schleswig-holsteinischen Reithalle, zeigte sich mein Pferd überrascht oder besser gesagt entsetzt über mein reiterliches Gehabe. So scheiterten meine krampfhaften Versuche, das Pferd an die Zügel zu stellen, kläglich, wobei das Publikum sich dankenswerterweise mit Kommentaren höflich zurückhielt. Allerdings: Die amüsierten Gesichter sprachen Bände.
Nach einigen Kampfhandlungen in Form von Steigen und Buckeln siegte auf meiner Seite die Einsicht, und ich verzichtete auf weitere Übungen europäischer Dressur, sodass am Ende weder Tote noch Verletzte zu beklagen waren. Beim anschließenden gemütlichen Bier fasste mein Onkel seine Eindrücke kurz und trocken zusammen: »Tja, mein Junge, dein Reitstil ist miserabel, aber an dir ist ein hervorragender Rodeoreiter verloren gegangen.« Na, ja, immerhin etwas.
An dieser Stelle möchte ich kurz eine Lobeshymne über die australische Polizei einflechten, die mich mit ihrer Ermittlungsgeschwindigkeit stark beeindruckt hat. Bei meinem Abflug aus Deutschland hatte ich meinen Eltern versprochen, sie über meine glückliche Ankunft in Australien sogleich in Kenntnis zu setzen. Durch den Kofferverlust und die weiteren bereits geschilderten Umstände hatte ich das aber glatt vergessen und so meine Eltern in nicht geringe Sorge versetzt. In Ermangelung einer anderen Telefonnummer rief mein Vater einen Onkel in Sydney an, der wiederum die Polizei informierte. Sie können sich mein Erstaunen vorstellen, als auf der Farm, es war am frühen Abend und wir saßen gerade gemütlich auf der Veranda, ein Polizeiwagen auftauchte und nach dem Verbleib eines jungen, blonden Deutschen namens Carsten Feddersen gefragt wurde. Selbst im australischen Busch geht man nicht verloren.
Nachdem ich mein Versäumnis mit schlechtem Gewissen nachgeholt hatte, teilte mir mein Onkel fast beiläufig mit, dass er am nächsten Morgen die Grenzzäune per Pferd zu kontrollieren gedenke. Er lud mich ein, ihn zu begleiten. Eine Nacht hätten wir im Busch zu kampieren. Ich war begeistert! Eine Nacht im australischen Busch! Das hatte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erhofft.
Schon die Vorbereitungen ließen erste Wildwestromantik aufkommen. Meine Tante stellte das Kochgeschirr zusammen, während mein Onkel Waffen und Munition bereitlegte. Streichhölzer, Decken und Getränke sowie Salz und Zucker folgten. Am nächsten Morgen ging es dann los. In Cowboymanier, mit der Winchester im Sattel, galoppierten wir vom Hof, und der rote Sand Australiens wirbelte hinter uns durch die Luft.
Nach diesem spektakulären Abgang mäßigten wir alsbald das für Ross und Reiter schweißtreibende Tempo und ritten gemütlich im Schritt weiter. Hier und da standen Rinder in kleinen Gruppen zwischen lockerem Buschwerk zusammen, dazwischen einige mächtige, böse dreinblickende Bullen, sodass mir anfangs etwas mulmig war. Mein Onkel beruhigte mich: Solange wir uns zu Pferde bewegten, hätten wir nichts zu befürchten. Seine Augen ruhten zufrieden auf dem wiederkäuenden Vieh.
Der Anblick eines Trupps flüchtender Kängurus jedoch verdüsterte seinen Blick sofort, und blitzartig lag die Waffe an der Wange. Nur kurz verhoffte eines der etwa einen Meter großen Kängurus vor einigen schützenden Büschen, um sich letzte Gewissheit über die nahende Gefahr zu verschaffen, da hallte der Schuss durch die Stille. Das Känguru lag im Knall. Ohne auch nur einen weiteren Blick auf die erlegte Kreatur zu werfen, nahm mein Onkel den Ritt wieder auf. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihm verwundert zu folgen.
Viele Kilometer hatten wir zurückgelegt, der glutrote Feuerball versank bereits langsam am Horizont, als wir etwa dreihundert Meter vor uns weitere Kängurus bemerkten. Fünf gleichgroße Tiere zogen, hier und da an ausgetrockneten Grashalmen äsend, vor uns her und verschwanden kurz darauf hinter einer leichten Bodenwelle. »Nimm das Gewehr und versuch, dich näher heranzupirschen!«, flüstere mein Onkel.
Ich zog die Winchester aus der Gewehrtasche, glitt so leise wie möglich vom Pferd und schlich tief gebückt hinterher, während mir der warme Wind ins Gesicht wehte. Vom Fuße der Bodenwelle an robbte ich in schönster Indianermanier, das Gewehr in »Verhalteposition«, bis zur Höhe, um dort, verborgen hinter einem Grasbüschel, vorsichtig das Gelände vor mir nach den Kängurus abzusuchen. Da, kaum 70 Meter vor mir, verhielten sie hinter einigen größeren Felsbrocken, sodass nur ab und zu ein Lauscher zu sehen war. Im Zeitlupentempo zog ich die Winchester in die Schulter, und der Sicherungsflügel gab mit einem feinen metallischen Klicken den Abzug frei.
Dann schob sich das erste Stück hinter dem Felsen hervor und äugte aufmerksam in meine Richtung. Der Zielstachel stand auf dem Wildkörper und der Finger lag am Abzug, da stutzte ich: Blickte dort nicht ein zweites Augenpaar und zwei überdimensionale Lauscher aus dem braunen Fell des Kängurus? Tatsache, das Tier führte und trug sein Junges im Beutel.
Da hüpfte mit einigen mächtigen Sätzen ein weiteres Stück auf das offene Grasland. Deutlich konnte ich das Tier aufgrund des imponierenden Kurzwildbrets als männlich ansprechen. Anscheinend handelte es sich hier um den Vater. Wieder wanderte der Zielstachel zum Blatt, wild klopfte das Herz, der Zeigefinger krümmte sich und der Schuss peitschte durch den Busch. Mit torkelnden Sprüngen flüchtete das beschossene Stück, um nach etwa zwanzig Metern verendet zusammenzubrechen. Mit zitternden Knien sowie einem unbeschreiblichen Gefühl zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt stand ich kurz darauf vor meinem ersten erlegten Känguru, während die letzten Sonnenstrahlen die rote Erde berührten.
Auch diesmal lehnte mein Onkel die Verwertung des Wildbrets kategorisch ab. Abends dann, am munter flackernden Lagerfeuer, kredenzte er mir als kulinarischen Leckerbissen eine stark verdünnte Tomatensuppe, und ich fragte ihn, ob nicht frisches Kängurusteak eine stilgerechtere Mahlzeit dargestellt hätte. Mit größtem Entsetzen und Verwunderung über einen derartigen Vorschlag hob er abwehrend die Hände.
Die explosionsartige Vermehrung der Kängurus, so erläuterte er mir, gefährdete die Ernährungsgrundlage der Rinder, sodass eine Reduzierung des Bestandes unumgänglich wäre, doch essen könnte man dieses Fleisch nicht.
Es folgte eine australische Nacht am Lagerfeuer unter einem sternenklaren Himmel, die mir mit all ihren fremdartigen Geräuschen bis an mein Lebensende in Erinnerung bleiben wird.
Bis heute kann ich die Sichtweise meines Onkels nicht verstehen, denn man erlegt nur, was man auch verwerten kann. Wie wir noch sehen werden, vertrat er jedoch eine im weiten australischen Busch durchaus geläufige Ansicht.
Auf nächtlicher Pirsch
Schnell sprach sich die Ankunft eines jagdbegeisterten jungen Deutschen auch auf den umliegenden Farmen herum, und so ließ die nächste verlockende Jagdeinladung nicht lange auf sich warten.
Ich brach also auf zu einer etwa zehntausend Hektar großen Farm. Sie lag hundertfünfzig Kilometer von Rockhampton entfernt und bot neben den obligatorischen Rindern eine große Anzahl von Kängurus sowie einen beträchtlichen Bestand an wilden Schweinen. Ich spreche bewusst nicht von Schwarzwild, denn bei den australischen Schweinen handelt es sich um verwilderte Hausschweine, die zurzeit der ersten Besiedlung des roten Kontinents durch die Europäer ihrem Schicksal als Sonntagsbraten durch eine beherzte Flucht in den Busch entgingen. Dort vermehrten sie sich mangels natürlicher Feinde in einem atemberaubenden Tempo.
Mit wie viel Mühe und Konditionsstärke der Fang ausgebrochener Schweine verbunden ist, durfte ich übrigens auf unserem kleinen Resthof in Schleswig-Holstein einmal am eigenen Leib erfahren. Wir schrieben den 18. Dezember, und der kalte, ungemütliche Wind fegte einen Regenschauer nach dem anderen über das Land. Überall standen große Wasserpfützen, und das schwere, lehmige Ackerland war völlig durchweicht. Wir hatten unsere Eltern zu einem zünftigen Gänsebraten eingeladen und waren gerade im Begriff, an der festlich gedeckten Tafel Platz zu nehmen. Das Feuer im kleinen Holzofen fackelte lustig und verströmte wohlige Wärme. Die Weingläser standen mit einem guten roten Tropfen gefüllt auf dem Tisch und die fertig gebratene Gans füllte den Raum mit ihrem appetitlichen Duft.
Die Kinder begannen bereits, sich um die Gänsekeulen zu zanken, während die ersten Schüsseln mit Rotkohl, Erbsen, Karotten und Kroketten ihren Weg rund um den Tisch antraten.
Zufällig blickte ich in diesem Moment durch das große Küchenfenster auf den Vorplatz unseres Hofes und nahm mit ungläubigem Staunen den Umriss eines rosaroten Etwas wahr, das am Fenster Richtung Straße vorbeiflitzte. »Ich glaube, da lief eben ein Schwein«, sagte ich. Alles lachte, doch das eine oder andere Augenpaar wandte sich jetzt ebenfalls dem Fenster zu. Gerade rechtzeitig, denn im selben Moment preschte das zweite Rüsseltier im Schweinsgalopp am Fenster vorbei.
Alles stürzte kopflos nach draußen in das widrige Wetter. Unsere beiden Schweine schien der niederprasselnde Regen nicht im Geringsten zu stören, denn während das eine sich in einer großen Wasserpfütze amüsierte, wühlte das andere ungeniert den Mist aus dem umgegrabenen Gemüsegarten.
Mit vereinten Kräften versuchten wir, dem wilden Treiben ein Ende zu bereiten und die beiden Randalierer zurück in den trockenen Stall zu treiben. Die dachten jedoch nicht im Traum daran, die einmal gewonnene Freiheit leichtfertig wieder aufzugeben und jagten quietschend und grunzend kreuz und quer über das Grundstück, dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassend. Doch auch wir waren nicht gewillt, uns der Schweinemeuterei zu ergeben, und hetzten keuchend hinter den Ausbrechern her.
Nach etwa einer halben Stunde wandte sich das Schlachtenglück aufgrund der erdrückenden Übermacht zu unseren Gunsten. Völlig durchnässt und ausgepumpt, von oben bis unten mit Schlamm und Matsch bespritzt, gelang es uns, die bereits schwächelnden Schweine endlich wieder in den Stall zurückzutreiben.
Müde und abgekämpft kehrten wir zum festlich gedeckten Tisch zurück, und während man sich in der Küche bemühte, die stark ausgekühlte Gans wieder zu erwärmen, suchte ich draußen nach meinen Schuhen, die ich während dieser Schlammschlacht im Gartenmatsch verloren hatte.
Doch zurück zu den Sauen im australischen Busch. Nach eingehender Inspektion sowie Einweisung in Waffen und Munition erklärte mir der Farmer, Allan, wir hätten jetzt noch alle Zeit der Welt für ein gepflegtes Bier und einen geruhsamen Plausch. Daraufhin wagte ich einen vorsichtigen Hinweis auf das unaufhaltsam schwindende Tageslicht. »Wir starten erst bei völliger Dunkelheit«, erklärte er mir im gemächlichen Plauderton, während er mit einem kurzen Ruck die Dose »Foster« öffnete. Angesichts der gerade eingetretenen Neumondphase zweifelte ich ernsthaft am Erfolg unserer Unternehmung, verzichtete aber auf weitere Nachfragen.
Nach der zweiten Runde Dosenbier und einem prüfenden Blick in die dunkle, nur von einem überwältigenden Sternenhimmel spärlich erhellte Nacht, blies Allan zum Aufbruch. Die Winchester mit einem sechsfachen Zielfernrohr über der Schulter, strebten wir dem Geländewagen zu und kletterten beide auf die Pritsche, während Charlie, ein Aborigine, mit laufendem Motor auf weitere Anweisungen wartete. Ein kurzer Wink von Allan, und los ging es in den australischen Busch.
Wie die eigentliche Jagd geplant war, wurde mir erst richtig klar, als Allan den riesigen Scheinwerfer, der hoch über dem Fahrerhaus des Geländewagens montiert war, anschaltete und systematisch die gesamte Umgebung ableuchtete. Überall huschten kleine und große Schatten aus dem Lichtkegel und suchten Deckung hinter Büschen und Sträuchern. Nur die Rinder rührten sich nicht und starrten wie gebannt in das grelle Licht. Allan klopfte mir auf die Schulter und flüsterte mahnend: »Don’t shoot my cattle!« (Schieße nicht auf meine Rinder!) Wie zur Warnung vor einem möglichen »Betriebsunfall« zog ein mächtiger Brahmanbulle vor unseren Wagen und stellte sich provozierend in Pose. Charlie lenkte das Auto geschickt an diesem Verkehrhindernis vorbei, weiter holperten über Stock und Stein.
Dann erfasste der Lichtkegel ein großes, fast schwarzes Känguru, das in etwa 80 Metern wie hypnotisiert verhoffte. Allan nickte, die Waffe glitt an meine Wange, und Sekunden später kracht der Schuss. Schlagartig brach das Känguru verendet zusammen. Allan wollte weiter, doch energisch drängte ich zu meiner Beute. Eine kurze Inaugenscheinnahme, ein kurzes Berühren des weichen, flauschigen Fells und schon fuhren wir weiter. Noch viermal sprach die Winchester, noch vier weitere Kängurus lagen auf der Strecke, während uns Sauen an diesem Abend nicht unterkamen. Allan klopfte mir anerkennend auf die Schulter und auch Charlie nickte beifällig, ein breites Grinsen auf dem Gesicht.
»Spot-lighting« nennen die Australier diese Art der Wildreduzierung, denn mit der Jagd nach unseren Vorstellungen hat das Ganze wenig zu tun.
Mir kamen damals erste Zweifel, vage und unausgesprochen noch, doch tief im Herzen verankert. Bis tief in die Nacht diskutierte ich an diesem Abend mit Allan über das Für und Wider dieser Maßnahme. Dennoch meine ich, dass es uns nicht zusteht, diese Art der Bejagung nur vehement und einseitig zu kritisieren; denn es ist ja so furchtbar einfach, von der warmen Stube aus, geborgen im Sofa sitzend, andere zu kritisieren. Aber diese Farmer kämpfen um ihre Existenz, kämpfen um jeden Grashalm, den sie durch das Schaffen neuer Wasserlöcher und die Aussaat neuer Pflanzen mühsam herangezogen haben. Außerdem dulden sie ja einen gewissen Bestand an Kängurus auf ihren Farmen und freuen sich auch über den Anblick, doch nimmt ihre Zahl überhand, wird regulierend eingegriffen.
Wenn ich mir heute unter Jagd dennoch etwas anderes vorstelle – ich gebe ehrlich zu, dass damals mein Herz vor Aufregung und Jagdfieber wild klopfte. Ich hoffe, der Leser sieht mir das nach.
In der Großstadt
Zwar ist Canberra die Hauptstadt Australiens, doch es gibt eine heimliche Konkurrentin, eine Wettbewerberin, die nicht zögert, ihre Reize sowie ihren ganzen Esprit auszuspielen, wenn es darum geht, sich in den Vordergrund zu drängen, um die Zuneigung und die Bewunderung der Besucher zu gewinnen: Sydney. Zweimal besuchte ich diese faszinierende Stadt und nutzte sie als Ausgangspunkt für meine australischen Exkursionen.
Die zweite Reise war meine Hochzeitsreise, die ich, frisch verliebt und verheiratet mit der attraktivsten Frau der Welt unternahm, um ihr diesen wunderbaren Kontinent zu Füßen zu legen. Und auch sie konnte sich dem pulsierenden Leben Sydneys nicht entziehen, dieser seltsamen Mischung zwischen ultramoderner Großstadt und stocksteif konservativer Kolonialstadt.
Bevor ich weiter die Vorzüge dieser herrlichen Stadt preise und von den Erlebnissen des verliebten Hochzeitspaares berichte, möchte ich zwei Episoden aus der Zeit meiner ersten Australienreise erzählen, die sich tief in mein Gedächtnis gegraben haben. Beide hätten sicherlich auch in einem eigenen Kapitel unter der Überschrift »Landei besucht Großstadt« einen würdigen Platz gefunden. Denn sie zeigen, wie es einem jungen Menschen ergehen kann, der mit wenig Lebenserfahrung und völlig blauäugig durch die Welt marschiert.
Ich hatte zwar einem in Sydney wohnenden Onkel meinen baldigen Besuch avisiert, mich aber mit dem Datum vertan, sodass ich beschloss, die große Stadt erst einmal auf eigene Faust zu erkunden.
Der Hafen war mein Ziel und auf dem Weg dorthin übersah ich leichtsinnigerweise eine rote Ampel. Ich lief schnellen Schritts über die Straße, ohne dabei über die Besonderheiten des australischen Straßenverkehrs – die Autos fahren down under nun einmal links – nachzudenken. Hätte nicht ein älterer Herr mich blitzschnell und geistesgegenwärtig von der Fahrbahn gerissen, hätte es wahrscheinlich nichts Weiteres zu berichten gegeben, mit Ausnahme einer kleinen Notiz in der örtlichen Presse über einen tragischen Verkehrsunfall vielleicht.
Nach einer längeren Gardinenpredigt über den Sinn und Zweck von Ampelanlagen bedankte ich mich erst einmal sehr herzlich für die Lebensrettung. Bald darauf ließen wir uns auf einer Parkbank nieder, und er erzählte mir eine Menge interessante Dinge über Sydney und sein Leben. Hoch in den Achtzigern stand dieser rüstige Mann und an seine letzten Worte erinnere ich mich gut: »Sieh mal, mein junger Freund, wir haben lange miteinander gesprochen, schätzen und respektieren uns. Wären wir uns vor einigen Jahrzehnten begegnet, hätten wir in dem großen Krieg sofort aufeinander geschossen, ohne uns überhaupt kennengelernt zu haben. Menschen sollten viel mehr miteinander sprechen, so manche Katastrophe ließe sich von vornherein vermeiden.« Er hatte Recht.
Am Abend dann schlenderte ich durch die hell erleuchteten Straßen und bewunderte all ihren Schick und Glanz. Schon von Weitem erblickte ich einen wundervoll angestrahlten Springbrunnen, der mich faszinierte. Was lag also näher, als meine Schritte in diese Richtung zu lenken. Bewundernd stand ich kurz darauf vor den gewaltigen Wasserfontänen und erfreute mich an dem Schauspiel. Rund um das Wasserspiel spazierten auch andere Personen; sie alle lächelten mich freundlich an. In Unkenntnis des eigentlichen Sachverhaltes lächelte ich selbstverständlich zurück und bewunderte im Stillen die australische Gastfreundschaft.
Jedoch: Es war schon eigentümlich, dass sich ausschließlich Männer an diesem Platz zu tummeln schienen. Als ich es bemerkte, geschah bereits das Unvermeidliche: Ein älterer Herr sprach mich an, lud mich auf einen Drink ein und legte mir dabei freundschaftlich seinen Arm um die Schulter. Nun fiel der Groschen endlich auch bei mir und ich begriff schlagartig, in welche Szene ich hier hineingeraten war. Im Eiltempo ergriff ich die Flucht, um eine Erkenntnis reicher.
Doch zurück zu den eigentlichen Sehenswürdigkeiten Sydneys. Die Anzahl prachtvoller historischer Bauten ist enorm und deren Besichtigung sicherlich manche Mühe wert. An dieser Stelle auf einzelne Bauwerke einzugehen, würde den Rahmen meines Berichtes natürlich sprengen. Ich möchte auch nicht langweilen. Doch wer ein Faible für Gebäude und ihre Historie hat, wird in Sydney bestimmt nicht zu kurz kommen.
Meine Frau und mich beeindruckten vor allem der imposante Hafen mit dem legendären Opernhaus, das herrlich blaue Wasser sowie die Skyline der Stadt, die von der Wasserseite besonders prachtvoll zur Geltung kommt. Man kann aus einer Vielzahl von Besichtigungstouren, die kreuz und quer durch den Hafen führen, wählen. Der Anblick der vielen Yachten mit ihren weißen Segeln, die das tiefblaue Meer durchpflügen, dass die Gischt nur so spritzt, war ein wunderbares Erlebnis, das wir rundum genossen.
Allerdings hingen die Pubs der Stadt, zumindest in den achtziger Jahren, noch einer Tradition an, die uns Deutschen völlig überholt und absolut unnötig erschien: Ausgedörrt, auf der Suche nach einer flüssigen Erfrischung, betraten wir einen Pub, der mit seinen bleigefassten bunten Fenstern sowie einer soliden Eichentür mit schweren eisernen Beschlägen so recht altehrwürdig und malerisch wirkte. Ob meine Frau nun den größeren Durst verspürte oder ob sie einfach besser zu Fuß war, weiß ich heute nicht mehr so genau, zumindest trat sie als Erste über die Schwelle der Lokalität und – wurde umgehend wieder hinauskomplimentiert. Erst mein Erscheinen sicherte auch meiner Frau ein Getränk, wobei die bösen Blicke der weiteren Gäste, ausschließlich Männer, uns rasch verschwinden ließen. Tja, andere Länder, andere Sitten.
Auf unserer Hafenfahrt stand natürlich auch der Besuch des Tierparks auf dem Programm. Taronga Park Zoo kann ich jedem Natur- und Tierliebhaber nur wärmstens empfehlen. Neben den unzähligen Tieren aus aller Welt lernten wir so viel über die ursprüngliche Flora und Fauna Australiens wie niemals zuvor. Auch wurden die einzelnen Gehege derartig tier- und artgerecht konzipiert, dass man schon den Eindruck gewinnen kann, die Tiere dürfen ein würdiges Dasein führen. Doch das hat für die Besucher natürlich auch Nachteile. Einer der berühmtesten und bekanntesten Vögel Australiens beispielsweise, der Leierschwanz, ließ sich in der urwaldähnlichen Wildnis seines Geheges allenfalls als flüchtiger Schatten erahnen. Dafür hielt es das Schnabeltier für eine gute Idee, den deutschen Touristen seine Schwimmkünste zu demonstrieren. Schnabeltiere erinnern mich in ihrer Schnelligkeit und Verspieltheit sehr stark an unsere Fischotter, auch wenn natürlich die eigenartigen Schnäbel eine einmalige Besonderheit darstellen.
Der botanische Garten ließ für meine Begriffe keine Wünsche offen. Wir vergaßen beinahe, dass wir uns inmitten einer Weltmetropole bewegten. Uralte Bäume, herrliche Wege, blühende Büsche und Sträucher, kleine Teiche mit einer Vielzahl von Enten, Gänsen, Ibissen und Löfflern verzaubern die Herzen. Überdachte Sitzecken, Bänke und Grillplätze laden zum Verweilen ein. An jeden ist gedacht.
Vor gar nicht so langer Zeit schufteten englische Sträflinge für ihr täglich Brot und kämpften auf diesem Kontinent um ihr Überleben. Vor gar nicht so langer Zeit lernte das Volk der Aborigines die weiße Rasse kennen und fürchten. Heute betrachten wir voller Stauen die für uns so neuartige Welt.
Und wird morgen sein?
Unter Schafzüchtern
Die nächste Etappe unserer Reise führte uns in das Zentrum des Bundesstaates New South Wales. Eine ganze lange Nacht transportierte uns der Greyhound, ein australischer Überlandbus, über die staubigen Straße, bis wir unseren Bestimmungsort, eine kleinere Ortschaft namens Inverell, erreichten. Dort wartete bereits, sie war genauso aufgeregt wie wir, meine langjährige Brieffreundin Susan mit ihren Eltern auf uns. Es war schon ein bewegendes Gefühl, einem Mädchen, von der ich so viel wusste und der ich in den vorangegangenen Jahren so vieles geschrieben und berichtet hatte, nun endlich persönlich gegenüberzustehen. Noch etwas befangen stiegen wir aus dem Bus, doch diese Gefühle wandelten sich sehr schnell, weil uns die Familie mit einer geradezu umwerfenden Herzlichkeit begrüßte.
Heiter, ich möchte fast sagen beschwingt, verluden wir unser Gepäck, und ab ging es zu der etwa hundert Kilometer entfernten Farm.
Bereits während der fast zweistündigen Fahrt entstand ein tiefes Gefühl der Zuneigung, und als wir das letzte Gatter Richtung Farmhaus öffneten, fühlten wir uns, so kitschig das auch klingen mag, irgendwie zu Hause. Schnell war der Frühstückstisch auf der Terrasse gedeckt, und bei einer starken Tasse Tee erfuhren wir einiges über die Sorgen und Nöte der australischen Schafzüchter.
Im Vordergrund der Zucht stand natürlich die Wollproduktion, die in früheren Jahren Europa und die USA zu einem großen Teil mit diesem geschätzten und entsprechend honorierten Rohstoff versorgte. Doch die Wollpreise sanken fast ins Bodenlose, sodass die reine Schafzucht die Familie nur unzureichend ernähren konnte. Daher hatte sich Dough, Susans Vater, ein weiteres Standbein als Lohnunternehmer geschaffen und zwar als sogenannter »Kultivierer«.
Was kann man sich darunter vorstellen? Nun, ich hätte bis zu dem Tag darüber auch keine Auskunft geben können. Also: Zwei große Bulldozer fahren in einem Abstand von etwa zwanzig Metern nebeneinander durch die Landschaft. Zwischen den beiden ist eine gewaltige eiserne Kette befestigt, mit der jeder Baum und Strauch mühelos umgerissen wird. Danach schiebt man die Baumstämme, störende Felsblöcke oder Ähnliches zusammen, und die so gewonnene Fläche wird mit Gras oder bestimmten Getreidesorten abgesät. Fertig ist das neue Weideland.
So saßen wir gemütlich auf der Terrasse, ließen uns zumindest theoretisch das australische Farmerleben erläutern, genossen die Sonne und ahnten nichts Böses. Bis, ja, bis ein etwa zwei Meter langes, braunes Etwas sich lautlos aus dem hohen Gras auf die Terrasse schlängelte. Wir alle saßen wie erstarrt und blickten ungläubig auf das züngelnde Reptil, das sich uns langsam aber sicher näherte. Bevor ich selbst einen klaren Gedanken gefasst hatte, ob nun panische Flucht, energischer Angriff oder beten und abwarten die richtige Strategie waren, krachte knapp neben meinem Kopf ein Schrotschuss, und die Schlange wand sich im Todeskampf.
Dough hatte die Situation lange vor uns erkannt und blitzschnell gehandelt. »Eine Brown Snake«, erläuterte er uns mit einem feinen Lächeln auf dem Gesicht. »Hätte sie dich gebissen, wäre es aus mit dir gewesen, denn Schlangenserum haben wir hier auf der Farm nicht vorrätig. Einen kleinen Whisky, eine kurze Zigarette und ein knappes Gebet, die Zeit hättest du noch gehabt.«
Ich bin heute noch davon überzeugt, dass das giftige Reptil nichts Arges im Sinn hatte, sondern nur die wärmende Sonne suchte. Trotzdem war ich Dough sehr dankbar für sein schnelles und überlegtes Handeln. Der weitere Farmurlaub war also gerettet.
So dachten wir zumindest und wünschten uns, verstaubt und verschwitzt, wie wir uns fühlten, erst einmal ein ausgiebiges heißes Bad. Diesem Wunsch wurde entsprochen, wenn auch, wie wir bemerkten, mit leichtem Zögern. Als meine Frau dann das Bad betrat und ein wenig ungläubig in die Wanne blickte, die etwa zehn Zentimeter hoch mit Wasser gefüllt war, erhielten wir von Dough erst einmal eine Aufklärung in Sachen Wasserversorgung im australischen Busch.
Das Trink- und Brauchwasser speicherte die Familie in zwei großen Metalltanks, die durch das von den Dächern abfließende Regenwasser gespeist wurden. Die sehnlichst erwartete Regenzeit war allerdings bisher ausgeblieben. Der Wasserpegel sank bedrohlich gegen Null. Daher war das Wasser streng rationiert und unsere Badearie stellte einen Luxus dar, den sich die Familie selbst nie gegönnt hätte. Doch für die Gäste aus Deutschland war das Teuerste gerade gut genug, und so wuschen wir uns in der Wannenpfütze, wenn auch mit schlechtem Gewissen. In Schleswig-Holstein gibt es Wasser im Überfluss und uns wurde hier zum ersten Male sehr konkret bewusst, welchen Stellenwert das kostbare Nass in anderen Teilen der Welt hat und wie verschwenderisch wir in der Heimat mit diesem kostbaren Gut umgehen.
Am nächsten Morgen wurde es dann ernst mit dem Farmerleben: Eine Herde Schafe sollte zusammengetrieben werden. Die Lämmer mussten geimpft, ihre Schwänze gekürzt sowie die Bocklämmer zusätzlich kastriert werden.
Nach Pferden für den Viehtrieb in Cowboymanier suchte ich vergeblich. Das extrem steinige, mit Felsklüften durchsetzte Gelände barg ein sehr hohes Verletzungsrisiko für die Pferde, erläuterte mir Dough, zudem fraßen sie ständig kostbares Gras, auch wenn sie nicht arbeiteten. Das stimmte zweifellos, doch ich fragte mich, wie wir denn die Schafe ohne die vierbeinigen Helfer in diesem weitläufigen Gelände finden und in den Pferch treiben sollten. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verschwand Dough in einem alten, rostigen Blechschuppen und schob zwei bereits arg lädierte Motocross-Räder ans Tageslicht. Nach einigen Übungsrunden auf dem Hofplatz lenkten wir die Zweiräder in Richtung Buschland, und die Aktion »Schaftrieb« begann. Erst vorsichtig, dann immer wagemutiger fuhren wir querfeldein über Schotterpisten, Fels und Geröll. Die rote Erde Australiens knirschte unter den profilstarken Reifen, und mich überkam ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit und Abenteuerlust.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?
Weitere E-Books rund um die Jagd
Sein bester FreundeISBN 978-3-475-54514-6 (epub)
Carsten Feddersen berichtet über die unvergängliche Freundschaft zwischen dem Jäger und seinem Hund. Der Vierbeiner ist unerlässlich für das Aufspüren der Beute und damit für den Jagderfolg. Wir lesen von der Rettung eines liebestollen Hausschweins und von einem Hirsch, der wieder zum Leben erwacht. Die enge Bindung wird deutlich spürbar, als die Dackeldame Daisy ihre Familie gegen Fremde verteidigt, selbst wenn es sich dabei um den Weihnachtsmann handelt. Der erfahrene Hundeführer bringt uns die Jagd in bewegenden und amüsanten Geschichten näher.
Frische FährteeISBN 978-3-475-54541-2 (epub)
Der zweite Band des beliebten Autors norddeutscher Jagderlebnisse entführt uns nach Vorpommern. Auf höchst vergnügliche Weise erfahren wir, wie ein Rehbock zweimal starb und zwei Rinder als Jagdhunde erfolgreich waren, wir lesen die Geschichte vom erlegten Ziegenbock und dem Jäger, der durch den morschen Hochsitz brach. Außerdem widmet sich Carsten Feddersen mit besonderer Liebe den Menschen dieses Landstrichs, ihrer auf den ersten Blick rauen, aber immer kameradschaftlichen und hilfsbereiten Art.
Im Visier des JägerseISBN 978-3-475-54396-8 (epub)
Der beliebte Autor deutscher Jagderlebnisse entführt uns mit seinen spannenden Geschichten nach Schleswig-Holstein. Auf höchst vergnügliche Weise erfahren wir, was der Jagdalltag mit sich bringen kann. Sei es das Heranpirschen an eine Rotte Sauen im tiefen Schnee, der Ansitz auf den treibenden Bock oder die Jagd auf Hasen mit der treuen Drahthaarhündin Anka. Sowohl lustige, aufregende, aber auch nachdenklich stimmende Geschehnisse aus seinem privaten Umfeld weiß Feddersen geschickt in seine jagdlichen Erlebnisse einzubinden. So berichtet er beispielsweise von der berührenden Handaufzucht eines verwaisten Rehkitzes zusammen mit seinen Kindern.
BlattschüsseeISBN 978-3-475-54539-9 (epub)
Von Jagdglück und Stoßgebeten, von Beute, die sich wehrt, und Jägern, die nicht immer ganz Herr des Reviers sind: Der Autor, dessen Jagdfieber bereits in der Kindheit erwachte, hat aus seinem Jägerleben eine solche Fülle von überaus vergnüglichen Jagdgeschichten zu erzählen, dass auch jeder Nicht-Jäger daran seine helle Freude hat.
Auf der PirscheISBN 978-3-475-54542-9 (epub)
In diesem Buch begegnet der Leser dem geheimnisvollen Abenteuer Jagd, als der Jäger noch das erlegte Wild auf dem Rücken zu Tal befördern musste und dies noch nicht der geländegängige Jeep besorgte. Durch diese Seiten weht noch der Harzduft des Bergwaldes, der Hauch des Geheimnisvollen, Abenteuerlichen. Josef Gehrer zeichnet mit seinen Geschichten eine Welt, in der heißblütige und wagemutige Wilderer wachsamen Jägern im Kampf auf Leben und Tod gegenüberstehen. Jeder, der mit der Natur verbunden ist, ob Jäger, Bergwanderer oder Heimatfreund, wird seine Freude an diesen Erzählungen haben.
Das Revier rufteISBN 978-3-475-54543-6 (epub)
Einfühlsam und fesselnd berichtet hier ein Jäger aus eigenem Erleben, erzählt von den Höhen und Tiefen, von Hege und Pflege, von heiteren und spannenden Momenten und lässt seine Leidenschaft für die Jagd spüren. Aus seinen Zeilen spricht die hohe Achtung vor der Natur und eine große Liebe zur Jagd. Mit der Nähe zum jagdlichen Alltag gelang es Alfred Walter ein unterhaltsames Buch für alle Jagdbegeisterten und Naturfreunde zu schreiben.
Auf dem JägerstandeISBN 978-3-475-54397-5 (epub)
Kurt J. Jaeger erzählt heitere und spannende Jagdgeschichten. Er hat als Revierpächter und Jagdaufseher schon viel erlebt. Aus diesem reichen Erfahrungsschatz berichtet er in seinem Buch. Etwa wie nach einem erfolgreichen Pirschgang das erlegte Bockkitz aus einer Felsspalte befreit werden muss. Von der Jagd mit Flinten auf Wildschweine in Afrika, die nicht nur wegen des unbekannten Geländes zu einem echten Abenteuer wird. Von einer Drückjagd, mit ihren strengen Regeln und wie dabei ein Rucksack verloren geht, der später unverhofft wieder auftaucht. Kurt J. Jaegers Geschichten sind teils komisch, teils bewegend, aber immer authentisch.
Und immer lockt das WildeISBN 978-3-475-54398-2 (epub)
Als langjähriger Revierpächter und Jagdaufseher hat Kurt J. Jaeger viel erlebt in Wald und Wiese. Er erzählt humorvoll von den Tücken des Jägerlebens sowie von lustigen Erlebnissen aus seinem Bekanntenkreis. Ein Geißbock irrt durch die Wälder, vertreibt das Wild und sorgt sogar nach seinem Abschuss für Aufregung. Empörung geht durch eine ländliche Gemeinde, als ein Gast ihren Steinbock erlegt. Besserwisserische Jagdgäste und Leichtsinn unter den Kollegen führen zu kleinen und größeren Pannen. Ebenso erfährt man von den Folgen des Abschusses eines Steinadlers. Kurt J. Jaegers Geschichten sind voller Frohsinn und Witz und vermitteln dennoch die Ernsthaftigkeit der Jagd.