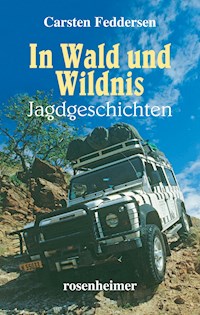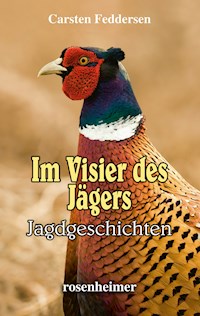
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der dritte Band des beliebten Autors deutscher Jagderlebnisse entführt uns nach Schleswig-Holstein. Auf höchst vergnügliche Weise erfahren wir, wie ein Rehbock zweimal starb und zwei Rinder als Jagdhunde erfolgreich waren. Wir lesen die Geschichte vom erlegten Ziegenbock und dem Jäger, der durch den morschen Hochsitz brach. Außerdem widmet sich Carsten Feddersen mit besonderer Liebe den Menschen dieses Landstrichs, ihrer auf den ersten Blick rauen, aber immer kameradschaftlichen und hilfsbereiten Art.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dieses Buch ist gewidmetmeiner geliebten Frau Susanne,sechs großartigen Töchtern,meinen bewundernswertenAusnahme-Elternsowie meinen Super-Schwiegereltern.
Wir sind schon ein tolles Team!Vielen Dank.
LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2012
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Lektorat und Satz: Bernhard Edlmann Verlagsdienstleistungen, RaublingTitelfoto: © Damian Kuzdak - istockphoto.com
eISBN 978-3-475-54396-8 (epub)
Worum geht es im Buch?
Carsten Feddersen
Im Visier des Jägers
Der dritte Band des beliebten Autors deutscher Jagderlebnisse entführt uns nach Schleswig-Holstein.
Auf höchst vergnügliche Weise erfahren wir, wie ein Rehbock zweimal starb und zwei Rinder als Jagdhunde erfolgreich waren.
Wir lesen die Geschichte vom erlegten Ziegenbock und dem Jäger, der durch den morschen Hochsitz brach.
Außerdem widmet sich Carsten Feddersen mit besonderer Liebe den Menschen dieses Landstrichs, ihrer auf den ersten Blick rauen, aber immer kameradschaftlichen und hilfsbereiten Art.
Inhalt
Vorwort
Ein Dank
Ein Abschied und ein Neubeginn
Zwischen Maklern und Masseusen
Der große Treck
Der Eishirsch
Die Wohldkoppel
Fionas letzte Heldentat
Der schwarze Hirsch
Festgefahren
Der Bienenschwarm
Zweimal auf den Hund gekommen
Stockern mit Anka
Jagd vorbei
Sauen einmal hautnah
Jagen mit unseren Mädels
Unverhofft kommt oft
Unsere Findelkinder
Ein Kitzjahr
Immer nur diese Frischlinge
Ein ganz Großer
Ein bayerisches Drama
Eine Winternacht
Auf den Platzhirsch
»Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen …«
Auf nach Ungarn!
Ausklang
Vorwort
Wie oft senkte sich schon das Visier des lauernden, nicht selten vor Jagdfieber zitternden Jägers in das Blatt des arglos äsenden oder auch des aufmerksam sichernden, zum Absprung bereiten Wildes. Wie oft fand die todbringende Kugel ihr Ziel, brachte Freude und doch Wehmut, Erlegerstolz und doch Selbstanklage.
Was aber muss der Jäger in seinem täglichen Leben nicht noch alles ins Visier nehmen! Ist er doch, quasi so nebenbei, häufig auch Ehemann, ehrlich und hart arbeitender Einkommensbeschaffer, Familienvater, Hobbygärtner auf dem eigenen Grundstück oder gar Hobbylandwirt auf eigener Scholle.
Ähnliches gilt für die Jägerinnen, denen oftmals ein vergleichbares Schicksal beschieden ist.
Lassen Sie mich daher erzählen, was ich alles so ins Visier nahm im Laufe der Zeit – vor allem auf der Jagd, aber auch in ganz anderen Bereichen –, als ich mit meiner Familie nach fünf ereignisreichen Jahren in Mecklenburg-Vorpommern zurückkehrte in die schleswig-holsteinische Heimat (wer mein Buch Frische Fährte gelesen hat, weiß über die hier nur angedeutete Vorgeschichte bereits bestens Bescheid).
Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam durch die verschiedenen Visiere des Lebens zu blicken und dabei eines nicht zu kurz kommen zu lassen: unsere Freude an Pirsch und Ansitz, an Jagd und Beute.
Ein Dank
An dieser Stelle möchte ich Herbert Brunner danken, der mir als zuständiger Revierleiter der Försterei Bordesholm erst die Jagd in der Wohldkoppel ermöglichte. Eine Reihe der folgenden Geschichten rankt sich um dieses Revier, an dem mein Herz von Anfang an besonders hing, unter anderem aus familiären Gründen.
Leider ist Herbert Brunner viel zu früh an einer tückischen Krankheit verstorben.
Er prägte die Försterei Bordesholm während der langen Jahre seines Wirkens in seiner ganz eigenen, charakteristischen Art und Weise.
Als gebürtiger Bayer eroberte er mit seiner herzlichen, gradlinigen Art in kurzer Zeit die Herzen vieler Menschen in seinem Umfeld. Noch heute steht im sogenannten Lärchenwald zwischen Brügge und Schönhorst ein großer Stein mit Inschrift zu seinem Gedenken.
Ich danke dir, Herbert, für all die Erlebnisse, die mir durch deine Unterstützung in der Wohldkoppel beschert wurden.
Ein Abschied und ein Neubeginn
Fünf Jahre ein neues Zuhause in Vorpommern erleben, ein unbekanntes Revier erkunden und erjagen.
Fünf Jahre – ein halbes Jahrzehnt, wie viel und doch wie wenig in unserer schnelllebigen Zeit.
Anfang 1997 hieß es dann Abschied nehmen von Kirschdorf am Greifswalder Bodden. Wehmut mischte sich mit der Vorfreude auf die alte Heimat, auf bekannte Gesichter, auf lange entbehrte Freunde und Bekannte.
Was würde uns wohl erwarten?
Etwas, was uns vorläufig nicht erwartete, stand in diesem Moment jedoch schon fest: nämlich ein neues Heim.
Während meine Frau Susanne mit unseren Töchtern Mareike und Annika erst einmal in Kirschdorf blieb, um potenziellen Käufern unser Anwesen zu präsentieren, ging ich, der Not gehorchend, mit Feuereifer auf die berühmt-berüchtigte Budensuche, frei nach dem allseits bekannten Film Feuerzangenbowle.
Fieberhaft studierte ich die Mietangebote in der örtlichen Presse, wobei die Ergebnisse eher dürftig ausfielen. Zu teuer, zu groß, zu klein, zu weit weg vom Arbeitsplatz, zu belebt, zu einsam. Vor allem aber wünschten sich die Vermieter einen langfristigen Mietvertrag, während ich ja nur eine Interimsbleibe suchte, bis ein neues Haus gefunden war.
Ich haderte bereits mit meinem Schicksal und sah ein campingähnliches Domizil bedrohlich näher rücken, als der erlösende Tipp von meinem Vater kam: Das Rentnerwohnheim der idyllisch gelegenen Gemeinde Groß Buchwald, gleich neben dem Haus meiner Eltern, suchte für eine Übergangszeit einen Nachmieter für eine kleine Wohnung. Herz, was willst du mehr!
Schon am nächsten Abend zog ich mit Sack und Pack in mein Refugium ein und begrüßte meine neuen Nachbarn, die sich im ersten Moment schon ein wenig über den jungen Rentner wunderten. Doch immerhin senkte ich den Altersschnitt in diesem Umfeld ganz gewaltig.
Ich kehrte damit in das Dorf zurück, in dem ich den Großteil meiner Jugend verbracht hatte. Jeden Weg und Steg kannte ich hier. Der Dorfplatz mit seinen alten Linden und Eichen, die Gehöfte, der Wald, die Menschen, alles war so vertraut, war einfach die Heimat.
Nur meine Frau und die Kinder fehlten mir zum vollständigen Glück. Doch auch die Zeit unserer Wochenendehe würde vorübergehen.
Nachdem nun die Frage der Unterbringung erst einmal mehr als zufriedenstellend gelöst war, galt es natürlich auch jagdlich wieder Tritt zu fassen.
So wunderschön, beschaulich und entspannend ein abendlicher Spaziergang durch Feld und Flur auch sein mag, das heimliche, vorsichtige Pirschen mit der Waffe über der Schulter fehlte mir doch sehr, und immer intensiver beschäftigte mich die Frage, wie diesem Missstand wohl abzuhelfen wäre.
Die Rettung nahte in Form eines Bayern in Schleswig-Holstein. Mein alter Freund Herbert Brunner, ehemals aus südlichsten deutschen Gefilden stammend, leitete seit einigen Jahren die Revierförsterei Bordesholm und prägte sie mit seiner unverwechselbaren Art. Ich klagte ihm mein Leid, und zu meiner freudigen Überraschung wusste er spontan Abhilfe zu schaffen.
»Die Begehungsscheine in den Waldrevieren sind momentan alle vergeben, aber für dich habe ich noch ein ganz besonderes Schmankerl in petto.«
Glücklicherweise reichten meine Fremdsprachenkenntnisse zumindest so weit aus, um ihn bei dem Ausdruck »Schmankerl« erwartungsvoll anzublicken.
Verschmitzt lächelte Herbert mich an: »Ein Teil des Dosenmoors wird forsttechnisch von mir betreut. Aufgrund der starken Vernässung und der vielen alten Torfkuhlen ist die Bejagung relativ schwierig und vor allem nicht ganz ungefährlich. Aber du liebst ja solche Herausforderungen, oder?«
Freudestrahlend, wenn auch mit einem leicht mulmigen Gefühl in der Magengegend, schlug ich ein.
Gleich der nächste Abend führte mich hinaus an meine neue jagdliche Wirkungsstätte. Auch wenn nur ein Bruchteil des etwa 500 Hektar großen Hochmoores für meine Jägerambitionen zur Verfügung stand – der Anblick war einzigartig. Offene Flächen, nur mit Torfmoosen und niedrigem Gras bewachsen, wechselten sich mit buschigen Birken- und Erlenbeständen ab. Das Ganze strahlte eine kaum zu beschreibende Atmosphäre aus, faszinierend und furchteinflößend zugleich. Leise zitterte das Wollgras im sanften Sommerwind des zu Ende gehenden Julitages, Lerchen jubilierten hoch am Himmel, während verschiedenste Schmetterlinge und Libellen über die an Savannen erinnernde Freifläche gaukelten. Bei jedem noch so vorsichtig angesetzten Schritt gurgelte braunes Wasser unter den Gummistiefeln, und hier und dort schimmerten offene Wasserstellen heimtückisch zwischen den einzelnen Grasbülten.
»Nur schön auf Binsen- und Grasbüscheln bleiben und nicht danebentreten«, befahl das besorgte Hirn den doch etwas wackligen Beinen.
Dann endlich entdeckte das suchende Auge einen anscheinend etwas trockeneren Platz hinter einer fast zwergwüchsigen, offenbar ums Überleben kämpfenden Eiche. Dort, mit Blick auf die Freifläche und die angrenzende Dickung aus Erlen und Birken, platzierte ich meinen Jagdstuhl und harrte der Dinge, die da kommen würden.
Ruhig und beschaulich lag das Moor vor mir, während die Sonne sich mehr und mehr hinter aufziehenden düsteren Wolken verbarg.
»Ein Gewitter im Moor, das hat mir gerade noch gefehlt«, dachte ich frustriert und wollte mir verärgert gerade eine Zigarette anzünden, als sich plötzlich ein roter Fleck aus dem Grün der Birken herausschob.
Die Zigarette landete erst einmal wieder in der Brusttasche des Hemdes, und das Jagdglas wanderte zu den Augen. Ein junger Rehbock, ein schwacher Jährling mit kleinfingerlangen Spießchen, zog, immer wieder ängstlich zurückäugend, langsam auf etwa 80 Gänge vor mir durch die Moorlandschaft. Sollte etwa noch ein älterer in dem undurchdringlichen Grün stecken, auf den weiteres Warten und Passen lohnte?
Ein erster, ferner Donnerschlag brachte die Entscheidung. Schnell hob ich den Drilling, legte über meine Bonsai-Eiche an, und der Schuss peitschte über das Moor. Mein kleines Böckchen schnellte mit allen vieren in die Luft, preschte hochflüchtig etwa 50 Meter von mir weg und verschwand hinter einem Büschel Wollgras. Erste schwere Regentropfen und ein greller Blitz sorgten dafür, dass die Zigarette auch diesmal ungeraucht blieb, da ich sofort meinen ersten Moorbock bergen wollte, bevor das Gewitter richtig über das Dosenmoor fegte, mit mir mittendrin.
Ich hüpfte also wie ein, wenn auch etwas schwergewichtiger, Kobold von Bülte zu Bülte auf meine Beute zu, umrundete das Wollgras und stand nicht etwa vor dem malerisch daliegenden Bock, sondern vor einem Moorloch, aus dem gerade noch ein Hinterlauf des eben Gemeuchelten gen Himmel ragte.
Hier war guter Rat teuer und zweifelsohne Eigeninitiative sowie Kreativität gefragt. Da nun, wie in der Landwirtschaft hinlänglich bekannt, in fast jeder Lebenslage ein Stück Sacksband weiterhelfen kann, gehört dieses Utensil auch für mich zum festen Bestandteil meiner jagdlichen Ausrüstung. Also schnell eine Schlinge geknüpft, an einem abgestorbenen Ast befestigt und bäuchlings Richtung Moorloch gerobbt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, die der Donnergott jedes Mal mit einem gehörigen Krachen kommentierte, gelang es mir tatsächlich, die Schlinge am Hinterlauf festzuzurren und den Bock seinem kühlen Grab zu entreißen. Bei prasselndem Regen zog ich meine Beute, so schnell es nur ging, hinter mir her, um wieder trockene und damit sichere Gefilde zu erreichen.
Fehltritte werden im Leben jedoch meist umgehend bestraft. Bei dem wilden und hektischen Gezerre rutschte ich von einer Bülte ab. Flugs versank das linke Bein bis zum Oberschenkel im Moor, und auch der Drilling rutschte mir dabei von der Schulter, um augenblicklich in der braunen Brühe zu versinken.
Fluchend und mit aufkeimender Angst zog ich die Waffe am Lauf wieder aus dem Moorloch und legte sie auf den Bock. An den Grasbülten festgekrallt, entriss ich dann mit aller Kraft mein Bein den saugenden Moorgeistern, wobei der Gummistiefel irgendwo in düsteren Tiefen auf der Strecke blieb.
Irgendwann erreichte ich dann doch das rettende Auto, von oben bis unten nass, bedeckt von einer dicken Schicht aus Moorwasser und Matsch.
Mein Stiefel steckt noch heute tief im Moorloch. Sollten ihn eines Tages Forscher späterer Generationen finden, wird ihnen die Erklärung des merkwürdigen Befunds sicher einige Denkarbeit abverlangen.
Zwischen Maklern und Masseusen
Es lag nicht in meiner Absicht, im Rentnerwohnheim auf meine tatsächliche Verrentung zu warten – zumal hier kein Platz für meine Familie war. Daher galt es, Augen und Ohren offen zu halten, ob nicht in der Umgebung ein Gehöft zum Verkauf stand, das unseren Vorstellungen entsprach. Groß sollte es sein, für unsere Töchter, die bereits das Licht der Welt erblickt hatten – und auch für diejenigen, die diesen großen Moment noch vor sich hatten. Eine eher einsame Lage war erwünscht, denn wir hatten uns in Vorpommern an ein nicht von Nachbarn reglementiertes Leben gewöhnt und wollten nur ungern darauf verzichten. Weide- und Ackerland sollte möglichst dabei sein, da wir unseren landwirtschaftlichen Ambitionen auch weiterhin frönen wollten.
Sie sehen, uns zeichnete nicht gerade Bescheidenheit aus. Weil derartige Objekte nicht so zahlreich gesät sind, beschlossen wir, auch einige Immobilienmakler mit der Suche zu beauftragen, um ja keine Chance ungenutzt zu lassen.
Da meine Frau, wie bereits erwähnt, in Kirchdorf die Stellung hielt, oblag es mir, die Erstbesichtigungen durchzuführen und eine gewisse Vorauswahl zu treffen. Erschien mir ein Objekt überlegenswert, besprach ich die Sache am Telefon mit meiner Frau, worauf meine persönliche Sachverständige kurzerhand aus dem Osten anrückte.
Was mir dann von einigen sogenannten kompetenten Maklern alles angeboten wurde, ist ein Kapitel für sich.
»Das Objekt habe ich gerade eben reinbekommen, ein wahrer Leckerbissen. Wie für Sie geschaffen. Bilder habe ich noch keine, deshalb müssen Sie es sich unbedingt selbst anschauen. Sie werden entzückt sein« – so oder ähnlich lauteten die verlockenden Angebote, die mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder frohes Hoffen in mir aufkeimen ließen. Vor Ort schlug das von interessierter Seite heraufbeschworene Entzücken dann mit ebenso schöner Regelmäßigkeit in blankes Entsetzen um, denn irgendein gravierender Pferdefuß lauerte stets auf mich: Entweder war das Weideland für die nächsten zehn Jahre verpachtet, oder die Autobahn nahm ihren Weg quasi über die Terrasse.
Ein wirklich entzückendes Anwesen am Rande eines Naturparks brachte dann auch meine Augen zum Leuchten und meine Gedanken zum Träumen. Ein großes, gepflegtes Bauernhaus mit Scheune und Stallungen, nicht zu groß und damit wie geschaffen für ein wenig Ackerbau und Viehzucht nebenbei. Weiden, ein kleiner Mischwald und sogar ein malerischer See umgaben das Gehöft, und ein Nachbarhaus schimmerte aus weiter Ferne. Hier stimmte alles, dachte ich glückselig, stieg in mein Auto und stellte mir schon vor, wie von zu Hause aus meine Frau anrief und von diesem Glücksgriff berichtete.
Bei meiner ganzen verklärten Träumerei verpasste ich leider die richtige Ausfahrt – oder glücklicherweise. Ich irrte orientierungslos durch die Feldmark und fand mich kurze Zeit später vor einer riesigen Müllkippe wieder, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu meinem Traumanwesen lag und nur heute aufgrund entgegengesetzter Windrichtung ihren Gestank nicht in diese Richtung verbreitete.
Zutiefst frustriert und unsagbar enttäuscht sowie absolut reif für mein Rentnerwohnheim fuhr ich zurück Richtung Groß Buchwald. Kaum stand ich in der Tür, klingelte das Telefon. »Oh Gott, bloß nicht noch so ein Makler«, dachte ich und zögerte bereits, überhaupt den Hörer zu ergreifen. Doch die Neugier siegte, und zu meiner Freude meldete sich Herbert Brunner, seines Zeichens Revierförster von Bordesholm.
»Ich dachte mir, du hättest vielleicht Lust, nach deinen nassen Füßen im Moor einmal auf festem Boden zu jagen. Im Revierteil Brüggerholz habe ich aufgrund der hohen Verbissschäden noch einen Bock zum Abschuss freibekommen. Übrigens treibt sich dort ein zurückgesetzter älterer Sechser herum, der recht regelmäßig auf der großen Waldwiese austritt.«
Vor Freude hätte ich den Förster durchs Telefon holen können. »Mensch, Herbert, natürlich habe ich Lust, wann darf ich starten?«
»Wenn du gleich bei mir vorbeikommst und dir den Erlaubnisschein abholst, von mir aus morgen Früh. Ich …«
Mehr hörte ich nicht, denn ich saß bereits im Auto und fuhr Richtung Försterei.
Am nächsten Morgen, vor Tau und Tag, pirschte ich vorsichtig den geschlungenen Waldweg in dem nur vier Kilometer entfernten Brüggerholz entlang. Das Ziel war eine geräumige Kanzel. Direkt am Waldrand gelegen, bot sie einen guten Überblick über die gepriesene Waldwiese.
Ich kannte den ganzen Komplex wie meine Westentasche, denn jedes Jahr nach dem Abschleudern des Rapshonigs half ich meinem Großvater und später meinem Onkel, die Bienenstöcke für die Sommertracht in dieses Waldgebiet zu bringen. Auch das Pilzesammeln und der Holzeinschlag erfolgten vorzugsweise in Brüggerholz, sodass ich bereits von Kindesbeinen an den ganzen Wald erkundet hatte.
Stern um Stern erlosch. Langsam wich das Dunkel der Nacht dem ersten Zwielicht. Hier und da begrüßten die Amseln verschlafen erst mich und dann immer kräftiger und sangesfreudiger den anbrechenden Tag mit ihrem Morgenlied. Eine erste zarte Röte überzog den Himmel, wurde allmählich stärker und intensiver, bis schließlich der rote Sonnenball einen schönen Spätsommertag ankündigte. Ein einzelner Hase hoppelte gemächlich genau unter meiner Kanzel Richtung Waldwiese, schüttelte sich behaglich den Morgentau aus dem Balg und begann mümmelnd mit dem Frühstück.
Da – ein leises Knacken vom gegenüberliegenden Waldrand. Kam der ersehnte ältere Bock? Vorsichtig wanderte das Jagdglas zum Auge.
Ein roter Fleck zeigte sich unter den tief hängenden Ästen einer ausladenden Randeiche. Daneben schob sich ein zweiter Wildkörper auf die Bildfläche. – Entwarnung! Damtier und Kalb wechselten vertraut auf die Wiese und ästen wie gewohnt an den vielfältigen Gräsern und Kräutern.
Dann fing das Auge eine weitere Bewegung ganz links unten am letzten Zipfel der Freifläche auf. Tatsächlich, etwa 150 Meter entfernt zog ein Bock! Der Pulsschlag erhöhte sich, der Atem ging ein wenig schneller.
Doch wieder Entwarnung! Was sich dort präsentierte, war ein zweijähriger Bock, dessen Gehörn mit seinen gut entwickelten Vordersprossen und leicht angedeuteten Hintersprossen knapp über die Lauscher reichte. Also wieder nicht der Gesuchte und Ersehnte.
Aber halt, irgendwie wirkte der Bock unförmig, irgendetwas irritierte das betrachtende Auge. Nochmals glitt der Blick durch das vergrößernde Glas über den Wildkörper. Ich stutzte, zweifelte, überprüfte nochmals, bestätigte mir meinen Eindruck, zweifelte dennoch. Aber die Erkenntnis blieb. Der Bock war übersät mit kleinen und großen Blasen. Immer noch unschlüssig hob ich den Drilling, sprach nochmals durch das Zielfernrohr an. Da, selbst das Haupt schien verquollen.
Dann schickte ich das 11,5-Gramm-Geschoss auf die Reise, und nach wenigen Fluchten brach der Bock zusammen.
Mich hielt nichts mehr auf der Kanzel. Kurze Zeit später stand ich vor der geschundenen Kreatur. Unzählige Eiterblasen, teilweise groß wie Tennisbälle, entstellten den Wildkörper. Eine dieser Blasen hatte das Geschoss durchschlagen. Die stinkende gelbliche Flüssigkeit vermischte sich mit dem Schweiß und tropfte träge an der Decke herunter. In diesem Moment brachte ich es einfach nicht über mich, den Bock aufzubrechen, um die inneren Organe auf mögliche Ursachen zu untersuchen. Ich schoss lediglich einige Beweisfotos und vergrub den Rehbock tief im Rand der Waldwiese. Immer wenn ich das Gehörn an der Trophäenwand betrachte, grüble ich darüber nach, was wohl die Ursache für diese verheerende Infektion gewesen sein mag. Doch dieses Geheimnis nahm der Bock mit sich in sein kühles Grab.
Zufrieden über diesen Hegeabschuss fuhr ich nach Hause. Dort wartete bereits die nächste Überraschung. An der Haustür klebte eine Nachricht:»Bitte sofort kommen, habe wichtige Info, Mutter.«
Augenblicke später saß ich ihr am Küchentisch gegenüber.
»Wie weit ist denn deine Haussuche gediehen?«, fragte sie mich, ein wenig süffisant schmunzelnd.
»Na, ja, du weißt ja, die Makler«, antwortete ich irritiert auf die unerwartete Frage.
»Makler sind dafür nicht die richtigen Ansprechpartner«, konstatierte sie belehrend. »Du musst eine Masseuse fragen.«
Mir blieb buchstäblich erst einmal die Spucke weg.
Mutter lachte mich an. »Nun hör mal gut zu«, begann sie ihren Bericht, »ich war heute Vormittag zur Massage. Dabei erzählte mir die Masseuse, dass ihr Onkel aus Altersgründen seinen Resthof, hier ganz in der Nähe, verkaufen will. Vielleicht schaust du dir das mal an.«
Zwei Stunden später stand ich staunend auf dem Hof. Alles, was wir uns erhofft und erträumt hatten, stand in seiner ganzen Pracht vor mir.
Schon am nächsten Tag folgte ein weiterer Besuch, diesmal mit meiner Frau. Auch sie verliebte sich fast sofort in dieses schöne Fleckchen Erde mit Haus, Stallungen und einer geräumigen Halle. Baulich warteten allerlei Herausforderungen auf uns, doch die schoben wir beiseite – zugegebenermaßen ein wenig leichtsinnig, wie die Zukunft zeigen sollte. Kurzerhand entschlossen wir uns zum Kauf und fanden damit unser neues Zuhause für uns und unsere Kinder – unsere zukünftige Heimat im wunderschönen Dosenbek.
Der große Treck
Fast zeitgleich mit unserem neuen Heim fanden wir einen Käufer für unseren Hof in Kirchdorf. Dieser hatte seinen ursprünglichen, im Hamburger Raum gelegenen Besitz bereits veräußert und drängte zwar höflich, jedoch mit Nachdruck darauf, den herrlichen Blick auf den Greifswalder Bodden täglich genießen zu können. Zudem hatte sich bei uns wieder Nachwuchs angekündigt. Also hieß es, nunmehr endgültig, die Siebensachen zu packen.
Dieser kleine, so lapidar klingende Satz hatte es in sich, denn mit dem Befüllen zweier großer Möbelwagen war es beileibe nicht getan. Zusätzlich galt es, die landwirtschaftlichen Maschinen vom Trecker über diverse Anhänger bis hin zum Kreiselmäher heil wieder nach Schleswig-Holstein zu schaffen. Auch das liebe Vieh scharrte bereits mit den Hufen, um ja nicht vergessen zu werden: unsere beiden Ponys Hanna und Willi sowie unsere Rinder, allen voran die Kuh Klausi, meinen treuen Lesern bereits aus der Frischen Fährte bekannt. Selbst die Bienen brummten unruhig in ihren Stöcken und verzichteten beim Check-in auf die obligatorische Selbstverteidigung in Form schmerzhafter Stiche.
Die langwierige Rückreise quer durch Rostock und Wismar, denn die komfortable A 20 präsentierte sich zur damaligen Zeit erst auf dem Reißbrett, barg jedoch auch ihre Gefahren. Das bekamen wir sehr eindringlich am eigenen Leib zu spüren, als wir Hanna und Willi im Pferdeanhänger Richtung Dosenbek transportierten.
Mein Vater fuhr an diesem Morgen den Geländewagen, meine Großmutter fungierte als Beifahrerin, während ich selbst mir eine kleine Verschnaufpause gönnte und mich im Gefühl absoluter Sicherheit genießerisch auf der Rückbank ausstreckte. Der leistungsstarke Motor brummte monoton. Ansonsten herrschte Schweigen, denn mein Vater konzentrierte sich auf den starken Verkehr, während meine Großmutter ihren eigenen Gedanken nachhing.
Immer tiefer versank ich in Schlaf, träumte wohlig vor mich hin, bis mich jäh Omas plötzlicher Aufschrei und Vaters gewaltiges Fluchen aus meiner beschaulichen Ruhe rissen. Bevor ich mich überhaupt vom Rücksitz emporstemmen konnte, um mir einen Überblick über die offenbar brenzlige Situation zu verschaffen, gab es einen gewaltigen Knall, und ich landete ungebremst zwischen Vordersitzen und Rückbank auf dem harten Autoboden.
»Der hat doch glatt versucht, mit seinem Trabbi die ganze Kolonne zu überholen, und das auch noch in der Kurve«, stotterte mein Vater, ganz blass um die Nase. Mühsam, die schmerzenden Körperteile reibend, rappelte ich mich wieder auf, um vorsichtig die Lage zu peilen.
»Als ich ihn von vorn kommen sah, habe ich noch versucht, nach rechts auszuweichen, aber die Leitplanke ließ mir keinen Spielraum mehr«, fuhr mein Vater, wohl eher im Selbstgespräch, fort.
Da gab es nur eins, aussteigen und gucken. Der erste Eindruck war niederschmetternd. Der gesamte linke Kotflügel unseres Frontera war zu einem unförmigen Blechhaufen zusammengedrückt, der linke Vorderreifen war wie das eingefahrene Fahrwerk eines Flugzeugs unter den Motorblock geklappt. Von unserem rasanten Trabbi-Fahrer fehlte vorerst jede Spur. Nur einzelne Teile, hier eine Stoßstange, dort die Motorhaube, lagen verstreut auf der Straße. Sie wiesen jedoch zweifelsfrei den weiteren Weg, nämlich eine steile Böschung hinab. Menge und Zerlegungsgrad dieser Teile ließ Schlimmstes ahnen. Mit dem Erste-Hilfe-Koffer in der Hand, die eigenen leichten Blessuren vergessend, lief ich Richtung Böschung.
Doch wie groß war meine Überraschung und Erleichterung, als im selben Moment ein junger Mann den steilen Hang heraufkraxelte. Er blickte sich um, kratzte sich ausgiebig hinter dem Ohr, grinste mich, wenn auch verlegen, an und sprach den denkwürdigen Satz: »Ist Gott sei Dank ja nichts passiert.«
Es ist eben alles eine Frage der Perspektive!
In der Zwischenzeit liefen die Bauarbeiten auf unserem neuen Hof auf vollen Touren. Viele meiner Freunde aus dem fernen Vorpommern opferten Freizeit und Urlaub, um dem Wessi in seiner alten Heimat wieder ein bewohnbares Domizil zu schaffen. Eltern und Schwiegereltern waren beinahe Tag und Nacht im Einsatz, während meine Großmutter die große Mannschaft täglich mit Essen versorgte.
Hofplatz auskoffern und pflastern, Terrasse an legen, alte Wände niederreißen, neue ziehen, Isolie rung verbessern, Heizkörper setzen, neue Balken lagen einbauen, die Sanitäranlagen modernisieren, die gesamte Elektroverkabelung austauschen … Endlos ließe sich die Aufzählung fortsetzen. Haus und Hof glichen einem Schlachtfeld. Eines Abends stand mein Schwiegervater mit sorgenvoller Miene vor dem ganzen Chaos, schüttelte verzweifelt den Kopf, legte mir schwer seine Hand auf die Schulter und riet mir, halb im Scherz, halb im Ernst, zum To talabriss. »Nimm einfach eine Bombe, sprenge den Trümmerhaufen in die Luft und baue alles neu auf, sonst wirst du niemals fertig.«
Der Rat kam nicht von ungefähr, denn die Zeit drängte. Das Mobiliar stapelte sich in der Halle, und das feuchte, kühle Herbstwetter war nicht gerade dazu angetan, die Lebensdauer von Möbeln zu verlängern. Meine Frau und unsere Töchter hatten zwischenzeitlich Unterschlupf im Hause meiner Schwiegereltern gefunden, denn in den Räumlich keiten des Rentnerwohnheims hausten ja mein vor pommerscher Bautrupp und ich.
Zudem drängte neuer Familienzuwachs in Form erster ernsthafter Wehen bereits ungestüm darauf, endlich das Licht der Welt erblicken zu dürfen. So ganz konnten wir aber dem anspruchsvollen Zeit plan unserer dritten Tochter Freya dann doch nicht folgen, denn bereits am 30. November ließ sie Ärzten und Hebamme kaum eine Chance, helfend die Geburt zu begleiten. Ihrem ungestümen Wesen entsprechend, kam sie allen zuvor und forderte laut schreiend ihren Platz, sprich ihre Wiege, in unserem neuen Domizil.
Knapp vier Wochen später, zu Weihnachten 1997, war es dann endlich so weit. Wir zogen ein in unser Haus in Dosenbek, begleitet von den guten Wünschen unserer neuen Nachbarn, alter und neuer Freunde. Längst noch nicht alle Bauarbeiten waren erledigt, doch wir hatten ein Dach über dem Kopf, die Heizung funktionierte, und auch Kerzen sowie die Petroleumlampe hatten ausgedient. Unsere beiden Großen, Mareike und Annika, freuten sich über die neuen Kinderzimmer, und Freya schaukelte zufrieden in ihrer Wiege.
Rinder und Ponys standen, behaglich Heu und Silage kauend, in ihren großräumigen Boxen, und unsere Schäferhündin Fiona reckte sich wohlig in einer Ecke unserer Küche dicht neben dem Holzofen mit seinem lustig flackernden Feuer.
Draußen, im schneebedeckten Garten, suchten Rehe und Hasen nach den letzten Äpfeln und Birnen oder naschten an Himbeer- und Brombeerblättern. Selbst der Weihnachtsmann fand den Weg zu unserem Hof in Dosenbek, während vier Generationen von den Urgroßmüttern bis hin zu unseren Töchtern vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum saßen oder krabbelten.
Dankbar schaute ich hinaus in die weiße, stille Pracht. Aus Kirchbarkau klangen leise die Kirchenglocken herüber. Die Familie war wieder vereint, wir freundlich aufgenommen in der neuen Dorfgemeinschaft.
Nur mit der Jagd könnte es noch ein bisschen mehr werden, dachte ich ein wenig sehnsüchtig, als eine Sternschnuppe über den winterlichen Nachthimmel zischte. Hoffnungsvoll blickte ich ihr nach. Sollte das etwa ein Zeichen sein?
Der Eishirsch
Das alte Jahr verabschiedete sich mit milden Temperaturen, die die ohnehin geringe Schneedecke innerhalb kürzester Zeit schmelzen ließen. Doch am Neujahrstag fegte unbarmherziger Nordostwind über das Land, brachte eisige Kälte, allerdings keinen Schnee. Der Ackerboden gefror zu Stein, spiegelblankes Eis bedeckte die Seen, Teiche und Tümpel. Leider nicht nur diese, denn auch vor den Tränkebecken im Stall machte die grimmige Kälte nicht halt: Statt auf klares, plätscherndes Wasser starrte ich, und starrte vor allem das durstige Vieh, auf trübe Eisbrocken.
Da ich keinerlei Lust verspürte, morgens noch eine Stunde früher aufzustehen, um eimerweise Wasser in den Stall zu schleppen, fuhr ich schnurstracks zu meinem Freund Holger ins Nachbardorf. Er war stolzer Besitzer einer Heizschlange, hatte die Tierhaltung jedoch vor Kurzem aufgegeben.
Als ich auf den Hof fuhr, stand Holger vor einem lustig flackernden Lagerfeuer, über dem ein großer Topf hing. Er lachte mich fröhlich an, denn heraus ragten zwei Geweihstangen eines Geringen ohne jegliche Schaufelbildung.
»Mensch, Waidmannsheil, Holger. Wo hast du denn den Hirsch geschossen?«, fragte ich neugierig.
»In Nehmten, einem herrlichen Hochwildrevier, ganz idyllisch gelegen am Plöner See«, antwortete er mit verträumtem Blick.
Mein entsagungsvoller Stoßseufzer war wohl doch etwas zu deutlich, denn plötzlich schaute mich Holger prüfend an und sagte nachdenklich:»Na ja, einige weitere Knieper stehen noch auf dem Abschussplan. Wenn du willst, arrangiere ich ein Treffen mit dem Förster. Vielleicht gibt er dir auch einen Hirsch frei.«
Schon am nächsten Samstagmorgen schüttelte ich Hubertus Mackelanz vor dem reetgedeckten Forsthaus kräftig die Hand. Der drahtige Ostpreuße alten Schlages musterte mich erst einmal kritisch von oben bis unten.
»Kannst du denn einen abschusswürdigen Knieper überhaupt erkennen, wenn er dir vor die Büchse läuft?«, fragte er skeptisch, eingedenk seiner langjährigen Erfahrungen, die er mit den zahllosen Jagdgästen gesammelt hatte. Noch bevor ich entrüstet antworten konnte, kratzte er mit der nächsten Frage wenig einfühlsam an meiner Jägerehre. »Und deine Donnerbüchse schießt nicht um die Ecke?«
Verärgert begann ich mit meiner Protestrede:»Bisher …«
Weiter kam ich nicht. »Schon gut, komm heute Nachmittag gegen ein Uhr vorbei, dann werden wir ja sehen.«
Mit gemischten Gefühlen stand ich eine halbe Stunde früher als verabredet vor der Försterei und fühlte mich etwas alleingelassen, denn von meinem Jagdbegleiter war weit und breit nichts zu sehen. Dann horchte ich auf, in dem Stallgebäude hinter dem Forsthaus schnaubte und wieherte es. Neugierig marschierte ich um die Ecke und erblickte meinen Förster, wie er hingebungsvoll seine Pferde fütterte und immer wieder liebevoll mit Streicheleinheiten und freundlichen Worten bedachte. Erschreckt zuckte er zusammen, als er mich entdeckte.
»Kann ich mit anfassen?«, fragte ich schnell, um das Schweigen zu überbrücken.
»Die Pferde müssen noch eingestreut werden. Das Stroh liegt um die Ecke«, erwiderte er knapp, drehte sich um und verschwand im Haus.
Na, dann mal her mit dem Stroh, rein in die Pferdeboxen und den beiden in die Jahre gekommenen Stuten ein gemütliches Lager bereitet.
Urplötzlich stand Hubertus schmunzelnd hinter mir, bereits im grünen Lodenmantel und mit einem alten, zerknautschten Jagdhut auf dem Kopf.
»Das machst du aber nicht zum ersten Mal«, bemerkte er anerkennend. »Wenn du als Jäger genauso routiniert bist wie als Stallmeister, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Komm, steig ein, ich fahre dich zum Ansitz.«
Also hineingezwängt in den jagdgrünen, hochbetagten Lada Niva, und ab ging es über Stock und Stein, Berg und Tal. Dunkle Fichtendickungen wechselten sich ab mit Hochwald aus Buchen und Eichen, sanfte Ebenen mit uriger Hügellandschaft. Der Lada klapperte und schepperte, röhrte beim Erklimmen der steilen Hügel wie ein brunftiger Hirsch. Immer enger und schmaler schlängelte sich der Fahrweg den Hang empor und endete schließlich in einem kaum erkennbaren Pirschweg. Links und rechts blockierten schroffe, lehmige Erdwände die Autotüren, sodass ich mich bereits fragte, wie in aller Welt ich wohl zu neuen jagdlichen Taten schreiten sollte. Doch Hubertus wusste Rat.
»Ich wende mal eben den Wagen, und du steigst aus der Heckklappe aus.«
»Wenden? Wo denn, bitte schön?«, fragte ich ungläubig, denn an jeder Seite des Autos verblieben etwa 20 Zentimeter Spielraum.
»Ein Lada Niva schafft das«, konstatierte mein Outdoor-Spezialist und begann wie wild am Lenkrad zu kurbeln. Es folgte ein kraftvoller Tritt auf das Gaspedal. Der so gepeinigte Niva schoss rückwärts auf den Erdwall zu und kletterte buchstäblich an der steilen Wand empor.
Meine Nase machte um ein Haar Bekanntschaft mit der Windschutzscheibe, hätte nicht der kalte Lauf meines Repetierers den Aufprall abgefangen. Es knirschte, als Hubertus den ersten Gang einlegte, und nun ging es ab in die andere Richtung. Wie ein Hengst, der seine Stute beschlägt, hing der Geländewagen an der steilen Kante und bewies so eindrucksvoll, dass er diese Bezeichnung durchaus zu Recht trug. Meine Knie schlugen schmerzhaft gegen das Armaturenbrett, und schon wiederholte mein Jagdherr das ganze Prozedere.
Noch zwei- oder dreimal ging das so. Doch zum Glück wächst der Mensch ja an seinen Aufgaben, und so wurde ich immer geschickter darin, das vor- und rückwärtige Aufbäumen abzufangen. Irgendwann stand der Wagen endlich in Fahrtrichtung. Ich kletterte hinten heraus und wurde mit einem kräftigen »Waidmannsheil« entlassen.
Vorsichtig pirschte ich den Fußsteig Richtung Kanzel entlang, die, umgeben von einem kleinen Fichtenhain, auf einer leichten Kuppe stand. Sie bot einen herrlichen Blick auf die vor mir liegende Schlucht. Ein kleiner Bach plätscherte und gurgelte links neben mir in tieferen Regionen, alte, knorrige Eichen säumten das Ufer. Eine geradezu grandiose Szenerie, die ich sicherlich in vollen Zügen genossen hätte, wenn ich nicht meine Handschuhe und mein Sitzkissen nach der abenteuerlichen Wendeaktion im Auto vergessen hätte. Kalt wie Eis starrte mir das hölzerne Sitzbrett entgegen.
Zwar versuchte ich, den Lodenmantel so weit wie möglich unter die Beine zu schieben, doch auch diese Maßnahme brachte keinen merklichen Erfolg. Als die Kälte nicht mehr zu ertragen war, blieb nur eines: hoch mit dem Hintern und tapfer in Hockstellung ausharren, um Frostbeulen zu vermeiden. Haben Sie einmal versucht, längere Zeit in dieser Stellung auf einem Hochstand durchzuhalten? Ich kann Ihnen nur abraten. Gelenke und Muskeln werden es Ihnen danken.
Zu allem Überfluss musste ich die Hände an den Brettern des Hochstandes abstützen, um einigermaßen das Gleichgewicht halten zu können. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Mir froren die Finger ein.
Bei den verschiedenen gymnastischen Übungen, zu denen diese Lage mich zwang, knarrte und quietschte meine hohe Warte in allen möglichen Tonarten. Nur dem starken Nordostwind, der mir unbarmherzig ins Gesicht blies, hatte ich es zu verdanken, dass ich nicht sämtliches Wild in der Umgebung vergrämte. Schon türmten sich dunkle Wolken bedrohlich am Himmel auf, und noch bevor die Wintersonne endgültig versank, ließen erste Schneeflocken ahnen, was noch kommen würde.
Plötzlich, wie hingezaubert, stand ein einzelner Hirsch, ein junger Spießer, unter den Eichen und suchte in aller Ruhe nach den letzten Eicheln. Da, ein mächtiger Schaufler übersprang den Bachlauf und brachte erst einmal den Teenager auf Trab, weg von der ersehnten Äsung. Ihm folgten sechs weitere Hirsche aller Alters- und Größenklassen.
Nun spielte die Kälte keine Rolle mehr. Fest auf meinem Sitzbrett platziert, suchte ich mit dem Fernglas nach einem Knieper. Tatsächlich, zwei zerrissene Stangen ohne jede Schaufelbildung leuchteten mir unter den Eichen entgegen. Also in gewohnter Routine und Geschwindigkeit das Glas mit dem Repetierer getauscht, befahl der jägerische Verstand. Doch an der Ausführung haperte es diesmal, denn die Finger waren regelrecht vor Kälte erstarrt und ließen sich nur unter großen Schmerzen bewegen. Daher erst einmal pusten, schütteln und reiben. Alles blieb zwecklos. Langsam zog der starke Schaufler spitz von mir weg, am Bachlauf entlang, um die dahinter liegende Dickung zu erreichen.
Schon verschwand das mächtige Geweih mit den knorrigen Schaufeln zwischen den tief hängenden Ästen der Randfichten. Hektik stieg in mir auf, denn die anderen Hirsche würden zweifellos folgen. Richtig, nervös traten sie bereits auf der Stelle herum, äugten dem alten Haudegen in sichtlicher Aufbruchsstimmung hinterher.
Da löste sich ausgerechnet mein auserwählter Knieper aus dem Trupp und schickte sich an, endgültig aus meinem Blickfeld und damit aus der Reichweite meiner Kugel zu verschwinden. Die einmalige Chance löste sich erschreckend schnell in nichts auf.
Mit beiden Händen öffnete ich schwerfällig den Reißverschluss der Joppe und steckte beide Hände unter die Achseln. Es knisterte regelrecht in den Händen, doch die Starre wich. Schon lag die Waffe an der Schulter, und der Zeigefinger, wenngleich noch halb erstarrt, versagte mir nicht den Dienst.
Beim Aufbrechen denn floss mir der heiße Schweiß über die Hände, und Zigtausende Nadelstiche erweckten diese wieder richtig zum Leben. Alle Plage war vergessen, denn vor mir lag er – der Eishirsch.
Die Wohldkoppel
Das Frühjahr begann und damit das neue Jagdjahr. Auch mich lockte die Pirsch im erwachenden Maienwald. Was die Erfüllung meiner Sehnsüchte anging, sah es jedoch eher schlecht aus, denn mir fehlte schlichtweg die Jagdmöglichkeit.
Die Buschwindröschen verwandelten den Hochwald in ein weißes Blütenmeer, Buchen und Eichen zeigten, fast schüchtern, ein erstes zartes Grün. Rehwild und Hasen zogen begierig auf die Wiesen auf der Suche nach den ersten schmackhaften Wildkräutern. Alles lechzte nach Licht, Wärme und Sonne, nur mein Repetierer führte bekümmert ein Schattendasein im finsteren, verschlossenen Jagdschrank.
Dann kam er, der nicht erwartete, aber doch so ersehnte Anruf. »Brunner hier, grüß dich. Hast du vielleicht Interesse an einem Pirschbezirk in der Wohldkoppel? Einer der jetzigen Jäger zieht weg.Wenn du willst, kannst du für ihn einspringen.«
Mir stockte regelrecht der Atem. Ausgerechnet die Wohldkoppel sollte es sein, die Heimat meiner ersten jagdlichen Aktivitäten. Bereits als kleiner Junge war ich mit Großvater oder Onkel durch den etwa 30 Hektar umfassenden Hochwald gepirscht, hatte an dem großen Mutterbau mit seinen unzähligen Ein- und Ausfahrten auf Fuchs und Dachs gepasst.
Mit 14 Jahren brach ich nach einer kleinen Drückjagd unter strenger Anleitung meines Onkels mein erstes Stück Rehwild auf und schnitt mir dabei fürchterlich in den Handballen. Damit auch ja keiner meine Ungeschicklichkeit bemerkte, ballte ich, mit einem Lächeln auf den Lippen, die Hand krampfhaft zur Faust. Trotzdem blieb die Verletzung nicht unentdeckt, denn ich produzierte eine auf dem Weiß des Schnees nicht zu übersehende Blutspur.
Auch meine Mutter hinterließ in diesem Waldstück ihre Spuren. Gleich nach dem letzten Krieg holzte die britische Besatzungsmacht den größten Teil der hochschäftigen Buchen und knorrigen Eichen ab und verschiffte das hochwertige Holz Richtung England. Was blieb, kam einem Kahlschlag gleich. Dann begann der Wiederaufbau Deutschlands, und auch die Wohldkoppel sollte davon profitieren. Eine Vielzahl von Buchen- und Eichensetzlingen wartete begierig darauf, den Platz ihrer gemeuchelten Stammesgenossen einzunehmen.
Doch wer konnte diese beschwerliche Arbeit übernehmen? Noch herrschte ein akuter Männermangel, und die Frauen hatten alle Hände voll zu tun, Haus und Hof, Vieh und Äcker zu bewirtschaften und zu versorgen.
Kurzerhand wurden die Schulkinder der kleinen Dorfschule, darunter meine Mutter, vom Unterricht freigestellt und versenkten nun, anstatt sich mit Schreiben, Lesen oder Rechnen zu beschäftigen, die kleinen Schösslinge in die lehmige Erde. Angewandter Heimatkundeunterricht eben. Unnötig zu erwähnen, dass der Lehrer selbstverständlich seiner Aufsichtspflicht, aber auch nur dieser, gewissenhaft nachkam.
Als ich dann, über dreißig Jahre später, das erste Mal als Jäger meinen Fuß in diesen Wald setzte, waren alle Wunden, die der Krieg und die Besatzungszeit geschlagen hatten, längst verheilt. Mit Macht krallten die Eichen und Buchen ihre Wurzeln in den Lehmboden, reckten stolz die Kronen in den Himmel. Und jedes Mal, wenn ich diesen Hochwald betrete, frage ich mich, welche der prachtvollen Bäume wohl durch die Hand meiner Mutter hier ihren Platz gefunden haben.
Gehörte die Wohldkoppel in früheren Zeiten als Enklave inmitten von Wiesen und Äckern zur Gemeindejagd Schönhorst, führten der Ankauf und die Aufforstung anliegender Flächen durch den vorausschauenden Förster Herbert Brunner Ende der Achtzigerjahre quasi zu einer Verselbstständigung, denn mit weit über 100 Hektar entwickelte sie sich jetzt zur Eigenjagd. Dank Brunners kluger Planung entstand ein vielfältiger Jungwald mit Ahorn, Kirsche, Buche, Eiche, Esche und Erle. Douglasien- und Lärchenhaine sorgten für zusätzliche Dickungskomplexe. Kleine Wiesen und Feuchtbiotope boten Amphibien und Niederwild einen attraktiven Lebensraum, Schutz und Nahrung. Stille Winkel und die hügelige Landschaft garantierten dem Wild Ruhezonen und Deckung.
Und all dies befand sich keine zehn Fahrminuten von meiner Haustür entfernt.
Ich denke, Sie können nun verstehen, warum mir der Atem stockte, als mir Herbert Brunner dieses Angebot unterbreitete. Teilen Sie in den folgenden Kapiteln mit mir Erfolg und Misserfolg, Freud und Leid in meinem kleinen jagdlichen Paradies, der Wohldkoppel.
Fionas letzte Heldentat
Vermutlich erinnern sich von den Leserinnen und Lesern meines Buches Frische Fährte so manche an unsere Fiona. Selbstverständlich begleitete uns die mit ihrer tiefschwarzen Färbung fast unheimlich wirkende Schäferhündin auch zurück nach Schleswig-Holstein und bewachte fortan unser Gehöft in Dosenbek.
Auch hier störte sie die Handwerker immer wieder bei der Arbeit, indem sie kleine und kleinste Stöckchen auf deren Stiefelspitzen legte, in der Hoffnung, sie damit zum stundenlangen Stöckchenwerfen zu animieren. Ansonsten hielt sie sich treu und brav an die Grenzen des Grundstücks, das immerhin knapp 5000 Quadratmeter umfasste und damit genug Platz für Bewachungsaufgaben aller Art bot. Diese für Hundebesitzer so angenehme Gewohnheit unterbrach sie nur, dafür aber in schönster Regelmäßigkeit, wenn sie läufig wurde und sich, aus Hundesicht verständlich, nach männlicher Nähe sehnte.
Dabei bewies sie, das muss man ihr lassen, durchaus Geschmack. Denn die um diese Zeit herumstreunenden Dorfköter unbekannter Herkunft und Abstammung würdigte sie keines Blickes, biss sie regelrecht ab. Der Auserkorene, ein prachtvoller Dalmatinerrüde, wohnte zwei Gehöfte weiter, Luftlinie etwa 500 Meter entfernt. Er umgarnte sie in seiner charmanten, man möchte fast sagen unaufdringlichen Art und Weise. Wir ließen es jedoch nie zum Äußersten kommen, denn zum einen zählte Fiona mit ihren zehn Lenzen bereits zu den betagteren Damen und zum anderen bot diese Mischung keinerlei Hoffnung auf zukünftige züchterische Ehren. So blieb diese große Liebe unerfüllt und damit für die Betroffene ein letztendlich tragisches Kapitel.
Zu dieser Zeit brach bei unserer Freya, sie muss etwa zwei bis drei Jahre alt gewesen sein, der ungezügelte Bewegungsdrang in seiner ganzen Dynamik durch. Sie lief, so schnell sie ihre Beinchen tragen konnten, kreuz und quer über den Rasen – und leider auch durch den Gemüsegarten. Die mühsam ausgelegten Erbsen-, Bohnen- und Karottensamen wurden einer eingehenden Inspektion unterzogen und fanden sich, zur Freude der Ringeltauben, alsbald mund- oder vielmehr schnabelgerecht breit verstreut auf dem Ackerboden wieder. Wenn es ihr auf zwei Beinen nicht schnell genug voranging, benutzte die Kleine einfach die Hände mit, und auf allen Vieren, sozusagen im Allradbetrieb, ging es in raketengleichem Tempo auf Erkundungstour über unser Grundstück.
Zudem entwickelte sie für ihr zartes Alter bereits einen beachtlichen Forscherdrang. Er bezog sich, weil diese eben schnell zu erwischen waren, insbesondere auf alle möglichen Spinnen- und Krabbeltiere. Nichts, aber auch gar nichts, was sich auch nur ansatzweise in ihre Nähe wagte, war vor ihr sicher. Ein schneller Griff, und das Objekt ihrer Begierde wurde befühlt, begutachtet, betastet, beobachtet und zu guter Letzt verkostet.
Diese abschließende Prüfung auf Essbarkeit und damit Verdaulichkeit führte besonders bei unserer damaligen Kinderärztin zu größten Irritationen. Ein der Windel entnommenes, nicht identifizierbares Etwas sorgte für die wildesten Spekulationen, mit welchen hochinfektiösen Keimträgern das arme Kind wohl verseucht sei. Erst ein eher zufällig zu Rate gezogener Tierarzt – er sollte eigentlich eine unserer Kühe auf Trächtigkeit untersuchen – erkannte den Tausendfüßler mit sicherem Blick und wischte alle Bedenken beiseite.
»Einem gesunden Kind kann so ein bisschen zusätzliches Eiweiß nicht schaden«, lautete seine beruhigende Beurteilung der Lage.
Nun, unsere Freya war und ist ein robustes, kerngesundes Mädel, und sie war vermutlich die Einzige, die über den ganzen Zirkus, den der kleine Energiehappen verursachte, innerlich den Kopf schüttelte. Unbeeindruckt frönte sie weiter ihren biologischen Exkursionen und Experimenten und scheute sich dabei nicht, auch sehr viel größere Tiere ohne jeglichen Respekt genauestens unter die Lupe zu nehmen.
Ich erinnere mich dabei an einen sonnigen, aber frostigen Wintertag, der mir geradezu ideal schien, den Kuhstall zu misten. Um freie Bahn zu haben, jagte ich unsere überschaubare Ammenkuhherde auf die kleine Hauskoppel. Die Tiere nutzten die Gelegenheit, sich in der klaren Winterluft ordentlich Bewegung zu verschaffen, und stürmten ausgelassen muhend und mit aufgewickeltem Schwanz kreuz und quer über die gefrorene Wiese. Freya wuselte die ganze Zeit immer in meiner Nähe herum, während ich eine Schubkarre nach der anderen Richtung Misthaufen schob.
Plötzlich fiel mir die Stille auf, die mich mit einem Mal umgab. Kein wuselndes Kind mehr, kein Muhen oder Blöken von der Koppel, nur völlige Ruhe und Schweigen. Einer inneren Eingebung folgend schaute ich um die Stallecke auf die Wiese. Mir stockte der Atem. Lag doch unsere Freya unter einer der Kühe und untersuchte in höchster Konzentration das Euter. Die Kuh stand wie erstarrt, nicht einmal die lange Schwanzquaste pendelte hin und her, während die restliche Herde sich neugierig rund um den Ort des Geschehens versammelt hatte.
Ein einziger Tritt hätte genügt, um unserer Tochter schwerste Verletzungen zuzufügen, doch das Tier rührte sich nicht. Erst als ich Freya mit List und Tücke vom Ort ihres Interesses fortgelockt hatte, begann das wilde Toben von Neuem. Überflüssig, Ihnen meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben.
Bei so viel Temperament und Tatendrang konnte es nicht ausbleiben, dass Freya früher oder später auch mit Wild in Berührung kam, und das, wie soll es anders sein, auf dramatische Weise.
Das Mädchen spielte an diesem Nachmittag in den ersten wärmenden Sonnenstrahlen des zeitigen Frühlings auf dem Sandhaufen vor dem Haus. Fiona lag, wie so oft, neben ihr und ließ es in stoischer Ruhe über sich ergehen, wenn sie an den Ohren gezogen oder am Bein gerissen wurde. Meine Frau und ich nutzten das schöne Wetter für erste Gartenarbeiten. Zwischenzeitliche Kontrollblicke Richtung Sandhaufen fielen beruhigend aus, denn Freya buddelte und schaufelte, was das Zeug hielt.
Nur Augenblicke später jedoch fanden wir den Ort des Straßen- und Wegebaus verlassen vor. Erste Rufe nach Kind und Hund blieben ergebnislos, die erweiterte Suche auf dem ganzen Grundstück führte ebenfalls zu keinem Ergebnis. Auch im Haus fanden wir von den beiden keine Spur. Es dämmerte bereits. Hektik und Nervosität keimten auf. Wo, um Himmels Willen, waren sie geblieben? Da half nur eines, ausschwärmen und suchen.
Während meine Frau den Weg Richtung Dorf einschlug, marschierte ich etwa dreihundert Meter über das mit Weizensaat bestandene Ackerland, um zum sogenannten Viehteich zu gelangen. Das ist ein mit uralten Eichen und allerlei Buschwerk eingefasstes, etwa 14 Hektar großes Gewässer. Schon wollte ich umkehren, da ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, ein dreijähriges Mädchen könne diesen langen Weg über Stock und Stein in so kurzer Zeit überwinden.
Aber Halt! Bellte dort unten nicht ein Hund? Ich blieb stehen und lauschte.
Tatsächlich! Wütendes Bellen und abgrundtiefes Knurren drang vom Viehteich herüber. Fiona!
Ich lief, was meine Beine hergaben, erreichte schon die ersten knorrigen Eichen und rief, ja brüllte aus Leibeskräften. Dazwischen drang Freyas aufgeregtes, erschrecktes Weinen an mein Ohr.
Endlich gelangte ich an den kleinen Abhang, der zum Wasser führte, und sprang mit einem Riesensatz hinunter. Ich rutschte aus und sauste auf dem Hosenboden durch die Büsche. Wildes Blasen und Brechen empfing mich, dazwischen Quieken, Heulen und Fionas Bellen.
Eine große, kohlrabenschwarze Bache nebst gestreiftem Nachwuchs schoss regelrecht an mir vorbei und flüchtete in den dämmerigen Wald. Ich ließ mich neben meine Tochter fallen, nahm sie erleichtert in den Arm und wischte ihr die Tränen aus dem verheulten Gesicht. Schwer hechelnd sank auch Fiona neben mir zu Boden, am Ende ihrer Kräfte. Mit wackeligen Knien, meine Freya auf dem Arm, wankte ich nach Hause, Fiona steifbeinig und zittrig neben mir.
Was nun wirklich den Angriff der Bache ausgelöst hatte, weiß ich bis heute nicht. Vermutlich gerieten meine beiden Forschungsreisenden zwischen sie und ihre Frischlinge.
Fiona jedoch war der große Star des Tages. Sie wurde umsorgt und gepflegt, geklopft und gestriegelt. Fast huldvoll nahm sie all die Zuwendungen entgegen, als wüsste sie, was sie geleistet hatte.
Es war ihre letzte Heldentat. Ein knappes halbes Jahr später beendete eine schwere Lähmung ihr ausgefülltes Hundeleben. Elf Jahre, wie viel und doch wie wenig.
Der schwarze Hirsch
Obwohl die Wohldkoppel mit ihren vielen eingesprengten Wiesen, der Vielzahl wilder Apfelbäume, dem Hochwald und den Deckung bietenden Anpflanzungen das Damwild magisch anziehen müsste, war und ist diese Wildart immer nur Wechselwild geblieben. Ab und zu stellte sich für wenige Tage ein Spießer oder Knieper ein oder ein kleiner Trupp Kahlwild. Ältere Hirsche dagegen durchzogen meist während der Brunft das Revier, um nach ein bis zwei Tagen wieder zu verschwinden. Wie Waldgeister tauchten sie plötzlich und unerwartet an den unmöglichsten Stellen auf, um sich schattengleich zwischen jungen Eichen und Buchen scheinbar in Nichts aufzulösen.
Für den Jäger bedeutet dies eine beständige Quelle höchster Spannung, weiß man doch nie, ob sich nicht plötzlich ein Hirschhaupt aus dem Grün der jungen Fichten hervorschiebt. Ich werde in einem weiteren Kapitel noch über die eine oder andere erfreuliche Hirschbegegnung zu berichten haben. Seien Sie gespannt!
Der Hirsch, von dem ich in diesem Kapitel erzählen möchte, wich allerdings von den oben beschriebenen Verhaltensweisen erheblich ab, wobei alles noch wie gewohnt begann.
Eines Abends im September machte ich es mir auf der Kanzel an der Fuchswiese gemütlich, um auf Rehwild zu passen. Stellen Sie sich bitte unter der Fuchswiese einen etwa 150 Meter langen, 50 Meter breiten Wiesenstreifen vor, rings von Erlen- und Lärchenkulturen umgeben. In der Mitte schlängelt sich in Längsrichtung ein kleiner Graben. An der Stirnseite dieses Wiesenstreifens, an der auch der Waldweg entlangführte, hatte ich meine Kanzel platziert.
Die Herbstsonne schien milde, kaum ein Lüftchen regte sich. Zwei Kohlmeisen kletterten munter durch die noch tiefgrünen Lärchenzweige, pickten hier und da nach kleinen Insekten. Eine Drossel scharrte hektisch in dem trockenen Laub unter meinem Hochsitz und suchte nach Würmern. Eine perfekte Idylle also – bis ein vorwitziger Zaunkönig ausgerechnet auf die Idee kaum, durch die geöffneten Fenster das Innere der Kanzel genauer zu untersuchen. Fröhlich flatternd nahm er Kurs auf die Einflugschneise und stieß förmlich mit mir zusammen. Wer von uns beiden seine Augen vor Schreck am weitesten aufriss, weiß ich nicht mehr. Wer jedoch nach dieser Schrecksekunde am lautesten schimpfte und zeterte, dessen kann ich mich noch sehr genau entsinnen. Ich war es zumindest nicht! Mein gefiederter Freund aber stürzte sich förmlich aus der Fensterluke, flüchtete in die nächste Schutz bietende Lärche hinein und stimmte ein fürchterliches Zeter und Mordio an. Obwohl über die genauen Hintergründe nicht informiert, stimmte die Vogelwelt der gesamten Umgebung vorsorglich in die Schimpftirade ein. Das hatte mir gerade noch gefehlt! Auf austretendes Wild brauchte ich nach diesem Großalarm nicht mehr zu hoffen.
Das dachte ich jedenfalls und steckte mir frustriert eine Zigarette an. Doch kaum brannte der Glimmstängel, trat mitten auf die Wiese, ohne sich um das ganze Vogelspektakel auch nur im Mindesten zu kümmern, ein kohlrabenschwarzer Damspießer aus und begann sofort gierig zu äsen.
Mit allem hatte ich gerechnet, damit aber bestimmt nicht. Zwar können beim Damwild die verschiedensten Farbvarianten auftreten, von weiß über wildfarben bis hin zum dunklen Typus, doch hier in der Wohldkoppel war mir so ein schwarzes Stück noch nicht untergekommen. Entsprechend hektisch glitt das Fernglas an die Augen. Mehr als lauscherhohe Spieße mit gut ausgeprägten Rosen zeigte der junge Zukunftshirsch. Also nichts für die Büchse.
Doch halt, was war das? Der linke Lauscher wirkte wie zweigeteilt. Richtig, ein langer Riss, der vielleicht bei einer hastigen Flucht durch einen Stacheldraht entstanden war, teilte das Ohr regelrecht in zwei Teile.
Während ich andächtig meinen schwarzen Hirsch und sein unverwechselbares Kennzeichen beobachtete und langsam die Dämmerung hereinbrach, rauschte es plötzlich ganz fürchterlich in der Lärchenschonung. Der Spießer zuckte erschrocken zusammen, warf auf und verschwand in hohen Fluchten in den gegenüberliegenden Erlen.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books im Rosenheimer Verlagshaus
Auf dem Jägerstand
eISBN 978-3-475-54397-5 (epub)
Kurt J. Jaeger erzählt heitere und spannende Jagdgeschichten. Er hat als Revierpächter und Jagdaufseher schon viel erlebt. Aus diesem reichen Erfahrungsschatz berichtet er in seinem Buch. Etwa wie nach einem erfolgreichen Pirschgang das erlegte Bockkitz aus einer Felsspalte befreit werden muss. Von der Jagd mit Flinten auf Wildschweine in Afrika, die nicht nur wegen des unbekannten Geländes zu einem echten Abenteuer wird. Von einer Drückjagd, mit ihren strengen Regeln und wie dabei ein Rucksack verloren geht, der später unverhofft wieder auftaucht. Kurt J. Jaegers Geschichten sind teils komisch, teils bewegend, aber immer authentisch.
Und immer lockt das Wild
eISBN 978-3-475-54398-2 (epub)
Als langjähriger Revierpächter und Jagdaufseher hat Kurt J. Jaeger viel erlebt in Wald und Wiese. Er erzählt humorvoll von den Tücken des Jägerlebens sowie von lustigen Erlebnissen aus seinem Bekanntenkreis. Ein Geißbock irrt durch die Wälder, vertreibt das Wild und sorgt sogar nach seinem Abschuss für Aufregung. Empörung geht durch eine ländliche Gemeinde, als ein Gast ihren Steinbock erlegt. Besserwisserische Jagdgäste und Leichtsinn unter den Kollegen führen zu kleinen und größeren Pannen. Ebenso erfährt man von den Folgen des Abschusses eines Steinadlers. Kurt J. Jaegers Geschichten sind voller Frohsinn und Witz und vermitteln dennoch die Ernsthaftigkeit der Jagd.
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com