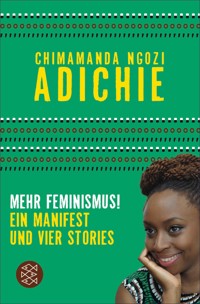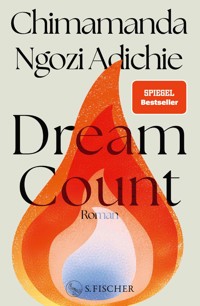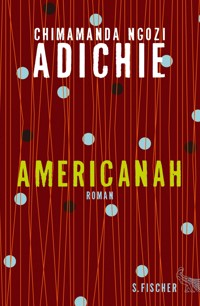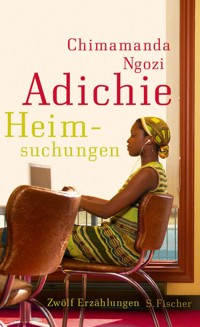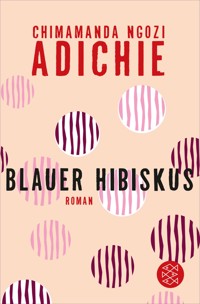
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Blauer Hibiskus« ist der erste Roman der Bestsellerautorin Chimamanda Ngozi Adichie - ein Meilenstein junger Weltliteratur. Schon mit diesem Roman war die Schriftstellerin für den Man-Booker-Preis nominiert. Das Haus von Kambilis Familie liegt inmitten von Hibiskus, Tempelbäumen und hohen Mauern, die Welt dahinter ist das von politischen Unruhen geprägte Nigeria. Mit sanfter, eindringlicher Stimme erzählt die 15-jährige Kambili von dem Jahr, in dem ihr Land im Terror versank, ihre Familie auseinanderfiel und ihre Kindheit zu Ende ging. Der erste vielgelobte Roman Adichies, verzweifelt schön und ganz gegenwartsnah.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Chimamanda Ngozi Adichie
Blauer Hibiskus
Roman
Über dieses Buch
Chimamanda Ngozi Adichies Debüt - ein Meilenstein junger Weltliteratur
Das Haus von Kambilis Familie liegt inmitten von Hibiskus, Tempelbäumen und hohen Mauern, die Welt dahinter ist das von politischen Unruhen geprägte Nigeria. Mit sanfter, eindringlicher Stimme erzählt die 15-jährige Kambili von dem Jahr, in dem ihr Land im Terror versank, ihre Familie auseinanderfiel und ihre Kindheit zuende ging. Der erste vielgelobte Roman Adichies, verzweifelt schön und ganz gegenwartsnah.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Chimamanda Ngozi Adichie ist eine der großen jungen Stimmen der Weltliteratur. Ihr Roman ›Blauer Hibiskus‹ war für den Booker-Preis nominiert, ›Die Hälfte der Sonne‹ erhielt den Orange Prize for Fiction 2007. Insgesamt wurde ihr Werk in 37 Sprachen übertragen und sie steht auf der renommierten Liste der »20 besten Schriftsteller unter 40« des »New Yorker«. Für ›Americanah‹, von der »New York Times« zu einem der fünf besten Romane von 2013 gewählt, erhielt sie den Heartland Prize for Fiction und den National Book Critics Circle Award. Adichie wurde 1977 in Nigeria geboren und lebt heute in Lagos und in den USA.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel Purple Hibiscus bei Algonquin Books of Chapel Hill, New York
© 2003 Chimamanda Ngozi Adichie
© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Coverabbildung: buxdesign, München
ISBN 978-3-10-403335-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Wenn Götter vom Himmel fallen
Als unsere Seelen miteinander sprachen
In den folgenden Wochen [...]
Jedes Mal, wenn ich [...]
In den Augen der [...]
Tante Ifeoma kam am [...]
Papa fuhr uns zur [...]
Während der Fahrt schaute [...]
In Tante Ifeomas Haus [...]
Papa-Nnukwu war vor allen [...]
An dem Tag, als [...]
Regen klatschte auf den [...]
Das grüne Schild vor [...]
Götter in Trümmern
Der Wind, der dem [...]
Ich saß mit Jaja [...]
Eine andere Stille
Danksagung
Glossar
Für
Professor James Nwoye Adichie
und
Mrs Grace Ifeoma Adichie
meine Eltern, meine Helden, ndi o ga-adili mma.
Wenn Götter vom Himmel fallen
Palmsonntag
Bei uns zu Hause begann alles in die Brüche zu gehen, als mein Bruder Jaja nicht bei der Kommunion war und mein Vater sein schweres Messbuch durch das Zimmer schleuderte und die Keramikfiguren auf der Etagere zerbrach. Wir kamen gerade von der Kirche. Mama legte die frischen Palmzweige, die noch feucht vom Weihwasser waren, auf den Esstisch und ging nach oben, um sich umzuziehen. Später würde sie die Zweige zu schweren Kreuzen binden und sie neben unser goldgerahmtes Familienfoto an die Wand hängen. Dort blieben sie bis Aschermittwoch; dann trugen wir sie in die Kirche, wo sie zu Asche verbrannt wurden. Papa half jedes Jahr beim Austeilen der Aschekreuze, wie die anderen Laienbrüder in einem langen, grauen Gewand. Seine Reihe kam immer am langsamsten voran, weil er mit seinem ascheverschmierten Daumen besonders fest auf jede Stirn drückte, um ein perfektes Kreuz zu malen, und dabei langsam und bedeutungsvoll jedes einzelne Wort betonte: »Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren.«
Papa saß bei der Messe immer in der ersten Reihe, gleich neben dem Gang, und Mama, Jaja und ich saßen neben ihm. Er war der Erste, der zur Kommunion ging. Um die Hostie zu empfangen, knieten die meisten Leute nicht vor dem Marmoraltar und der lebensgroßen Statue der blonden Jungfrau Maria nieder, aber mein Vater schon. Er kniff die Augen so fest zusammen, dass sein Gesicht sich zu einer starren Grimasse verzog, und streckte dabei die Zunge heraus, so weit er nur konnte. Anschließend lehnte er sich in seiner Kirchenbank zurück und sah zu, wie die übrigen Gemeindemitglieder zum Altar pilgerten, die Handflächen aufeinandergepresst und senkrecht nach oben gestreckt, als müssten sie einen auf den Rand gestellten Teller festhalten. So hatte es ihnen Pater Benedict beigebracht. Obwohl Pater Benedict schon sieben Jahre in St. Agnes war, nannten ihn die Leute immer noch »unseren neuen Priester«. Vielleicht hätten sie das nicht getan, wenn er nicht weiß gewesen wäre. Er sah einfach immer noch aus wie neu. Die Haut seines Gesichts, das die Farbe von Kondensmilch und einer aufgeschnittenen Sauer-Annone hatte, war während dieser sieben Jahre im glutheißen Harmattan-Wind Nigerias kein bisschen braun geworden. Seine englische Nase war genauso verkniffen und schmal, wie sie es immer gewesen war, dieselbe Nase, von der ich damals, als er in Enugu eintraf, befürchtet hatte, er würde nicht genügend Luft durch sie bekommen. Pater Benedict hatte in der Gemeinde so manches umgekrempelt. Zum Beispiel durften das Credo und das Kyrie nur in Latein gesprochen werden, und Igbo, unsere Muttersprache, war verboten. Auch das Händeklatschen sollte auf ein Minimum beschränkt sein, um die Feierlichkeit der Messe nicht zu beeinträchtigen. Immerhin erlaubte er uns, die Opfergebete auf Igbo zu singen; er nannte sie »Eingeborenenlieder«, und wenn er »Eingeborene« sagte, verzogen sich die Winkel seines schmalen, geraden Mundes nach unten und bildeten ein umgedrehtes U. Während seiner Predigten nahm Pater Benedict meistens Bezug auf den Papst, auf Papa und auf Jesus – in dieser Reihenfolge. Papas Beispiel benutzte er, um das Evangelium zu veranschaulichen. »Wenn wir unser Licht leuchten lassen vor allen Menschen, so tun wir es in Gedenken an den Einzug Christi in Jerusalem«, sagte er an diesem Palmsonntag. »Seht euch Bruder Eugene an. Er hätte es nach dem Putsch so machen können wie die anderen bedeutenden Männer in diesem Land. Er hätte beschließen können, zu Hause zu bleiben und nichts zu tun, damit die neue Regierung sich nicht in seine Geschäfte einmischt. Er aber nutzte den Standard, um der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen, obwohl das für die Zeitung den Verlust von Anzeigen bedeutete. Bruder Eugene trat für die Freiheit ein. Wie viele von uns sind aufgestanden und haben für die Wahrheit gekämpft? Wie viele von uns haben des glorreichen Einzugs in Jerusalem gedacht?«
Die Gemeindemitglieder sagten »Ja« oder »Gott segne ihn« oder »Amen«, aber nicht zu laut, damit es nicht klang wie bei den Pfingstgemeinden, die überall aus dem Boden schossen wie die Pilze; dann hörten sie wieder leise und aufmerksam zu. Sogar die Babys hörten auf zu brüllen, als ob auch sie dem Pater lauschten. An manchen Sonntagen hörte die Gemeinde sogar aufmerksam zu, wenn Pater Benedict über Sachen redete, die schon alle wussten, zum Beispiel, dass Papa die größte Geldsumme für den Peterspfennig und für St. Vincent de Paul gespendet hatte. Oder dass er die Kartons mit Messwein bezahlt hatte oder die neuen Öfen im Kloster, wo die Ehrwürdigen Schwestern die Hostien buken, oder den neuen Flügel des St.-Agnes-Krankenhauses, wo Pater Benedict immer die Letzte Ölung verabreichte. Und ich saß dann neben Jaja, die Knie zusammengepresst, und versuchte, ein ausdrucksloses Gesicht zu machen, damit man nicht sah, wie stolz ich war. Papa sagte immer, dass Bescheidenheit sehr wichtig ist.
Auch Papas Gesicht war ausdruckslos, wenn ich ihn anschaute, wie auf dem Foto in der Zeitung, nachdem Amnesty World ihm einen Menschenrechtspreis verliehen hatte. Er hatte nur dieses eine Mal erlaubt, dass in seiner Zeitung etwas über ihn geschrieben wurde. Sein Chefredakteur, Ade Coker, hatte darauf bestanden und gesagt, Papa habe es verdient, er sei zu bescheiden. Das hatten Jaja und ich von Mama gehört; Papa sagte uns solche Sachen nicht. Das ausdruckslose Gesicht behielt er, bis Pater Benedict seine Predigt beendet hatte und es Zeit für die Kommunion war. Wenn er dann das Sakrament empfangen hatte, lehnte er sich zurück und sah zu, wie die Gemeindemitglieder nach vorne zum Altar gingen, und nach der Messe berichtete er Pater Benedict mit ernster Miene, wenn jemand an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen nicht zur Kommunion ging. Er ermutigte Pater Benedict, sich um diese verlorenen Schafe zu kümmern und sie in die Gemeinde zurückzuholen; denn nur eine Todsünde konnte schuld daran sein, wenn jemand zwei Sonntage hintereinander die Kommunion ausließ.
An diesem Palmsonntag, an dem alles anders wurde, sah also Papa, dass Jaja nicht zum Altar ging, und haute mit seinem ledergebundenen Messbuch, aus dem rote und grüne Lesebändchen hingen, auf den Esstisch, als wir nach Hause kamen. Der Tisch war aus Glas, aus schwerem Glas. Er wackelte, ebenso wie die Palmzweige, die darauf lagen.
»Jaja, du bist nicht zur Kommunion gegangen«, sagte Papa leise. Es war fast eine Frage.
Jaja blickte auf den Tisch hinab, als spräche er zu dem Messbuch. »Von der Waffel kriege ich schlechten Atem.«
Ich starrte Jaja an. War bei ihm eine Schraube locker? Papa bestand darauf, dass wir Hostie sagten, weil »Hostie« das Wesen des Leibes Christi, seine Heiligkeit, am besten ausdrückte. »Waffel« war zu weltlich, denn Waffeln waren etwas, das in Papas Fabriken hergestellt wurde – Schokowaffeln, Bananenwaffeln, ein Gebäck eben, das die Leute ihren Kindern als Belohnung gaben, wenn es etwas Besseres sein sollte als Kekse.
»Und außerdem wird mir immer ganz schlecht, wenn der Priester mich am Mund berührt«, sagte Jaja. Er wusste, dass ich ihn ansah, dass meine erschrockenen Augen ihn anflehten, still zu sein, aber er schaute nicht zu mir her.
»Es ist der Leib unseres Herrn.« Papas Stimme war leise, sehr leise. Sein Gesicht war zwar schon ganz aufgedunsen und mit eitergefüllten Pusteln bedeckt, aber jetzt schien es noch mehr anzuschwellen. »Du kannst nicht einfach aufhören, den Leib unseres Herrn zu empfangen. Das bedeutet den Tod, und das weißt du.«
»Dann sterbe ich eben.« Vor Angst hatten Jajas Augen die Farbe von Teer angenommen, aber jetzt blickte er Papa direkt ins Gesicht. »Dann sterbe ich eben, Papa.«
Papa schaute sich rasch im Zimmer um, als suchte er nach dem Beweis dafür, dass etwas von der hohen Decke gefallen war, etwas, von dem er nie gedacht hatte, es könnte herunterfallen. Dann nahm er das Messbuch und warf es quer durch den Raum nach Jaja. An Jaja flog es vorbei, aber es traf die Glasetagere, die Mama so oft polierte. Es zertrümmerte das obere Bord, schleuderte die cremefarbenen, fingergroßen Balletttänzerinnen aus Keramik, die sich in allen möglichen Positionen verrenkten, auf den harten Boden und landete ebenfalls dort. Vielmehr landete es auf den vielen Scherben. Und da lag es nun, ein wuchtiges, ledergebundenes Messbuch mit allen Lesungen für die drei Zyklen des Kirchenjahres.
Jaja rührte sich nicht. Papa schwankte von Seite zu Seite. Ich stand an der Tür und beobachtete sie. Der Deckenventilator drehte und drehte sich, und die Glühbirnen, die daran befestigt waren, schlugen klirrend aneinander. Dann kam Mama in ihren Gummislippern herein, die leise, klatschende Geräusche auf dem Marmorboden machten. Sie hatte ihr münzbesticktes Sonntagswickeltuch und die Bluse mit den Puffärmeln ausgezogen und trug jetzt ein schlichtes buntgemustertes Tuch, locker an der Taille zugebunden, und das weiße T-Shirt, das sie jeden zweiten Tag anhatte. Es war ein Andenken an ein spirituelles Exerzitium, an dem sie und Papa teilgenommen hatten; die Worte GOTT IST LIEBE standen in schiefen Buchstaben über ihren schweren Brüsten. Sie starrte auf die Keramikscherben auf dem Boden, kniete nieder und begann sie mit bloßen Händen aufzusammeln.
Nur das Surren des Ventilators, der noch immer durch die Luft pflügte, unterbrach die Stille. Obwohl unser geräumiges Esszimmer in ein noch größeres Wohnzimmer mündete, hatte ich das Gefühl, zu ersticken. Die eierschalenfarbenen Wände mit den gerahmten Fotos von Großvater schienen langsam auf mich zuzukommen, mich zu bedrängen. Sogar der Esstisch aus Glas bewegte sich auf mich zu.
»Nne, ngwa. Geh hoch und zieh dich um«, sagte meine Mutter zu mir. Ich erschrak, obwohl ihre Worte auf Igbo ruhig und besänftigend klangen. Im selben Atemzug, ohne Pause, sagte sie zu Papa: »Dein Tee wird kalt«, und zu Jaja: »Komm und hilf mir, biko.«
Papa setzte sich an den Tisch und goss sich aus dem Service mit den Bordüren aus rosa Blümchen Tee ein. Ich wartete darauf, dass er Jaja und mich dazu aufforderte, einen Schluck davon zu nehmen, so wie er das immer tat. Er nannte das einen Schluck der Liebe, weil man die kleinen Dinge, die man liebt, mit den Personen teilt, die man liebt. Nimm einen Schluck der Liebe, sagte er dann, und Jaja würde als Erster trinken. Dann würde ich die Tasse in beide Hände nehmen und sie an meine Lippen heben. Ein Schluck. Der Tee war immer zu heiß, immer verbrannte ich mir den Mund, und wenn es zum Mittagessen etwas Scharfes gab, brannte es noch mehr auf meiner wunden Zunge. Aber das machte nichts, weil ich wusste, wenn der Tee mir auf der Zunge brannte, dann brannte er auch Papas Liebe in mich hinein. Heute jedoch sagte Papa nicht: Nimm einen Schluck der Liebe; er sagte gar nichts, während ich ihm zusah, wie er die Tasse an seine Lippen hob.
Jaja kniete neben Mama nieder, formte aus dem Kirchenblättchen, das er in der Hand hielt, eine flache Kehrschaufel und legte eine der scharfkantigen Scherben darauf. »Sei vorsichtig, Mama, sonst schneidest du dich in die Finger«, sagte er.
Ich zog an einem der kleinen Zöpfe, die unter meinem schwarzen Kirchenschal verborgen waren, um sicherzugehen, dass ich nicht träumte. Warum verhielten sich Jaja und Mama so normal, als wüssten sie nicht, was gerade eben passiert war? Und warum trank Papa seelenruhig seinen Tee, als hätte Jaja ihm nicht gerade eine freche Antwort gegeben? Ich drehte mich langsam um und ging nach oben, um mein rotes Sonntagskleid auszuziehen.
Als ich mich umgekleidet hatte, saß ich an meinem Schlafzimmerfenster. Der Cashewbaum war so nahe, dass ich die Hand hätte ausstrecken können, um ein Blatt zu pflücken, wenn nicht das silberfarbene Moskitogitter dazwischen gewesen wäre. Die glockenförmigen gelben Früchte hingen träge und schwer an den Zweigen und lockten Bienen an, die summend gegen das Gitter vor meinem Fenster flogen. Ich hörte, wie Papa nach oben in sein Zimmer ging, um ein Nickerchen zu machen. Ich schloss die Augen, saß ganz still und wartete darauf, dass er Jaja rufen und Jaja in sein Zimmer gehen würde. Nichts passierte, und nach langen, stillen Minuten öffnete ich die Augen wieder und drückte meine Stirn gegen das Gitter, um nach draußen zu sehen. Unser Hof war so groß, dass hundert Leute darin atilogu tanzen konnten, und so geräumig, dass zwischen den Tänzern genug Platz bleiben würde, damit sie ihre halsbrecherischen Saltos machen und auf den Schultern des nächsten Tänzers landen konnten. Die Mauern des Grundstücks, auf denen sich elektrisch geladener Stacheldraht ringelte, waren so hoch, dass ich die Autos, die an unserem Haus vorbeifuhren, nicht sehen konnte. Es war zu Beginn der Regenzeit, und die Tempelbäume an den Mauern erfüllten den Hof bereits mit dem betäubend süßlichen Duft ihrer Blüten. Eine Reihe von purpurroten Bougainvilleen, kerzengerade beschnitten wie ein Küchentisch, trennte die knorrigen Bäume von der Auffahrt. Vor dem Haus standen üppige Hibiskussträucher, die ihre Zweige ausstreckten, als wollten sie ihre Blüten miteinander tauschen. Am Blauen Hibiskus zeigten sich zwar schon die ersten schläfrigen Knospen, doch die meisten Blüten trug der rote Hibiskus. Er schien so schnell zu blühen, dieser rote Hibiskus, zumal wenn man bedachte, wie oft Mama Zweige abschnitt, um den Kirchenaltar zu schmücken, oder wie oft Besucher sich auf dem Weg zu ihren parkenden Autos ein paar Blüten abzupften.
Es waren vor allem die Frauen aus Mamas Gebetsgruppe; einmal hatte ich von meinem Fenster aus beobachtet, wie sich eine von ihnen eine Blüte hinters Ohr steckte. Doch selbst die Agenten der Regierung, zwei Männer in schwarzen Jacken, die vor einiger Zeit bei uns gewesen waren, hatten sich am Hibiskus zu schaffen gemacht, als sie hinausgingen. Sie kamen in einem Pick-up mit Regierungsnummernschild und parkten direkt bei den Hibiskussträuchern. Lange waren sie nicht geblieben. Später sagte Jaja, sie seien gekommen, um Papa zu bestechen, und dass er gehört hätte, wie sie sagten, ihr Pick-up sei voll mit Dollarnoten. Ich war mir nicht so sicher, ob Jaja das richtig verstanden hatte. Aber selbst heute dachte ich noch manchmal daran. Ich stellte mir den Laster vor, auf der Ladefläche ganze Stapel von Geldbündeln in fremder Währung, und fragte mich, ob sie das Geld wohl in viele einzelne Kartons gepackt hatten oder in einen von den großen, in denen man auch unseren Kühlschrank geliefert hatte.
Ich stand immer noch am Fenster, als Mama zu mir ins Zimmer kam. Jeden Sonntag vor dem Mittagessen, während Papa sein Nickerchen hielt, flocht sie mir die Haare und wies zwischendurch Sisi an, sie solle etwas mehr Palmöl an die Suppe geben oder ein kleines bisschen weniger Curry an den Kokosreis. Dabei saß sie auf einem Lehnstuhl in der Nähe der Küchentür, und ich hockte vor ihr auf dem Boden, den Kopf zwischen ihren Beinen. Obwohl es in der Küche luftig war und die Fenster immer offen standen, nahm mein Haar die würzigen Düfte des Essens an, und wenn ich mir später einen meiner Zöpfe an die Nase hielt, konnte ich egusi-Suppe riechen, utazi, Curry. Heute jedoch kam Mama nicht mit der Tasche voll Kämmen und Haaröl in mein Zimmer und bat mich, zum Flechten nach unten zu kommen. Sie sagte nur: »Das Mittagessen ist fertig, nne.«
Eigentlich wollte ich sagen, wie leid es mir tat, dass Papa die Figuren zerbrochen hatte, aber die Worte, die tatsächlich aus meinem Mund kamen, lauteten: »Es tut mir leid, dass deine Figuren kaputtgegangen sind, Mama.«
Sie nickte schnell und schüttelte den Kopf, als wollte sie mir sagen, dass die Figuren nicht wichtig seien. Dabei waren sie es durchaus. Vor Jahren, bevor ich alles begriff, fragte ich mich oft, wieso sie sie jedes Mal polierte, wenn ich diese Geräusche aus ihrem Zimmer gehört hatte, ein Rumpeln, als würde etwas gegen die Tür geschlagen. Ihre Gummislipper machten nie ein Geräusch auf der Treppe, aber ich wusste, dass sie auf dem Weg nach unten war, wenn ich hörte, wie sich die Tür zum Esszimmer öffnete. Wenn ich dann zu ihr ging, sah ich sie bei der Etagere stehen, in der Hand ein mit Seifenwasser getränktes Küchenhandtuch. Für jede kleine Ballerina brauchte sie mindestens eine Viertelstunde. Tränen sah man nie auf ihrem Gesicht. Das letzte Mal, vor nur zwei Wochen, als ihr geschwollenes Auge noch dunkelviolett war wie eine überreife Avocado, hatte sie die Figürchen nach dem Polieren umgruppiert.
»Ich flechte dir die Haare nach dem Mittagessen«, sagte sie und wandte sich zum Gehen.
»Ja, Mama.«
Ich folgte ihr die Treppe hinunter. Sie hinkte leicht, als ob eines ihrer Beine kürzer wäre als das andere, wodurch sie noch kleiner wirkte, als sie war. Die Treppe bildete ein schwungvolles S, und ich war schon halb unten, als ich Jaja in der Diele stehen sah. Gewöhnlich ging er vor dem Mittagessen in sein Zimmer hoch, um zu lesen, aber heute hatte er sich gar nicht nach oben begeben; er hatte die ganze Zeit bei Mama und Sisi in der Küche gesessen.
»Ke kwanu?«, fragte ich, obwohl ich gar nicht zu fragen brauchte, wie es ihm ging. Ich brauchte ihn nur anzuschauen. Tiefe Falten hatten sich in sein Gesicht eingegraben, das Gesicht eines Siebzehnjährigen; sie zogen sich in Zickzacklinien über seine Stirn, und in jeder dieser Falten stand tiefe, dunkle Anspannung. Ich drückte ihm schnell die Hand, bevor wir ins Esszimmer gingen. Papa und Mama saßen schon am Tisch, und Papa wusch seine Hände in der Schüssel mit Wasser, die Sisi ihm hinhielt. Er wartete, bis Jaja und ich uns ihm gegenüber hingesetzt hatten, und begann mit dem Tischgebet. Zwanzig Minuten lang bat er Gott, das Essen zu segnen. Danach begann er die Gesetze des Rosenkranzes zu beten, und nach jedem »Gegrüßet seist du Maria« antworteten wir: »Bitte für uns Sünder.« Sein Lieblingsgesetz war: »Unsere Liebe Frau, Schutzherrin des nigerianischen Volkes.« Er hatte es selbst erfunden. Wenn die Leute es jeden Tag beteten, sagte er, würde Nigeria nicht mehr so armselig dastehen wie ein großer, starker Mann auf den spindeldürren Beinen eines Kindes.
Zum Mittagessen gab es fufu und onugbu. Das fufu war locker und geschmeidig. Sisi machte es sehr gut; energisch zerquetschte sie die Yamswurzeln zu Brei, wobei sie immer wieder ein paar Tropfen Wasser in den Mörser gab, und ihre Backen zogen sich im Takt mit dem Stampfen des Stößels zusammen. Die onugbu-Soße war sämig, mit dicken Brocken gekochtem Rindfleisch, Stockfisch und den dunkelgrünen onugbu-Blättern darin. Wir aßen schweigend. Ich formte mein fufu mit den Fingern zu kleinen Bällchen, tauchte sie in die Soße und führte sie zusammen mit einem Stück Fisch oder Fleisch zum Mund. Ich war mir sicher, dass die Soße gut war, aber ich schmeckte sie nicht, konnte sie nicht schmecken. Meine Zunge fühlte sich an wie Papier.
»Könnte ich bitte das Salz haben?«, bat Papa.
Wir alle griffen im selben Moment nach dem Salz. Als Jaja und ich den Streuer aus Kristallglas berührten, strichen meine Finger sanft über seine, dann zog er die Hand zurück. Ich reichte Papa das Salz. Das Schweigen dauerte immer länger.
»Heute Vormittag haben sie den Cashewsaft gebracht. Er schmeckt sehr gut. Ich bin mir sicher, dass er sich gut verkaufen wird«, sagte meine Mutter schließlich.
»Sag diesem Mädchen, es soll ihn bringen«, sagte Papa.
Mama drückte auf den Knopf der elektrischen Klingel, die an einem durchsichtigen Kabel von der Decke hing, und Sisi erschien.
»Ja, Madam?«
»Bring uns zwei Flaschen von dem Getränk, das aus der Fabrik geliefert wurde.«
»Ja, Madam.«
Ich wünschte, Sisi hätte gefragt: »Was für Flaschen, Madam?« oder: »Wo sind sie denn, Madam?«, bloß damit sie und Mama irgendetwas redeten und von den nervösen Bewegungen ablenkten, mit denen Jaja sein fufu zu Kugeln rollte. Kurz darauf war Sisi zurück und stellte die Flaschen neben Papa auf den Tisch. Sie hatten die gleichen verblichen aussehenden Etiketten wie all die anderen Dinge, die in Papas Fabriken hergestellt wurden – die Waffeln und die mit Creme gefüllten Kekse, die Fruchtsäfte und die Bananenchips. Papa goss jedem von uns ein Glas von dem gelben Saft ein. Ich streckte rasch die Hand nach meinem Glas aus und nahm einen Schluck. Der Saft schmeckte wässrig, aber ich wollte einen eifrigen Eindruck machen. Wenn ich sagte, wie gut der Saft schmecke, würde Papa ja vielleicht vergessen, dass er Jaja noch nicht bestraft hatte.
»Er ist sehr gut, Papa«, sagte ich.
Papa schwenkte den Saft in seinen aufgeblähten Backen. »Ja, ja.«
»Er schmeckt wie frische Cashewnüsse«, sagte Mama.
Sag irgendwas, bitte, hätte ich Jaja am liebsten angefleht. Man erwartete jetzt von ihm, dass er etwas sagte, dass er sich am Gespräch beteiligte und Papas neues Produkt lobte. Das machten wir immer so, wenn ein Angestellter aus einer seiner Fabriken uns etwas zum Probieren brachte.
»Fast wie Weißwein«, meinte Mama. Sie war nervös, das wusste ich – nicht nur, weil frische Cashewnüsse überhaupt nicht wie Weißwein schmecken, sondern weil ihre Stimme leiser war als sonst. »Wie Weißwein«, sagte Mama noch einmal und schloss die Augen, als könnte sie so noch besser schmecken. »Fruchtiger Weißwein.«
»Ja«, sagte ich. Ein Bällchen fufu glitt mir aus den Fingern und fiel in die Soße.
Papa sah Jaja auffordernd an. »Jaja, hast du nicht mit uns getrunken, gbo? Hast du keine Worte im Mund, um zu reden?«, fragte er. Er sagte alles auf Igbo. Ein schlechtes Zeichen. Igbo sprach er nur selten, und obwohl Jaja und ich es zu Hause mit Mama benutzten, mochte er es nicht, wenn wir es in der Öffentlichkeit sprachen. Dort sollten wir klingen wie zivilisierte Menschen, sagte Papa; deshalb mussten wir Englisch reden. Papas Schwester, Tante Ifeoma, hatte einmal gesagt, Papa sei zu sehr das Produkt der Kolonialherrschaft. Sie hatte es in einem milden, nachsichtigen Ton gesagt, als wäre es nicht Papas Schuld, als wäre er ein Mensch, der Malaria hat und im Fieber unflätige Worte von sich gibt.
»Hast du nichts zu sagen, gbo, Jaja?«, fragte Papa noch einmal.
»Mba, es sind keine Worte in meinem Mund«, erwiderte Jaja.
»Was?« Ein Schatten legte sich über Papas Augen, der Schatten, der zuvor Jajas Augen verdunkelt hatte. Es war Angst. Der Schatten hatte Jajas Augen verlassen und stand jetzt in Papas Augen.
»Ich habe nichts zu sagen«, antwortete Jaja.
»Der Saft ist gut –«, fing Mama an.
Jaja schob seinen Stuhl zurück. »Ich danke dir, Herr. Danke, Papa. Danke, Mama.«
Ich drehte mich zu ihm und starrte ihn an. Wenigstens sagte er auf die richtige Art danke, so wie wir es nach einer Mahlzeit gewohnt waren. Aber zugleich machte er etwas, was wir nie taten: Er stand vom Tisch auf, bevor Papa das Dankgebet nach dem Essen gesprochen hatte.
»Jaja!«, rief Papa. Der Schatten wuchs und erfasste jetzt auch das Weiße in Papas Augen. Jaja ging einfach aus dem Zimmer, seinen Teller in der Hand. Papa erhob sich halb, um aufzustehen, und ließ sich dann auf seinen Stuhl zurückfallen. Seine Wangen hingen schlaff herab, wie bei einer Bulldogge.
Ich griff nach meinem Glas und starrte in den Saft, der die wässrig-gelbe Farbe von Urin hatte. Dann stürzte ich das Glas auf einen Satz hinunter. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. So etwas war noch nie in meinem Leben passiert, niemals. Die Mauern um unser Grundstück würden zusammenbrechen, da war ich mir sicher, und würden die Tempelbäume unter sich begraben. Der Himmel würde auf uns herabfallen. Die persischen Teppiche auf dem glänzenden Marmorboden würden schrumpfen. Etwas würde passieren. Aber das Einzige, was passierte, war, dass ich mich verschluckte. Ich erstickte fast, so sehr musste ich husten. Papa und Mama sprangen auf, um mir zu helfen. Papa klopfte mir auf den Rücken, während Mama mir die Schultern rieb und sagte: »O zugo. Hör auf zu husten.«
An diesem Abend blieb ich im Bett und aß nicht mit der Familie zu Abend. Ich hatte richtigen Husten bekommen, und wenn ich meine Wangen mit dem Handrücken berührte, konnte ich spüren, wie heiß sie waren. In meinem Kopf spielten Tausende von bösen Ungeheuern Fangen, aber statt einem Ball war es ein braunes ledergebundenes Messbuch, das sie sich zuwarfen. Papa kam in mein Zimmer; die Matratze bog sich durch, als er sich hinsetzte, mir sanft über die Wangen strich und fragte, ob ich noch etwas brauchte. Mama wollte mir bereits ofe nsala machen. Ich sagte, nein, ich bräuchte nichts, und wir saßen lange Zeit schweigend da. Er hielt meine Hand. Papa atmete immer sehr geräuschvoll, aber jetzt keuchte er fast, als wäre er außer Atem, und ich fragte mich, was er wohl dachte; ob er in seinem Inneren rannte, vor etwas wegrannte. Ins Gesicht schaute ich ihm nicht, denn ich wollte nicht die eitrigen Pusteln sehen, die sich über jeden Zentimeter seiner Gesichtshaut zogen, so viele und so gleichmäßig, dass seine Haut aussah wie aufgepumpt.
Eine Weile später brachte mir Mama ein wenig ofe nsala, aber von der aromatischen Suppe wurde mir schlecht. Nachdem ich mich im Badezimmer übergeben hatte, fragte ich Mama, wo Jaja sei. Seit dem Mittagessen war er nicht in mein Zimmer gekommen.
»In seinem Zimmer. Er war nicht beim Abendessen.« Sie strich zärtlich über meine dicht an der Kopfhaut geflochtenen Zöpfchen; das tat sie gern, als wollte sie den Weg verfolgen, den die einzelnen Strähnen zurücklegten, um sich schließlich mit dem anderen Haar zu vereinen. Mit dem Flechten würde sie bis nächste Woche warten. Mein Haar war zu dick und zog sich sofort wieder zu einem dichten Büschel zusammen, nachdem sie mit einem Kamm durchgefahren war. Wenn sie jetzt versuchte, es zu kämmen, würde das die kleinen Ungeheuer in meinem Kopf erst recht wütend machen.
»Wirst du dir neue Figuren besorgen?«, fragte ich. Ich roch den kalkigen Duft ihres Deodorants. Ihr braunes Gesicht, makellos bis auf die noch frische Narbe an der Stirn, war ausdruckslos.
»Kpa«, sagte sie. »Ich werde sie nicht ersetzen.«
Vielleicht war Mama klargeworden, dass sie die kleinen Tänzerinnen nicht mehr brauchen würde; dass nicht nur die Figürchen in die Brüche gingen, sondern alles um uns herum, wenn Papa mit dem Messbuch nach Jaja warf. Mir wurde das erst jetzt klar, erst jetzt ließ ich den Gedanken zu.
Nachdem Mama gegangen war, lag ich im Bett und dachte über die Vergangenheit nach, all die Jahre, in denen Jaja und Mama und ich mehr durch unsere Seelen miteinander gesprochen hatten als mit unseren Lippen. Bis Nsukka. Mit Nsukka hatte alles angefangen. In Tante Ifeomas kleinem Garten vor der Veranda ihrer Wohnung in Nsukka war das Schweigen langsam gelüftet worden. Plötzlich schien mir, als sei Jajas Trotz wie Tante Ifeomas besondere Züchtung von Blauem Hibiskus: selten, mit dem leisen Duft von Freiheit, einer anderen Freiheit als der, die die Menschen nach dem Putsch auf dem Government Square gefordert hatten, singend, in den Händen Zweige mit grünen Blättern. Die Freiheit, zu sein, zu handeln.
Doch meine Erinnerungen begannen nicht erst in Nsukka. Sie begannen in einer Zeit davor, als all die Hibiskussträucher in unserem Garten in flammendem Rot standen.
Als unsere Seelen miteinander sprachen
Vor Palmsonntag
Ich saß an meinem Schreibtisch, als Mama in mein Zimmer kam, meine Schuluniformen über dem Arm. Sie hatte sie von den Wäscheleinen im Hinterhof hereingeholt, wo ich sie an diesem Morgen zum Trocknen aufgehängt hatte, und legte sie auf mein Bett. Jaja und ich wuschen unsere Schuluniformen selbst, während Sisi den Rest unserer Kleidung besorgte. Wir steckten das Gewebe immer zuerst an kleinen, unauffälligen Stellen in die Seifenlauge, um zu überprüfen, ob die Farbe auslief, obwohl wir wussten, dass das nicht passieren würde. Wir wollten einfach jede Minute der halben Stunde ausnutzen, die Papa für das Waschen der Uniformen angesetzt hatte.
»Danke, Mama. Gerade wollte ich sie selber hereinholen«, sagte ich und stand auf, um die Kleider zusammenzulegen. Es gehörte sich nicht, wenn man eine ältere Person seine Aufgaben erledigen ließ, aber Mama machte das nichts aus; es gab so viel, was ihr nichts ausmachte.
»Es wird gleich einen Schauer geben. Ich wollte nicht, dass sie nass werden.« Sie strich mit der Hand über meine Uniform, einen grauen Rock mit dunkler getöntem Bund, der gerade lang genug war, um meine Waden zu bedecken. »Nne, du wirst noch ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen.«
Ich starrte sie an. Die Knie fest zusammengepresst, saß sie auf meinem Bett. »Du bekommst ein Baby?«
»Ja.« Sie lächelte. Ihre Hand strich immer noch über meinen Rock.
»Wann?«
»Im Oktober. Ich war gestern bei meinem Arzt in der Park Lane.«
»Gott sei’s gedankt.« Das sagten Jaja und ich, wenn gute Dinge passierten, weil Papa das von uns erwartete.
»Ja.« Mama ließ fast widerwillig von meinem Rock ab. »Auf Gott ist Verlass. Weißt du, als du auf die Welt gekommen warst und ich all diese Fehlgeburten hatte, haben die Leute im Dorf angefangen zu reden. Unsere umunna hat sogar Leute zu deinem Vater geschickt, um ihn zu bedrängen, mit einer anderen Frau Kinder zu zeugen. So viele Leute hatten Töchter, die gewillt waren, das zu tun, und viele von den Mädchen waren sogar auf der Universität gewesen. Sie hätten viele Söhne zur Welt bringen können, und dann hätten sie unser Zuhause übernommen und uns davongejagt, so wie Mr. Ezendus zweite Frau es gemacht hat. Dein Vater aber ist bei mir geblieben, bei uns.« Sie sagte sonst nie so viel auf einmal. Meine Mutter sprach so, wie Vögel essen, immer in kleinen Häppchen.
»Ja«, sagte ich. Natürlich war es Papa hoch anzurechnen, dass er keine weiteren männlichen Nachkommen mit einer anderen Frau gezeugt hatte, dass er sich nicht dazu entschlossen hatte, eine zweite Frau zu nehmen. Aber Papa war schließlich anders. Ich wünschte, Mama hätte ihn nicht mit Mr. Ezendu verglichen, überhaupt mit niemandem; das machte ihn kleiner und beschmutzte ihn.
»Sie haben sogar gesagt, jemand hätte meinen Leib beim ogwu-Tanz verschlossen.« Mama schüttelte den Kopf und lächelte, dieses nachsichtige Lächeln, das sich auf ihrem Gesicht ausbreitete, wenn sie von Menschen sprach, die an Orakel glaubten, wenn Verwandte ihr den Vorschlag machten, einen Zauberdoktor aufzusuchen, oder wenn Leute erzählten, wie sie in ihrem Garten Stoffbündel mit Haarbüscheln und Tierknochen ausgegraben hätten, die jemand dort versteckt habe, damit sie im Leben nicht weiterkämen. »Sie wissen nicht, dass Gottes Wege unergründlich sind.«
»Ja«, sagte ich. Ich hielt die Kleider vorsichtig im Arm, damit sie ordentlich gefaltet blieben. »Gottes Wege sind unergründlich.« Dass sie seit ihrer letzten Fehlgeburt vor sechs Jahren versucht hatte, ein Baby zu bekommen, hatte ich nicht gewusst. Ich konnte mir sie und Papa nicht einmal vorstellen, zusammen auf ihrem Bett, das maßgefertigt und breiter war als die üblichen Doppelbetten. Wenn ich mir Zuneigung zwischen ihnen vorstellte, kam mir immer das Bild in den Sinn, wenn sie bei der Messe den Friedensgruß austauschten, die Art, wie Papa sie in den Armen hielt, nachdem sie sich die Hände gereicht hatten.
»War in der Schule alles in Ordnung?«, fragte Mama und stand auf. Das hatte sie mich vorher schon gefragt.
»Ja.«
»Sisi und ich machen moi-moi für die Schwestern. Sie werden bald hier sein«, sagte Mama, bevor sie wieder nach unten ging. Ich folgte ihr und legte meine gefalteten Uniformen auf den Tisch in der Diele, wo Sisi sie zum Bügeln abholen würde.
Die Schwestern, Mitglieder der Betgruppe »Unsere liebe Frau von der wundersamen Münze«, trafen bald darauf ein, und ihre Gesänge auf Igbo, begleitet von kräftigem Händeklatschen, tönten bis in den ersten Stock. Sie würden etwa eine halbe Stunde beten und singen, dann unterbrach sie Mama immer mit ihrer leisen Stimme, die im ersten Stock kaum zu hören war, obwohl ich die Tür offen hatte, und sagte, sie habe »eine Kleinigkeit« für sie vorbereitet. Wenn Sisi dann die Platten mit moi-moi, Jollof-Reis und gebratenem Hühnchen hereinbrachte, schimpften die Frauen mit Mama. »Schwester Beatrice, was ist denn das? Warum hast du das getan? Sind wir nicht zufrieden mit den Speisen, die wir bei den anderen Schwestern zu Hause bekommen? Das wäre wirklich nicht nötig gewesen.« Dann piepste eine Stimme: »Gelobt sei Gott in der Höhe!«, wobei sie das erste Wort so lange hinauszog, wie es ging. Die Antwort »Halleluja!« brachte die Wände meines Zimmers zum Beben, bestimmt auch die Glasartikel im Wohnzimmer. Dann würden sie beten, würden Gott darum bitten, die Großzügigkeit von Schwester Beatrice zu entlohnen, und Mama mit noch mehr Segenswünschen überschütten. Schließlich würde das Klirren und Kratzen der Gabeln und Löffel auf den Tellern durch das ganze Haus hallen. Mama benutzte niemals Plastikbesteck, ganz gleich, wie groß die Gästeschar war.
Sie hatten gerade mit dem Dankgebet für das Essen begonnen, als ich Jaja die Treppe heraufstürmen hörte. Ich wusste, dass er als Erstes in mein Zimmer kommen würde, weil Papa nicht zu Hause war. In diesem Fall ging Jaja immer zuerst in sein eigenes Zimmer, um sich umzuziehen.
»Ke kwanu?«, fragte ich, als er hereinkam. In seiner Schuluniform, den blauen Shorts und dem weißen Hemd, auf dessen linker Brust das Abzeichen von St. Nicholas prangte, waren immer noch die Bügelfalten zu sehen. Letztes Jahr war er zum ordentlichsten Jungen seines Jahrgangs ernannt worden, und Papa hatte ihn so fest umarmt, dass Jaja gedacht hatte, er würde ihm die Rippen brechen.
»Gut.« Er stand neben meinem Schreibtisch und blätterte beiläufig in meinem Schulbuch Einführung in die Technik, das offen vor mir lag. »Was hast du gegessen?«
»Garri.«
Ich wünschte, wir würden immer noch zusammen zu Mittag essen, stand in Jajas Augen geschrieben.
»Ich auch«, sagte ich laut.
Früher hatte Kevin, unser Fahrer, mich immer zuerst bei den Töchtern des Unbefleckten Herzens abgeholt, und dann fuhren wir zusammen zu St. Nicholas, wo Jaja schon wartete. Wenn wir nach Hause kamen, aßen Jaja und ich gemeinsam zu Mittag. Mittlerweile war das anders. Weil Jaja an dem neuen Programm für begabte Schüler an St. Nicholas teilnahm, besuchte er zusätzliche Stunden nach der Schule. Papa hatte Jajas Tagesplan umgestellt, meinen jedoch nicht, und ich durfte nicht mit dem Mittagessen auf ihn warten. Von mir wurde erwartet, dass ich zu Mittag gegessen, ein Nickerchen gehalten und mit meinen Hausaufgaben begonnen hatte, wenn Jaja nach Hause kam.
Dennoch wusste Jaja jeden Tag, was ich zu Mittag gegessen hatte. An der Küchenwand hing ein Speiseplan für uns, den Mama zweimal im Monat austauschte. Er fragte mich trotzdem immer danach. Das taten wir oft – dem anderen Fragen stellen, auf die wir die Antworten schon wussten. Vielleicht, damit wir die anderen Fragen, auf die wir die Antworten nicht wissen wollten, nicht stellten.
»Ich habe drei Hausaufgaben auf«, sagte Jaja und machte Anstalten zu gehen.
»Mama ist schwanger«, sagte ich.
Jaja kam zurück und setzte sich auf die Kante meines Bettes. »Hat sie dir das gesagt?«
»Ja. Im Oktober ist es so weit.«
Jaja schloss kurz die Augen und öffnete sie dann wieder. »Wir werden auf den Kleinen aufpassen. Wir werden ihn beschützen.«
Ich wusste, dass Jaja meinte, wir würden das Baby vor Papa beschützen, aber ich sagte nichts dazu. Stattdessen fragte ich: »Woher weißt du, dass es ein Junge wird?«
»Das spüre ich. Was glaubst du?«
»Ich weiß nicht.«
Jaja blieb noch eine Weile auf meinem Bett sitzen, bevor er zum Mittagessen hinunterging. Ich schob mein Lehrbuch zur Seite und blickte zu meinem Stundenplan hoch, der an die Wand über mir geklebt war. Kambili stand in schwungvollen Lettern oben auf dem weißen Stück Papier, so wie auf dem Plan über dem Schreibtisch in Jajas Zimmer Jaja stand. Ich fragte mich, wann Papa wohl einen Plan für das Baby, für mein neues Brüderchen, aufstellen würde, ob er es wohl gleich nach der Geburt machen oder ob er warten würde, bis das Kind im Krabbelalter war. Papa liebte Ordnung. Das sah man sogar an den Stundenplänen selbst: an der Art, wie akkurat die Linien über das Blatt gezogen waren, in schwarzer Tinte, von Tag zu Tag, wie sie akribisch die Lernstunden von den Ruhepausen trennten, die Ruhepausen von der Zeit, die man in der Familie verbrachte, die Familienzeit von den Mahlzeiten, die Mahlzeiten vom Gebet, das Gebet vom Schlafen. Wenn wir in der Schule waren, hatten wir weniger Zeit zum Ausruhen und mehr Zeit zum Lernen, selbst an Wochenenden. In den Ferien dagegen gab es ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Ein bisschen mehr Zeit, um Zeitung zu lesen, Schach oder Monopoly zu spielen und um Radio zu hören.
Es war während der Familienzeit am nächsten Tag, einem Samstag, als der Putsch stattfand. Papa hatte Jaja gerade schachmatt gesetzt, als im Radio Marschmusik gespielt wurde und uns die feierlichen Klänge aufhorchen ließen. Ein General mit starkem Hausa-Akzent verkündete, es habe einen Staatsstreich gegeben, und wir hätten eine neue Regierung. In Kürze würde man uns mitteilen, wer unser neues Staatsoberhaupt sei.
Papa schob das Schachbrett beiseite und entschuldigte sich, um in seinem Arbeitszimmer zu telefonieren. Schweigend warteten Jaja, Mama und ich auf ihn. Ich wusste, dass er seinen Chefredakteur Ade Coker anrief, vielleicht um ihm zu sagen, was er über den Staatsstreich schreiben solle. Als er zurückkam, tranken wir den Mangosaft, den Sisi uns in hohen Gläsern servierte, während Papa über den Putsch sprach. Er sah bedrückt aus; seine eckigen Lippen schienen nach unten zu hängen. Aus Staatsstreichen entstehen neue Staatsstreiche, sagte er und erzählte uns von den blutigen Putschen der Sechziger, die, direkt nachdem er Nigeria verlassen hatte, um in England zu studieren, zum Bürgerkrieg geführt hatten. Ein Staatsstreich münde immer in einen Teufelskreis. Militärs setzten sich immer gegenseitig ab, einfach weil sie dazu in der Lage waren und weil sie alle machttrunken waren.
Natürlich, sagte Papa, seien die Politiker alle korrupt, und der Standard habe viele Artikel über Kabinettsmitglieder gebracht, die Geld auf ausländischen Konten horteten, Geld, mit dem eigentlich Lehrer bezahlt oder Straßen gebaut werden sollten. Doch was Nigeria brauche, seien keine Soldaten, die uns regierten; was wir brauchten, sei eine rundum erneuerte Demokratie. Eine rundum erneuerte Demokratie. Die Art, wie er das sagte, klang überaus bedeutsam, aber eigentlich klang das meiste von dem, was Papa sagte, bedeutsam. Er lehnte sich gern zurück und schaute zur Decke, während er sprach, als suche er da oben nach etwas. Ich konzentrierte dann meine ganze Aufmerksamkeit auf seine Lippen, seine Bewegungen, und manchmal vergaß ich mich selbst und hätte am liebsten immer dort gesessen und seiner Stimme gelauscht, all den wichtigen Dingen, die er sagte. Genauso war es auch, wenn er lächelte, wenn sein Gesicht sich zu einem breiten Lachen öffnete, wie eine Kokosnuss mit ihrem strahlend weißen Mark im Inneren.
Am Tag nach dem Staatsstreich, bevor wir zur Abendmesse in St. Agnes aufbrachen, saßen wir im Wohnzimmer und lasen Zeitung; unser Zeitungslieferant brachte uns auf Papas Anweisung jeden Morgen jeweils vier Exemplare der wichtigsten Blätter ins Haus. Zuerst lasen wir den Standard. Nur im Standard stand ein kritischer Leitartikel, in dem die neue Militärregierung aufgefordert wurde, sofort eine Rückkehr zur Demokratie in die Wege zu leiten. Papa las uns laut einen der Artikel in Nigeria Today vor, die persönliche Kolumne eines Autors, der der Meinung war, die Zeit sei reif für einen Militärpräsidenten, da die Politiker völlig außer Kontrolle geraten seien und unsere Wirtschaft im Argen liege.
»So einen Unsinn würde der Standard nie schreiben«, sagte Papa und ließ die Zeitung sinken. »Ganz zu schweigen davon, diesen Mann Präsident zu nennen.«
»Der Ausdruck Präsident suggeriert, dass er gewählt wurde«, sagte Jaja. »Staatsoberhaupt wäre der richtige Ausdruck.«
Papa lächelte, und ich wünschte, ich hätte das gesagt, nicht Jaja.
»Der Leitartikel im Standard ist gut geschrieben«, sagte Mama.
»Ade ist eben einfach der Beste da draußen«, sagte Papa mit beiläufigem Stolz, während er ein anderes Blatt in Augenschein nahm. »›Wachwechsel.‹ Was für eine Schlagzeile. Die haben alle Angst. Schreiben darüber, wie korrupt die Zivilregierung war, als glaubten sie allen Ernstes daran, das Militär sei nie korrupt. Mit diesem Land geht es bergab, das sage ich euch.«
»Gott wird uns erlösen«, sagte ich, weil ich wusste, dass es Papa gefiel, wenn ich so etwas sagte.
»Ja, ja«, sagte Papa nickend. Dann beugte er sich vor und nahm meine Hand, und ich hatte das Gefühl, mein Mund sei voll von schmelzendem Zucker.
In den folgenden Wochen klangen die Zeitungen, die wir während der Familienzeit lasen, anders, verhaltener. Auch der Standard klang anders; er war kritischer, stellte mehr Fragen als sonst. Selbst die Fahrt zur Schule war anders. In der ersten Woche nach dem Putsch pflückte Kevin jeden Morgen grüne Zweige und steckte sie auf das Auto, oberhalb des Nummernschildes, damit uns die Demonstranten am Government Square durchließen. Die grünen Zweige bedeuteten Solidarität. Allerdings sahen unsere Zweige nie so frisch und leuchtend aus wie die der Demonstranten, und wenn wir an ihnen vorbeifuhren, fragte ich mich manchmal, wie es wäre, mich ihnen anzuschließen, »Freiheit! Freiheit!« zu rufen und den Verkehr zu blockieren.
Wenn Kevin dann einige Wochen später an der Ogui Road vorbeifuhr, sah man Soldaten bei der Straßensperre in der Nähe des Marktes, die herumliefen und ihre langen Gewehre zärtlich im Arm trugen. Ab und zu hielten sie ein Auto an und durchsuchten es. Einmal sah ich einen Mann mit hocherhobenen Händen neben seinem Peugeot 504 auf der Straße knien.
Zu Hause jedoch änderte sich nichts. Jaja und ich hielten uns immer noch an unsere Tagespläne, stellten uns immer noch Fragen, auf die wir die Antworten bereits wussten. Die einzige Veränderung war Mamas Bauch, der ganz langsam und unauffällig dicker wurde. Zuerst sah er noch aus wie ein Fußball, aus dem Luft entwichen ist, aber am Pfingstsonntag war er unter ihrem rotgoldenen Sonntagswickeltuch bereits so deutlich zu erkennen, dass es sich nicht bloß um die Schicht Stoff darunter handeln konnte oder um das geknotete Ende des Wickeltuches. Der Altar war in demselben Rotton geschmückt wie Mamas Kleid. Rot war die Farbe Pfingstens. Der Gastpriester hielt die Messe in einem roten Gewand ab, das sichtlich zu kurz für ihn war. Er war jung und blickte oft auf, während er das Evangelium las, um mit seinen forschen braunen Augen den Blick über die Gemeinde schweifen zu lassen. Als er fertig war, küsste er langsam die Bibel. Wenn jemand anders das getan hätte, hätte es vielleicht theatralisch gewirkt, bei ihm jedoch nicht. Es wirkte echt. Er sei gerade zum Priester geweiht worden, erzählte er, und warte darauf, dass man ihm eine Gemeinde zuwies. Er und Pater Benedict hätten einen engen gemeinsamen Freund, und es habe ihn gefreut, als Pater Benedict ihn dazu eingeladen habe, als Gastpriester bei uns die Messe zu halten. Er sagte jedoch nicht, wie schön unser Altar in St. Agnes sei, mit seinen Stufen, die glänzten wie polierte Eisblöcke. Oder dass es einer der schönsten Altäre in ganz Enugu sei, wenn nicht gar von ganz Nigeria. Im Gegensatz zu all den anderen Priestern, die St. Agnes besuchten, sagte er auch nicht, dass Gottes Anwesenheit hier deutlicher zu spüren sei oder dass die schimmernden Heiligen auf den hohen Buntglasfenstern, die vom Boden bis zur Decke reichten, Gott vielleicht davon abhielten, die Kirche jemals wieder zu verlassen. Dafür stimmte er mitten in seiner Predigt plötzlich ein Igbo-Lied an: »Bunie ya enu …«
Die ganze Gemeinde hielt die Luft an, einige seufzten, andere formten ihre Münder zu großen O. Sie waren an Pater Benedicts spärliche Gottesdienste gewöhnt, an seine näselnden, monotonen Predigten. Langsam fielen sie in den Gesang ein. Ich sah, wie Papa missbilligend die Lippen schürzte. Er blickte zur Seite, um festzustellen, ob Jaja und ich mitsangen, und nickte zustimmend, als er sah, dass unsere Lippen versiegelt waren.
Nach der Messe standen wir draußen vor dem Eingang der Kirche und warteten auf Papa, der einige Leute begrüßte, die sich um ihn scharten.
»Guten Morgen, gelobt sei Gott«, sagte er, und dann schüttelte er den Männern die Hand, umarmte die Frauen, strich den Kleinkindern über den Kopf, kniff den Babys in die Wange. Einige der Männer flüsterten ihm etwas zu, Papa antwortete flüsternd, und die Männer dankten ihm, ergriffen seine Hand mit beiden Händen und schüttelten sie, bevor sie gingen. Dann war Papa endlich fertig mit dem Begrüßen, und nachdem der große Kirchhof, auf dem sich zuvor die Autos gedrängt hatten wie Zähne in einem Mund, fast leer war, gingen wir auf unseren Wagen zu.
»Dieser junge Priester da singt mitten in der Predigt wie einer von diesen gottlosen Anführern in den Pfingstgemeinden, die überall aus dem Boden schießen wie die Pilze. Leute wie er machen der Kirche nur Scherereien. Wir dürfen nicht vergessen, für ihn zu beten«, sagte Papa, während er den Mercedes aufschloss und das Messbuch und das Kirchenblatt auf den Sitz legte. Er wandte sich in Richtung Pfarrhaus, weil wir nach der Messe immer Pater Benedict einen Besuch abstatteten.
»Lass mich im Auto warten, biko«, sagte Mama und lehnte sich an den Mercedes. »Ich spüre, dass ich mich übergeben muss.«
Papa wandte sich um und sah sie an. Ich hielt den Atem an. Der Moment kam mir ewig lang vor, obwohl er wahrscheinlich nur ein paar Sekunden dauerte.
»Bist du sicher, dass du im Auto warten willst?«, fragte Papa.
Mama schaute zu Boden; ihre Hände lagen auf ihrem Bauch, als wollte sie verhindern, dass ihr Wickeltuch sich löste oder dass ihr das Frühstück aus Brot und Tee hochkam. »Mein Körper fühlt sich irgendwie nicht richtig an«, murmelte sie.
»Ich habe gefragt, ob du sicher bist, dass du im Auto bleiben willst.«
Mama schaute auf. »Ich komme mit. So schlimm ist es doch nicht.«
Papas Gesicht blieb unverändert. Er wartete darauf, dass sie zu ihm kam, dann drehte er sich um, und sie machten sich gemeinsam auf den Weg zum Haus des Priesters. Jaja und ich folgten ihnen. Ich sah Mama an, während wir gingen. Bis dahin war mir noch gar nicht aufgefallen, wie verhärmt sie aussah. Ihre Haut, die sonst das geschmeidige Braun von Erdnusspaste hatte, sah so aus, als wäre alle Feuchtigkeit aus ihr herausgesaugt worden, wie die Farbe von rissiger Erde im Harmattan. Was, wenn sie spucken muss?, fragte mich Jaja mit den Augen. Ich würde den Saum meines Kleides hochhalten, und Mama konnte sich darin übergeben, damit wir in Pater Benedicts Haus keinen Dreck machten.
Das Pfarrhaus sah aus, als hätte der Architekt zu spät bemerkt, dass er ein normales Wohnhaus bauen sollte, keine Kirche. Der Bogen, durch den man ins Esszimmer ging, erinnerte an den Zugang zu einem Altar; die Nische mit dem cremefarbenen Telefon machte den Eindruck, als könne man hier jeden Moment das heilige Sakrament empfangen; und das winzige Arbeitszimmer, das vom Wohnzimmer abging, hätte ebenso gut eine Sakristei sein können, so vollgestopft war es mit heiligen Büchern, Messgewändern und Ersatzkelchen.
»Bruder Eugene!«, rief Pater Benedict. Sein blasses Gesicht verzog sich zu einem Lächeln, als er Papa sah. Der Pater saß am Esstisch und war über eine Mahlzeit gebeugt. Es gab Scheiben von gekochtem Schinken, was nach Mittagessen aussah, aber auch einen Teller mit gebratenen Eiern, mehr wie zu einem Frühstück. Er bat uns an den Tisch, aber Papa lehnte in unserem Namen ab und ging dann zu dem Pater und sprach leise mit ihm.
»Wie geht es dir, Beatrice?«, fragte Pater Benedict und hob die Stimme, damit Mama ihn aus dem Wohnzimmer hören konnte. »Du siehst nicht gut aus.«
»Es geht mir gut, Pater. Bloß meine Allergien machen mir bei diesem Wetter zu schaffen, wissen Sie, wenn der Harmattan und die Regenzeit aufeinandertreffen.«
»Und ihr, Kambili und Jaja, hat euch die Messe gefallen?«
»Ja, Pater«, sagten Jaja und ich gleichzeitig.
Kurz darauf, ein wenig früher als sonst bei den Besuchen bei Pater Benedict, verabschiedeten wir uns. Papa sagte nichts im Auto, nur sein Kinn mahlte, als knirsche er mit den Zähnen. Wir schwiegen und lauschten dem »Ave-Maria« aus dem Kassettenrecorder. Als wir nach Hause kamen, hatte Sisi für Papas Tee den Tisch gedeckt. Die Porzellantässchen hatten winzige, verschnörkelte Henkel. Papa legte sein Messbuch und das Kirchenblatt auf den Esstisch und nahm Platz. Mama blieb in seiner Nähe.
»Ich schenk dir deinen Tee ein«, bot sie an, obwohl sie das nie tat.
Papa achtete nicht auf sie und goss sich seinen Tee selbst ein, und dann forderte er Jaja und mich auf, einen Schluck zu nehmen. Jaja trank und stellte die Tasse zurück auf die Untertasse. Papa nahm die Tasse und reichte sie mir. Ich hielt sie mit beiden Händen, nahm einen Schluck von dem Lipton-Tee, der mit Milch und Zucker gesüßt war, und stellte sie dann wieder an ihren Platz zurück.
»Danke, Papa«, sagte ich und spürte, wie mir die Liebe auf der Zunge brannte.
Jaja, Mama und ich gingen nach oben, um uns umzuziehen. Der Klang unserer Schritte auf der Treppe war wie die Stille und Feierlichkeit unserer Sonntage: die Stille, wenn wir darauf warteten, dass Papa sein Nickerchen gemacht hatte und wir zu Mittag essen konnten; die Stille der Zeit des Nachdenkens, wenn Papa uns eine Passage aus der Heiligen Schrift gab oder ein Buch eines der frühen Kirchenväter, damit wir es lasen und darüber meditierten; die Stille des abendlichen Rosenkranzes; die Stille im Auto, wenn wir danach zur Abendmesse fuhren. Sogar unsere Familienzeit am Sonntag war still, ohne Schachspiele oder Diskussionen über die Zeitung, ganz im Einklang mit dem Tag, an dem man ruhen soll.
»Vielleicht kann Sisi das Essen ja heute einmal allein kochen«, sagte Jaja, als wir am oberen Absatz der geschwungenen Treppe ankamen. »Du solltest dich ein bisschen hinlegen, Mama.«
Mama wollte etwas sagen, aber dann hielt sie inne, schlug die Hand vor den Mund und rannte in ihr Zimmer. Ich blieb noch einen Moment stehen und hörte das laute Würgen tief aus ihrer Kehle, bevor ich in mein Zimmer ging.
Zum Mittagessen gab es Jollof-Reis, faustgroße Stücke azu, der so lange gebraten worden war, dass die Gräten ganz knusprig waren, und ngwo-ngwo. Papa aß das meiste davon, wieder und wieder tauchte er den Löffel in die würzige Brühe in der Glasschüssel. Schweigen hing über dem Tisch wie die bläulichschwarzen Wolken mitten in der Regenzeit, nur unterbrochen vom Zwitschern der ochiri-Vögel draußen. Jedes Jahr kamen diese Vögel, bevor der erste Regen fiel, und nisteten in dem Avocadobaum direkt vor dem Esszimmer. Manchmal fanden Jaja und ich heruntergefallene Nester auf dem Boden, Nester aus verschlungenen Zweigen, getrocknetem Gras und den winzigen Stückchen Faden, die Mama mir ins Haar flocht und die die ochiri aus der Mülltonne im Hinterhof pickten.
Ich war als Erste mit dem Essen fertig. »Ich danke dir, Herr. Danke, Papa. Danke, Mama.« Ich verschränkte die Arme und wartete, bis alle fertig waren und wir beten konnten. Dabei sah ich niemandem ins Gesicht, sondern blickte auf das Bild von Großvater, das an der Wand gegenüber hing.
Als Papa mit dem Gebet begann, bebte seine Stimme mehr als sonst. Zuerst dankte er für das Essen, dann bat er Gott, denen zu vergeben, die versuchten, seine Pläne zu durchkreuzen, die ihre eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle setzten und sich geweigert hatten, seinen Diener nach der Messe zu besuchen. Mamas »Amen!« hallte laut durch den ganzen Raum.