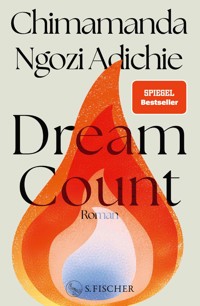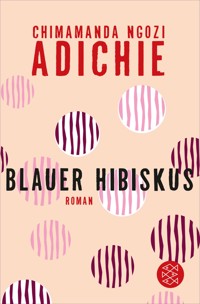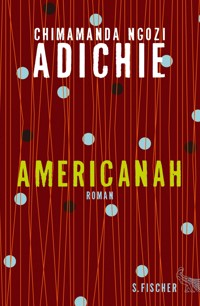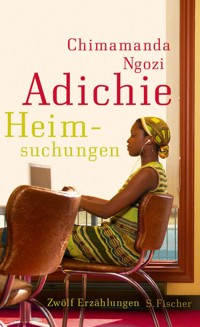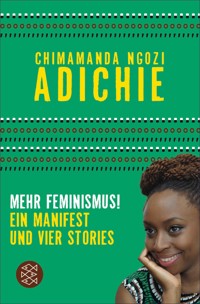
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mehr Feminismus! - Der legendäre TED-Talk und vier neue Stories von Chimamanda Ngozi Adichie Die junge Bestsellerautorin Chimamanda Ngozi Adichie begeistert mit ihrem TED-Talk ›We Should All Be Feminists‹ (dt.: ›Mehr Feminismus!‹). Der vielfach geteilte Vortrag, den Popsängerin Beyoncé Knowles in ihrem Song ›Flawless‹ sampelte, liegt hier nun zum Nachlesen vor. Ergänzt wird er durch vier neue Stories, die Adichies Rang als herausragende Erzählerin untermauern. Mit ihren eindringlichen Geschichten gelingt es Adichie, das Innerste ihrer Figuren bloßzulegen und gesellschaftliche Wahrheiten zu enthüllen. Sie erzählt davon, wie Rollenerwartungen erlernt und gebrochen werden, von Schuld, Scham, Sexualität, Feminismus, Liebe und Heimat. Ihre messerscharfen Beobachtungen unserer Zeit sind eine literarische Offenbarung, die den Schimmer einer toleranteren Welt aufscheinen lässt. Mehr Feminismus! ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Ein Muss für alle, die sich nach einer gerechteren Gesellschaft sehnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Chimamanda Ngozi Adichie
Mehr Feminismus!
Ein Manifest und vier Stories
Über dieses Buch
Mit ihrem berühmten TED-Talk verankert die junge nigerianische Bestsellerautorin den Feminismus fest in der Popkultur und mit ihren Geschichten gelingt ihr, was nur große Literatur vermag: Minutiös legt sie das Innerste ihrer Figuren bloß und enthüllt damit Wahrheiten unserer Gesellschaft, die so offenkundig sind, dass wir sie kaum jemals durchschauen. Adichie erzählt davon, wie man Rollenerwartungen erlernt, und davon, wie man lernt, sie zu brechen. Sie erzählt von Schuld, Scham und Sexualität, von Liebe und Heimat. Über all ihren Geschichten liegt der helle Schimmer einer besseren, einer toleranteren Welt. Adichie ist eine hellwache Beobachterin unserer Zeit und ihre Stories sind eine literarische Offenbarung.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Chimamanda Ngozi Adichie ist eine der großen jungen Stimmen der Weltliteratur. Für ihren Roman ›Americanah‹ erhielt sie den Heartland Prize for Fiction sowie den renommierten National Book Critics Circle Award for Fiction 2013. ›Blauer Hibiskus‹ war für den Booker-Preis nominiert. Ihr Werk ist in 37 Sprachen übersetzt. Sie wurde 1977 in Nigeria geboren und lebt in Lagos und den USA.
Impressum
Erschienen bei FISCHER digiBook
Das Manifest ›Mehr Feminismus!‹ erschien 2014 unter dem Titel
›We should all be Feminists‹ bei Fourth Estate, London
© Chimamanda Ngozi Adichie 2014
Die Story ›Meine Mutter, die durchgeknallte Afrikanerin‹
erschien 2009 unter dem Titel ›My Mother, the Crazy African‹
in ›One World. A Global Anthology of Short Stories‹ bei
New Internationalist Publications Ltd, Oxford
© Chimamanda Ngozi Adichie 2009
Die Stories ›The Feminine Mistake‹ (›Der weibliche Irrtum‹), ›The Grief of Strangers‹ (›Der Schmerz Fremder‹) und ›Apollo‹ liegen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches im Original noch nicht in Buchform vor.
© Chimamanda Ngozi Adichie 2015
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München
Coverabbildung: Ivara Esege
ISBN 978-3-10-403523-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
MEHR FEMINISMUS!
Ein Manifest
Dies ist die leicht revidierte Version einer Rede, die ich im Dezember 2012 bei der jährlich stattfindenden Konferenz TEDxEuston gehalten habe, die Afrika zum Gegenstand hat. Kurze Reden aus unterschiedlichen Bereichen sollen Afrikanerinnen und Freunde Afrikas provozieren und inspirieren. Ein paar Jahre zuvor hatte ich auf einer anderen TED-Konferenz darüber gesprochen, wie Stereotype unser Denken formen und einschränken, insbesondere wenn es um Afrika geht. »Die Gefahr einer einzigen Geschichte« hieß damals mein Vortrag. Mir scheint, dass auch feministische Denkansätze von Stereotypen eingegrenzt werden. Als mein Bruder Chucks und mein bester Freund Ike, beide Mitorganisatoren der TEDxEuston-Konferenz, darauf bestanden, dass ich wieder sprach, konnte ich nicht ablehnen und beschloss, über Feminismus zu reden, weil ich dazu klare Ansichten habe. Ich nahm an, das Thema sei nicht sehr populär, hoffte jedoch, eine notwendige Diskussion anzustoßen. Doch als ich an jenem Abend auf der Bühne stand, hatte ich das Gefühl, im Kreis meiner Familie zu sein: Das Publikum war freundlich und aufmerksam, aber womöglich hatte es etwas gegen das Thema meines Vortrags. Die stehenden Ovationen am Ende haben mir Hoffnung gemacht.
Okoloma war einer meiner besten Kindheitsfreunde. Er lebte in meiner Straße und kümmerte sich um mich wie ein großer Bruder: Wenn mir ein Junge gefiel, fragte ich Okoloma nach seiner Meinung. Er war witzig, intelligent und trug spitze Cowboystiefel. Im Dezember 2005 kam er bei einem Flugzeugabsturz im Süden Nigerias ums Leben. Es fällt mir immer noch schwer, in Worte zu fassen, wie ich mich damals fühlte. Okoloma war jemand, mit dem ich streiten, lachen und wirklich reden konnte. Und er war der Erste, der mich eine Feministin nannte.
Ich war ungefähr vierzehn. Wir waren bei ihm zu Hause und stritten, beide strotzten wir vor halbverdautem Wissen aus den Büchern, die wir gelesen hatten. Ich weiß nicht mehr, worum es bei diesem Streit ging. Aber ich weiß noch, dass Okoloma mich unverwandt anschaute, während ich argumentierte, und sagte: »Dir ist doch klar, dass du eine Feministin bist.«
Es war kein Kompliment. Ich hörte es seinem Tonfall an – der gleiche Tonfall, in dem jemand sagt: »Du unterstützt den Terrorismus.«
Ich wusste nicht genau, was das Wort Feministin bedeutete. Aber ich wollte nicht, dass Okoloma erfuhr, dass ich es nicht wusste. Also tat ich es ab und stritt weiter. Ich hatte vor, es im Wörterbuch nachzuschlagen, kaum wäre ich zu Hause.
Schnell ein paar Jahre weiter.
Im Jahr 2003 schrieb ich einen Roman mit dem Titel ›Blauer Hibiskus‹ über einen Mann, der unter anderem seine Frau schlägt und dessen Geschichte nicht allzu gut endet. Während ich das Buch in Nigeria vorstellte, wollte mir ein Journalist, ein netter, wohlmeinender Mann, einen guten Rat geben. (Nigerianer sind, wie Sie vielleicht wissen, mit ungefragten »Ratschlägen« großzügig.)
Er erklärte mir, dass die Leute meinen Roman für feministisch hielten, und sein Rat war – er schüttelte bekümmert den Kopf, während er sprach –, dass ich mich nie so nennen sollte, da Feministinnen Frauen sind, die unglücklich sind, weil sie keinen Mann finden.
Also beschloss ich, mich eine glückliche Feministin zu nennen.
Als Nächstes belehrte mich eine nigerianische Akademikerin, dass der Feminismus nicht zu unserer Kultur gehöre, dass Feminismus unafrikanisch sei und ich mich nur eine Feministin nennen würde, weil ich von westlichen Büchern beeinflusst sei. (Was mich amüsierte, denn ein Großteil meiner frühen Lektüre war definitiv nicht feministisch: Ich muss jeden einzelnen Liebesroman von Mills & Boon gelesen haben, der vor meinem sechzehnten Geburtstag veröffentlicht wurde. Und jedes Mal, wenn ich mir einen sogenannten »klassischen feministischen Text« vornehme, langweile ich mich und kann ihn nur unter Mühen zu Ende lesen.)
Da der Feminismus unafrikanisch ist, beschloss ich jedenfalls, mich von nun an als glückliche afrikanische Feministin zu bezeichnen. Dann sagte ein lieber Freund, mich eine Feministin zu nennen hieße, dass ich Männer hasste. So wurde ich zu einer glücklichen afrikanischen Feministin, die Männer nicht hasst. Irgendwann war ich eine glückliche afrikanische Feministin, die Männer nicht hasst und Lippenstift und hohe Absätze zum eigenen Vergnügen und nicht zum Vergnügen der Männer trägt.
Natürlich war viel davon ironisch, aber es beweist, wie stark belastet, wie negativ belastet das Wort Feministin ist:
Du hasst Männer, du hasst BHs, du hasst afrikanische Kultur, du bist der Ansicht, dass Frauen immer das Sagen haben sollen, du trägst kein Make-up, du rasierst dir nicht die Beine, du bist immer wütend, du hast keinen Sinn für Humor, du benutzt kein Deodorant.
Eine weitere Geschichte aus meiner Kindheit:
Als ich in Nsukka, einer Universitätsstadt im Südosten von Nigeria, in die Grundschule ging, sagte meine Lehrerin zu Beginn des Schuljahrs, dass die Klasse eine Prüfung ablegen müsse und wer am besten abschnitte, würde zum Aufpasser der Klasse. Aufpasser zu sein war eine große Sache. Wenn man Klassenaufpasser war, schrieb man jeden Tag die Namen derjenigen auf, die den Unterricht störten, was allein schon eine berauschende Machtfülle war, aber meine Lehrerin stattete den Aufpasser zudem mit einem Rohrstock aus, den man in der Hand hielt, während man auf der Suche nach Störenfrieden durch das Klassenzimmer patrouillierte. Natürlich durfte man den Stock nicht wirklich benutzen. Aber für mich als Neunjährige war es eine aufregende Aussicht. Ich wollte unbedingt Klassenaufpasserin werden. Und ich schnitt bei der Prüfung am besten ab.
Doch dann erklärte die Lehrerin zu meiner Überraschung, dass der Aufpasser ein Junge sein müsse. Sie habe vergessen, das von Anfang an klarzumachen; sie habe angenommen, dass jeder es wüsste. Ein Junge hatte als Zweitbester abgeschnitten. Er wurde Aufpasser.
Interessanter noch war, dass dieser Junge lieb und sanftmütig war und keinerlei Interesse daran hatte, mit einem Stock in der Hand die Klasse zu überwachen. Während ich ehrgeizig darauf brannte.
Aber ich war ein Mädchen, und er war ein Junge, und er wurde Klassenaufpasser.
Diesen Vorfall habe ich bis heute nicht vergessen.
Wenn wir etwas immer wieder tun, wird es normal. Wenn wir die gleiche Sache immer wieder sehen, wird sie normal. Wenn nur Jungen Aufpasser werden, dann denken wir alle irgendwann, wenn auch nur unbewusst, dass Klassenaufpasser Jungen sein müssen. Wenn wir nur Männer als Firmendirektoren sehen, scheint es irgendwann »naturgegeben«, dass ausschließlich Männer Firmendirektoren sein sollen.
Ich mache oft den Fehler zu glauben, dass etwas, was für mich auf der Hand liegt, für alle anderen ebenso offensichtlich ist. Nehmen wir meinen guten Freund Louis, der ein intelligenter, fortschrittlicher Mann ist. Wenn wir uns unterhielten, sagte er oft: »Ich verstehe nicht, was du damit meinst, wenn du sagst, die Dinge sind für Frauen anders und schwieriger.« Ich verstand nicht, warum Louis nicht sah, was so offensichtlich war.
Ich bin gern zu Hause in Nigeria und verbringe viel Zeit in Lagos, der größten Stadt und dem wirtschaftlichen Zentrum des Landes. Wenn abends die Hitze nachlässt und das Leben zur Ruhe kommt, gehe ich mit Freundinnen und Freunden oder der Familie in ein Restaurant oder ein Café. An einem dieser Abende waren Louis und ich mit Freunden unterwegs.
In Lagos gibt es eine wunderbare Einrichtung: Eine kleine Gruppe tatkräftiger junger Männer treibt sich vor bestimmten Etablissements herum und »hilft« dir auf höchst dramatische Weise, deinen Wagen zu parken. Lagos ist eine Metropolis mit nahezu zwanzig Millionen Einwohnern, mehr Energie als London, mehr Unternehmergeist als New York, und die Leute erfinden alles Mögliche, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wie in den meisten Großstädten kann es abends schwierig sein, einen Parkplatz zu finden, und die jungen Männer machen ein Geschäft daraus, freie Parkplätze zu suchen und – auch wenn genügend davon vorhanden sind – dir mit wildem Gestikulieren beim Einparken zu helfen und auf deinen Wagen »aufzupassen«, bis du zurückkommst. Ich war beeindruckt von der besonderen Theatralik des Mannes, der uns an diesem Abend zu einem Parkplatz dirigierte. Als wir gingen, wollte ich ihm ein Trinkgeld geben. Ich öffnete meine Tasche, holte Geld heraus und gab es dem Mann. Und er, dieser zufriedene und dankbare Mann, nahm das Geld, schaute an mir vorbei zu Louis und sagte zu ihm: »Danke, Sah!«
Louis sah mich überrascht an und fragte: »Warum bedankt er sich bei mir? Ich habe ihm das Geld nicht gegeben.« Da konnte ich an Louis’ Gesicht ablesen, wie ihm eine Erkenntnis dämmerte. Der Mann glaubte, dass alles Geld, das ich hatte, ursprünglich von Louis stammte. Weil Louis ein Mann ist.
Männer und Frauen sind verschieden. Wir haben unterschiedliche Hormone, unterschiedliche Geschlechtsorgane und unterschiedliche biologische Fähigkeiten – Frauen können Kinder kriegen, Männer nicht. Männer haben mehr Testosteron und sind in der Regel physisch kräftiger als Frauen. Es gibt etwas mehr Frauen auf der Welt als Männer – 52 Prozent der Weltbevölkerung sind weiblich –, doch die meisten Macht- und Prestigepositionen sind von Männern besetzt. Die verstorbene kenianische Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai hat es einfach und treffend ausgedrückt, als sie sagte: je höher die Positionen, umso weniger Frauen.
Während der letzten Wahlen in den USA haben wir mehrfach von Lilly-Ledbetter gehört, und dabei ging es um Folgendes: In den USA verrichten ein Mann und eine Frau mit der gleichen Qualifikation die gleiche Arbeit, und der Mann wird besser bezahlt, nur weil er ein Mann ist.
Männer beherrschen die Welt also tatsächlich. Das war sinnvoll – vor tausend Jahren. Weil die Menschen damals in einer Welt lebten, in der körperliche Stärke der wichtigste Garant war, um zu überleben; eine physisch stärkere Person war mit großer Wahrscheinlichkeit ein Anführer. Und Männer sind im Allgemeinen stärker. (Es gibt natürlich etliche Ausnahmen.) Heute leben wir in einer ganz anderen Welt. Die zum Führen qualifiziertere Person ist nicht die physisch stärkere Person. Es ist die intelligentere, die kenntnisreichere, die kreativere, die innovativere. Und diese Eigenschaften werden nicht von Hormonen bestimmt. Ein Mann ist mit der gleichen Wahrscheinlichkeit intelligent, kreativ, innovativ wie eine Frau. Wir haben uns entwickelt. Doch unsere Vorstellungen von den Geschlechterrollen sind zurückgeblieben.