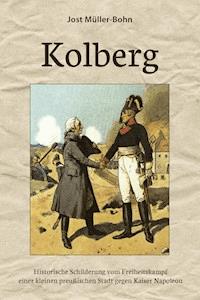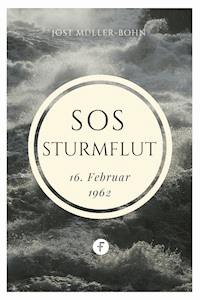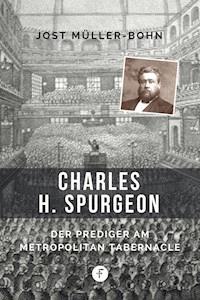Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 2. Weltkrieg
- Sprache: Deutsch
Familie Nowaks zweiter Sohn, Eberhard, erlebt den Krieg als Navigator und Fotograf in einer Aufklärungsmaschine, während sein Bruder Hans als Infanterist das Ende der Vorwärtsstrategie der deutschen Wehrmacht in Russland bis zur furchtbaren Kesselschlacht bei Stalingrad erleidet. Im Elternhaus in Berlin erleben die Eltern Nowak die ganze Not der Ungewissheit über das Ergehen der Söhne an der Front. Ihre flehende Fürbitte, auch für Ruth Engelmann, ist das einzige, was sie tun können. Die Trilogie „Bleib du im ewgen Leben mein guter Kamerad“ zeigt die ganze Problematik des Verhaltens von entschiedenen Christen in einem furchtbaren Krieg und unter dem antichristlichen Gewaltregime auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bleib du im ewgen Leben mein guter Kamerad
Band II
Jost Müller-Bohn
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Cover: Caspar Kaufmann
Autor: Jost Müller-Bohn
Lektorat: Mark Rehfuß, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-95893-048-3
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Das eBook Bleib du im ewgen Leben mein guter Kamerad – Band 2 ist als Buch erstmals 1981 erschienen.
Autorenvorstellung
Jost Müller-Bohn, geboren 1932 in Berlin, ist der bekannte Evangelist und Schriftsteller von über 40 Büchern. Er studierte in Berlin Malerei und Musik. Über 40 Jahre hielt er missionarische Vorträge. Seine dynamische Art der Verkündigung wurde weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt.
Als Drehbuchautor und Kameramann ist er der Begründer der „Christlichen Filmmission“. Seine Stimme wurde unzähligen Zuhörer über Radio Luxemburg bekannt. Einige seiner Bücher wurden zu Bestsellern in der christlichen Literatur.
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Autorenvorstellung
Vorwort
Wissen ist Macht
Der Startbefehl
Die Frühjahrsoffensive
Die Vermisstenanzeige
Raserei des Todes
Oase des Friedens
Nach Ostland geht unser Ritt
Die apokalyptischen Reiter
Verkehrte Flucht
Christus in Stalingrad
Unsere Empfehlungen
Vorwort
»Es kommt Krieg!« sagte die Mutter, »an der Grenze wird schon geschossen!« Sie blickte besorgt in die Ferne. Ich hielt mich fest an ihrer Hand und schaute mit angstvollem Gefühl in die Dämmerung bis hin zur dunklen Hecke. Ich meinte, nicht weit von dieser Hecke entfernt müsse die Grenze zwischen Krieg und Frieden sein.
Die Menschheit stand am Abgrund eines furchtbaren Weltkrieges, des schrecklichsten, der je über die Erde seit Schöpfungsbeginn kommen sollte.
Nun sind bereits über vierzig Jahre vergangen seit den ersten Schüssen zu diesem zweiten Weltkrieg. Viele Wunden sind verheilt, manches Grauen fast vergessen, leider aber auch Gottes Güte und Erbarmen, welche in vielen Einzelschicksalen sichtbar geworden waren.
In dieser Berichterstattung sollen keine alten Dinge wieder aufgewärmt werden, wie es im Trend unserer Zeit liegen mag, sondern der Name Gottes soll verherrlicht werden, der in den Tagen größter Not für viele die einzige Zuflucht und Hilfe war.
In diesem Werk soll keinem Menschen ein Heldendenkmal gesetzt werden, wir sollen aber erinnert werden an wunderbare Führungen und Bewahrungen in gefahrvollster Zeit.
In den vergangenen Monaten wurden mir so viele eindrucksvolle Zeugnisse vom Wirken Gottes im Leben einzelner Familien während des Krieges, die Gott allein vertraut haben, erzählt, dass ich mich entschloss, aus den hervorragendsten Berichten ein Gemälde der Vergangenheit zu gestalten. Ich hielt es für angebracht, aus der Vielzahl der Berichte eine fortlaufende, zusammengefasste Erzählung niederzuschreiben, wobei Namen von noch lebenden Personen rein zufällig wären. Die Begebenheiten, die hierin geschildert werden, beruhen aber auf durchlebten Erfahrungen. Nie werde ich die Tatsache vergessen, dass sich ein junger Christ aus unserer Heimat freiwillig gemeldet hat für die Schlacht um Stalingrad, um damit einem Familienvater die Rückkehr aus dem Kessel zu ermöglichen. Er selber hat dadurch sein Leben geopfert, denn er hat seine irdische Heimat nie wiedergesehen. Auch von ihm werden wir in diesem Buch lesen können.
In der Person des Hans Nowak wurden Zeugnisse von ehemaligen Frontkämpfern, die als Jünger Jesu in den Kriegsdienst berufen wurden und die erregenden Jahre des Krieges miterlebt haben, dargestellt. Es wurden Auszüge aus Fronttagebüchern und Berichte verwandt, um ein möglichst umfassendes Bild aus dieser Zeit von den damaligen Umständen wiedergeben zu können. Viele Gespräche, die ich mit überzeugten Christen geführt habe, wurden bei der Schilderung des Russlandfeldzuges verwandt, um somit eine viel zu wenig beschriebene Seite des Krieges zu beleuchten, nämlich die bewahrende Gnade und die wunderbaren, das soll heißen: die an Wunder grenzenden Führungen Gottes in den seelenlosen Materialschlachten des zweiten Weltkrieges.
Möge es dem Geist Gottes gelingen, viele durch diese Erzählung an die Wohltaten des Schöpfers inmitten des Infernos von Schlachten nachdrücklich zu erinnern und so manchem noch sein einst gegebenes Gelübde ins Gedächtnis zurückrufen, das er seinem Schöpfer gegeben hat, als er in Todesnöten nach ihm rief.
Die bewegte Vorgeschichte des Gefreiten Hans Nowak wurde im ersten Band unter dem Titel »Bleib du im ewgen Leben« dargestellt. Hans Nowak ist seit der Schlacht um Stalingrad vermisst. Den Russlandfeldzug hatte er in allen Phasen in der ersten Kompanie mitgemacht. Als überzeugter Christ lernt er hier seine Kameraden kennen, die ihn verspotten und verlästern, aber auch einige, die nachdenklich werden und miterleben, welche Kraftwirkungen durch Gottes Geist von dem »Schutzengel« der Kompanie ausgehen. Ihm besonders zugetan sind Albert Kusserow sowie der Obergefreite Kittel, der urwüchsige Berliner.
In der Heimat lebt und leidet die Zivilbevölkerung im täglichen Leben wie bei den nächtlichen Bombenangriffen.
In Berlin findet Ruth Engelmann, die Tochter jüdischer Eltern, Unterschlupf im Hause der Eltern von Hans Nowak.
Als der Frontkämpfer Hans zum Weihnachtsfest auf Urlaub kommt, begegnet er Ruth und empfindet starke Sympathien für die jüdische Schutzbefohlene im Hause seiner Eltern.
Die Christen Russlands atmen nach dem Einmarsch der Deutschen auf, weil sie glauben, dadurch endlich frei und öffentlich ihren Glauben bezeugen und nach ihm leben zu können. Sie berichten den deutschen Soldaten von den abenteuerlichen Missionsdiensten im Untergrund während der Stalin-Ara.
Bei der Winterschlacht im hohen Norden von Russland werden Teile der ersten Kompanie, der sogenannten »Kampfgruppe Köhler«, eingeschlossen. In einem todesmutigen Ausbruch bei arktischen Temperaturen von 45° C unter Null erleben die Front-kämpfer die bewahrende Gnade Gottes.
Hier nun beginnt der zweite Teil der nach Tagebüchern und Erlebnisberichten niedergelegten Erzählung unter dem Titel.
Wissen ist Macht
Die stark dezimierte Kampfgruppe Köhler soll nach den schweren Kämpfen wieder aufgefrischt werden. Die ungeheuren Strapazen, die Anstrengungen und die Verluste beim Ausbruch aus dem Kessel sind an keinem spurlos vorübergegangen. Die körperlich und seelisch erschöpften Infanteristen bedürfen unbedingt der Ruhe und Erholung.
Ein Vorauskommando unter der Führung von Oberfeldwebel Heinze wird in ein kleines Etappenstädtchen, etwa 200 km hinter der Front gelegen, geschickt. Sie sollen Quartiere einrichten. Der Ortskommandant, ein echter Etappenhase, ist bereits durch den Divisionskommandeur informiert.
Im Morgengrauen trommeln Heinze und seine Männer den »hohen Herrn« aus den Federn. Im Laufe des Nachmittags werden die Quartiere besichtigt und eingeteilt. Die Kampfgruppe Köhler kann einrücken. Zunächst aber müssen die aus den Gräben und Löchern kommenden verdreckten Landser in die Entlausungsanstalt. Eine kräftige Desinfektionsdusche soll sie von den heimtückischen »Haustierchen« befreien. Mit zwei Lastwagen kommen die ersten Kämpfer bei Eis und Schnee in der Etappe an. Die Männer sind zum Umfallen müde. In den weit auseinanderliegenden Quartieren sinken sie dann erschöpft auf ihre Lager nieder.
In der öden, fast leeren Provinzstadt bleiben alle Läden geschlossen. Auch gibt es kaum ein Gasthaus. Eine einzige »Hauptstraße« mit flachen, grauen Häusern bildet den Kern der Ortschaft. Einige altmodische Villen mit den typisch russischen Türmchen auf den Dächern beleben das eintönige Panorama etwas. Die Menschen auf den Straßen erinnern an Hauptfiguren in altrussischen Romanen, wie etwa korrupten Richtern, bestechlichen Polizisten und dem allgewaltigen Bürgermeister.
In den Außenbezirken deuten schwere Häuserschäden und ganz zerstörte Fabrikanlagen auf erbitterte Kampfhandlungen hin. Im vereisten Stadtpark liegen die Reste eines umgestürzten Lenin- und Stalindenkmals unter Schnee.
An den öffentlichen Gebäuden hängen noch die großen Sowjet-sterne. Kleine Steinreliefs mit Darstellungen von Marx und Engels, Lenin und Stalin erinnern an die Machthaber dieses Landes. Die Hauswände haben teilweise riesige Löcher durch Granateinschläge.
Überall begegnet man der Sowjetpropaganda in kitschigen Bildern und Parolen.
In einem der öffentlichen Gebäude hat man ein Soldatenkino und eine Frontbühne eingerichtet. Die erschöpften Kämpfer sollen durch Unterhaltung aus dem grauen Alltag der Front herausgeholt werden und sich entspannen können.
»Wen die Götter lieben«, steht auf einem Plakat in deutscher Schrift über dem Eingang zum Kino. Darunter als zusätzliche Erläuterung: »Ein Spielfilm über das Leben des großen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart.«
In ehemaligen sowjetischen Kultursälen können die Männer Schach und Skat spielen. Vorsichtig, ja fast ein wenig ängstlich betreten die ersten Feldgrauen der Kampfgruppe die große Halle. Mit erstaunten Gesichtern betrachten sie die Marmortreppe und den spiegelglatten Parkettboden. Sie sehen den kleinen Musiksaal, in dem ein alter Bechstein-Flügel steht, das Billardzimmer und den Tischtennisraum. Welch ein unverständlicher Kontrast zu den primitiven Behausungen der Zivilbevölkerung.
Die Frontsoldaten haben sich bald eingelebt. Der Leiter des ›Fronterholungsheimes‹ ist ein überzeugter Nationalsozialist, er trägt das Goldene Parteiabzeichen, war Stammführer beim Jungvolk und hat das Deutsche Verdienstkreuz in Gold, genannt ›Parteiabzeichen für Kurzsichtige‹. Schon beim ersten Kameradschaftsabend entspinnt sich ein hitziges Streitgespräch zwischen dem Schulungsoffizier und der Mannschaft, die von vorderster Front gekommen ist. Dieser ›Etappenkrieger‹, wie ihn die Männer nennen, sieht blendend aus, sein glattrasiertes Gesicht wirkt jedoch ungemein ausdruckslos.
»Kameraden, ich bin stolz, euch als die Helden und Sieger dieses heiligen Kreuzzuges im Osten gegen die beiden großen Weltvergifter, den barbarischen Bolschewismus und das internationale Judentum, hier in diesem Hause begrüßen zu können. Die überlegene Kraft der germanischen Herrenrasse hat den Bolschewismus das Fürchten gelehrt. Gerade in den harten Winterkämpfen hat der deutsche Frontsoldat die feigen kommunistischen Horden in die Knie gezwungen. Durch den unerschütterlichen Glauben an unseren heißgeliebten Führer haben wir die Sowjets bereits vernichtend geschlagen. Dem letzten Aufgebot an schlecht ausgebildeten russischen Halbwüchsigen und Greisen werden unsere Divisionen im kommenden Frühjahr eine endgültige Vernichtungsschlacht liefern …«
Die Frontkämpfer haben erstaunt ihre Augen aufgerissen. Sie schütteln sich innerlich wie nach einem scharfen Schnaps. Sie trauen ihren Ohren nicht. Spinnt denn dieser geschniegelte Kerl da vorn? Ist es nun Dummheit oder gezielte Propaganda, was man ihnen da vorsetzt?
Hauptmann Köhler trommelt nervös mit seinen Fingern auf der Stuhllehne herum. Dann meldet er sich kurz entschlossen zu Wort.
»Ja bitte, Herr Hauptmann?« fragt der Schulungsoffizier mit näselnder Stimme.
»Herr Oberleutnant, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie unter-breche, aber Ihre Darlegung spricht der tatsächlichen Frontlage einfach Hohn! Wir kommen ja eben erst aus dem furchtbarsten Schlamassel. Mit Ach und Krach haben wir uns mit den gut ausgerüsteten sowjetischen Elitetruppen herumgeschlagen. Mit Aufbietung unserer letzten Kräfte sind wir aus dem Kessel bei Temperaturen von Minus 40 Grad Kälte ausgebrochen und haben uns in finsterer Nacht davongeschlichen. Sie behaupten nun, wir würden den Endsieg schon quasi in der Tasche haben!«
Des Hauptmanns Stimme klingt mächtig erregt. Er hat die Worte gereizt und in zunehmender Aggressivität hervorgeschleudert. Seine Adern an den Schläfen schwellen an, als er mit vor Zorn gerötetem Gesicht fortfährt: »Sagen Sie, haben Sie sich die Karte von Russland schon einmal richtig angesehen?«
»Was wollen Sie damit sagen?« fragt ihn der geschniegelte Parteioffizier.
»Ich meine, ob Sie schon einmal eine Gesamtübersicht von dem russischen Riesenreich gesehen haben! Bei allen grandiosen Kesselschlachten und Panzersiegen im vorigen Sommer, stehen wir noch immer am westlichen Rand dieses großen Landes, und zwar für meine Begriffe nur am äußersten Rand! Vor uns liegen weitere 8000 bis 9000 Kilometer, und kein Mensch weiß, was sich in diesem ungeheuer großen Hinterland verbirgt, wie viele Fabriken im Uralgebiet und in dem riesigen Sibirien auf Hochtouren arbeiten! Unsere eigenen Frontlinien sind zerfetzt! Nur unter größten Kraftanstrengungen halten wir die Winterstellungen, und wie ich sehe, nur notdürftig!«
»Herr Hauptmann …«, schroff und schneidend scharf fährt der NS-Führungsoffizier dem Kompaniechef in die Rede, »sollen Ihre Worte eine Kritik an unserem Führer sein?« Lauernd blickt er den Hauptmann an.
»Herr Oberleutnant, der Führer sieht die Lage sicher realistisch, aber ich glaube, er ist leider durch gefährliche Phantasten und ehrgeizige Schwärmer, die absolut nichts von der Kriegsführung verstehen, schlecht, ich meine sogar sehr schlecht beraten!
Eines ist klar, militärisch haben wir dem roten russischen Bären erst nur auf die Vorderfüße geklopft. Gewaltige Aufgaben stehen uns bevor. Wir wollen nicht nur siegen, wir müssen sogar siegen, sonst können wir alle unser letztes Gebet sprechen! Denn: ›Vae victis!«‹
»Was soll das heißen, Herr Hauptmann?«
»Das soll heißen: ›Wehe dem Besiegten!‹ und ich möchte noch hinzufügen: ›una salus victis nullam sperae salutem!‹, was bedeutet: ›Einziges Heil der Besiegten ist es, kein Heil zu erhoffen!‹ Darin stimmen wir wohl überein, nicht wahr, Herr Oberleutnant?«
Danach setzt er sich, und seine Männer blicken bewundernd auf ihn. Einige räuspern sich zustimmend.
Konsterniert und ein wenig zögernd antwortet der NS-Offizier: »Es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen einen militärwissenschaftlichen Vortrag zu halten. Eines aber ist sicher, die Juden und die bolschewistischen Horden sind die historischen Feinde unseres Volkes. Wir werden nicht ruhen, bis die Brut des internationalen Judentums mit Stumpf und Stiel ausgerottet ist! Die Juden haben diesen schmutzigen Krieg vom Zaun gebrochen. Dem Führer aber ist es gelungen, ihnen einen unmissverständlichen Denkzettel zu verpassen. Deutschland, unser Vaterland, wird von nun an nicht mehr durch das jüdische Gift verpestet werden. Die Juden sind ein arbeitsscheues, dummes, dreckiges und faules Gesindel. Deshalb mein Wahlspruch: ›Juda verrecke!‹«
Manche der Landser feixen oder gähnen provozierend vor sich hin, einige beherrschen meisterhaft die Kunst, mit geöffneten Augen zu schlafen. Markig und in zackigem Tonfall palavert der Braune in seiner geschniegelten Ausgehuniform weiter: »Die Nürnberger Gesetze haben den Juden als biologischen Faktor ein für allemal ausgeschaltet. Die nordische Rasse wird sich nie wieder durch das minderwertige Erbgut des jüdischen Blutes verunreinigen lassen …«
Im Hintergrund beginnt jemand zu schnarchen. Manche blicken schon nervös auf ihre Uhren und sehnen ein Ende herbei. Allen scheint diese Judenfrage im Augenblick furchtbar egal zu sein. Nur Hans Nowak und der Kompaniechef sind bei der Sache. Hans hat seinen Kopf auf die Ellbogen gestützt, um seine Mundwinkel zuckt es augenfällig. Seine Augen glänzen vor Erregung. Das liebliche Bild von seiner Ruth steht ihm vor Augen und leise flüstert er »Ruth«. Es ist ihm, als würde er den Hauch ihres Mundes spüren. Der Braune hämmert weiter: »Wir haben uns von der dekadenten Kultur dieser Unmenschen, wie der Musik, der Literatur und der Malerei befreit. Wir haben die schwülstige Erotik, die niedere Gesinnung der jüdischen Unkultur für alle
Zeiten begraben. Wir haben ihre Schmutz- und Schundliteratur in die reinigenden Flammen des nationalsozialistischen Feuers geworfen und für immer verbrannt!«
Hauptmann Köhler starrt angewidert auf den Referenten und sagt: »Herr Oberleutnant, könnten Sie den einfachen Männern hier, die wahrscheinlich nicht allzuviel von Literatur und Musik verstehen, einige Beispiele zur Beleuchtung Ihrer Ausführungen geben? Vielleicht wäre es angebracht, je einen Vertreter von Literatur, Musik und Malerei zu nennen, um uns dann an deren Werken die von Ihnen genannte Verderblichkeit dieser Künstler darzustellen.«
Der Hauptmann wagt es, den Schulungsoffizier aufs Glatteis zu führen. Er will ihn testen und in Widersprüche verwickeln und ahnt dabei noch gar nicht das Maß an Unwissenheit und Arroganz. An die Frontsoldaten gewandt, fragt der Kompaniechef: »Wer kann uns Dichter, Musiker oder Maler nennen, die jüdischer Herkunft sind, der Herr Oberleutnant ist gewiss gern bereit, durch typische Beispiele der genannten Personen uns seine Ausführungen daran zu erläutern.«
Hans Nowak erhebt sich und sagt: »Als Dichter möchte ich Heinrich Heine nennen, als Musiker den Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy und als Maler Professor Max Lieber-mann.«
»Gut, Nowak, ich danke Ihnen. Herr Oberleutnant kann uns nun anhand von einigen Details die zersetzende Art der jüdischen Kunst vor Augen führen.« Damit setzt sich der Hauptmann. Die Landser sind aufgewacht, denn sie ahnen, was sich da entwickeln wird und was ihr Kompaniechef vorhat.
Neugierig erwarten sie jetzt die Antworten des NS-Bonzen. Ihr Chef hat endlich ein wenig Schwung und Spannung in den müden Laden gebracht.
Leicht nervös und irritiert blickt der Schulungsoffizier in die Runde. Schließlich sagt er: »Nun, vom Namen her sind mir diese Leute – äh – schon bekannt – äh –, doch habe ich meine Zeit nie für die dreckigen Produkte der jüdischen Unterweltsmenschen vergeudet.«
»Das ist bedauerlich, Herr Oberleutnant, denn ich meine, man sollte seinen Feind eigentlich kennen, bevor man gegen ihn zu Felde zieht! Nun, vielleicht kann uns jemand von den Kameraden aushelfen und einige Werke nennen, die von den genannten Personen stammen.«
Hans Nowak meldet sich zu Wort. »Na, Nowak, bitte, was können Sie uns erzählen?«
»Der Dichter Heinrich Heine schrieb die Texte zu dem von Robert Schumann vertonten Liederzyklus »Dichterliebe«. Auch Schubert und Brahms haben Gedichte von Heinrich Heine vertont.
»Können Sie uns vielleicht einen Vers aus »Dichterliebe« zitieren?«
»Jawohl, Herr Hauptmann,« antwortete Nowak.
Dann rezitiert er:
»Im wunderschönen Monat Mai,als alle Knospen sprangen,da ist in meinem Herzendie Liebe aufgegangen.
Im wunderschönen Monat Mai,als alle Vögel sangen,da hab ich hier gestanden,mein Sehnen und Verlangen.«
Der Schulungsoffizier steht mit verschränkten Armen und einem verbissen dreinschauenden Gesicht an die Wand gelehnt, ja wie an die Wand gedrückt. Köhler, jetzt in seinem Element als Lehrer, der er im zivilen Beruf ist, fragt weiter:
»Welche Musik schrieb Mendelssohn?«
»Die biblischen Oratorien ›Elias‹ und ›Paulus‹.«
»Sehr gut«, lobt ihn der Hauptmann, »und können Sie uns auch ein Werk des Malers Max Liebermann nennen?«
»Ja, zum Beispiel ›Das Waisenhaus in Amsterdam‹.«
»Sehr richtig.«
Albert Kusserow möchte etwas sagen und meldet sich.
»Ja, Kusserow, was möchten Sie noch zu diesem Thema sagen?«
»Ich meine, die Bibel ist doch zum größten Teil von Juden niedergeschrieben worden, weshalb zitieren denn der Führer und der Reichspropagandaminister in ihren Ansprachen Zitate aus diesem von jüdischen Menschen geschriebenen Buch?«
»Das wäre eine Frage an unseren Herrn Oberleutnant, bitte, sagen Sie uns etwas dazu?«
Fast liebenswürdig grinst der Hauptmann Köhler zum Oberleutnant hinüber. »Sonst würde es noch heißen: ›Cum tacent, clamant‹.«
»Ich verbitte mir in diesem Hause solche Einmischung in einen nationalsozialistischen Schulungsunterricht, Herr Hauptmann! Diese Art von jesuitischen Einmischungen und Zersetzung des nationalsozialistischen Gedankenguts muss ich aufs Schärfste zurückweisen! Tatsache ist doch, dass die nationalsozialistische Bewegung und das internationale Judentum unversöhnliche Gegensätze sind. In diesem Krieg um Sein oder Nichtsein gibt es keine Sentimentalitäten gegenüber dem Weltfeind Nummer Eins, dem Judentum. Die Endlösung der Judenfrage wurde vom Führer befohlen, wir werden den Abschaum der Menschheit gnadenlos ausrotten! Jeder Jude ist ein Feind der humanistischen Gesellschaft, deshalb: Juda verrecke! – Wir danken unserm heißgeliebten Führer für seine Maßnahmen! Heil Hitler! – Sieg Heil!«
Bei der Ehrenbezeugung verliert der Oberleutnant fast sein Gleichgewicht, als er mit aller Energie den rechten Arm zum Deutschen Gruß emporstreckt.
Hauptmann Köhler erhebt sich in Zeitlupentempo und sagt müde: »Der Unterricht ist beendet, ich wünsche Ihnen allen noch gute Erholung und ein fröhliches Beisammensein in diesen Räumen oder auch in Ihren Quartieren.«
Bedrückt und keinesfalls erfreut über diesen unseligen Ausgang der ersten Empfangsstunde in der Etappe verlassen die Soldaten den Saal. »Junge, Junge, wenn det man jut jeht«, meint Kittel besorgt, »der Alte hat ja keen Blatt vorn Mund jenommen. Hoffentlich zeigt ihn der Klugscheißer nich bei der Jestapo an. Sag mal, wat hieß denn dat letzte … ›cum clana und noch so irjend wat?«
»Cum tacent, clamant heißt: ›Indem sie schwiegen, klagen sie an‹.«
Mensch, der Alte, der hat wat in sein' Jehirnkasten drin, ick jloobe, den Heini von der Partei is de Lust verjangen, uns wat zu lernen.«
»Uns was zu lehren«, sagt Hans lächelnd.
»Nee, ick meene, wat zu lernen! Jeleert werden wir von andere.«
»Komm, Siegfried, wir gehen mal ins Musikzimmer.« Hans greift seinen Kameraden am Arm und schiebt ihn durch die Tür. Dort setzt er sich an den Flügel und fängt an zu spielen. Einige Soldaten haben sich ihnen angeschlossen und singen nun mit ihren rauen Männerstimmen das in der Schulzeit gelernte Lied: »Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute, klinge kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite.«
Kaum jemand von ihnen weiß, dass dieses bekannte Volkslied von dem eben verpönten jüdischen Dichter Heinrich Heine gedichtet und von dem ebenfalls geächteten Musiker Felix Mendelssohn-Bartholdy vertont worden ist, auch nicht der Schulungsoffizier.
Die Ruhe in der Folgezeit tut den Landsern gut. Rasch haben sie sich an die normale Umgebung gewöhnt und dem jetzigen Rhythmus angepasst. Dort, wo sie ihr müdes Haupt hinlegen können, wo es ihnen nicht unverschämt auf den Kopf regnet oder Granaten hagelt, fühlen sie sich heimisch. Zunächst werden ihnen drei Tage ohne jeglichen militärischen Dienst gegönnt. Mit den Versorgungsfahrzeugen kamen vom Ersatzbataillon auch einige Kriegsfreiwillige zur Kompanie. Mit ihren neuen Uniformen und den unerfahrenen Kindergesichtern fallen sie dem Kommandeur beim Appell sofort auf. Von den alten Fronthasen werden sie nicht ganz für voll genommen. Wie kann man sich ›anno 1942‹ nur noch als Kriegsfreiwilliger melden und in die Zerreißmaschine des Todes begeben? Man nennt sie deshalb sarkastisch ›Kriegsmutwillige‹. Anständige Jungen und Männer bleiben, solange es irgend geht, in der Heimat, gehen zur Schule, studieren, arbeiten auf einem Bauernhof oder absolvieren eine Berufsausbildung.
»Die wollen doch nur die Helden spielen und Militärkarriere machen«, höhnt Unteroffizier Diehlmann.
In diesen recht friedlichen Tagen kommt es zu einem peinlichen Zwischenfall. Ein Kriegsfreiwilliger meldet dem Oberfeldwebel Heinze den Verlust seiner pelzgefütterten, warmen Lederhand-schuhe. Dabei verdächtigt er unglücklicherweise auch noch bewährte Frontsoldaten, die bereits mit dem »Gefrierfleisch-Orden« ausgezeichnet, aus der Winterschlacht als untadelige Kämpfer hervorgegangen sind.
Das ist zu viel! Heinze platzt der Kragen. Er brüllt den armen Jungen mit einer angestauten Bärenwut an: »Menschenskind, wir sind hier doch nicht im Kindergarten, mein Söhnchen! Sollen wir etwa auf deine Waschlappen oder deine warmgefütterten Handschuhe aufpassen? Wir können doch für dich keine extra Garderobenfrau anstellen, bei der du deine feinen Sachen abliefern und beaufsichtigen lassen kannst! Du kannst von Glück sagen, wenn dich dein Gruppenführer nicht wegen Verführung zum Kameradendiebstahl anzeigt! Vielleicht fehlt dir morgen noch die Unterhose, deine Socken oder das Gewehr und übermorgen die ›Hurra-Tüte«‹, brüllt Heinze, dass es durch die Gegend schallt. Völlig am Boden zerstört, verschwindet der langaufgeschossene, spindeldürre Kriegsfreiwillige wie ein geprügelter Hund. Er merkt mit aller Deutlichkeit, hier ist man wirklich nur der ›gemeine Mann‹, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bei diesem uniformierten Schlächterhandwerk werden Menschen in seelenloser Grausamkeit als Kanonenfutter vor gierige Maschinengewehre geworfen. Der Soldat ist dazu geboren, um zu sterben.
Hans, der das Spektakel mitangehört hat, geht dem ›Neuen‹ hinterher und nimmt ihn mit in sein Quartier. Dort versucht er, mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihn zu trösten. Es gelingt ihm, schnell in einen ganz persönlichen Kontakt zu dem Unglücklichen zu kommen. Er erfährt die Vorgeschichte dieses Jungen, der sich freiwillig gemeldet hatte.
Der Vater des Kriegsfreiwilligen von Hellwig war im Sommer 1941 als Major von russischen Partisanen in einen Hinterhalt gelockt und von ihnen erhängt worden. Die Frau des Majors übergab ihrem Sohn an dessen 18. Geburtstag die Dienstpistole des Vaters mit den Worten: »Räche deinen Vater, der von den Bolschewisten heimtückisch ermordet worden ist, hundertfältig!«
Nach der Grundausbildung kam der Rekrut Joachim von Hellwig als Fahnenjunker in ein Ersatzbataillon. Er hatte die gefütterten Lederhandschuhe des Vaters bei sich.
»Wir sind umgeben von Feinden, Hellwig«, sagte Hans. »Wir müssen uns nach innen und nach außen zur Wehr setzen! Doch Rache ist ein fragwürdiges Motiv. Weißt du, Rache ist nur neues Unrecht. Rache kann einen Menschen verwunden, vernichten, aber sie kann nie erlittenes Unrecht heilen. Rache ist wie der Stachel einer Biene, die sich selbst tötet, indem sie ihren Feind damit sticht. Hör mal, Hellwig, ich bin ein überzeugter Christ, deshalb ist das Wort Gottes für mich die Richtschnur, und an dieses halte ich mich, so gut ich kann. Es sagt mir zum Beispiel: ›Segnet, die euch fluchen! Tut wohl denen, die euch hassen! Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel! Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.««
Erstaunt blickt der Jüngling im feldgrauen Rock auf den ›alten‹ Frontkämpfer Hans Nowak, der eine ganze Ordenspalette an seinem Waffenrock trägt. Alles hat er erwartet, nur das nicht. Ein Mann mit diesen Tapferkeitsauszeichnungen soll fromm sein? Wie konnte man das begreifen?
»Soll man dem Unrecht freien Lauf lassen?« fragt er den Kameraden provozierend.
»Wenn alles Unrecht, was wir hier den einfachen Menschen in Russland zufügen, auf uns zurückkäme, würde Deutschland kaum eine Chance zum Überleben haben! Für mich gilt: ›Ist es möglich, so viel an mir ist, so hab' Frieden mit allen Menschen. Rächet euch selber nicht, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht Gott der Herr. Wenn deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das hat kein anderer als der Apostel Paulus geschrieben, und Matthias Claudius hat es so verstanden: ›Dürstet nicht nach Rache und Blut; vergeben wäre wohl so gut!‹«
»Sind Sie etwa Pfarrer?« möchte der Fahnenjunker wissen.
»Nein, mein Lieber, ich bin ein evangelischer Christ.«
»Das klingt mir alles sehr weltfremd, muss ich sagen. Für mich gilt die Devise: ›Aug um Auge, Zahn um Zahn!‹ Das steht doch wohl auch in der Bibel, oder? Ich will meinen Vater rächen. Meiner Mutter habe ich das heilige Versprechen gegeben. Trotzdem danke ich Ihnen. Wie war doch Ihr Name?«
»Hans Nowak.«
»Ja, nichts für ungut, Kamerad Nowak, aber ich möchte mein Versprechen einlösen. Vielleicht können Sie das verstehen.«
»Vielleicht, aber trotzdem will ich für Sie beten, dass Ihre Meinung sich ändert, ehe Sie ins Verderben rennen.«
Der zweite ›Neue‹ im dritten Zug heißt Matthias Grün. Bald nennt man ihn nur noch Grünewald, was seinen besonderen Grund hat.
Albert schreibt an seine Eltern: »… Wir hausen hier übrigens mit einer russischen Großmutter, deren Tochter und den Enkelkindern in einer Stube. Zweidrittel des Raumes sind ausgefüllt von dem Ofen mit der Ofenbank. Dieses Monstrum bildet für alle jetzt den Mittelpunkt des Daseins, denn Wärme ist alles. Die verrußten Deckenbalken hängen schon tief durch. Die Pfostenträger sind weiß gestrichen, in keinem Raum fehlt ein Heiligenbild. Die vier Hausinhaber schlafen oben auf dem Ofen. Sie haben ihre Schlafstatt mit einem Vorhang abgeschirmt. Die Kinder besitzen nur sehr einfaches, primitives Spielzeug. Überhaupt fällt uns die sehr einfache Lebensweise auf: viel geschmorter Kohl vom Fass, raues Maisbrot und Wasser. Keine Limonadengetränke. Hans und ich wollen morgen nach Z. zur Familie Gontscharow. Damals schrieb ich Euch doch von den überzeugten russischen Christen, die auf mich einen so großen Eindruck gemacht haben. Heute verstehe ich es noch besser, weil ich täglich das Vorbild eines echten Christen durch Hans vor mir habe.
Eben ist er gerade dabei, einen neuen Fahnenjunker zu trösten, der vom Vorgesetzten ordentlich zusammengedonnert worden ist. Täglich lesen Hans und ich in der Bibel, auch der urige Berliner Siegfried Kittel beteiligt sich daran. Ansonsten haben echte Christen ja mehr Feindschaft als Freundschaft zu erwarten. Leider, sage ich, obwohl es in dieser Zeit bitter nötig wäre, dass …«
Mit einem Melder der Division müssen Hans und Albert bald danach durch die schneeverwehte Landschaft fahren. Mühsam quält sich das Gefährt durch die Schneewehen. Die Scheiben sind ständig beschlagen, weil bei diesen außergewöhnlich tiefen Temperaturen die Scheibenheizung total versagt. Gegen solche Kältegrade kommt sie nicht an. Von Zeit zu Zeit unterbrechen die Männer ihre Fahrt, um sich in Bauernhäusern kurz aufzuwärmen. Hierbei treffen sie oftmals Kameraden von anderen Truppenteilen, die ebenfalls unterwegs sind. So mancher von ihnen hat noch immer keine entsprechenden Winterkleider, wie sie notwendig wären. Mit ihren relativ dünnen Sommermonturen sind die Landser der furchtbaren Kälte und dem eisigen Nordwind ausgesetzt. Pelze sieht man selten, und nicht einmal dicke Wintermützen mit Ohrenschutz besitzen die Soldaten. In ihren hohen Lederstiefeln bekommen viele von ihnen bei der enormen Kälte krampfartige Schmerzen in den Beinen und erleiden Erfrierungen.
Wider Erwarten kommen die drei in ihrem Pkw gut voran. Sie holpern über festgefrorene Knüppeldämme, sie quälen sich durch Massen von Treibschnee. Endlos zieht sich die Straße nach Westen, hin und wieder wird ihr Vorwärtskommen durch Schnee-wehen vorübergehend blockiert. Die Räder mahlen sich fest und fassen mitunter nicht mehr, obwohl sie Winterketten aufgelegt haben. Dann müssen Hans und Albert aussteigen und schieben.
Zu allem Unglück kommt in einer Flussniederung Nebel auf, so dass die Scheiben auch von außen vereisen. Alle paar hundert Meter halten sie an, um das Eis von der Scheibe zu kratzen. Irgendein Mittel zum Auftauen des Eises haben die deutschen Truppen nicht zur Verfügung. Auch Salzbeutel nützen nicht viel, der Frost ist einfach zu stark.
Nach stundenlanger Fahrt erreicht das Fahrzeug endlich die ihnen vertraute Etappenstadt Z. Das zerstörte Innenviertel ist total eingeschneit. In der ehemaligen Russenkaserne neben dem Lazarett befindet sich der Divisionsgefechtsstand.
»Also, in drei Stunden geht es wieder los, Kameraden!« sagt der Divisionsmelder. »Pünktlichkeit ist des Soldaten Freiheit!« Er bedankt sich für die Zigaretten und andere Kleinigkeiten, die die beiden ihm überreichen.
Schnell haben Hans und Albert das kleine Häuschen in der Puschkinstraße gefunden. Frau Gontscharow öffnet selbst die Tür. Die Überraschung ist den beiden gelungen, wie angewurzelt steht sie vor den deutschen Soldaten. Nur allmählich löst sich ihre Erstarrung. Hans und Albert scheinen eine gewisse Zurückhaltung in der dann doch geäußerten Wiedersehensfreude zu spüren. Die Kinder Natascha, Mischa und Igor sind in der Schule. Anja lebt zur Zeit bei der Großmutter auf dem Lande.
»Kommän Sie doch herein«, sagt sie zu den beiden.
»Wir kommen doch hoffentlich nicht ungelegen?« fragt Hans. »Nein, nein, härzlich willkommän!«
»Danke, wir beide haben uns schon so sehr auf ein Wiedersehen gefreut, und Albert konnte es kaum erwarten!«
Hans übergibt nach der Begrüßung Frau Gontscharow ein riesiges Paket mit ausgewählten Naturalien aus deutschen Heeresbeständen. »Ein kleiner Liebesgruß, liebe Schwester!«
»Oh, härzlichen Dank – vielen Dank, der Härr vergelte es euch!«
Hans stellt das schwere Paket auf die Bank und sagt: »Es ist auch noch etwas ganz Besonderes drin für die Geschwister der Gemeinde, einige Bibeln und Traktate in russischer Sprache! Da wird sich dein Mann aber freuen, nicht wahr?«
Das Gesicht von Frau Gontscharow verwandelt sich augenblicklich und spiegelt eine unendliche Traurigkeit wieder.
»Was ist?« fragt Hans.
»Er ist nicht mehr bei uns, die deutschen Parteileute haben ihn abgeholt und nach Deutschland zum Arbeitseinsatz abtransportiert.«
Hans und Albert stehen ganz benommen da und wissen nichts zu sagen. Damit hatten sie nicht im Entferntesten gerechnet. Frau Gontscharow erklärt:
»Zuerst gekommen deutsche Soldaten, waren gutt. Haben nur verlangt, was eben brauchen. Dann kommän SS-Polizeisoldaten – Gästapo – Nazi-Sonderführer – machen alles kapuut. Kein Vertrauen mär, nur Hass! Viele Männer jetzt bei Partisanen. Vorhär wir hofftän, dass Deutsche uns retten vor Stalin und Diktatur, jetzt alles kapuut.« Frau Gontscharow ist sehr traurig und entmutigt. Hans und Albert erfahren nun, zu welchem politischen Missgriff es im Hinterland in der Zwischenzeit gekommen ist. Die von Rassenwahn und Überheblichkeit beherrschten Zivilverwaltungen hausen wie die Vandalen in den besetzten Gebieten.
In Weißrussland sind die russischen Zivilisten vor den Deutschen geflohen wie vor dem Antichristen. Aber hier in den Gebieten des Baltikums wurden die Deutschen von den Bewohner vor wenigen Monaten wie ihre Befreier empfangen. Die Bauern hatten auf die Wiederherstellung ihrer Eigentumsrechte gewartet und die Befreiung vom Druck der Kolchosenwirtschaft. Vor allem erhoffte sich die Bevölkerung die Befreiung von dem allgegenwärtigen und unseligen Spitzel- und Aufpassersystem und das Ende der Verhaftungen in nächtlichen Stunden. Sie glaubten, Stacheldrahtzäune und Zwangsarbeitslager nicht mehr sehen zu müssen. Die Soldaten der Roten Armee hatten im Sommer 1941 beim Rückzug in ihren Heimatdörfern die Gewehre in die nächsten Straßengräben geworfen und waren in ihre Häuser gegangen in der Hoffnung, befreit zu sein von der roten ›Landplage‹, die ihrer Meinung nach der Teufel holen sollte.
»Jetzt hier genauso Zwang und Ungerächtigkeit wie vorher«, sagte Frau Gontscharow. »Schade, Deutsche hätten können haben ganze russische Reich. Die Bauärn müssen gähen arbeiten in deutsche Kolchosän – alles abliefern. Viele tausend Mänschen jäden Tag verschläppt nach Deutschland. Und die Judän – o nein, ganz furchtbar! Schräcklich – solche Teufel! Ich wissen, nicht alle Deutsche so sein, aber jetzt großer Hass gegen alle Deutsche. Wenn mich sähen andere von meine Volk, dass ich hab Deutsche in meine Haus, dann sähr gefährlich. Vielleicht kommän nächste Nacht Partisanen und zünden meine Haus an. Hass, Rache und Tod, von alle Seiten, besonders gegen Christen«, Frau Gontscharow spricht leidenschaftslos, einfach resignierend, hoffnungslos. Beschämt haben Albert und Hans ihr zugehört, erschüttert über das, was sie hören müssen von dieser einfachen Frau.
»So was kennen wir an der Front nicht«, sagt Albert.
»Ja, ich wissen, die meisten Deutschen wohl keine Nazis, aber hier jetzt Hölle auf Erden!«
Frau Gontscharow bietet ihren Gästen Tee an. Sie bewirtet ihre Gäste, so gut sie kann. Bei aller christlichen Gesinnung mit der Bereitschaft zur Vergebung, spüren Hans und Albert eine ein-schneidende Veränderung in der russischen Bevölkerung. Frau Gontscharow hat noch immer keine Nachricht, wo sich ihr Mann in Deutschland befindet.
»Der Herr weiß, er wird bewahren!« sagt sie ganz ruhig.
Bei dieser Gelegenheit erfahren sie auch, dass Kostja und andere Christen von Partisanen abgeholt worden sind. Noch bevor die Kinder aus der Schule kommen, verabschieden sich die beiden. Gegenseitig wünschen sie sich Gottes Segen und Bewahrung, nachdem sie miteinander gebetet haben. Traurig blickt Albert zu dem Haus zurück, in dem er das Abendmahl, den Bericht der jungen Christen und die herrliche Gastfreundschaft erlebt hatte. Vor allem bedauert er zutiefst, Natascha nicht mehr gesehen zu haben, in die er so verliebt ist.
»Es gibt bestimmt noch ein schreckliches Gericht Gottes über das deutsche Volk, soviel Unrecht kann nicht ungestraft bleiben!« stellt Albert fest.
Dann eilen sie zu der Kaserne, wo sie den Divisionsmelder wiedertreffen, mit dem sie zurückfahren müssen.
Der Startbefehl
Am Himmel türmen sich hohe Wolkengebirge auf. Frühlingsregen verwandelt die Landschaft in grundlosen Morast. Der Regen wird zum Wolkenbruch. Gewitter, Sturm und Hagelschauer verändern in wenigen Minuten das Aussehen der Landschaft. Schwere Nachtgewitter entladen sich mit gewaltigem Dröhnen. Sprühende Blitze und sintflutartige Regengüsse haben zwar die Luft gereinigt, aber das Land unwegsam gemacht. Auf den verschlammten und zerwühlten Wegen können selbst die wendigen Meldefahrer mit ihren schweren Motorrädern nur langsam vorankommen. Reitpferde kommen dadurch wieder zu Ehren. Oft genug aber müssen sich Melder zu Fuß durch Schlick, Schlamm und große Wasserpfützen hindurchquälen. Heimtückisch lauern Heckenschützen in gut getarnten Verstecken, und jeder unübersehbare Winkel wird zur tödlichen Gefahr. Die Etappe verwandelt sich in ein gnadenloses Kampfgebiet.
Die Straßenräumkommandos, ein bunt zusammengewürfelter Haufe von deutschen Soldaten und russischen Zivilisten, wühlen wie Wildschweine zwischen Fahrzeugen aller Art herum. Steckengebliebene Militärlastwagen sollen mit Karacho aus den versumpften Löchern herausgeschoben werden. Man baut dazu notdürftig Dämme aus Maisrohr. Jede Wegstrecke muss vor und hinter den Kolonnen ausgebessert, der schmutzige Brei gut verteilt werden. Jämmerliches Fluchen, Schimpfen und Schreien ist weithin zu vernehmen. An den gefährdeten Stellen versuchen sie mit Hunderten von Leibern, Annen und eingesunkenen Beinen die schweren Wagen meterweise schiebend, hebend, stoßend oder pressend voranzubringen. Schon bald ist ein Hohlweg nur noch mit einer Jauchegrube zu vergleichen. Geringste Steigungen werden zu unüberwindlichen Hindernissen. Alles gerät durcheinander: Munitionswagen, Verpflegungsfahrzeuge, Lastwagen aller Art stellen sich quer, Pferde scheuen, Motoren dampfen, planlos irrt der Mensch zwischen Pferd und Wagen hin und her. Vorbei-eilende Truppen versuchen zu helfen. Der Mensch dirigiert die Tiere, die die Motorenkraft ersetzen sollen, doch alles gerät in eine unübersichtliche Wirrnis.
Besorgt blicken die überforderten Offiziere zum Himmel. Wenn sich diesem chaotischen Gedränge nur nicht noch ein Tieffliegerangriff nähert! Die Vernichtung wäre unausdenkbar. Doch das mörderische Wetter scheint auch die Feindflieger abzuhalten. Ein peitschender Sturmregen bringt alles zum Stehen, Personen- und Lastwagen rutschen kreuz und quer, gleiten wie steuerlos dahin, schlingern und schaukeln gefährlich. Motoren brüllen und fauchen mit letzter Kraft. Schwere Versorgungswagen nicken, stellen sich steil, kippen schief ab und versinken im Schlamm. Die Räder erscheinen nur noch als Scheiben von braunem Lehm. Auch Schneeketten versagen in diesem Frühjahrssumpf. Selbst schwere Raupenschlepper bleiben stecken, Endstation! – Naturgewalt! Jeder Landser weiß, dass Sonne und Wind für nur wenige Stunden die einzige Hilfe und Rettung wären. Schnell würde sich dann die Landschaft ändern. Das Chaos könnte beseitigt werden. Doch die Schleusen des Himmels scheinen geöffnet. Kleine Wasserläufe werden zu Flüssen, Teiche und Tümpel zu Seen, hohe Pappeln, verkrüppelte Weiden, Holzbrücken und Dörfer werden ersäuft von diesem Frühlingsregen. Angestrichene graue Lehmhäuser mit verwahrlosten Strohdächern triefen vor Feuchtigkeit.
Noch immer regnet es. Erst in der Nacht kommt starker Wind auf. Für das Kampfgeschwader wird Orkanwarnung gegeben. Heulend fegen Sturmböen über das weite Land. Bei Morgengrauen ist der Himmel wie blankgefegt. Seit Tagen war der Startbefehl immer wieder verschoben worden. Er lautet: Wichtige militärische Anlagen, Brückenübergänge, Feldflughäfen und Eisenbahnknotenpunkte sind auszuschalten.
Unter Tarnnetzen versteckt stehen die Kampfbomber vom Typ He 111 und JU 88 am Platzrand unter Kiefern im Unterholz abgestellt. Fernaufklärer sollen sich nach dem Start dem Bomber-verband anschließen, um die Wirkungen der Angriffe durch Fotos festzuhalten und eventuelle Truppenbewegungen des Feindes aufzudecken. Die strategische Bedeutung ihrer Aufgabe ist klar.
Noch am selben Abend wird eine letzte Einsatzbesprechung abgehalten. Der leitende Einsatzoffizier erläutert anhand von neuesten Luftaufnahmen die Situation am Ziel. Zweigleisige Eisenbahnbrücken führen über einen Strom. Die gut sichtbaren Gleise führen in weitem Bogen direkt zu einem großen Güterverschiebebahnhof, der voller Nachschubzüge mit Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen steht. Aus den Luftbildern ist klar ersichtlich, wo die vereinzelten und leichten Flakstellungen der Sowjets liegen. Einen Tag zuvor schon war der Verschiebebahnhof fast zur Hälfte vernichtet worden. Die Flugabwehr ist viel zu schwach, um einen größeren, konzentrierten Angriff erfolgreich abzuwehren. Der Angriffsplan für das Kampfgeschwader und die begleitenden Jagdflugzeuge ist bis in die kleinsten Einzelheiten festgelegt. Die Begleitjäger sind angehalten, während des Anfluges und beim Angriff selber im verhaltenen Tempo mit den Bombern in Tuchfühlung zu bleiben. Das Ziel soll nach Möglichkeit ohne Behinderung und Verluste erreicht werden. Diese Aufgabe für die Jagdflugzeuge ist gar nicht so einfach zu erfüllen, denn die Geschwindigkeitsunterschiede bei den verschiedenen Flugzeugtypen sind ziemlich groß. Außerdem müssen sich die Jagdflieger größte Disziplin auferlegen, und zwar mit dem Verzicht auf ihre sonst gewohnte freizügige Kampfbeweglichkeit, dem Kampfverband sich anpassend. Je nach Lage, die sie vorfinden, sollen die Jäger nach erfolgtem Bombenangriff auch Bodenziele mit Bordwaffen bekämpfen.
Eberhard Nowak kommt, wie viele seiner Kameraden an diesem Abend, nur schwer in den Schlaf. Die Gedanken an den bevorstehenden Angriff wollen ihn nicht zur Ruhe kommen lassen. Viele Fragen gehen ihm durch den Sinn: Werden die Motoren und andere technische Anlagen einwandfrei funktionieren? Wie wird das Wetter sein? Werden sich die Jäger pünktlich in den Verband einfädeln? Wird es einen Luftkampf geben? Schon frühzeitig hatte sich Eberhard ins Bett gelegt, doch von Unruhe geplagt, steht er noch einmal auf und schreibt einige Zeilen an seine Mutter.
»Liebe Mutter, es drängt mich, noch schnell einige Zeilen an Dich zu schreiben. Ich möchte Dir für alle Liebe und Fürsorge danken. Ob ich morgen von einem wichtigen Feindflug zurückkommen werde, weiß ich nicht, alles liegt in Gottes Hand, seiner Führung unterstehe ich. Mein ganzes Leben habe ich vertrauensvoll unter Jesu Willen gestellt. Meine Gedanken sind oft bei Euch, liebe Mutter, hab Dank, herzlich Dank für Deine Geduld mit mir. Oft habe ich Dir Kummer und Sorgen bereitet, vergib mir bitte alle Schmerzen, die ich Dir zugefügt habe. In den letzten Tagen war mir oft das Dichterwort im Sinn: ›Wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden.‹ Es ist mir ein Herzensanliegen geworden, wie der weise König Salomo zu sprechen und zu handeln: ›Lass deinen Vater und deine Mutter sich freuen, und fröhlich sein, die dich geboren hat.‹ Es soll mir Richtschnur sein, wenn ich einst aus diesem grausamen Krieg heimkehren darf. Ja, eine Mutter hat man nur einmal, und eine Mutter weiß allein, was Lieben heißt und Glücklichsein. Nun ›Gute Nacht!‹ Mutter, und auf ein fröhliches Wiedersehen! Wenn nicht hier auf Erden, so dann ganz gewiss im Himmelreich!
Dein Eberhard«
Als der Offizier vom Dienst um 5 Uhr früh die Besatzungen wecken will, ist Eberhard bereits wach, seine Bibel liegt aufgeschlagen vor ihm. Kurze Zeit später trifft er die übrigen Mitglieder seiner Besatzung im Gefechtsstand, den Flugzeugführer Oberleutnant Hansen, den Navigator Leutnant Schwarzkopf und Franz Springer, den Funker und Bordschützen. Mit grauen, übernächtigten Gesichtern hören sie vom »Wetterfrosch« die letzten Meldungen des meteorologischen Institutes. Im westlichen Teil des zu überfliegenden Gebietes ist eine durchbrochene Wolkendecke, deren untere Grenze bei 2000 m über dem Boden liegt. Weiter nach Osten hin lösen sich die Wolken mehr und mehr auf. Über dem Zielgebiet herrscht aller Voraussicht nach eine klare Sicht.
Der Einsatzleiter ergänzt dazu: »Es kommt also darauf an, dass der Jagdschutz insbesondere im Zielraum funktioniert! Dies ist deshalb so wichtig, weil dort keine Wolken als rettende Flucht-möglichkeit vor feindlichen Jägern für unsere Bomber vorhanden sind. Der Führer des Angriffsgeschwaders Oberst Baumann gibt Ihnen das Signal zum Angriffsbeginn bekannt. Die allgemeine Startzeit ist 7 Uhr. Bitte Uhren vergleichen! Sonst noch irgendwelche Fragen? – Danke!« Die Besatzungen besteigen die klapprigen Feldomnibusse, die sie zu den Maschinen bringen.
Auf dem Rollfeld dröhnen die Motoren. Die Flugzeugwarte und das übrige Bodenpersonal haben noch alle Hände voll zu tun. Die Bombenwarte und der Waffenmeister sind bereits abgefahren. Die letzten Probeläufe der Flugzeugmotoren werden durchgeführt, ehe der Pilot mit der Besatzung die Maschine übernimmt. Fröstelnd besteigen Eberhard und der Flugzeugführer Oberleutnant Hansen die Kanzel. Schnell haben sich die Männer angeschnallt und schließen das Kabinenfenster.
In der . Kabine herrscht eine ungewöhnliche Nervosität und Ungeduld. An der Borduhr nähern sich die Zeiger der befohlenen Startzeit. Der Pilot beobachtet wieder und wieder das Wetter, die Wolken und die Windrichtung.
»Alle Mann auf Gefechtsposten?« fragt Oberleutnant Hansen. Durch das Kehlkopfmikrofon kommt es zurück: »Gefechtsposten 1 – 2 – klar!«