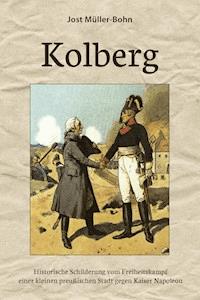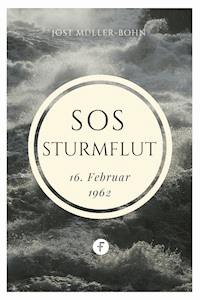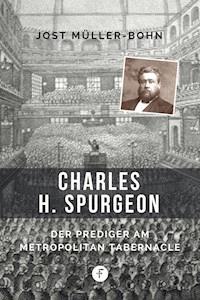Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Preußen-Saga
- Sprache: Deutsch
Am frühen Morgen des 15. August 1756 reißt ein donnerndes Trommelgewitter die Berliner aus dem Schlaf. Die Stadt, umgeben von Mauern und Toren, wird Zeuge des Moments, den viele bereits erwartet haben: Der Krieg gegen Österreich, Russland und Frankreich hat begonnen. Für Alexander Blankenburg bedeutet dieser Tag nicht nur den Beginn eines blutigen Konflikts, sondern auch einen herben persönlichen Verlust. Seine Hoffnungen auf eine engere Verbindung mit der adligen Jeannette von Priegnitz zerschlagen sich, als sie überstürzt mit dem russischen Fürsten Wobronski nach St. Petersburg aufbricht – aus Gründen, die ihm ein Rätsel bleiben. Mit seinen Kameraden stürzt sich Alexander in die Wirren des Krieges. Hass, Gewalt und Plünderungen sind allgegenwärtig, und die Grausamkeit des Schlachtfelds lässt kaum Raum für Hoffnung. Doch dann erhält er einen brisanten Auftrag: König Friedrich der Große beauftragt ihn, sich als russischer Offizier getarnt in das schwer befestigte Prag einzuschleichen und geheime Dokumente aus dem Hauptquartier des österreichischen Oberkommandos zu schmuggeln. Doch die Mission läuft aus dem Ruder. Als ein österreichisches Militärkommando eine plötzliche Hausdurchsuchung anordnet, droht Alexander aufzufliegen – und sein Leben hängt am seidenen Faden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Choral von Leuthen
Preußen-Saga Band 2
Jost Müller-Bohn
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Jost Müller-Bohn
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-034-6
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Ausmarsch aus Berlin
Schloss Greiffenhain
In geheimer Mission
Die Schlacht bei Prag
Das Drama von Kolin
Überraschender Besuch
Unter den Augen des Königs
Das Wunder von Leuthen
Ausmarsch aus Berlin
Seit Mitte August war in Preußen für alle Infanterie- und Kavallerieregimenter erhöhte Alarmbereitschaft angeordnet. Tagtäglich kamen neue Rekruten zu den Kompanien, die Freiwächter wurden ins Regiment zurückbeordert.
In den letzten Tagen segelten mit Kanonen und Proviant voll beladene Schiffe und Lastkähne auf der Spree flussabwärts in Richtung Süden.
Berlin erlebte noch einmal einen erdrückenden Hochsommertag. Bei Sonnenuntergang waren die Ziegel auf den Dächern noch immer glutheiß.
Hinter den streng bewachten Toren und Mauern der preußischen Garnisonsstadt hallten die Schritte und das Rufen der Patrouillen sowie der Offiziersronden durch die nächtlichen Straßen.
Im Quartier des Sergeanten Hermann Wuttke schnarchten die Musketiere Reinhold Friesicke, Leo Tafelski und Heinz Zittelmann nach den anstrengenden Übungsdiensten des vergangenen Tages. Alexander Blankenburg aber war schon kurz nach Mitternacht erwacht und konnte nicht wieder einschlafen. Noch immer lag bleierne Schwüle in dem niedrigen Raum. Unruhig wälzte sich der Pfarrerssohn hin und her, bald streckte er das linke, bald das rechte Bein unter der leichten Decke hervor. Gedanken über Gedanken reihten sich aneinander und jagten durch sein Gehirn. Je mehr er sich Mühe gab, um wieder in den Schlaf zu kommen, desto wacher wurde er. Er dachte an die vergangenen Wochen, an die überraschende Begegnung mit Fräulein von Priegnitz, an ihren Brief und an das ihm übersandte Medaillon. Immer wieder hatte er das kostbare Schmuckstück geöffnet und sich das liebe Antlitz seiner ihm zugeneigten Jeannette angeschaut, sie in Gedanken ans Herz gedrückt und das herrliche Miniaturportrait geküsst. Noch immer klang ihm ein Lied aus vergangenen Zeiten im Ohr:
»Sag mir, wo die Liebe wohnt,mein junger Gardeoffizier,sag mir, wo die Sehnsucht thront,ach Liebster, sag es mir.«
Jeannette hatte ihn aber auch mit Vorbedacht in die preußische Armee gelockt und dabei in ihm die Hoffnung geweckt, dass er bald, Sprosse um Sprosse erklimmend, die Höhe der Offizierslaufbahn erreichen könnte. Statt dessen war er in die gnadenlose Maschinerie des preußischen Drills geraten.
Nach dieser bitteren Ernüchterung war ihm bewusst geworden, dass er niemals Offizier, geschweige denn Gardeoffizier werden könnte. Trotzdem fühlte er sich nach ihrem eindeutigen Liebesgeständnis von der Anmut und dem Charme ihres Liebreizes erfüllt und durchdrungen.
Jetzt, mitten in der Nacht, vernahm er aus der Ferne das dumpfe Grollen eines nahenden Gewitters, das grelle Wetterleuchten wurde immer intensiver. Die schwüle, feuchtwarme Luft hatte ihre höchste Konzentration erreicht. Mit stärker werdendem Getöse zog ein mächtiges Unwetter heran. Blitze durchzuckten den hohen Himmel über Berlin, blendendes Licht erhellte immer wieder in Sekundenschnelle die kleine Schlafkammer der preußischen Soldaten. Ein sintflutartiger Wolkenbruch ging auf die heißen Dächer und Mauern der Stadt hernieder. Der scharfe Wind riss die Fenster auf. Dann begann es heftig zu prasseln. Kirschkerngroße Hagelkörner flogen auf das Kopfsteinpflaster und die Dachziegel. Endlich entlud sich ein schon vor Wochen erwarteter Regen über Stadt und Land.
Bei einem besonders kräftigen Blitzschlag schreckte Heinz Zittelmann hoch.
»Donnerlittchen!« rief er. »Was ist los?«
»Ein Gewitter ist das. Jetzt gibt es frische und gereinigte Luft. Schlaf weiter, Heinz«, beruhigte ihn Alexander.
Grunzend legte sich Zittelmann auf die andere Seite und schlief schnell wieder ein. Bald ließ der Schauer nach, es hörte auf zu regnen. Alexander schlummerte langsam wieder ein.
Schwer ging der Atem der beiden Schläfer in der stickigen Zimmerluft. Die kräftigen Glockenschläge der Stadtkirche erklangen dreimal.
Plötzlich dröhnte ein Schwall von unzähligen Trommeln in der ganzen Stadt. Sergeant Wuttke sprang aus seinem Bett. Draußen riefen Offiziere und Unteroffiziere: »Alarm! Alarm!« und schlugen mit ihren Spontons und Piken gegen die Haustüren. Durch alle Straßen der Stadt konnte man es hören: »Alarm! Alarm!«
Wuttke klopfte an die Türen der Soldaten: »Aufstehen, Ihr Kerls, aufstehen und fertigmachen!«
Die Soldaten griffen nach ihren Kleidern. Zittelmann saß noch einige Sekunden auf der Bettkante und kratzte sich am Hinterkopf: »Weeßte wat …, jetzt werden wir für längere Zeit keen richtiges Bett mehr zu Gesicht bekommen!«
Auch im Nebenraum rumorte es bereits. Schnell sprangen Reinhold und Leo aus den Betten. Die Soldaten drehten sich gegenseitig die Zöpfe, die Stiefeletten wurden zugeknöpft und darüber der blaue Rock angezogen. Alexander hängte sich behutsam das goldene Medaillon von Jeannette um den Hals.
Heinz grinste: »Ja, ja, Junge, Junge, vergiss die Liebe nicht.« Dann ging er an seinen Schrank, holte ein Stück Brot und eine harte Dauerwurst heraus. Stehend aß er gierig einige Happen. »Ein guter Magen kann allet vertragen, nur keene Eile«, er verschluckte sich und begann mächtig zu husten.
Sergeant Wuttke steckte schon wieder den Kopf in den Türrahmen: »Schockschwerenot, – seid Ihr Kerls immer noch nicht fertig? Der Feind wartet nicht, bis Ihr satt seid. Vorwärts! Raus mit Euch zum Abmarsch!«
Flink schnallten sich die beiden ihre weißen, breiten Säbelgurte um, dann wurden Patronentaschen mit je sechzig Schuss Munition über die linke Schulter geworfen.
»Schwer wie Blei macht bleich und frei«, fabulierte Heinz schon wieder. Dann wurden die Tornister übergeschnallt, sie waren mit Wäsche und anderen Utensilien vollgestopft, was man eben beim Marsch und im Krieg brauchte. Zuletzt kam noch eine Feldflasche aus Metall zu dem übrigen Gepäck. Das Gewehr wog allein schon achteinhalb Pfund. Trotzdem begann Heinz Zittelmann leise vor sich hinzusingen:
»So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage …«
Alexander stöhnte: »Ich muss schon sagen, eine ungeheure Last für alle Tage.«
Prompt antwortete Heinz: »Erst trag die Last, dann kommt die Rast. Marschieren wollen sie alle, nur fressen will keener!« Sein Mundwerk stand selten still.
Im Vorraum prüfte Wuttke beim Schein eines Talglichtes den Sitz der Uniformen, der Waffen und des Gepäcks. »He, Tafelski«, schrie er den Polen an, »Ihm liegt wieder der Puder pfundweise auf der Schulter. Ordnung und Sauberkeit waren wohl nie seine Taufpaten, wie?« Er klopfte ihm mit der flachen Hand die weiße Spreu von der Uniform.
Soldaten der bekannten Stadtregimenter rannten auf der Straße in verschiedene Richtungen und schleppten große Gepäckstücke mit sich. Bei manchen Ausländern herrschte trotzdem freudige Erregung, denn endlich war der langweilige Garnisonsdienst vorüber. Darüber hinaus schien ein leichtes Landsknechtsleben sehr verlockend zu sein. Gar manches fragwürdige Abenteuer wartete nun auf sie. Viele Ausländer, die man wie Alexander in die Armee gepresst hatte, dachten an die verschiedenen Fluchtmöglichkeiten beim Marsch durch Feindesland oder aber auch während des Getümmels einer Schlacht.
Die arme Frau Wuttke fiel ihrem Mann zum letzten Mal um den Hals und weinte bitterlich.
»Nur keine Weichlichkeiten, Frau Sergeant!« herrschte der drahtige Preuße seinen Ehegemahl an, »Sie heult ja wie ein jüdisches Klageweib! Haltung, Frau Wuttke! Wenn der König ruft, müssen alle anderen Dinge zurückstehen, hat Sie verstanden?«
Frau Wuttke nickte und schluckte heftig, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. »Gott behüt dich, mein herzensguter Mann«, brachte sie gequält über ihre Lippen. Vom Leid geschüttelt, sah sie ihm nach, wie er mit seinen vier Musketieren in der Dunkelheit verschwand.
Von allen Seiten marschierten Gruppen und Abteilungen heran und nahmen in der Krausenstraße Aufstellung.
»Siehste, det sind alles Männer von's Regiment ›Donner und Blitz‹«, sagte Zittelmann, »so nennt man die Soldaten des Regiments Itzenplitz.« Er machte mit seiner Rechten ein zuckende Abwärtsbewegung: »Die kommen alle wie een Blitz aus heiterem Himmel und dienen König Fritz auf seinem großen Schimmel.« Stolz auf sein dichterisches Talent, tippte sich Heinz auf die Brust.
Das Regiment hatte zwölf Kompanien zu je einhundertfünfzig Mann. Junge Bräute und Frauen, Väter und Mütter und auch Großeltern standen dicht gedrängt bei den abmarschbereiten, jugendlichen Männern. Sie umarmten und küssten einander. Man hörte ein lautes Schluchzen und auch Zurufe, die irgendeinem guten Bekannten oder Verwandten galten.
Junge Bräute und Frauen, Väter, Matter und auch Großeltern standen dicht gedrängt bei den abmarschbereiten Männern. Illustration: Adolph von Menzel
Familienvater Friesicke stand bei seiner Frau und seinen Kindern. Im Vergleich zu anderen musste Alexander bei ihnen feststellen, dass die beiden, die ebenso unter dem Abschiedsschmerz litten, diese letzten Minuten vor dem Abmarsch irgendwie gefasster und getragener erlebten. Alexander, der ziemlich einsam in der Menge verharrte, hörte, wie Reinhold seine Frau tröstete:
»Mein Liebes, sei ganz getrost. – Gestern, ehe ich mich zu Bett legte, las ich in der Heiligen Schrift das teure Gotteswort: ›Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest«‹. Er umarmte seine Frau, die das kleinste der Kinder auf dem Arm trug: »Der Herr segne dich und behüte dich, mein allerliebstes Weib. Ich werde immer an dich denken und täglich für euch beten.« Er legte seine Hand jeweils nacheinander auf die Köpfe seiner Kinder: »Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und gebe euch Frieden.« Noch einmal küssten sie sich.
Alexander war gerührt von dieser Abschiedsszene und den glaubensstarken Worten, die er so deutlich mithören konnte.
Jetzt wurde der Marsch geschlagen, die Trommeln grollten, die Querpfeifen fielen ein. Überall hörte man Kommandorufe. Das ganze Regiment setzte sich in Marsch.
Umgeben von mitlaufenden Bürgern der Stadt, von Soldatenfrauen und Kindern, die heulend und schreiend die Truppe noch eine kleine Strecke bis zum Spitalmarkt begleiteten, gelangte die Kompanie zur Köpenicker Landstraße. In Reih und Glied marschierte man eine Weile an der Spree entlang, bis man im Morgengrauen das Köpenicker Tor durchquerte. Hinter dem Regiment zogen die Packpferde der Offiziere. Jede Kompanie hatte einen Munitionswagen, der von vier Pferden gezogen wurde, und einen Brotwagen. Die Ladungen der Pferdewagen waren mit Planen abgedeckt, worauf jeweils der Name des Regiments in Verbindung mit dem Namen des Eigentümers gemalt war.
Leo Tafelski, der neben Alexander marschierte, blickte finster drein.
»Leo, nimm's nicht so schwer, jede Kugel trifft ja nicht«, tröstete dieser ihn. »Hast du eigentlich mal von Ella etwas gehört?«
»Ja, is sich wiedergekommen – is sich hier bei den Marketenderinnen.«
»Wie? Uns begleiten Frauen und Mädchen?«
»Hat sich Oberst für jede Kompanie zehn Frauen gelassen, für waschen und Wäsche und stopfen und sonst dergleichen.«
»Na, Mensch, freust du dich denn nicht, wenn deine Braut mitmarschiert?«
»Weiß nicht, kriegen ein Kind, weiß ich nicht von wem? Haben Oberst nicht gesagt.«
»Junge, Junge«, fiel jetzt Heinz Zittelmann ein, »det sind ja Zicken, die deine Braut dreht.« Er zischte derweil durch die Zähne. Dann frotzelte er: »Ein schönes Weib ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Haarband. – Stimmt's Reinhold, det steht doch schon in de Bibel.« Provozierend blickte er zu Friesicke hinüber.
»Das ist auch wohl das einzige, was du aus der Heiligen Schrift kennst, wie?« konterte Reinhold. »Man sollte dem Leo lieber helfen …«
»Ruhe im Glied!« schrie Wuttke von vorn.
Das Gewitter in der Nacht hatte kaum eine Abkühlung gebracht. Um die Mittagszeit wurde die drückende Schwüle fast unerträglich. Zuerst hatten noch einige gesungen, dann aber verstummte einer nach dem anderen. Schweigend zogen die Truppen, in eine gelbbraune Staubwolke gehüllt, weiter. Mit der Zeit schien das umgehängte Gepäck zur Zentnerlast zu werden.
»Menschenskinder, ist det ne Sauerei. Een breiten Buckel hab ick ja, aber wat zu viel ist, det ist einfach zu viel«, stöhnte Zittelmann.
Während die Patronentasche rechts, sechzig Kugeln schwer, und der Felltornister, der die linke Schulter beschwerte, das Gleichgewicht des Körpers halten sollte, hatten die Männer bei der Länge des Marsches den Eindruck, von der mörderischen Last fast zu Boden gedrückt zu werden.
Bei dieser Hundshitze lief den Soldaten unter ihren Monturen der Schweiß über den ganzen Körper.
Alexander litt sehr darunter. »Ich habe einen entsetzlichen Durst«, keuchte er vor sich hin.
»Ja, ja, Durscht is schlimmer als Heimweh«, Heinz wischte sich mit der Hand ständig über die Stirn.
Nach vier Stunden erreichte das Regiment das kleine Städtchen Köpenick. Die erste Etappe war erreicht. Bei jedem Gehöft wurden dreißig bis fünfzig Grenadiere einquartiert. Sergeant Wuttke wurde mit seinen vier Männern und anderen Soldaten der Kompanie in einem bäuerlichen Anwesen untergebracht.
Der Bauer behauptete, nicht mehr allzu viel Vorräte von der letzten Ernte zu haben. Leutnant von Wartenberg schrie den verdutzten Bauern an: »Vorwärts, elender Geizkragen, öffne Er hier die Falltür. Für jeden Mann bekommt Er einen Groschen Essens-geld. Des Königs Soldaten müssen fürstlich bewirtet werden, sonst zieht er sich sofort den Uniformrock selber an und marschiert mit ins Feld!«
Vor Schreck erblasst, holte der Bauer sofort den Schlüssel. Unter einer Falltür kamen herrliche Dinge zum Vorschein: Schinken, Wurst, Käse, Speck, schönes Brot und ein Fässchen Bier. Wie ausgehungerte Wölfe fielen die Männer darüber her. Zunächst aber soffen sie wie durstige Pferde literweise Wasser, Milch und Bier. Als der Bauer sich noch einmal zu Wort meldete, brüllte Unteroffizier Mengke: »Kanaille, schaffe Er alles her, was die Soldaten des Königs verlangen, sonst stöbern wir aus dem äußersten Winkel noch das Letzte hervor.«
Erschrocken sah der Wirt, wie die Soldaten Stroh herbeischafften und alle Fußböden damit bedeckten. Als er wieder reklamieren wollte, schrie der schiefnasige Mengke noch lauter: »Was will Er noch mehr? Er bekommt pro Soldat ein Groschentraktament, wenn Er sein liederliches Maul nicht halten will, lasse ich Ihn in Arrest setzen! Hat Er mich verstanden?«
Endlich gab der Bauer Ruhe.
Am Abend wurde der Truppe ein Extrablatt von beiden Berliner Zeitungen gebracht. Alexander als der Intellektuelle las den Männern in seinem Quartier den Text vor:
»Wir, Friedrich, von Gottes Gnaden, König von Preußen, Markgraf zu Brandenburg, haben Unserer Armee den Befehl zum Einmarsch in Sachsen gegeben, um dem Angriff der österreichischen Armee zuvorzukommen. Maria Theresia, Königin von Böhmen und Ungarn, hat einen Komplott aller europäischen Staaten gegen Preußen geschmiedet. Uns ist bekannt, dass diese Staaten zum Krieg gegen Preußen rüsten. Entlang der schlesischen Grenze liegen bereits Waffen- und Munitionsdepots der österreichischen Armee. Deshalb sind Wir gezwungen, den Krieg zu beginnen, bevor Österreich und seine Verbündeten ihre Aufrüstung beendet haben. Mit dem heutigen Tag marschiert die Preußische Armee in Sachsen ein.
So gegeben zu Berlin am 29. August 1756
Friedrich.«
Ein geworbener Ausländer aus Frankreich, der sich auch unter den dreißig einquartierten Männern befand, sagte: »Ja, ja, jetzt ist es wohl auch dem Dümmsten klar, wohin der König von Preußen uns führt, mit welcher Brutalität und Kaltschnäuzigkeit wir einfach durch Sachsen vordringen müssen, um die Österreicher anzugreifen. Das ist eine Frechheit, die ihresgleichen sucht. Macht geht eben doch vor Recht. Aber was kümmert den großen Fritz Recht oder Unrecht …«
Zittelmann unterbrach den Franzosen: »Det is im Leben ebenso. Jeder hat soviel Recht, wie er Macht hat. Also, haste die militärische Macht, so haste eben det Recht auf Erden. Det is der Lauf der Welt.«
Der Franzose, der nie einen Hehl daraus machte, bei bester Gelegenheit fliehen zu wollen, setzte noch hinzu: »Das bedeutet aber, dass das Recht des Stärkeren eben auch zum größten Unrecht unter den Menschen werden kann.«
Jetzt schaltete sich Sergeant Wuttke in das Gespräch: »Der König von Preußen ist das lebendige Gesetz seines Landes. Deshalb nennen ihn seine Bürger auch Friedrich den Großen.«
Wuttke blickte auf Reinhold Friesicke: »In des Königs Wort ist Allgewalt, und wer darf zu ihm sagen: ›Was machst du?‹ So steht's geschrieben, nicht wahr, Musketier Friesicke? Das hat Er mir doch einmal vorgelesen.«
Reinhold gab der Wahrheit die Ehre, indem er hinzusetzte: »Ja, es steht geschrieben: ›Den Königen ist Unrecht tun ein Gräuel, denn durch Gerechtigkeit wird der Thron befestigt‹. Gott allein weiß, ob dieses Wort auf Friedrich zutrifft.«
Der Franzose lachte hell auf: »Also doch ein Reichsfriedens-brecher.«
Friesicke setzte aber dann erklärender Weise hinzu: »Es steht aber auch geschrieben: ›Fürchte den Herrn und den König und menge dich nicht unter die Aufrührer!‹«
»Deshalb will ich ja auch weit fort von hier …«, lachte der Franzose, »so weit wie nur möglich.«
»Ruhe jetzt!« schrie Wuttke. »Für den König von Preußen zu arbeiten und zu kämpfen, ist unser aller Pflicht. Vor Gott haben wir es beim Fahneneid geschworen.«
Bald schliefen und schnarchten die erschöpften Musketiere auf dem frischen Stroh. Schon in aller Herrgottsfrühe standen die Kompanien wieder abmarschbereit. Auf allen Wegen und Straßen, die nach Süden führten, wälzten sich die Heersäulen der Preußischen Armee auf das Königreich Sachsen zu. Vier Gardebataillone und fünfundzwanzig Infanterieregimenter, darunter auch die vier Prinzenregimenter, Prinz von Preußen, Prinz Ferdinand, Prinz Karl und Prinz von Württemberg, befanden sich auf dem Marsch.
Über die sandigen Wege und Straßen stampften zigtausend Hufe der überaus farbenprächtigen Kavallerie, weiße, blaue, rote
Auf allen Wegen und Straßen, die nach Süden führten, wälzten sich die Heeressäulen der Preußischen Armee auf das Königreich Sachsen zu. Illustration: Adolph von Menzel
und grüne Husaren, hellblaue Dragoner und weiße Kürassiere. Das größte Aufsehen erregten die schwarzen Husaren, als sie, die schwarzen Pelzjacken über die Schulter gehängt, auf dem Kopf die verwegene schwarze Filzmütze tragend, mit dem abschreckenden Totenschädel und einem vollständigen Skelett mit der Aufschrift »Der ganze Tod«, an den marschierenden Blauröcken vorbei jagten. Diesem folgten die stolzen Angehörigen des Gardes du Corps, die weißen Leibröcke mit Kurassen aus blinkendem Eisen und Silber geschmückt. Die Armee des großen Königs zählte im August 1756 mit Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Zimmerleuten und Pionieren 126 000 Mann.
Waren die preußischen Truppen am ersten Tag nur vier Stunden marschiert, so mussten sie am zweiten bereits zehn Stunden durchhalten, ehe sie nach zwei kurzen Pausen das verträumte Städtchen Fürstenwalde erreicht hatten.
Viele Soldaten waren am Ende ihrer Kräfte, einige brachen einfach zusammen, so dass sie auf die Packwagen gelegt wer-den mussten. Nachdem sie später den brennenden Durst gelöscht hatten, sanken sie in ihrem Quartier ins Stroh und schliefen sofort ein.
Erst am dritten Tag, nachdem die Truppen wieder acht Stunden marschiert waren, wurden drei Rasttage eingelegt. Der Marsch unter wolkenlosem Himmel war sehr kräftezehrend, zumal die Armee den Langstreckenmarsch noch nicht geübt hatte.
Die Bauern in der Umgebung stöhnten unter der militärischen Einquartierung. Obwohl die meisten Soldaten kaum noch ein Stück Kommissbrot bei sich hatten, waren manche Brotsäcke mit allerlei besseren Dingen prall gefüllt.
Leo Tafelski war der gerissenste Dieb. Keiner verstand es wie er, den Hühnern und Gänsen den Hals umzudrehen, um sie dann im »Habersack« verschwinden zu lassen. Sein Brotsack sah aus wie eine fetter Schmerbauch.
Jeden Abend hatte das Quartett aus der Krausenstraße seine »Geflügelmahlzeit«. Heinz und Alexander schüttelten, trotz des furchtbaren Gezeters der Bauern, von den überladenen Obstbäumen Birnen und Äpfel herunter. Nur Reinhold Friesicke beteiligte sich nicht an diesen »Plünderungsfeldzügen«. Als Christ aß er nicht einmal von dem Diebesgut mit, sondern teilte sich seine Portionen gut ein und fastete lieber mal. Später, als aus Berlin die Nachschubwagen anrollten, regulierte sich die Verpflegung von selbst. Tag um Tag zogen vier, manchmal auch sechs Pferde die Proviantwagen mit Lebensmitteln, Pulver, Gewehren, Kugeln und anderen militärischen Dingen. Jetzt gab es die beste Versorgung: Fleisch, frisches Brot und Wein dazu. Jede Mahlzeit war ausreichend und gut.
»Wie geht's?« fragte Alexander seinen Freund Heinz.
»Ach weeßte«, lächelte dieser, »ick will lieber die ganze Woche faulenzen, um mich dann wenigstens am Sonntag richtig ausschlafen zu können.« Er war und blieb der Spaßvogel der Kompanie, er verlor kaum einmal seine gute Laune.
Vom siebten bis zum dreizehnten Tag kamen die Infanterieregimenter über Guben, Spremberg und Hoyerswerda schnell voran, bis sie das letzte Örtchen auf einheimischen Boden erreicht hatten, wo die Soldaten in festen Quartieren untergebracht waren.
In Eilmärschen zogen die preußischen Regimenter durch Sachsen. Alle nach Süden führenden Wege waren von blauen Uniformen und hell aufblinkenden Grenadiermützen erfüllt. Das neutrale Sachsen galt aber schon als gefährdetes Gebiet, deshalb kampierten die Truppen von jetzt ab nur noch in großen Zeltlagern unter freiem Himmel.
Eines Abends hatte das Regiment Itzenplitz sein vorläufiges Ziel erreicht, nämlich ein böhmisches Dorf mit einem unaussprechlichen Namen. Hier wurden die Truppen wieder in Bauernhöfen untergebracht. Der Armeebefehl lautete: Kein Biwak, um die eigenen Absichten zu verschleiern, da sich der Feind in Reichweite befand.
Die böhmischen Landsleute nahmen die preußischen Soldaten weder feindlich noch freundlich auf, waren aber bereit, sie für ein geringes Entgelt zu versorgen. Heißhungrig stürzten sich die Musketiere auf die herzhaften Speisen. Soweit Reinhold Friesicke anwesend war, sprach man wie selbstverständlich ein Tischgebet:
»Speise, Vater, deine Kinder, tröste die betrübten Sünder, sprich den Segen zu den Gaben, die wir jetzt so vor uns haben, dass sie uns zu diesem Leben Stärke, Kraft und Nahrung geben, bis wir endlich zu den Frommen an die Himmelstafel kommen. Amen!«
Die Bäuerin, die stehend ihre Hände gefaltet hatte, bekreuzigte sich und wiederholte laut und vernehmlich: »Amen!«
Dann brachte sie die dampfenden Knödel mit Geflügelragout auf den Tisch. Danach gab es Backobst und einen leichten Wein, den die Bauern an den Südhängen ihrer Weinberge geerntet und gemostet hatten. Heinz Zittelmann ließ es sich mit den anderen gut schmecken.
»He, junger Mann«, rief er einem Bauernburschen zu, »können Sie mir noch einmal een bisschen Wein einschenken, aber een bisschen viel, wenn ick bitten darf. Det Zeug schmeckt nämlich vorzüglich. Daran könnt ick mir direkt gewöhnen. Auf alle Fälle schmeckt er besser, als immerzu nur Gänsewein aus dem Brunnenrohr.« Er aß mit größtem Wohlbehagen. »Mensch, so een Soldatenleben ist doch wat Gutes. So lass ick mir den Krieg gefallen«, lachte er, »det könnte immer so weitergehen.«
Am nächsten Tag marschierte die Kompanie weiter. Überhaupt sollte durch Märsche und Kontramärsche der Feind getäuscht werden. Selbst bei sternklarer Nacht zogen die Truppen von Ort zu Ort und gelangten so wieder auf sächsisches Gebiet. Am 10. September erreichten sie die Gegend der Stadt Pirna.
Die sächsische Armee wurde von allen Seiten eingeschlossen. Das Gelände war unübersichtlich. Felsige Hänge fielen steil bis zur Elbe ab und zogen sich auf der anderen Seite des Tales zerklüftet wieder hinauf. Sanft abfallende Hügel waren mit alten, verzweigten Weinstöcken bewachsen. In der Ferne sah man hoch auf dem Felsenplateau des Tafelberges die Festung Königstein. Die zur Elbe gerichteten, wuchtigen Festungsanlagen waren von Wachttürmen flankiert, durch die eine gute Beobachtungsfunktion über das weite Land gegeben war. Zur Westseite hin glich das trotzige Felsmassiv einer offenen Schere, eine gefährliche Falle für jeden anstürmenden Feind. An der Westbebauung der Festung hatte man über eine verbreiterte Felsschlucht ein Torhaus errichtet. Nur über diese unüberwindliche Toranlage war es möglich, in die Festung einzudringen. Das gesamte Felsenplateau war umgeben von einer geschlossenen Brustwehreinfassung mit den dazugehörigen Wachttürmen und Schießscharten für Geschütze. König August von Sachsen hatte sich mit seinem Hofstaat in die Festung Königstein geflüchtet. Aus dieser schwindelnden Höhe konnte seine Generalität über die große Elbschleife hinüber zum Lilienstein, einem sehr markanten Bergfelsen, sehen. Im weiten Vorland dieser Festung lagerte die sächsische Armee.
Um dieses riesige Sachsenlager postierte sich ein Teil der preußischen Armee, unter ihnen auch das Regiment der Itzenplitzer. Zuerst wurde der Lagerplatz abgesteckt, dann der Raum in so viele Gassen zergliedert wie Kompanien lagerten. Kleine Zeltflaggen trennten die Bataillone und einzelnen Regimenter voneinander. In der Mitte des Regiments wurden Trommeln und Fahnen aufgerichtet. Die Fahne wurde wie der Adler bei einer römischen Legion mit großer Ehrfurcht betrachtet. Wenn sie vor den Linien vorbeigetragen wurde, begrüßte man sie, wie den König selbst. Dabei ertönte die ganze Feldmusik. Die Kompanien und Regimenter nahmen die Waffen, und die Offiziere standen mit entblößten Häuptern andächtig da. Selbst der König gab dieses Zeichen der Ehrerbietung, indem er seinen Dreispitz vom Kopf zog, um die farbige Standarte mit dem schwarzen Adler und der goldenen Krone zu huldigen.
Das ganze Lager war durch ein engmaschiges Sicherheitsnetz geschützt. Neben jedem Bataillon postierte sich, etwa 200 Schritt entfernt, eine Feldwache von 40 Mann. Diese wurde wiederum von Schildwachen und weiteren Doppelposten bewacht, die sehr nahe beieinander standen. Bei Nacht patrouillierten Streifen- und Offiziersronden von Posten zu Posten. Das gesamte Lager wurde außerdem noch von einer Husarenwache und anderen Kavallerieeinheiten gesichert, so dass eine Flucht aus diesem Bereich so gut wie ausgeschlossen war.
Die Zeltgemeinschaft des Sergeanten Wuttke wurde neben Alexander, Leo, Heinz und Reinhold auch von anderen Soldaten gebildet, die ausschließlich in Preußen geboren, und mit ihrem jugendlichen Elan ihren König geradezu vergötterten. Der Kompanie von Kapitän von Möllendorf hatte man einen neuen Feldwebel zugeteilt. Dieser galt als ein »Erweckter«, ein besonders frommer Mann. Er genoss in der Kompanie sofort eine gewisse Achtung, weil er bei aller Strenge doch sehr gerecht urteilen und auch liebenswürdig sein konnte.
Der September dieses Jahres war grün, warm und sehr fruchtbar. Die Sonne schien mild. Das große Lager der Armee glich einem Ameisenhaufen, alles wimmelte durcheinander. Die Grenadiere, Musketiere und Füsiliere saßen vor ihren Zelten und brachten ihre Sachen in Ordnung. Von den Kochstellen stieg bläulicher Rauch empor. Mit großer Hingabe rührten die Soldaten ihre Suppen und brutzelten in ihren Pfannen Fleischstücke. Der Schuhmacher der Kompanie war zu einer begehrenswerten Persönlichkeit geworden, den man mit Geld oder Naturalien bestechen musste, um rechtzeitig sein Schuhwerk repariert zu bekommen. Neue Sohlen mussten aufgesetzt werden, Absätze erneuert, Risse im Oberleder mit Flechtdraht geflickt werden.
Alexander schlenderte mit Heinz Zittelmann durch die Marketendergasse. Hier konnte man für wenig Geld Äpfel, Birnen, Pflaumen und anderes Obst kaufen, Metzger boten frisches Fleisch an. Große Käsestücke verschiedener Art, in Blätter gewickelte Butter, wurden feilgeboten. Es gab auch ein reiches Angebot an Gemüse. Das ganze Lager erschien wie ein aufs Feld verlegter Marktplatz.
Alexander und Heinz setzten sich auf eine frisch gezimmerte Bank vor einem rohen Tisch nieder und bestellten sich Bier.
»Meinst du, wir müssen die Festung erstürmen?« wollte Alexander wissen. Er blickte besorgt zu dem über 200 Meter hohen Felsen hinauf.
»Mitnichten, mein Guter.« Wie ein kleiner Feldherr saß Heinz vor ihm: »Die sächsische Armee beherrscht zwar mit ihrer Artillerie das Vorgelände und hat sich sehr gut durch Verhaue und Palisaden verschanzt. Auch ist sie durch die Festungsanlagen eigentlich uneinnehmbar.« Er tippte sich gewichtig an die Stirn: »Weeßte, man dachte an fast allet, an det Schwert und an de Waffen, aber die armen Sachsen haben darüber einen weit fürchterlicheren Feind vergessen, einen Feind, der schon seit Jahrtausenden so viele Heere besiegt und Feldherren gestürzt hat …«
»Denkst du an das Wasser?« fragte Alexander.
»Nee, mitnichten, Wasser gibt'det da oben genug, denn sie besitzen einen sehr tiefen Brunnen. Nee, die haben nich genug zu fressen. General Hunger wird sie besiegen. Wie man munkelt, haben die Sachsen nur für 15 Tage Lebensmittel im Lager, und det reicht eben nicht hinten und nicht vorn …«
Aus den Marketenderzelten erklangen fröhliche Reden und das Jauchzen der leicht geschürzten Mädchen, die die Soldaten bedienten.
»Weeßte, die Sachsen, die haben bald so eenen Hunger, det se nich aus noch ein wissen. Außerdem werden'se bald nich mehr wissen, wo'se schlafen sollen, weil et doch öfter geregnet hat, und det gibt'nen nassen Hintern. Die armen Teufel sind wirklich zu bedauern.«
Alexander fand die originelle Art des Berliner Humors immer wieder neu erfrischend.
Im Lager herrschte ein fröhliches Treiben. Nicht weit von ihrer Bank entfernt spielten Soldaten mit ihren Kegeln, einige putzten ihre Gewehre und wieder andere wuschen ihre Wäsche. Die preußischen Soldaten erhielten täglich eine Ration von 2 Pfund Brot, wöchentlich 1 Pfund Wurst und Rindfleisch.
Sergeant Wuttke kam mit Leo Tafelski die große Lagergasse herauf. Als er seine beiden Musketiere am Biertisch sah, rief er: »Schockschwerenot, da schau mir doch einer diese Windhunde an, sitzen vor ihrem Maß Bier und lassen ihren alten Sergeanten verdursten.« Er strich sich über seinen grauen Schnurrbart.
»Willkommen, Herr Sergeant«, Alexander stand auf und lud Wuttke ein. »Ein Bier, wenn's gefällig ist?«
Wuttke besah sich die Krüge, die auf dem Tisch standen: »Nichts als gefärbtes Wasser, was man hier so Bier nennt. Aber was tut's, Durst ist der beste Kellner. Mein Durst ist groß, das Glas ist klein, das Bier, das will getrunken sein.«
»Richtig, Herr Sergeant«, lachte Heinz Zittelmann, »bei die Hitze wird selbst det Fuselwasser zur Delikatesse. Wer nichts trinkt, hat im Marketenderzelt nischt verloren.«
Leo Tafelski setzte sich auch an den Tisch. »Leo, Mensch, du hast doch die besten Beziehungen zum Bierfaß. Wo steckt denn deine Ella?« fragte Heinz ihn ganz unvermittelt. »Ick gloobe, heute sind wir Gast bei dir, oder?«
Leo bestellte mit saurer Miene vier Bier. Der Sergeant schien ganz aufgeräumt zu sein.
»Heute früh ritt der König mit seinem Adjutanten hier vorbei, um die Stellung der Feinde zu erkunden.« Wie von etwas ganz Heiligem sprach er. »Die Sachsen sitzen fest in der Falle«, erklärte Wuttke mit Nachdruck wie ein Feldherr, dabei malte er mit seinem Stock neben der Bank die Umrisse der sächsischen Stellungen auf die Erde.
»Hier lagern die Sachsen«, er zog kräftige Ringe um das Lager der Feinde, »und hier stehen die Truppen seiner Majestät.« Er blickte in die Runde. »Nun, Kerls, was folgt daraus? Na? – Ist doch sonnenklar: Wir hungern die Sachsen aus, und bald müssen sie kapitulieren. Habt Ihr verstanden, Kerls?« Siegesbewusst schaute er seine Leute an. Da niemand sich zustimmend äußerte, fragte er gereizt: »Oder sind die Soldaten des Regimentes Itzenplitz etwa anderer Meinung?«
Tafelski zeichnete mit seinen Hacken einen Querstrich durch beide Kreise: »Und wenn sich nun kommen Österreicher und befreien ihre sächsischen Freunde?«
Wuttke starrte den Polen entgeistert an. Er begann hysterisch zu lachen: »Hör sich doch einer den polnischen Feldherrn an, die Österreicher sollen einen preußischen Belagerungsring auseinandersprengen? Hat Er wohl Seinen Verstand verloren? Man merkt Ihm auf Schritt und Tritt an, dass Er den Angriff der Truppen Seiner Majestät bei der Schlacht von Hohenfriedberg und Kesselsdorf nicht miterlebt hat. Wie die Hasen haben wir die Weißröcke gejagt. Wenn Friedrich das Kommando führt, dann sind die Preußen unbesiegbar«, er klopfte sich auf die Brust, »so wahr ich Hermann Wuttke heiße … Wir werden diesmal in Wien unsere Winterquartiere einnehmen.« Drohend sah er den finster dreinblickenden Polen an: »Oder zweifelt Er an meinen Worten, wie?«
Alexander dachte an das Gespräch in der Kutsche zwischen Karlsruhe und Mannheim. »Herr Sergeant, wenn ich mir eine Frage erlauben darf. Zu Beginn der Schlacht bei Mollwitz wurde doch die preußische Kavallerie durch eine wuchtige Attacke der Österreicher zurückgeworfen. Sie jagte damals in wilder Panik davon, und der König konnte diese fliehende Masse trotz größter Anstrengung nicht zum Stehen bringen, bis er endlich selbst von dem Strom der Flüchtenden mitgerissen wurde. Daraufhin gab er doch Feldmarschall von Schwerin das Kommando und verließ heimlich das Schlachtfeld …?«
Wuttke stemmte seine Fäuste in die Seite und rief erregt: »Seine Majestät, der König, hat niemals das Schlachtfeld verlassen, und schon gar nicht heimlich. Er hat lediglich nach einem schwachen Punkt in der feindlichen Schlachtordnung gesucht, um dann als Held wieder auf das Schlachtfeld zurückzukehren. Alles andere sind infame Verleumdungen durch die Feinde.« Mit großen Augen blickte er von einem zum andern. Ein fast heiliger Glanz lag auf seinem Gesicht: »Ihr hättet sehen sollen, wie die preußische Infanterie sich zum Widerstand formierte. Sie war von allen Seiten eingeschlossen! Österreichische Infanterie vor uns, die feindliche Kavallerie im Rücken und an beiden Seiten!« Er war aufgestanden und stützte sich mit beiden Händen auf den Biertisch.
»Die preußischen Linien standen wie Mauern, sie wankten nicht, das Schnellfeuer der Preußen war so präzise und fürchterlich, dass alle Feinde zurückwichen. Zuerst kämpften wir die österreichischen Reiter nieder, und dann die feindliche Infanterie. Schließlich gingen wir zum Sturmangriff über. Mit wehenden Fahnen und wildem Trommelschlag, Mann an Mann gereiht, wie auf dem Exerzierplatz, so haben wir sie geschmissen.«
Der Sergeant nahm Haltung an: »Hört, Kerls, die preußische Infanterie ist die beste der Welt, und wenn der König bei ihr ist, dann ist sie unbesiegbar.«
Während der kleinen Ansprache des Sergeanten war auch Reinhold Friesicke dazugekommen. Begeistert bestätigte er die Worte Wuttkes: »Der König ist ein großer Siegesheld, auch Gott, der Herr, steht ihm sichtbar bei.«
Heinz Zittelmann bemerkte: »Det stinkt aber mächtig nach
»Mit wehenden Fahnen und wildem Trommelschlag, so haben wir sie damals bei Mollwitz geschmissen.« Illustration: Adolph von Menzel
Bibel. König David hat ooch nich immer gesiegt. Det kann doch auch einmal anders kommen.«
Friesicke verteidigte seine Ansicht: »Wenn ein König das Gesetz Gottes missachtet, fällt er in Ungnade, ansonsten ist Gott auf seiner Seite.«
»Ach, und Friedrich ist so een unfehlbarer König Gottes, der immer den Willen Gottes tut? Det gloob ick aber nicht.«
»Herr Gott, Sakrament!« schrie Wuttke zornentbrannt. »Glaubt Er etwa nicht, dass der Herrgott mit Seiner Majestät ist? Hab ich Euch nicht auf dem schönsten Exerzierplatz der Welt die Unbesiegbarkeit des Königs von Preußen in die Knochen hineinexerziert? Wie kommen Euch denn solche dämlichen Gedanken ins Gehirn? Ich werde Euch noch den Glauben an Seine Majestät beibringen, so wahr ich Hermann Wuttke heiße und meinem Vaterland, dem Königreich Preußen, schon über 30 Jahre diene.«
Betroffen starrten seine Männer auf die Erde. Wie ertappte Sünder standen sie um den Sergeanten herum. »So, nun schert euch davon!« Voller Verachtung und im Zorn trank der Sergeant allein seinen Krug Bier aus.
Noch bis zum Anbruch der Dunkelheit saßen die Truppen vor ihren Zelten oder am Wachtfeuer. Alexander hatte sich zu Reinhold Friesicke gesetzt. Rücken an Rücken betrachteten sie die aufleuchtenden Sterne. In der Ferne vor dem Lilienstein flackerten die Wachtfeuer der Sachsen. Aus den Elbniederungen stiegen milchige Nebelschwaden auf. Reinhold erinnerte sich an das Gedicht von Paul Gerhardt. Leise sagte er es vor sich hin:
»Nun ruhen alle Wälder,
Vieh, Menschen, Städt' und Felder,es schläft die ganze Welt;ihr aber, meine Sinnen,auf, auf, ihr sollt beginnen,was eurem Schöpfer wohlgefällt.«
Der neu ernannte Feldwebel der Kompanie Liebler kam durch die Lagergasse und hörte Reinhold sprechen. »Ist's gestattet, Kameraden, mich zu Euch zu setzen?«
Reinhold und Alexander wollten aufstehen, um ihre Ehrenbezeugung zu machen.
»Bleibt sitzen, Männer«, sagte der Feldwebel, »bleibt sitzen. Jetzt nach dem Dienst will ich ganz privat bei Euch sein, wo ich hier solche frommen Worte höre. Redet nur weiter.«
Auf einer Kiste ließ er sich nieder, faltete seine Hände und bat: »Sprich weiter, Kamerad, sag uns das schöne Abendlied noch einmal auf.«
Reinhold nickte, dann sprach er ganz melodisch weiter:
»Wo bist du, Sonne, blieben?Die Nacht hat dich vertrieben,die Nacht, des Tages Feind:fahr hin, ein' and're Sonne,mein Jesus, meine Wonne,gar hell in meinem Herzen scheint.«
Alexander dachte an die Heimat und an sein Elternhaus. Er sah den Vater vor seiner geöffneten Bibel sitzen, am Tisch die Mutter, Marie-Luise und Georg. Wie mochte es ihnen gehen? Wochenlang hatte er keine Post von ihnen bekommen. Die Nacht war nicht dunkel. Im milden Mondenlicht konnte man die Konturen einzelner Berge des Elb-Sandsteingebirges erkennen. Oben auf der Burg Königstein flackerten die Wachtfeuer der Feinde. Die Fenster des Kommandantenhauses waren zum Teil hell erleuchtet. Reinhold sprach unterdessen weiter:
»Der Tag ist nun vergangen,die güld'nen Sternlein prangenam blauen Himmelssaal:also werd ich auch stehen,wenn mich wird heißen gehenmein Gott aus diesem Jammertal.«
»Wenn der Herr Feldwebel mit uns noch das Abendgebet sprechen wollen«, bat Reinhold.
Wie selbstverständlich faltete Liebler die Hände und sprach: »Wir danken dir, o treuer Herr und Heiland, dass du uns heute den ganzen Tag über an Leib und Seele vor allem Schaden und Übel so gnädiglich behütet hast. Wir bitten dich, du wollest uns alles, wo wir heute mit Herz und Mund, aber auch mit der Tat gesündigt haben, um deines teuren Blutes willen gnädig vergeben. Zu dir fliehen wir, wenn uns Angst befällt. Bei dir finden wir Frieden und Ruhe. Lass uns auch diese Nacht durch deinen Schutz sicher ruhen und schlafen.«
Bis tief in die Nacht hinein dachte Alexander über die Worte, die der Feldwebel gebetet hatte, nach. Es beeindruckte ihn, mit welcher Glaubensgewissheit er den Herrn anrief. Während die Zeltgemeinschaft schon schlief, hörte er durch die Zeltwand die Rufe der Patrouillen und der Offiziersronden. »Halt, wer da?« erscholl es hin und wieder.
»Gut Freund!« kam es zurück.
»Gebt Feldgeschrei und Losung!«
»Wartburg! Für König und Vaterland!«
»Passieren!«
In der Ferne quakten die Frösche. Alexander dachte noch an Jeannette. Große Sehnsucht überkam ihn, die ihn nun ganz gefangen nahm. Er spürte ihre zärtlichen Hände, berührte im Geist ihre duftigen Lippen, teilte ihr Haar im Nacken, um ihren Hals und ihre Schulter zu küssen. Dann aber schlief er ein.
Ein Tag nach dem andern verging im Einerlei des Lagerlebens. Die Feinde ergaben sich nicht. Das Sonderbare war, dass von beiden Seiten kein Schuss fiel. Zwar bedrohten die schweren Geschütze der Preußen die Festung Königstein. Ganze Batterien richteten ihre gefährlichen Schlunde gegen das Lager der Feinde vor dem Lilienstein. Vergebens warteten die Kanoniere auf den Feuerbefehl. Immer wieder ritt der König mit seinen Generälen die Frontlinie ab. Seine Truppen begrüßten ihn stürmisch, doch zur Schlacht kam es nicht. Überall in Sachsen waren gut bewachte Magazine angelegt. Hinzu kamen eine immer bewegliche Proviantabteilung, selbständige Feldbäckereien und einige Feldlazarette. Im Lager gab es ein Feldpostamt und eine Feldapotheke. Hunderte von Marketenderinnen und Krämern umschwärmten das Lager und sorgten für das Wohl und die Abwechslung der Soldaten.
Eines Morgens schlugen die Trommler Alarm. Die Zelte wurden abgerissen und verpackt, die Zeltstangen an den Riemen befestigt und verladen. Spaten, Hacken, Beile, Feldkessel und Schaufeln wurden auf dem Rücken festgeschnallt. Innerhalb einer halben Stunde stand das Regiment Itzenplitz abmarschbereit hinter seinen Fahnen. Oberst von Lattorff ritt mit seinem Stab voraus.
Beim Abmarsch sangen die Soldaten das neu entstandene Lied:
»In drei Kolonnen frisch aufmarschiert,der König geht voran.Er gibt nun aus das Feldgeschreiund kommandiert: ›Heran!«‹
Zur Befreiung der bei Pirna eingeschlossenen sächsischen Armee rückten die Österreicher unter ihrem Feldmarschall Browne heran. König Friedrich warf ihnen einen Teil seiner Streitkräfte entgegen.
Jeden Tag rückten mehr preußische Soldaten über die sächsische Grenze nach Böhmen ein. Jedes Dorf an den Aufmarschstraßen wurde belegt. Obwohl sich der König noch in Sachsen aufhielt und der größte Teil seiner Hauptarmee die Festung Königstein und die sächsische Armee bei Pirna fest umschlossen hielten, ging der rechte Flügel der preußischen Armee unter Prinz Ferdinand von Braunschweig südwärts dem Feind entgegen. Täglich stießen Husarenpatrouillen und berittene Feldjäger weit ins Böhmische vor. Ihnen folgte in strammen Märschen die Infanterie. Es ging über verschlungene Pässe in Richtung Süden. Die Sonne brannte unbarmherzig auf die marschierenden Preußen nieder.
»Mensch, wenn ick mir det so recht überlege, wat haben wir eigentlich hier in Böhmen verloren? Det arme Volk will doch keenen Krieg. Wenn wir uns verteidigen, gut, aber det is doch ein wahrer Eroberungskrieg«, meinte Zittelmann, indem er sich den Schweiß vom Nacken wischte.
»Das ist der ewige Kampf der Natur«, erklärte Alexander, »Macht geht vor Recht. Die Wölfe gehen auf Raub aus. Alle haben Hunger auf Beute. Jeder will die eigene Macht vergrößern und die fremde schwächen. Was am Ende zählt, ist die Gewalt, die aus den Gewehrläufen und den Kanonen kommt. Den Erfolg schaffen die schnelleren Bewegungen, wie man kommandiert, und die Disziplin der Regimenter. Jeder strebt nach Ausdehnung auf Kosten des Nachbarn.«
Plötzlich pfiff es von den Höhen und aus den Büschen: »Pfft, Pfft! « Von rechts und links aus den Wäldern des von Hügeln und Schluchten umgebenen Weges zischte es feindselig heran.
»Hilfe! Mutter! O Gott …!« schrie jemand aus den ersten Gliedern der Kolonne. Er sank nieder und wurde beiseite geschafft.
»Mensch, Junge, Junge!« rief Heinz, »wir bekommen Feuer! Jetzt wird's ernst!«
Alexander verspürte ein ziehendes Gefühl in der Herz- und Magengegend. Ob ich wohl auch bleich geworden bin? dachte er.
Tafelski kniff seine Augen zusammen und schniefte hastig mit der Nase. Mit angstverzerrten Zügen starrte er nach links und rechts. Hinter jedem Gebüsch vermutete er Heckenschützen. Das Pfeifen kam immer näher, die Kugeln zischten über ihre Köpfe hinweg.
»Panduren!« schrie ein Musketier, aber das Wort blieb ihm im Munde stecken. Er fiel seinem Hintermann in die Arme. Zwei Mann schleppten ihn aus dem Glied und legten ihn an den Grabenrand. Aus seinem Munde quoll Blut.
»Det wird ja immer schöner, elende Teufelsbrut! Die schießen uns ab wie die Kaninchen!« rief Zittelmann voller Angst.
Reinhold begann zu beten: »Von allen Seiten umgibst du mich
Die Soldaten stürzten sich auf einen Brunnen. Ächzend knarrte der alte Hebebalken. Unzählige Male wurde der große Holzeimer heruntergelassen. Illustration: Adolph von Menzel
und hältst deine Hand über mir.« Auch seine Stimme verriet ängstliches Rufen.
Oberst von Lattorff sprengte auf schäumendem Pferd vorbei. »Ruhe, Kerls!« schrie er, »gleich schießt die Regimentsartillerie und das Pack läuft davon!«
Sergeant Wuttke umkreiste seine Gruppe. »Nur keine Panik!« rief er.
Bald jagten die Regimentskanonen ihr Eisen in das Gebüsch, und sofort verstummte das Gewehrfeuer.
Nach stundenlangem Marsch wurde eine Rastpause eingelegt. Die Soldaten stürzten sich auf einen Ziehbrunnen. Offiziere hatten ihn hinter einem Hügel entdeckt. Ächzend knarrte der alte Hebebalken. Unzählige Male wurde ein großer Holzeimer immer wieder in die Tiefe heruntergelassen. Wenn das kalte Nass gerade den hölzernen Brunnenrand passierte, kämpften die Männer wie um ihr Leben. Sie versuchten, das wertvolle Wasser sogar in ihren Hüten fortzuschaffen.
»Es trinken tausend eher den Tod, als eener sterbt in Durstes Not«, reimte Zittelmann.
Erst spät am Abend des 30. September erreichten die Itzenplitzer ihre vorgesehenen Positionen.
Die Dunkelheit hielt das unbekannte Land bedeckt. Als man lagern wollte, wurde es verboten, Zelte aufzuschlagen und Wachtfeuer zu entzünden. Das Gewehr durfte nicht aus der Hand gelegt werden. Auf dem Boden hockend und frierend verbrachten die Truppen die Nacht in der kalten feuchten Herbstluft.
Die vier Soldaten aus dem Quartier des Sergeanten Wuttke saßen hinter einem Gebüsch Rücken an Rücken beieinander. Die Brotwagen lagen um Stunden zurück, man teilte das letzte Brot untereinander auf.
»Wir haben Brot, und wir haben auch noch einen Schluck Wein«, sagte Reinhold. »Ich glaube, dass wir morgen eine Schlacht erleben werden, weil wir in unmittelbarer Nähe der Österreicher liegen. Da der Feldprediger nicht in unserer Nähe ist, würde ich vorschlagen, dass wir das heilige Abendmahl feiern.«
»Dürfen wir denn als Laien das Sakrament des heiligen Abendmahls spenden?« fragte Alexander.
»Weshalb denn nicht?« erklärte Reinhold. »Die Christen der ersten Gemeinde waren täglich zusammen und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Sie freuten sich über die Gemeinschaft und hielten mit Freuden die Mahlzeiten miteinander. Es gab also damals noch keine sogenannten Amtsträger. Deshalb dürfen wir es nach dem biblischen Prinzip auch tun.«
Reinhold drehte seinen Tornister mit der flachen Seite nach oben, stellte einen Becher mit Wein darauf und legte ein Stück Brot daneben.
»Dieses heilige Mahl wollen wir auch würdig nehmen und deshalb unsere Schuld dem Herrn Jesus bekennen.«
Er öffnete sein Gebets- und Gesangbuch und las daraus: »Allmächtiger Gott, barmherziger Vater! Ich armer, elender, sündiger Mensch bekenne dir alle meine Sünden und Missetaten, die ich begangen mit Gedanken, Worten und Taten …«
Zwischen den einzelnen Wortabschnitten ließ er die Sätze von den drei Kameraden nachsprechen. Sie taten es ohne jeglichen Widerstand. Die Tränen rannen Leo Tafelski über die Wangen, als er dem Vorredner nachsprach: »Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr …«
Alexander wurde es ganz seltsam ums Herz. Auch er sprach jedes Wort mit großem Ernst: »Ich bitte dich um deine große Barmherzigkeit um des unschuldigen und bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesu Christi willen …«
Heinz Zittelmann faltete seine Hände und wiederholte in bestem Hochdeutsch: »Du wollest mir armem, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und mir zu meiner Besserung deine Geisteskraft verleihen. Amen!«
Hinter ihnen hatte es leise geraschelt. Alexander war erstaunt, Sergeant Wuttke mit gefalteten Händen dort stehen zu sehen. Über dieser andächtigen kleinen Gruppe, die hier in der Dämmerung zusammen war, lag eine geheimnisvolle Weihe.
Während Reinhold jedem das Brot und den Becher mit Wein reichte, sprach er die Worte des Kirchenvaters Augustinus: »Du Sohn des lebendigen Gottes, der du als das wahre Brot des Lebens alle betrübten Seelen, geängsteten Gewissen, hungrigen und durstigen Herzen mit deinem Leib und Blut sättigest, speisest und tränkest, auch zu dieser himmlischen Mahlzeit jedermann aufforderst und ladest: nimm mich auch in Gnaden an, erquicke und speise mit deinem wahren Leib und Blut meine arme Seele zum ewigen Leben. Amen!«
Es hatten sich auch andere Kameraden eingefunden. Auch sie wiederholten bestimmt und kräftig: »Amen!«
An diesem Abend legten sich alle auf dem kühlen Boden zur Ruhe.
Die erste Auseinandersetzung, den die preußischen Soldaten zu bestehen hatten, war der Kampf mit den Mücken und Schnaken. Diese ekelhaften Blutsauger machten sich in der Elbniederung sehr bemerkbar. Endlich stieg das erste Tageslicht herauf. Noch an keinem Morgen vorher war der Nebel so dicht gewesen wie an diesem. Der Herbst meldete sich mit den ersten Anzeichen. Die Soldaten konnten die Elbe nicht erkennen. Man schrieb den 1. Oktober 1756. Die preußischen Regimenter sammelten sich und marschierten in die ihnen vorgeschriebenen Aufmarschstellungen. Wo aber befand sich der Feind? Welche Absichten hatte er? Man konnte zeitweilig keine hundert Schritte weit sehen.