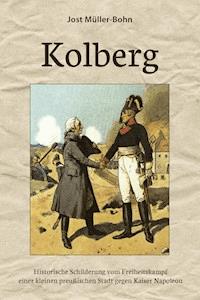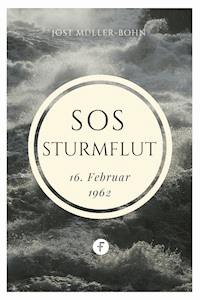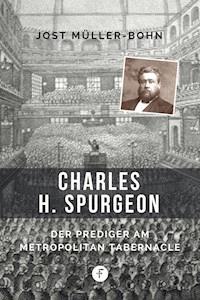Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Preußen-Saga
- Sprache: Deutsch
Im Zentrum dieses fesselnden historischen Romans stehen die anmutige und kluge Komtesse Jeannette von Priegnitz sowie der mutige Kapitän Alexander von Blankenburg. Ihre Schicksale sind untrennbar mit den dramatischen Ereignissen des Siebenjährigen Krieges verwoben – einer Zeit voller Intrigen, Verluste und großer Entscheidungen. Wenn die Liebe König wird bildet den packenden Höhepunkt der Preußen-Saga und bringt die Schicksalsfäden der vorangegangenen Bände – Die Rebellion des Herzens, Der Choral von Leuthen und Des großen Königs Adjutant – zu einer bewegenden Auflösung. Leidenschaft, Treue und der unerschütterliche Kampf um das eigene Glück bestimmen den Weg der beiden Hauptfiguren, während sie sich in einem Netz aus politischen Machtspielen, persönlichen Prüfungen und tiefen Gefühlen behaupten müssen. Wird ihre Liebe den Wirren der Zeit standhalten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn die Liebe König wird
Preußen-Saga Band 4
Jost Müller-Bohn
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Jost Müller-Bohn
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-036-0
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Vision neuer Liebe
Schloss Greiffenhain
Heimkehr des Totgeglaubten
Der König ruft
Die letzte Schlacht
Eine gute Nachricht
Hochzeit in Königsruh
Das große Dankfest
EPILOG
Nachwort
Unsere Empfehlungen
Vision neuer Liebe
Alexander von Blankenburg schien aus dieser Welt entrückt zu sein. Er hatte das Empfinden, irgendwo in lichten Räumen zu schweben. »Ich muss tot sein«, dachte er und verspürte nur noch Wärme und höchstes Wohlbehagen. Nichts von der Welt existierte mehr für ihn. In diesem Zustand gab es allein Ruhe und Frieden.
Alles, was ihn je bedrückt hatte, schien von ihm genommen zu sein. Erleichtert atmete er tief durch: »Oh, welch eine Stille, welch eine Harmonie. Ich habe ja überhaupt keine Schmerzen mehr«, ging es ihm durch den Sinn. Jenes Drohende, Unbekannte und Furchterregende, das er während seines vergangenen Lebens fortwährend empfunden hatte, war entschwunden. Er meinte, allem Irdischen enthoben zu sein. Dabei empfand er eine seltsame, nie gekannte Leichtigkeit. Ohne Ungeduld und Unruhe ergab er sich dem Kommenden.
Beglückende musikalische Klänge drangen zu ihm. Sie erfreuten ihn in diesem Zustand der Schwerelosigkeit. Dann war es ihm wiederum, als höre er aus weiter Ferne ein vom Wind herübergetragenes Glockengeläut, nicht wie jene schweren Klänge aus der anderen Welt, nein, es hörte sich an wie leichte Windglöckchen, die mit ihrem Klang das ganze All erfüllten.
Das Faszinierendste für ihn aber war die Begegnung mit einem strahlenden Licht, einer nie gekannten Helligkeit, die sich sehr rasch zu einer überirdischen Leuchtkraft steigerte. Ungeachtet dieser Erscheinungsform hatte er nicht den geringsten Zweifel daran, dass das Licht eine Persönlichkeit sei, ein Lichtwesen, welches ihm unbeschreibliche Liebe und Geborgenheit spendete. Er fühlte sich von diesem Wesen vollkommen umfangen und angenommen.
»Jesus!«, hauchte Alexander matt.
»Bist du bereit, vor mir zu erscheinen?« klang es wie aus überirdischen Sphären. »Was hast du durch dein Leben bewirkt, das du mir nun vorweisen kannst?«
Es durchfuhr ihn! »Vielleicht überhaupt nichts?«
Bei dieser ungewöhnlichen Begegnung, die er in solcher Intensität noch nie erlebt hatte, erkannte er, dass sein bisher geführtes Leben im Lichte dessen, der zu ihm gesprochen, keine bleibenden Werte aufwies. Darüber erschrak er, und mit diesem Erschrecken gewann er sein reales Bewusstsein wieder.
Zehn Tage waren vergangen, seit Alexander nach dem nächtlichen Überfall von Hochkirch aus todesähnlicher Ohnmacht wieder zu sich gekommen war. Ein starkes Fieber und eine lebensgefährliche Entzündung durch eine Kopfverletzung hätte nach Ansicht des Arztes seinen Tod bald herbeiführen müssen.
Verwundert blickte Alexander, soweit es ihm sein Zustand erlaubte, im Raum umher. Er hörte plötzlich das Summen einer Fliege, die gegen die Bettkante und dann gegen sein Gesicht stieß.
Jedes Mal, wenn die Fliege sein Gesicht berührte, rief sie dort ein ekelhaft brennendes Gefühl hervor. Wiederholt versuchte er, das lästige Insekt zu vertreiben, doch immer wieder summte es heran:
»Bssst – bssst – pläk!«
»Wo bin ich?« In seinem Schädel arbeitete es dumpf, aber ein strammer Reifen umspannte seine Stirn und behinderte ihn scheinbar in seinen Wahrnehmungen.
»Was war geschehen?« Er versuchte, mit seiner Linken nach dem ungewohnten Stirnband zu greifen, aber ein stechender Schmerz fuhr ihm durch den Arm bis in seine Herzseite. Sein ganzer Brustkorb schmerzte unsagbar.
»Aaah! « stöhnte er und wollte sich bewegen, doch seine Glieder gehorchten ihm nicht. Zum ersten Mal war ein solches Empfinden über ihn gekommen, als eine Kanonenkugel sich vor ihm wie ein Kreisel gedreht hatte, und es ihm bewusst wurde, dass dies den Tod für ihn bedeuten könnte. Er bemühte sich, seine Zunge zu bewegen, doch sie lag wie ein Stück Blei im Mund, er konnte sie kaum vom Gaumen lösen.
»Wasser«, dachte er, »nur ein wenig Wasser!« Vergebens versuchte er, seinen Kopf zu wenden. Eine brennende Hitze jagte durch seinem Körper.
»Wasser, Wasser…!« begann er zu röcheln.
»Der Herr ist erwacht!« rief eine freundliche Stimme. Eine feine, weiße Frauenhand schob ihm zugleich eine Flasche mit Wasser an den Mund. Wie ein Verdurstender sog er das kühle Nass in sich hinein. Ein ovales, feingeschnittenes Frauengesicht, umhüllt von einer weißen Haube, neigte sich über ihn.
»Gelobt sei der Herr Jesus Christus, er hat unsere Gebete erhört«, sagte die Unbekannte. Sie tupfte ihm den kalten Schweiß von der Stirn.
Alexander starrte sie, ohne sie zu verstehen, mit einem seltsamen Blick an. Wie sollte er das alles begreifen? Starke Schmerzen im Kopf übermannten ihn erneut, er sah feurige Ringe vor seinen Augen tanzen und verlor wieder das Bewusstsein.
Von neuem begannen seine Fieberträume. Wie aus dem Nichts traten ihm jetzt bekannte und auch unbekannte Personen entgegen. Diese märchenhaften Traumgebilde schienen zu schweben.
»Wer sind diese Menschen? Weshalb sind sie hier? Was wollen sie? Will es denn kein Ende nehmen?« fragte sich Alexander, als er die Gestalten erblickte, die sich vor seinen Augen bewegten.
Seine Mutter kam ihm entgegen. Ihre schmale, weiße Hand wollte ihn streicheln. – Er sah des Vaters ermahnenden Blick. – Marie Luise hüpfte auf ihn zu und hielt ihre Puppe in die Höhe. – Thomas verhandelte mit Indianerhäuptlingen. Er trug einen langen Bart und lachte kindisch.
Jeannette erschien, umhüllt von einem weißen Schleier. Er erkannte ihre schmächtigen Schultern. Sie zog ihn an seinem Arm zur Seite, um ihn zu beschützen. Er versuchte hartnäckig, sich zu befreien, doch es war ihm nicht möglich.
In dieser kurzen Zeitspanne träumte er zahllose Dinge.
– Heinz Zittelmann lachte ihn an und sprang auf einem Bein über Gräben und Hügel. – Sergeant Wuttke drohte mit scharfer Stimme, so dass sein Schnurrbart zitterte. Er wollte Leo mit der Partisane stechen, aber der rannte davon. Allmählich verschwanden alle Personen, eine nach der anderen, und an die Stelle all dessen, was er bisher gesehen, trat eine finstere Macht auf den Plan. Eine dunkle Gestalt löste sich aus einem Nebel.
In seinem Fieberwahn meinte Alexander, er müsse die Tür verschließen oder den Riegel vorschieben, um den Unbekannten daran zu hindern, eintreten zu können. Angsterfüllt ging er auf die Tür zu. Er wusste, dass alles davon abhing, diese finstere Unheilsmacht nicht in den Raum zu lassen. Er stemmte sich mit aller Kraft gegen die Tür, ja er klemmte seine Schulter unter die Klinke. Qualvolles Entsetzen packte ihn. Er wusste: Dies war Todesangst.
Draußen vor der Tür stand der Fürst des Schattens, der mit übermenschlicher Macht heftig gegen die Tür drückte. Alexander bot sämtliche Kräfte auf, aber seine letzten Energien reichten nicht aus, um den Schlüssel umzudrehen, oder wenigstens den Zimmereingang zuzuhalten.
Noch einmal drückte »Es« von außen dagegen. – Plötzlich standen beide Türflügel weit offen …
»Geh in die Hölle, dorthin, wo du hingehörst!« schrie Alexander angsterfüllt und krallte sich an der Klinke fest … Sein Atem wurde immer heftiger …
Ganz außer sich erwachte er, öffnete die Augenlider und blickte erschrocken um sich. Die Schmerzen am Kopf, in der Brust und am Arm wurden immer ärger. Rote Ringe hüpften wieder vor seinen Augen.
»N e i n!!!« schrie er mit übermenschlicher Kraft.
»Ruhig – ruhig!« sagte die freundliche Frauenstimme, die er schon einmal vernommen hatte.
»Der Herr ist in besten Händen, es wird ihm kein Leid mehr geschehen.«
Erneut hielt die weiße, feine Frauenhand die Flasche mit Wasser an seinen Mund. Gierig schlürfte er den gesamten Inhalt hinunter, bis ihm fast die Luft ausging.
Nun begann sein normales Denken wieder zu arbeiten mit der Klarheit und Tiefe wie in gesunden Tagen.
»Wo bin ich?« fragte Alexander die junge Frau mit der weißen Haube.
»Der Herr hat Glück gehabt, das war eine böse Sache.«
»Was ist geschehen? Ich kann mich nicht erinnern, erzählen Sie doch bitte!«
Die Frau deckte ihn liebevoll zu.
»Mein Mann wird Ihnen später alles berichten. Nun bleiben Sie schön brav liegen, damit Sie schnell wieder gesund werden.« »Bin ich schwer verwundet?« forschte Alexander.
»Das Gröbste ist wohl überstanden, aber Sie müssen jetzt erst wieder zu Kräften kommen. Ich werde Ihnen eine Brühe zubereiten. Sie werden doch nun etwas zu sich nehmen können?« fragte die Frau.
Alexander nickte: »Ja, bitte.«
Eilend verließ die Unbekannte den Raum. Die Fliegen summten immer noch unter der dunklen Decke, die Bettwäsche sah aber sauber aus. Scharfer Geruch von Pferden stieg Alexander in die Nase, doch ein tiefhängendes Dach vor dem Fenster versperrte ihm die Sicht. Die dicke Aasfliege summte wieder um sein Gesicht herum, ansonsten war im ganzen Gebäude kaum ein Laut zu vernehmen. Nur vom Stall her hörte man das Stampfen der Pferde.
»Romany!« sagte Alexander. Da stiegen in ihm erste Erinnerungen an das nächtliche Gefecht auf: – Kommandos – Trompetensignale – der Schlachtenlärm – das Explodieren von Granaten – die brennenden Häuser – der König mit der blutbefleckten Schärpe. Bild um Bild reihte sich aneinander: die zischende Kanonenkugel, der ohrenbetäubende Knall, aber dann …?
Alexander atmete schwer. Er seufzte, und mit dem Seufzer verband sich unwillkürlich ein Stöhnen.
»Wie bin ich nur hierhergekommen? Wo sind meine Kameraden? Wo ist Reinhold Friesicke, mein frommer Bursche?«
Allmählich gewann er immer mehr Klarheit über Einzelheiten aus der Vergangenheit.
Seine Aufmerksamkeit übertrug sich nun auch zunehmend auf das Sichtbare. Er suchte die Uniform und die dazugehörenden Teile wie Hut, Schärpe und Degen.
In diesem Augenblick trat ein einfach gekleideter Mann ins Zimmer. Er trug einen dunkelbraunen, hochgeknöpften Rock mit weißer Kragenblende und blickte ihn mit gütigen Augen an:
»Seien Sie willkommen in meinem Haus.« Er legte seine Hand auf die linke Brustseite: »Mein Name ist Johannes Wabnitz. Vor zehn Tagen habe ich Sie mit meinem Fuhrknecht in Hochkirch verwundet aufgefunden und hierhergebracht.«
Alexander reichte dem freundlichen Mann seine gesunde Hand: »Ich möchte Ihnen ganz herzlich für alles danken, ich heiße Blankenburg.« Für Sekunden schloss er wieder seine Augen und fuhr dann fort: »An den schrecklichen Kampf kann ich mich nur noch dunkel erinnern, doch wie ich hierhergekommen bin, entzieht sich gänzlich meiner Kenntnis.«
Der Hausherr holte einen Stuhl, stellte ihn neben das Bett und setzte sich.
»Ja, Sie haben viel Schlimmes erlebt, Herr Blankenburg, nuoh!«
In der tiefen, ruhigen Stimme des einfachen Mannes lag soviel schlichte Freundlichkeit und Mitleid, dass Alexander die Tränen in die Augen stiegen und er seinen Kopf zur Seite drehte.
»Nun, lieber Freund, lassen Sie den Kopf nur nicht hängen. Das Leid dauert seine Zeit, und später können Sie vielleicht sagen: Gehabte Schmerzen sind segensreiche Schmerzen. Hier kann Ihnen ja nichts Böses mehr geschehen. Aber es ist schon so, auch bei den Feinden gibt es gute und schlechte Menschen, nuoh!«
Er tätschelte Alexanders Hand und begann recht umständlich zu erzählen:
»Vor der Schlacht bei Hochkirch hatte ich etwas nach Bautzen zu transportieren. Durch die starken militärischen Bewegungen konnten wir aber nicht mehr zurückkommen. Alle Straßen waren gesperrt!
Als wir uns dann wenige Stunden, nachdem der Schlachtenlärm verhalft war, wieder auf den Heimweg machten, wurde es bald dunkel. In Hochkirch brannten noch vereinzelt Gehöfte. Uns bot sich ein unbeschreibliches Schreckensbild. Überall lagen verstümmelte Tote, Waffen, Helme, zerstörte Geschütze und Wagen, es war ein unübersehbares Tohuwabohu. Die Preußen hatten sich nur eine Meile vom Schlachtfeld zurückgezogen, und die Österreicher waren wieder in die Berge verschwunden. So wollte ich mit meinem Knecht in einem nicht niedergebrannten Pferdestall übernachten, nuoh. Können Sie mir noch zuhören, oder quäle ich Sie mit meinem Bericht?«
Alexander bewegte leicht den Kopf: »Nein, nein, Herr Wabnitz, sprechen Sie nur weiter.«
»Nun, wie gesagt, mein Knecht, der Emil, der hatte die Pferde schon abgeschirrt und gefüttert. Als ich so aus dem kleinen Stallfenster schaute, um noch einmal alles zu überblicken, entdeckte ich etwas Schauriges. Wissen Sie, die Helden des Tages sind oft auch die Hyänen der Nacht. Sie denken, man habe schließlich das Recht, eine Leiche einfach auszuziehen. Das ist bei allen Armeen so, nuoh.
Es ist eine Tatsache, dass nach den Kämpfern dann die Diebe kommen. Die kennen keine Gottesfurcht, o nein, wie Ratten durchstreifen sie in der Dämmerung das Schlachtfeld. Halunken sind das, das kann ich Ihnen sagen, zwielichtige Kreaturen, Plünderer aller Art, nuoh.
Dieses Gesindel nennt man die Leichengeier, nuoh. Wie gesagt, ich starre zum Stallfenster hinaus, da sehe ich solche dunklen Gestalten durch einen Hohlweg schleichen. Vom Geruch des Todes angelockt, kamen sie, um die Leichen zu plündern. Unruhig und dreist tasteten sie sich voran, und spähten nach links und nach rechts. Einige trugen Beutel, andere hatten offenbar weite Taschen unter ihren Mänteln.
Einer von ihnen, so ein Buckliger, trug einen Rock, der wie eine preußische Uniform aussah, nuoh. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen, prüfte die Gegend, als wolle er sehen, ob man ihn beobachte. Dann bückte er sich plötzlich und durchstöberte auf der Erde etwas Lebloses. Doch bald richtete er sich wieder auf und verschwand hinter einer Mauer, nuoh.«
Alexander verzog vor Schmerzen sein Gesicht und stöhnte leise vor sich hin.
»Soll ich Ihnen etwas zu trinken geben?«
Alexander wollte antworten, doch vermochte er nur seinen Kopf leicht zu bewegen.
Sogleich nahm Herr Wabnitz die bereitstehende Flasche und setzte sie dem Verwundeten an den Mund.
Alexander trank einige Schluck, dann sagte er: »Danke, erzählen Sie nur weiter.«
Herr Wabnitz räusperte sich: »Ja, wo war ich denn stehengeblieben?
Ach ja: Bald kam der Strauchdieb wieder hervor. Er belauerte das grausige Schlachtfeld wie bei einer Totenschau. Plötzlich blieb er stehen. Wenige Schritte vor dem Hohlweg, in der Menge übereinanderliegender Toter, ragte eine Hand heraus. Er ergriff diese und zerrte daran herum. Offensichtlich zog er einen Ring von einem Finger ab. Er blieb in der gebückten Haltung und beugte sich über den Körper des Dahingestreckten. Dann spähte er wieder in alle Richtungen, um sicher zu sein, nicht beobachtet zu werden, nuoh.
Wieder neigte er sich herab und wühlte weiter. Er packte die Hand und zerrte den Uniformrock von dem scheinbar noch nicht erstarrten Körper. Die Schärpe legte er beiseite. Aus der Hosentasche entnahm er eine Börse und steckte sie ein. In der Weste fand er ein Buch, das er im hohen Bogen zur Seite warf. Zuletzt zog er dem Offizier die Stiefel aus.
Dann verschwand er mit der Beute wie ein räudiger Fuchs. Die Schärpe hatte er sich um den Hals gelegt. Solch ein skrupelloser Sündermensch, nuoh. Keine Gottesfurcht hat diese Brut, nuoh.
Zu meinem Knecht sagte ich: Du, Emil, ich will mal sehen, was der da für ein Buch weggeworfen hat, nuoh! Und nun gehen wir beide und Emden das Buch …«
Herr Wabnitz erhob sich und holte etwas vom Tisch.
»Hier, diese Bibel finde ich, und dadurch auch Sie, gnädiger Herr. Sie stöhnten plötzlich so stark auf, da merkten wir beide, dass Sie noch lebten.«
Herr Wabnitz öffnete seine andere Hand und hielt ihm das zerbeulte Medaillon hin: »Nur dies hier hat der Halunke nicht gefunden, oder es war ihm zu zerbeult …«
»J e a n n e t t e !« flüsterte Alexander.
»Wie bitte?« fragte Herr Wabnitz.
»Es hat mir das Leben gerettet!«
Herr Wabnitz legte das Medaillon behutsam auf das Bett und meinte: »O ja, wie unerforschlich sind die Wege des Herrn.«
Alexander bemerkte die besondere Gläubigkeit, die in diesem Hause herrschte, deshalb flüsterte er stockend: »Sie waren mir wie ein Engel von Gott gesandt, sonst wäre ich jetzt nicht mehr am Leben.«
Der Hausherr berichtete Alexander, wie er ihn mit Hilfe seines Knechtes auf den Wagen gehoben, wie sie ihn in Decken eingehüllt, und dann unbehelligt ihres Weges gezogen waren. Die Österreicher hätten noch immer mit flammenden Fackeln das Schlachtfeld nach Verwundeten abgesucht und seien deshalb völlig mit sich selbst beschäftigt gewesen. Mit der Dunkelheit sei dann dichter Nebel aufgekommen. Erst nach stundenlanger Fahrt seien sie in Löbau angekommen und hätten bei einem Bekannten ein erstes Quartier gefunden. Er, Alexander, sei beim Transport in das Haus schreiend erwacht, weil die linke Brustseite und der Arm besonders geschmerzt hätten.
Noch in der Nacht habe man einen Arzt rufen müssen, der aus dem linken Oberarm mit Zange und Skalpell eine Gewehrkugel herausoperierte. Die Wunde am Kopf sei von dem Arzt gut ausgewaschen und verbunden worden. Auch am Brustkorb habe der Mediziner zwei Einschnitte gemacht.
Herr Wabnitz tätschelte Alexander die Hand, dann fuhr er fort: »Zunächst mussten wir natürlich in Löbau bleiben, denn in diesem Zustand war eine Weiterfahrt mit Ihnen unmöglich. Der Gehilfe des Chirurgen kam des Öfteren, erneuerte den Verband und behandelte später die nässenden Wunden mit Höllenstein. Sie müssen furchtbar gelitten haben und magerten auch sehr schnell ab, weil Sie kaum etwas zu sich nahmen, nuoh.
Erst am siebenten Tag nach der Schlacht kamen wir hier an.
Danach hatte sich Ihr Zustand wieder zusehends verschlechtert. Sie wurden von wildem Fieber geschüttelt. Wir fürchteten, dass sich bei Ihnen ein Wundbrand einstellen würde. Aber Gott hat Gnade geschenkt.«
Herr Wabnitz blickte zur Decke, dann schloss er seine Augenlider: »O Herr, mein Schöpfer! Du hast unsere Gebete erhört …«, sagte er mit zitternder Stimme, indem er die Hände faltete. »Du hast Herrn Blankenburg gerettet. Ich danke dir, Herr!«
Frau Wabnitz brachte die Rinderbrühe in einem kleinen Schälchen. »So, mein Herr, jetzt müssen Sie aber etwas essen, damit Sie wieder zu Kräften kommen.«
Die Eheleute versuchten vorsichtig, Alexander etwas aufzurichten, indem sie ihm mehrere Kissen hinter den Rücken stopften. Obwohl beide sehr behutsam mit dem Schwerverletzten umgingen, stöhnte dieser heftig. Er zitterte vor Schmerzen und Furcht, der Schweiß trat ihm durch alle Poren.
»Diese Brühe ist schon ein wenig abgekühlt, sie gibt Ihnen bestimmt etwas Kraft.« Liebevoll reichte die Frau ihm einen Löffel nach dem anderen.
Alexander hatte starke Schluckbeschwerden, selbst die kleinsten Fleischfasern erzeugten beim Essen starke Schmerzen am Kehlkopf und in der Speiseröhre. Dem Magen aber brachte die Brühe wohltuende Wärme.
Nachdem Alexander die Hälfte der Nahrung zu sich genommen hatte, flüsterte er: »Es ist erstmal genug…«, dabei verschluckte er sich und begann zu husten, was ihm heftige Schmerzen bereitete. Der Hausherr strich ihm sanft über die Hand, während ihm die Frau den Schweiß von der Stirn wischte. Nachdem der Hustenanfall vorüber war, legten die beiden ihn vorsichtig wieder zurück.
Erneut fiel Alexander in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf, doch von Tag zu Tag blieb er länger wach. Allmählich nahmen seine Kräfte zu und die Heilung schritt voran.
Eines Morgens, als Herr Wabnitz merkte, dass sich der Verwundete etwas erholt hatte, schlug er ihm vor: »Nun möchte ich Ihnen gern ein Gotteswort aus dem Evangelium lesen, natürlich nur, wenn Sie es wünschen.«
Alexander nickte.
Herr Wabnitz blätterte in der Heiligen Schrift, es war die Bibel, die Alexander vor Jahren nach seiner Flucht aus Berlin vom evangelischen Pastor in Sachsen geschenkt bekommen, und in der er schon oftmals, angeregt durch die geistlichen Gespräche mit seinem Burschen Reinhold Friesicke, gelesen hatte.
Dann begann er mit Andacht und ohne Pathos zu lesen:
»Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann.
Und ich hörte eine mächtige Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Stätte Gottes bei den Menschen; und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen; und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.«
Er hatte sich nicht unterbrochen, nur hin und wieder auf den Kranken geblickt, der seine Augen geschlossen hielt, und beobachtet, dass Tränen an seinen Wangen herunterliefen.
»Ja«, sagte Herr Wabnitz, »eine völlig neue Welt. Welch eine Herrlichkeit, Gottes Geist schafft eine neue Erde und auch einen neuen Himmel. So etwas kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber man kann es erahnen.
Der Mittelpunkt in dieser neuen Welt ist die große Gottesgemeinde, die hier als Braut dargestellt wird. Gott wird sich um alle einzeln kümmern, deshalb trocknet der Schöpfer alle Tränen ab«, dabei wischte Herr Wabnitz mit einer Serviette die Tränen von Alexanders Wangen.
»Es gibt dort keine Missklänge und keinen Kummer mehr. Alles wird neu und unvergänglich sein, kein Sterben, kein Tod. Das Wesen dieser Welt ist dann völlig vergangen.«
Alexander erinnerte sich an die überirdischen Erscheinungen.
Sollte er ihnen davon berichten? Würden die beiden gottesfürchtigen Menschen ihn nicht für unzurechnungsfähig halten? –
Doch dann begann er: »Etwas von diesem lichtvollen Zustand habe ich erlebt, als ich nach meiner Verwundung das Bewusstsein verloren hatte. Ich vermag kaum Worte zu finden, mit denen ich diese Erlebnisse angemessen schildern könnte.«
Alexander schluckte gequält, fuhr dann aber leise fort: »Auf einmal befand ich mich in einem sehr tiefen Tal. Es war, als ob ein Weg, ja fast eine Straße durch das Tal führte. Über diesem Weg schwebte ich. Alles erglänzte in einem unbeschreiblichen Licht. Ich hatte überwältigende Gefühle von Frieden, Freude und Liebe.«
Alexander schloss seine Augenlider und sagte ganz hingegeben: »In jener Welt regiert die Liebe, nur Gottes Liebe ist dort Maßstab aller Dinge«, hauchte er.
Nach einer eindrucksvollen Pause meinte Herr Wabnitz: »Ja, die Liebe ist das Leben. Alles, was wir in Wahrheit erleben, verstehen wir nur dadurch, dass wir richtig lieben. Durch diese Liebe wird alles geheilt, verbunden und erneuert. Gott ist Liebe, und wenn wir endgültig diese Welt verlassen, werden wir erkennen, ob wir zur Quelle der ewigen Liebe zurückgekehrt sind.«
Alexander neigte sich erschöpft zur Seite. Seine Kräfte waren aufgebraucht, um weiter von der Schönheit seiner jenseitigen Erlebnisse und ihrer Bedeutung zu reden.
Die Hände gefaltet, von Ehrfurcht ergriffen, standen Herr und Frau Wabnitz neben dem Bett.
»Du gütiger Vater, bitte segne unseren Gast und Freund, lass ihn recht bald zu Kräften kommen und gesunden. Wir bitten es in Jesu Namen, Amen!«
Bald darauf schloss Alexander, sichtlich ermüdet, wieder seine Augen.
Beim Einschlafen hatte er fortwährend an Jeannette gedacht. Obwohl mehr als 100 Meilen von ihr entfernt, fühlte er sich seiner Liebsten näher als Wochen zuvor. Immer wieder kreisten die Gedanken in seinem Kopf:
»Die Liebe ist das Leben! Was ist Liebe? Die Liebe besiegt den Tod. Alles, was ich verstehe, verstehe ich nur dadurch, dass ich liebe. Alles ist und existiert nur dadurch, dass ich liebe. Alles ist durch die Liebe miteinander verknüpft.«
Nun erschien ihm Jeannette im Traum, sie wurde in einem kleinen, offenen Schlitten von einem Mann über ein zugefrorenes Wasser gelenkt. Der Mann trug eine braune Pelzmütze, und seine Schultern umschloss ein roter, pelzbesetzter Umhang. Flink glitten die Kufen im großen Kreise über das spiegelglatte Eis. Für die winterlichen Temperaturen war Jeannette eigentlich zu frühlingshaft gekleidet, obwohl sie ihre Hände in einem Muff wärmte. Sie blickte schelmisch und verheißungsvoll zur Seite. Am Horizont hinter dunklen Wolken schimmerte trübes Mondlicht. In der Ferne erkannte Alexander eine in Eis erstarrte Wassermühle.
An der Frontseite des Rokokoschlittens glänzte ein kleiner Schwan aus purem Gold. Jetzt wandte der Mann im roten Umhang, der den Schlitten schob, seinen Kopf zur Seite. Da erkannte Alexander sich selbst. Nun meinte er, Jeannette singen zu hören:
»Folg diesem sanften Schwanund lass den schwarzen Adler fliegen,komm heim ins Reich der Liebe dannund lass den Frieden blühen.«
Ihn überkam dabei ein glückseliges Empfinden. Plötzlich schmolzen Eis und Schnee, das ganze Land begann zu blühen, der Schlitten hatte sich in einen Kahn verwandelt. In einem wunderschönen Frühlingsgewand, das einem Brautkleid glich, lachte Jeannette ausgelassen und beglückt, so dass der Bräutigam, der kein anderer als er selbst war, jetzt den Kahn mit kräftigen Schlägen ruderte.
In diesem Traum waren seine Gedanken außerordentlich klar. Als Alexander kurze Zeit danach wieder zu sich kam, erblickte er Frau Wabnitz, die auf einem Lehnstuhl saß und strickte. Ihre schlanken Finger hantierten schnell mit den Nadeln, die munter aneinanderschlugen. Durch eine ungeschickte Bewegung rollte plötzlich das Knäuel Garn von ihrem Schoß herunter. Sie beugte sich zur Seite, hob die Wolle auf und bemerkte dabei, dass ihr Schutzbefohlener erwacht war.
»Haben Sie geschlafen und etwas Schönes geträumt?« fragte sie.
»Woher wissen Sie, dass ich geträumt habe?«
»Nun, Sie haben sehr frohe Laute von sich gegeben, so dass ich vermute, Sie haben etwas Beglückendes geträumt.«
»Ja«, sagte Alexander, »ich habe vom Frieden und von meiner Braut geträumt. Ich muss ihr dringend eine Nachricht zukommen lassen. Wer könnte für mich hier wohl einen Brief schreiben?«
Frau Wabnitz blickte ihn freundlich an: »Heute Nachmittag kommt der Arzt, der wird Ihnen bestimmt behilflich sein. Wenn mein Mann dann über Land fährt, kann er dafür sorgen, dass der Brief weitertransportiert wird.«
Am Nachmittag bat Alexander den Arzt, ihm die Gefälligkeit zu erweisen, einen Brief für ihn zu schreiben. Der Mediziner, der dem Herrnhuter Gemeindekreis angehörte, tat dies um so lieber, da er die Gottesfurcht des preußischen Offiziers hoch zu schätzen wusste. Alexander diktierte dem Arzt:
»Geliebte Jeannette!
Gott hat ein herrliches Wunder getan, er hat mich aus dem Tal des Todes zu den Lebendigen gebracht. Meine schweren Verwundungen erlauben es mir noch nicht, aufzustehen, ich befinde mich aber auf dem Weg der Besserung. Umgeben von lieben Menschen, die mich aus christlicher Nächstenliebe wie einen Sohn aufgenommen haben, werde ich aufs beste gepflegt.
Aus Gründen der Sicherheit möchte ich Dir meinen Aufenthaltsort noch nicht mitteilen, weil ich nicht weiß, wie und unter welchen Umständen dieser Brief zu Dir gelangt. Mach' Dir keine Sorgen um mich. Sobald ich kann, werde ich versuchen, zu Dir zu kommen.
Bitte bete für mich, so wie ich es auch täglich für Dich tue. Wir werden uns, so Gott will, bald wiedersehen und dann in Frieden leben können.
Bitte grüße ergebenst die Fürstin und den Fürsten von mir. Sie mögen noch keine Meldung an das Hauptquartier weitergeben.
Sei innig umarmt von Deinem Dich liebenden
Alexander.«
Seit Tagen fegte heulend ein Sturm über die kleinen Gehöfte in der Oberlausitz. Er jagte die letzten Blätter vor sich hin. Der scharfe Ostwind trieb eine grimmige Kälte herbei. Die Pfützen froren zu Eis. Tagelange Schneefälle verwandelten die sächsischen Wälder und die abgeernteten Fluren in eine glitzernde Winterlandschaft.
Die Bevölkerung litt unter den Lasten des Krieges. Aus Futtermangel verkauften Landarbeiter ihre Schafe für zwölf oder sogar für nur sieben Groschen. Pferde, Kühe und Ochsen waren zum größten Teil den Leuten von den durchziehenden Besatzungstruppen weggenommen worden. Seuchen, durch böhmische Ochsen eingeschleppt, dezimierten die kümmerlichen Bestände. In den Dörfern verwahrlosten zusehends Häuser, Scheunen und Kirchen, von den Wänden bröckelte der Putz ab. Unter der ärmeren Landbevölkerung hatte so mancher nicht mehr satt zu essen. Einige litten an Typhus oder Cholera. Schon Mitte Dezember war die letzte Garbe Korn verkauft. Die Marketender der Österreicher zahlten auf den Scheffel Korn vier Groschen, auf den Scheffel Hafer sogar fünf Groschen weniger als vor einigen Wochen die preußischen Kornjuden.
Überall herrschte tiefe Resignation, nur bei der christlichen Herrnhuter Brüdergemeine funktionierte ein gemeinschaftliches Hilfssystem. Die begüterten Familien versorgten die Annen, Witwen und besonders die Kranken.
Alexander verspürte eine besondere Obhut im Hause des Fuhrunternehmers. Nach acht Wochen war seine Heilung so weit fortgeschritten, dass er sich aufrichten und anziehen konnte.
Herr Wabnitz trug ihn dann wie ein Kind zum Lehnstuhl, der am Fenster stand. Langsam kam der Genesende wieder zu Kräften. Die Wunde an der Brust eiterte noch. Am Kopf und an einem Arm trug er Verbände. Er war für die liebevolle Pflege sehr dankbar.
»Gott sei gepriesen, ich werde bald wieder hergestellt sein«, sagte er zu Herrn Wabnitz, »für mich ist jetzt alles ganz neu. Was ich früher als selbstverständlich ansah, sehe ich heute als Gnade und Hilfe Gottes. Für jeden Tag, an dem ich schmerzlos erwache, danke ich ihm von ganzem Herzen. Für jeden Schritt, den ich vorsichtig gehen kann, will ich den Herrn loben. Für jede Liebestat, die ich von Ihnen empfange, bin ich unendlich dankbar; denn der Herr sagt: ›Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.«‹
Herr und Frau Wabnitz taten, was sie konnten, aus reiner Nächstenliebe und weigerten sich, dafür ein Lob anzunehmen. Sie teilten auch in der schlimmen Zeit alles ganz selbstlos mit Alexander. Er spürte die innige Frömmigkeit. Schon in der Frühe hörte er ihre Gebete und Gesänge.