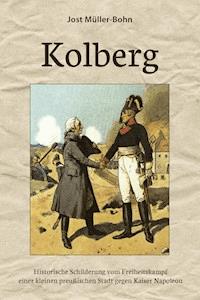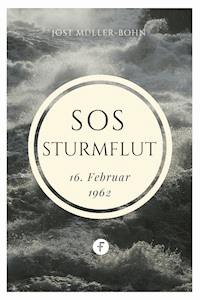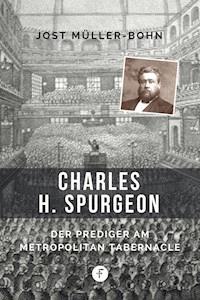Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Preußen-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Rebellion des Herzens erzählt die mitreißende Geschichte eines jungen Abenteurers, der unfreiwillig in die Disziplin und Härte der preußischen Armee gerät. Als er einem geschickten Werbeoffizier in die Hände fällt, scheint sein freies Leben vorbei. Doch es ist nicht nur militärische Strenge, die ihn in Preußens Reihen hält – die bezaubernde Komtesse Jeannette von Priegnitz entfacht in ihm eine glühende Bewunderung für Friedrich den Großen und sein Reich. Doch die Wirklichkeit hinter den glänzenden Fassaden des preußischen Militärs holt ihn schnell ein. In der von Mauern umgebenen Garnisonsstadt Berlin zerbrechen seine kühnsten Träume von Heldentum und Liebe. Der Drill, die Strenge und die unerbittlichen Regeln der Armee machen ihm zu schaffen. Gerade als er jede Hoffnung auf ein anderes Schicksal aufzugeben droht, wendet sich das Blatt. Kurz vor Ausbruch des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) führt ihn eine königliche Revue erneut mit seiner geliebten Jeannette zusammen – ein Moment, der sein Leben für immer verändern könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Rebellion des Herzens
Preußen-Saga Band 1
Jost Müller-Bohn
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Jost Müller-Bohn
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-033-9
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Jugend im Aufbruch
Die Reisegesellschaft
In den Fängen der Werber
Die große Enttäuschung
Sag mir wo die Liebe wohnt
Der Privatlehrer
Flucht in die Freiheit
Die Königsparade
Jugend im Aufbruch
An einem milden Frühlingstag gingen ein wohlgekleideter Mann und sein Sohn am Ufer des Neckars entlang. Beide schienen von einem ausgedehnten Spaziergang zurückzukehren, denn ihre schwarzen Schuhe waren sehr verstaubt.
Der Alte trug einen langen Spazierstock mit goldenem Knauf unter dem Arm. Mit seinen dunklen Augen, aus welchen noch ungebrochene Geisteskraft hervorleuchtete, blickte er von Zeit zu Zeit seinen Ältesten an.
Beide verlangsamten ihre Schritte und sahen noch einmal hin-über zu dem wunderbar geformten Höhenzug der Schwäbischen Alb. Im Westen zog langsam eine mächtige Wolkenbank von leuchtendem Rot mit Gelb umkränzt auf. Die verwinkelten Dächer der altehrwürdigen Universitätsstadt Tübingen glänzten in flammendem Abendrot.
»Welch ein herrliches Leuchten. Ihr werdet morgen einen schönen Reisetag haben«, der Alte nahm seinen kunstvoll geschnitzten Spazierstock wieder in die Hand und stützte sich darauf. Knirschend bohrte sich die Spitze zwischen Sand und Steinen in den unebenen Fußweg.
»Mein Junge«, begann der Alte, »um deine Zukunft ist mir in keiner Weise bange, du gehst deinen Weg besonnen und zielstrebig«, er seufzte tief, »aber dein Bruder, was soll ich sagen …; – ja – «, seine blauen schmalen Lippen verzogen sich recht schmerzvoll, »er hat scheinbar das aufrührerische Wesen der alten Schlange geerbt.« Seine linke Hand bewegte sich nervös hin und her: »Ein furchtbar leichtes Blut fließt in seinen Adern.« Der Alte räusperte sich erregt.
»Herr Vater, Alexander befindet sich in den schlimmen Jahren des Umbruchs. Man sollte sein Temperament nicht so streng bewerten, er ist noch sehr jung …«
»Ach was, zu jung! In seinem Alter war ich bereits ein entschlossener Mann mit klaren Vorstellungen.«
»Vater, Alexander ist wohl leichtblütig, aber er ist nicht verdorben …«
»Noch nicht, mein Sohn, noch nicht verdorben«, unterbrach ihn der Alte energisch und unterstrich seine Aussage, indem er mit dem Stock vor sich in die Luft stieß.
»Ich glaube, in ihm steckt ein guter Kern.« Thomas wagte es, noch einmal seinen Bruder zu verteidigen: »Es muss auch alles ausreifen.«
»Tja, – vielleicht magst du recht haben, trotzdem mache ich mir große Sorgen um ihn. Es fließt ein kriegerisches Blut in seinen Adern. Sein Wesen ist so launenhaft und so unbeständig. Von einem ordentlichen Beruf will der Bursche überhaupt nichts wissen.«
Thomas schwieg. Er dachte an den peinlichen Auftritt, dem er vor einigen Tagen beigewohnt hatte. Alexander war in einer berüchtigten Schenke in fragwürdiger Gesellschaft gesehen worden. Der Vater hatte ihn mit üblen Worten beschimpft und mit moralischen Grundsätzen überhäuft, bis er sich dann verärgert in sein Refugium zurückgezogen hatte.
Der Alte schritt energisch weiter. Laut schlug der Stock auf das Kopfsteinpflaster, als die beiden von Süden her einen schmalen Pfad zur Stadt hinaufstiegen.
»Von wem er diesen flatterhaften Sinn geerbt hat, kann ich mir auch nicht erklären«, schnaufte der alte Mann. Seine Stimme wurde kurzatmig: »Ich hoffe nur, dass er in Frankfurt etwas Gescheites lernt. Ich habe dem Professor geschrieben und ihn um strengste Zucht gebeten. Ich habe veranlasst, dass dieser Herr Leichtfuß in einer frommen Familie Unterkunft findet, die ihn beaufsichtigt. Er kann sich dort durch Unterrichtsstunden für die zahlreiche Kinderschar sein Geld zum Studium verdienen. Und damit er auf keine dummen Gedanken kommt, soll man das Geld sofort dem Kollegium übergeben.
»Druck erzeugt Gegendruck«, gab Thomas zu bedenken, »ob das die richtige Methode ist, einen begabten Jungen in seinem Alter so hart an die Kandare zu nehmen?«
Verärgert schlug der Vater mit seinem Stock auf einen Stein: »Mir scheint, du unterstützt diesen Hans-Liederlich noch, ihr steckt wohl beide unter einer Decke, wie? Was soll aus diesem grünen Früchtchen denn werden? Letzten Endes kommt er mir noch mit einer verrufenen Stadtdirne ins Haus. – Nein, meine
Alt-Tübingen, Stadtansicht. Illustration: Georg Salzmann
Herren, nein, daraus wird nichts! Nein und nochmals nein, so wahr mir Gott helfe! Ich will mein Bestes tun, um ihn vor dem Schlimmsten zu bewahren.«
Thomas wusste den Vater an seiner empfindlichsten Stelle zu packen, als er begann, Verse der Heiligen Schrift vorzutragen.
»Ein Vater hatte zwei Söhne …«, sagte er geschickt und fragte, »was unternahm der Vater, von dem Jesus damals sprach, als der Jüngere seine eigenen Wege gehen wollte?«
Johannes Blankenburgs Gesicht wurde milder. Die Adern, die unter den Schläfen entlang dem einfachen Dreispitz hervorquollen, entspannten sich zusehends.
»Schon gut, mein Sohn, schon gut, ich kenne dieses Gleichnis. Trotzdem will ich nichts unversucht lassen, um meinen Kindern manchen Irrweg zu ersparen.«
Sie begegneten älteren und jüngeren Bürgern der Stadt, die sich ehrwürdig vor ihnen verneigten und mit einem »Grüß Gott, Herr Pfarrer« an ihnen vorübergingen.
Unterdessen hatten die beiden ihr Ziel erreicht. Ein letztes Mal blickte der Vater über die Dächer der Stadt, ehe er mit seinem Sohn an der schmiedeeisernen Gartentür vorbei in den Vorgarten eines alten Fachwerkhauses trat.
Noch einmal versuchte Thomas den Vater zu besänftigen. Sehr diplomatisch sagte er: »Alexander würde gewiss mehr Freude am Leben haben, wenn er seinen Beruf selbst wählen könnte …«
»Darf ich wohl erfahren, welchen Beruf mein Herr Sohn denn ergreifen will? Kannst du mir das wohl sagen?«
Die Stimme des Pfarrers klang unerbittlich: »Morgens wälzt er sich bis in den Vormittag hinein im Bett, um faule Bücher zu lesen, die sich mit Kriegen, Uniformen, Waffen und Schlachtplänen befassen, als gelte es, die Türken vor den Toren Wiens noch einmal zu vertreiben. Nein, nein, und nochmals nein! Thomas, dein Bruder soll mir hier nur nicht in der verhassten Montur dieses gottlosen Menschenschinders aus Potsdam erscheinen. Nichts wäre schrecklicher für mich, als meinen Sohn in der Uniform des lästernden Antichristen aus Preußen zu sehen.«
Thomas hielt es inzwischen für angebracht, endgültig zu schweigen, denn er merkte, dass seine Argumente den Vater in dieser Verfassung bestimmt nicht überzeugen würden. Die Stimme klang so aufgebracht, dass er von nun an jeden Einwand unterließ.
Am Pfarrhaus waren bereits die schweren Läden vor den Fenstern geschlossen. Im Innern des Hauses schien sich seit dem Dreißigjährigen Krieg nichts verändert zu haben. Verzogene Balken und schiefe Wände, die wohl gepflegt und mit allerlei wertvollen Kupferstichen behangen waren, zierten den Flur. Eine winklige Treppe führte hinauf zu den Wohnräumen. Im Arbeitszimmer des Pfarrers stapelten sich kleine und größere, in Leder gebundene, theologische Werke. An den Wänden hingen gerahmte Holzschnitte von Albrecht Dürer, einige aus der großen Passion und andere Christusdarstellungen. Auf dem Hausaltar stand ein siebenarmiger Leuchter aus Bronze hinter einer großen, aufgeschlagenen Bibel.
Vater und Sohn stiegen die dunkle Holztreppe hinauf, die unter der Last der beiden zu knarren und zu ächzen begann. Der Mittelteil der Stufen war schon beachtlich ausgetreten.
»Wir können gleich essen!« rief eine weibliche Stimme über den Flur. Gerade hatten sich Johannes Blankenburg und Thomas an den Tisch gesetzt, als auch schon das Abendessen serviert wurde. Als Vorspeise stellte Marie-Luise, die einzige Tochter des Hauses, eine große Terrine mit würziger Bouillon auf den Tisch. Danach wurden selbstbereitete Spätzle und Kartoffelsalat gereicht.
Blankenburg sah seine Frau vorwurfsvoll an: »Wo ist Alexander? Hat man ihn nicht zu Tisch gerufen? Was ist los mit ihm?«
Verlegen blickte die Mutter auf die Speisen: »Ich habe dem Jungen gestattet, sich von seinen Freunden zu verabschieden, weil er doch jetzt für viele Monate nicht mehr nach Hause kommt.«
Blankenburg seufzte: »Freunde? – Schöne Freunde, sehr vor-teilhafte Freunde, das muss ich schon sagen«, nörgelte er verärgert vor sich hin.
»Johannes, das ist der letzte Tag heute. Für ihn beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Gönne ihm doch die Freude. Wer weiß, wann er wohl dazu kommt, seine Schulkameraden wiederzusehen. Er hat mir auch versprochen, vor zehn Uhr daheim zu sein.«
Pfarrer Blankenburg sprach das Tischgebet und wünschte allen: »Gott segne euch die Speisen«.
»Hoffentlich haben wir eine gesicherte Überfahrt«, meinte Thomas, »der Seekrieg zwischen England und Frankreich nimmt immer größere Formen an.«
Genüsslich trank der Vater seinen schwäbischen Apfelmost. Nachdem er das Glas zur Seite gestellt und sich die Mundwinkel getrocknet hatte, erklärte er: »Tja, Krieg und Kriegsgeschrei, wie es der Herr vorausgesagt hat. Ich würde dir deshalb auch dringendst raten, Thomas, ein niederländisches Schiff zu besteigen. Auf neutralen Seglern ist man doch etwas sicherer als auf einem Schiff von einer der beiden Kriegsparteien.«
Der Pfarrer hielt sich plötzlich die Serviette vor den Mund, weil er aufstoßen musste, denn er hatte sich vor Erregung verschluckt.
Thomas nickte zustimmend: »Die Völker haben aus der Geschichte nichts gelernt. Spätestens nach dem Dreißigjährigen Krieg hätte doch das Morden endgültig aufhören müssen …«
Frau Magdalena Blankenburg legte demonstrativ den Löffel hin: »Müssen wir denn gerade heute über diese Dinge sprechen? Thomas und Alexander sind wahrscheinlich für lange Zeit zum letzten Mal an diesem Tisch. Schon morgen reisen sie fort von hier, und wir reden noch immer von Kriegen und Kriegsgeschrei.«
Dem Hausherrn kam der letzte Satz gerade gelegen. Sofort machte er seinem noch nicht verrauchten Groll wieder Luft: »Einer deiner Söhne nimmt es sich nicht so zu Herzen, Mutter; Alexander sitzt wohl zum letzten Abendessen an einem anderen Ort.« Frau Blankenburg blickte sichtlich gekränkt auf ihren Teller.
Georg, das jüngste Glied der Familie, schaute mit seinen wachen Augen über den Tisch und lenkte schnell die Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Mit seinen 14 Jahren fragte er voller Interesse: »Ist es wahr, dass es in Kanada noch viele Indianer gibt?«
»Ja, Georg, es gibt dort Indianer, aber auch noch viele Braunbären und Wölfe.«
»Ach, wenn dich die Indianer nur nicht töten«, rief Marie-Luise erschrocken und begann zu weinen.
»Aber bitte, nur keine Wehleidigkeiten hier bei Tisch«, fuhr der Vater dazwischen. Er sah, wie auch die Augen seiner Frau plötzlich feucht wurden. Magdalena putzte sich erregt die Nase.
»Es wird mir hier in den letzten Tagen überhaupt zu viel geweint«, sagte Johannes Blankenburg betroffen, »wir ruhen doch alle in Gottes Hand.«
Alle spürten beim Vater auch eine gewisse Erregung in der Stimme, die man bei ihm sonst nicht kannte.
Geräuschvoll schob er seinen Sessel zurück und erhob sich. Das Abendessen war damit beendet. Johannes Blankenburg blieb mit seinem ältesten Sohn allein im hell erleuchteten Wohnzimmer. Zur Feier des Tages hatte die Mutter nicht nur die Wachskerzen in den Wandhaltern angezündet, sondern auch die Vielzahl der Lichter des schönen Kronleuchters. Ein warmer Schein ergoss sich über das gesamte Mobiliar. Das Zimmer war bis zu einem Meter hoch mit wertvollem Holz getäfelt, ab dieser Höhe zogen sich Stofftapeten bis an die Decke. Auf der Konsole schwang das Pendel einer goldverzierten Uhr hin und her.
»Morgen um diese Zeit bist du schon in Pforzheim«, sagte der Vater zu Thomas. Seine Stimme klang etwas belegt: »Monate werden vergehen, bis du in Kanada bist und dich in der Fremde eingelebt hast.« Er streifte sich dabei eine Fussel vom linken Ärmel: »Vergiss nie deinen Missionsauftrag. Die familiären Angelegenheiten kommen erst an zweiter Stelle.«
»Verwandte in einem so großen Erdteil aufzuspüren, würde schon an ein Wunder grenzen. Weiß man überhaupt etwas von den Verwandten jenseits des Ozeans?«
»Sehr wenig. Der Bruder meines Großvaters zog nach dem grauenhaften Krieg über das Meer. Aus einigen Dokumenten geht hervor, dass es ihm gelungen war, als Viehhändler große Reichtümer zu erwerben. Doch später hörte man nichts mehr von ihm, bis dann im letzten Jahr die Anfrage aus Quebec kam, ob noch eine Familie Blankenburg in Hamburg leben würde; und wenn ja, so hätten sie die Möglichkeit, ein bedeutendes Erbe anzutreten.«
»Das bedeutet doch, dass der unbekannte Verwandte kinderlos war, wenn ich das richtig verstehe«, fragte Thomas und fuhr dann fort: »aber ich bin kein Jakob, Vater, ich habe nie Viehzucht betrieben, und außerdem fühle ich mich berufen, den Indianern das Evangelium zu predigen.«
»Recht so, mein Sohn. Was soll uns der schnöde Mammon. Ackerbau und Viehzucht ist ein ehrenwerter Beruf, aber nicht jeder ist dazu geeignet.« Pfarrer Blankenburg strich nachdenklich über seine rechte Spitzenmanschette: »Was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und nähme doch Schaden an seiner Seele. ›Homo novus‹ – ein neuer Mensch durch den Glauben …«
Thomas nickte: »Ja, das soll mein Leitbild sein, so will ich predigen, Vater …«
Vom Flur her hörte man Schritte. Thomas wusste, dass sein Bruder gekommen war. Eine unbehagliche Stille trat ein. Pfarrer Blankenburg erhob sich und ging mit verschränkten Händen auf dem Rücken hin und her. Man hörte, wie der jüngere Sohn einige Worte mit der Mutter wechselte, dann öffnete sich die Tür: »Da bin ich, Vater, guten Abend allerseits.«
Der Pfarrer blickte missmutig auf die Uhr am Kamin: »Es ist höchste Zeit, mein Sohn, sich wenigstens in den letzten Stunden im Hause der Eltern sehen zu lassen.«
»Vater, ich hatte von der Mutter Erlaubnis bekommen, mich von meinen Freunden zu verabschieden.« Alexander versuchte, möglichst unbefangen den Vater anzuschauen. Sein junges, kühnes Gesicht sprühte vor Unternehmungslust und Entschlossenheit, als er sich noch einmal seinen Herzenswunsch von der Seele redete:
»Am liebsten würde ich ja mit Thomas nach Kanada reisen, Vater, um dort durch die Wälder zu streifen und ihm zur Seite zu stehen.«
»Thomas wird die Indianer auf den guten Weg des Glaubens führen und sie mit den Geboten Gottes vertraut machen, doch dazu muss man berufen sein«, betonte der Vater.
»Herr Vater, weshalb soll ich denn studieren«, widersprach Alexander aufgebracht, »ich könnte Thomas doch viel besser als Missionsgehilfe begleiten. Was man in einer Universität lernt, ist doch nur graue Theorie, die man überhaupt nicht gebrauchen kann.«
Wieder zogen sich die schmalen Lippen des Vaters verdächtig zusammen: »Du weißt nicht, was du redest, du grüner Junge. Nicht für die Schule, sondern für das Leben sollst du lernen. Und außerdem ist das Studium Balsam gegen jede Leidenschaft. Es wird höchste Zeit, dass du dir diese alte, jüdische Weisheit endlich einmal einprägst.«
Der Alte warf Alexander einen wütenden Blick zu: »Du wirst mir einmal sehr dankbar sein, dass ich dich zum Studium zwang, – ja, – man muss die Jugend oft zu ihrem Glück zwingen«, polterte er drauflos.
»Jeder Zwang ist Gift für die Seele«, erwiderte Alexander recht kühn und wunderte sich über seinen Mut.
»Papperlapapp, – Gift für die Seele – hat man schon je so etwas gehört? Was verstehst du Grünschnabel schon von der Seele? Steht nicht geschrieben: ›Der Narr verschmäht die Zucht seines Vaters; wer aber Zurechtweisung annimmt, ist klug? Die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt, und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen‹, hast du das vergessen?«
Der Ausdruck der Verzweiflung stand dem Jüngeren ins Gesicht geschrieben: »Ich bin nicht für die Universität geschaffen, Herr Vater.«
Der Pfarrer lachte: »Nicht für die Universität geschaffen! Hör sich das doch einer an. Was willst du denn werden, wenn ich einmal fragen darf?« Er wartete auf keine Antwort, sondern sprach erregt weiter: »Ich weiß schon, ein Wegelagerer, ein Tunichtgut, ein Faulenzer in Uniform, irgend so ein Affe von Offizier. Aber daraus wird nichts, solange ich lebe und für deine Zukunft verantwortlich bin!«, rief der Pfarrer.
Alexanders Augen glühten: »Der Offiziersstand ist nicht so schlecht, wie es mein Herr Vater sieht, denn Ruhe und Ordnung verdanken alle Bürger dem Schutz der Armee. Der König von Preußen ist außerdem noch Schriftsteller, Philosoph, Musiker, Staatsmann …«, er kam nicht weiter.
Gefährlich näherte sich der Pfarrer seinem Sohn: »Still jetzt! Dieser verruchte Narr wird in meinem Hause nicht genannt, hat Er mich verstanden? Ich will von diesem Friedensbrecher hier nichts mehr hören! Seine unerhörten, höchst frevelhaften Taten schreien zum Himmel! Seine entsetzlichen Verbrechen sind Gotteslästerung! Die Generale und Offiziere dieses Mordbrenners sollten ihren Dienst quittieren und sich in Armeen begeben, die für eine gerechte Sache kämpfen.«
Alexander schoss es glutheiß in die Adern. Mit nie gekannter Leidenschaft verteidigte er seine Meinung: »Für mich ist dieser König ein Held und Staatsmann, wie ihn Deutschland seit langer Zeit nicht hatte.«
Wieder fuhr ihn der Vater an: »Dieser Emporkömmling aus Brandenburg ist eine Kanaille, ein Reichsfriedensbrecher, der die Staaten ins Verderben stürzt. Man sollte ihn aus Schlesien wieder hinausjagen!« Schwer atmete der Alte jetzt.
»Herr Vater, ich verehre diesen König, er ist wie Gustav Adolf ein Verteidiger der protestantischen Sache, also auch unseres Glaubens.«
Thomas beobachtete erschrocken den unwürdigen Auftritt zwischen dem Vater und seinem jüngeren Bruder. Er wagte es aber nicht, sich in diesen heftigen Streit einzumischen.
Der Vater war seinem Sohn jetzt so nahe, dass sich ihre Nasenspitzen fast berührten: »Höre Er, mein Sohn, dies ist mein letztes Wort. Ich verbiete dir, in meinem Hause noch einmal den Namen dieses verantwortungslosen Abenteurers aus Potsdam zu nennen. Und jetzt geh mir aus den Augen, damit ich mich nicht vergesse!«
Thomas winkte seinem Bruder hinter dem Rücken des Vaters heimlich zu, um ein größeres Unheil am Tag vor seiner Abreise zu verhindern.
Alexander verließ zornentbrannt und wortlos das Zimmer. Als er die Tür laut hinter sich zufallen ließ, keuchte der Alte: »Dieser Mensch ist so aus der Art geschlagen, ich finde keine Worte für solche Starrköpfigkeit …«
Thomas schwieg. Er dachte bei sich: »Von wem er wohl einen solchen Starrkopf geerbt hat?«
Nun wandte sich der Vater wieder an den Ältesten: »Hör, Thomas, ich werde noch heute einen Brief an den Professor in Frankfurt aufsetzen, den du ihm vertraulich überreichst. Es wäre doch gelacht, wenn man solch einem infamen Aufrührer nicht die Flausen aus dem Kopf treiben könnte!« Weiterhin schnaubte der alte Herr: »Und nun geh und gib mir während eurer gemeinsamen Fahrt auf diesen Lotterbuben acht. – Gute Nacht!«
Thomas stieg die Treppe zu den beiden Dachkammern empor, in denen die Brüder bisher wohnten. Er überlegte, ob er noch einmal zu Alexander gehen sollte, um mit ihm zu reden.
Er hatte schon die Türklinke in der Hand und wollte eintreten, doch dann zog er es vor, noch damit zu warten und ihn erst auf der Fahrt nach Frankfurt ins Gebet zu nehmen, ihn vor allen Dingen zur Besonnenheit zu ermahnen und zu bitten, sich zu beruhigen.
Innerlich in großer Anspannung und ziemlich aufgewühlt, betrat er das »Prophetenstübchen«, wie er sein Studierkämmerlein zu nennen pflegte.
Er zog sich aus und legte sich ins Bett.
Tief bekümmert über den eben erlebten Ausbruch des Vaters gegenüber Alexander sann er noch eine Weile darüber nach, ob es nicht besser wäre, den Bruder mit nach Kanada zu nehmen. Übermüdet schlief er jedoch ein, ohne zu einem endgültigen Entschluss gekommen zu sein.
Die Zeit verrann, Thomas wälzte sich ungewöhnlich oft in seinem Bett hin und her. In dieser Nacht kam er kaum zu einem tiefen, erholsamen Schlaf.
Irgendwann begann er zu träumen. Er sah eine dürre, flache
»Der Schimmel ist ja wie toll! Kann ihn denn niemand halten?« Illustration: Adolph von Menzel
Landschaft, durchzogen von dunklen Wäldern. Ein starker Nord-Ost-Wind fegte über das öde Land. Hoch am Himmel jagten an der Mondsichel dunkle Wolken vorüber. Schatten und Licht wechselten einander am Erdboden ab. Der wilde Sturm nahm an Stärke zu. Aus der dunklen Ebene, noch ziemlich weit entfernt am Horizont, erhob sich ein kleiner heller Punkt, der aber schnell näher kam. Er wuchs und wuchs und im Traumbild erkannte sich Thomas auf dem Rücken eines Pferdes. Krampfhaft hielt er sich mit beiden Händen an der Mähne des galoppierenden Tieres fest.
Wie von Sinnen schnellte das Ross dahin, es machte einen tollkühnen Satz und warf ihn dabei auf die Erde. Dann wieherte es wie befreit, es klang wie ein Trompetensignal in dem Heulen des Sturmes.
»Bleib stehen!« schrie Thomas aus der Tiefe seiner Brust. »Bleib stehen, du Wahnsinniger!«
Von Ängsten gepeinigt rief es aus ihm heraus: »Der Schimmel ist ja wie toll! Kann ihn denn niemand halten?«
Das Tier stieg mit den Vorderfüßen in die Höhe, machte einen mächtigen Satz und stürmte davon wie ein Streithengst, der sich in die Schlacht stürzt. Die Haare an Kopf und Hals flatterten im Wind mächtig wie eine Löwenmähne.
Im Sturmgeheul blähten und türmten sich die düsteren Wolken zu Gebirgen auf. Ein atemberaubender Donner erscholl aus dem hohen Himmel und brachte Thomas zur Verzweiflung. Mit wild pochendem Herzschlag erwachte er und kam nur langsam zu sich.
Erschrocken und irritiert zugleich versuchte er, die eben geschauten Traumbilder zu deuten. Alles erschien ihm wie eine Warnung in der Vision, doch konnte er keine klare und einleuchtende Auslegung in diesem schwindelerregenden Naturschauspiel erkennen. Sollte dieses Nachtgesicht etwas mit seiner nicht ungefährlichen Mission in Kanada zu tun haben? Lauerten vielleicht irgendwelche, ihm noch unbekannte Gefahren auf der weiten Reise zu Lande oder auf dem Meer?
Weshalb war ihm das feurige Pferd entflohen? Warum musste er zu Boden stürzen?
Oder hatte das Traumgesicht etwas mit dem erbitterten Streitgespräch zwischen Vater und seinem Bruder Alexander zu tun? Ein seltsames Zittern erfasste ihn und er überlegte, ob er mit dem Vater über die geschauten Bilder reden sollte. Sicher würde der ihn auslachen. Konnte er sich lieber der Mutter anvertrauen? Doch die wollte er nicht unnötig in Angst versetzen.
Thomas stand auf und setzte sich in den Sessel am Fenster. Unten im Tal glitzerten im Dämmerlicht die langsamen Wasser des Neckars. Aus den Büschen hörte er das Schlagen der Nachtigall. Aber der Schlag seines Herzens schien ihm noch stärker. Eine Zeitlang saß er so da, dann erhob er sich und legte sich ins geöffnete Fenster. Der Nachttau rieselte von den Blättern und unter einer Hecke raschelte ein Igel im Gras.
Allmählich wurde das tiefe Dunkel des Nachthimmels von Osten her durch einen blassgelben Schimmer verdrängt. Ein frischer Wind erhob sich von Westen her und streifte seine heiße Stirn. Die erste Lerche stieg jubilierend in die Luft. Nun gab es keine Zeit mehr zum Schlafen. Thomas wusch sich und zog seine Reisekleider an, denn unten in den Wohnräumen hörte er erste Geräusche.
Serge, der Gehilfe von Thomas, hatte schon in aller Frühe das umfangreiche Gepäck seines Herrn und von dessen Bruder zum Marktplatz transportiert und mit dem Postillion auf dem Dach des Wagens verstaut.
In der frischen Maikühle zwitscherte eine hundertfältige Schar von Amseln, Drosseln, Meisen, Finken und Staren. Der Bunt-specht hämmerte lustig in dieses stimmenreiche Konzert hinein.
Bald sah man die Familie Blankenburg vom Schlossberg die Burgsteige herabkommen. Angeführt wurde die kleine Gruppe vom Vater, der seinen einfachen Dreispitz auf dem schlohweißen Haar trug. In der Hand hielt er den goldverzierten Spazierstock. Er trug seinen schwarzseidenen Amtsrock, darunter eine graue Samtweste mit dunkler Einfassung. Die schwarzen Seidenstrümpfe glänzten in den gleichfarbenen Schuhen mit dunkler Schnalle. Die Mutter hatte ein lindgrünes Sonntagskleid angezogen. Ihr reich verziertes Mieder war eng geschnürt, ein feines gelbes Seidentuch hatte sie über die Schultern gelegt. Für ihr Alter sah sie recht apart und jung aus.
Die Kinder, allen voran Marie-Luise, gingen sehr schweigsam hinter den Eltern her. Johannes Blankenburg schritt mit unbeweglicher Miene an der Seite seiner Frau. Magdalena begann leise zu weinen. Sie zog in einem unbeobachteten Augenblick ihren Sohn zur Seite und flüsterte ihm ins Ohr: »Bitte, Alex, sprich doch noch kurz mit Vater.«
Vom Gefühl des Abschieds ergriffen, nickte er zustimmend. Kurz entschlossen trat er auf seinen Vater zu: »Vater, ich möchte mich entschuldigen wegen meines heftigen Auftritts von gestern. Ich will versuchen, mein Temperament etwas mehr zu zügeln und in Zukunft mein Bestes zu tun.«
Auch Thomas, der dies beobachtet hatte, stiegen jetzt die Tränen in die Augen. Er biss sich heftig auf die Lippen. Sichtlich gerührt ergriff der Pfarrer die Hand Alexanders und murmelte mit rauer Stimme: »Ich meine es auch nur gut mit dir. Ich will inständig beten, dass der Herr euch auf dem rechten Weg leite.« Kurz umarmte er beide Söhne: »Alexander und Thomas, vergesst eure Eltern und du, Thomas, deine Heimat nicht.«
Georg flog seinem Bruder in die Arme: »Gelt, Thomas, du schickst mir einen Tomahawk und einen Kopfschmuck von einem Indianerhäuptling mit vielen Federn!«
Thomas versprach seinem kleinen Bruder, dieses sobald wie möglich zu tun. Alexander und Thomas umarmten die Mutter besonders innig, aber auch ihre Schwester Marie-Luise küssten sie auf die Wangen.
Nun stiegen die beiden in den Fahrgastraum der klobigen Kutsche, während Serge sich zum Postillion auf den Kutschbock setzte.
Pfarrer Blankenburg hob segnend seine Hände. »Der Herr begleite euch auf allen euren Wegen«, sagte er tief bewegt.
»He-ja!«, schrie der Postillion und knallte mit der Peitsche. Die Mutter und Marie-Luise schwenkten weinend ihre Tücher. Schwerfällig setzte sich das Gefährt in Bewegung und rumpelte über das raue Kopfsteinpflaster. Bald waren Pferde und Wagen hinter einer Straßenecke verschwunden.
Das Wetter hielt nicht, was es am Morgen versprochen. Als man an Stuttgart vorüber war, begann es stark zu regnen. Bald waren die Wege aufgeweicht. Mühselig zogen die Pferde das schwere Fahrzeug durch den Morast. Thomas und Alexander wurden wie die anderen Fahrgäste auf dem Lederpolster hin- und her gestoßen.
»Ich bin froh, wenn wir endlich in Pforzheim angekommen sind«, meinte Thomas. »Man wird ja schon auf dem Lande see-krank, was soll das erst auf dem Meer werden?«
»Bitte, nimm mich mit nach Kanada«, bettelte Alexander erneut. »Mir graust vor der Universität in Frankfurt.«
»Aber was soll ich denn mit dir in Kanada? Du kannst doch kein Französisch, und gerade diese Sprache wird doch vornehmlich in diesem Lande gesprochen.«
»Aber ich kann sehr gut Russisch«, unterbrach Alexander den großen Bruder.
»Dann müsstest du nach Russland reisen. Vielleicht kannst du nach dem Studium Diplomat bei der Zarin werden!«
»Bei dieser infamen Hure des Nordens?«
»Alex, wie kannst du nur eine Kaiserin mit solchen gemeinen Worten betiteln«, sagte Thomas entrüstet.
»Das sind nicht meine Worte, die stammen vom König von Preußen.«
Thomas erhob beschwörend seine Rechte: »Außerdem, was sollte der Vater von mir denken, er würde sich verraten und hintergangen fühlen.«
Alexander nickte: »Ich weiß, – ich hab ja auch nur laut gedacht.
Gelt, du schreibst mir bald?« Nach einer kurzen Pause begann er erneut: »Wenn ich die französische Sprache einigermaßen beherrsche, dann komme ich nach.«
Thomas legte die Hand auf die seines Bruders: »Ich denk an dich und will sehen, wie ich dir helfen kann.«
Die Reisegesellschaft
Bei strömendem Regen erreichten sie am Abend ein einfaches Hotel in Pforzheim. Es war eine sehr bescheidene Herberge in der von Bergen umringten Stadt. Der Regen verstärkte sich in der Nacht. Alexander lag noch lange wach. Es beschlich ihn ein unheimliches Angstgefühl wegen seiner Zukunft. Was sollte er tun? Er war auf die Mittel seiner Eltern angewiesen, doch unwiderstehlich lockte es ihn in die Ferne und in ein freies Leben. Ja, er liebte das Abenteuer und er träumte davon, im Glanz des bunten Rockes bei der Armee seine große Erfüllung zu finden. Er erinnerte sich an sein leuchtendes Vorbild, den Preußenkönig Friedrich. Auch er hatte ja als junger Kronprinz versucht, dem Elternhaus zu entfliehen. Er hatte alles gewagt, aber auch alles verloren, als man seine Fluchtabsicht entdeckte. Doch später erreichte er als König und Sieger von Mollwitz und Hohenfriedberg seine Heldenlaufbahn. Von solch einer glänzenden Laufbahn träumte Alexander immer wieder. Danach schlief er ein.
Am anderen Morgen regnete es noch immer, und im Laufe des Tages verstärkte sich das Unwetter erneut. Als man von Pforzheim bergab nach Durlach fuhr, schimpfte der Postillion vor sich hin:
»Sauwetter, elendes Schweinewetter! Da jagt man keinen Hund ins freie Feld. Hoffentlich kommen wir bei diesem Schlamm gut ins Tal. Die Wege dort hinunter sind katastrophal«, schimpfte der Kutscher.
Serge, der fest in eine Decke gehüllt neben dem Kutscher saß, war bemüht, sich laufend die Wassertropfen aus dem Gesicht zu wischen.
Der Postillion schnäuzte sich mehrmals geschickt mit zwei Fingern und wischte sich immer wieder mit dem Handrücken über die Nase.
»Bis nach Kanada werdet Ihr noch manchen Sturm und Regen erleben«, begann er neugierig ein Gespräch mit seinem Reisegefährten, »seid Ihr der Diener des feinen Herrn?«
»Das könnt Ihr doch alles aus den Frachtpapieren entnehmen«, maulte Serge, der bei diesem Wetter an keinem langen Gespräch interessiert war.
Der Kutscher aber ließ nicht nach: »Ihr könnt wohl auch in mehreren Sprachen schweigen, he?«
»Schweigen ist das Vorrecht der kleinen Leute«, gab Serge zu bedenken.
»Na, wer nicht will, der hat schon …«, polterte der Schwabe. Aus dem Mantelsack kramte er eine Branntweinflasche hervor, warf einen unschlüssigen Blick auf seinen Nachbarn und schüttelte dann verneinend mit dem Kopf. Nein, für einen so mundfaulen Diener war ihm sein Schnaps zu schade. Er nahm einen großen Schluck, schüttelte sich und stellte fest: »Dös is ebbes Guets, dös heizt von inne auf!«
Bald lag die Weite der Rheinebene vor ihnen. In der Ferne sah man die Residenzstadt Karlsruhe, das nächste Ziel ihrer Fahrt.
Bei der rasanten Abwärtsfahrt gerieten die Pferde außer Kontrolle. Mit ungeheurer Kraft brannten die Gäule durch, so dass die Kutsche eine bedenkliche Geschwindigkeit erreichte.
Plötzlich gab es einen heftigen Schlag an einem der Räder. Das schwere Gefährt geriet bedenklich ins Schwanken. Der Kutscher hatte große Mühe, den Postwagen in der Gewalt zu halten und die scheu gewordenen Pferde zu zähmen. Er zog energisch die Bremse. Endlich kam der Wagen zum Stehen. Umständlich stieg der Postillion vom hohen Kutschbock herunter und besah sich den Schaden.
»Sapperlot – «, fluchte er, »wenn das Rad noch bis Karlsruhe hält, haben wir saumäßiges Glück gehabt. Nun werden wir bestimmt einen Tag später in Mannheim ankommen. Ja, da is halt nix zu mache.«
In der Poststation von Durlach trafen die Wagen aus der Schweiz, Freiburg, Straßburg, Frankreich und der Pfalz zusammen. Mitten in dem regen Treiben war der Postkutscher aus Tübingen damit beschäftigt, seine Pferde auszuschirren. Missmutig standen Thomas und Alexander neben dem Wagen. Serge hatte bereits das schwere Gepäck auf dem Boden gestapelt.
Thomas dachte an den seltsamen Traum der vergangenen Nacht im elterlichen Hause. War es diese Gefahr, vor der ihn die Vorsehung warnen wollte?
Fluchend setzte der Kutscher mit Hilfe eines anderen Kamera den die Hinterachse des Postwagens auf übereinandergestapelte Holzböcke, um das zerbrochene Rad vom Wagen zu schlagen.
»Da kann man nix mache«, brummte er immer wieder vor sich hin und wandte sich an seine Fahrgäste: »Sie müsse halt hier für oie Nacht oie Unterkunft besorge, so schnell wird mir koi Stellmacher des Rad repariere.« Er hob seine Hände und zuckte verzweifelt mit seinen beiden Schultern.
Hinter dem Fenster der Poststation stand ein hagerer, gutgewachsener Mann, der Thomas und Alexander schon einige Zeit beobachtet hatte. Neben ihm auf einem Stuhl saß ein bildhübsches junges Mädchen von zirka 17 Jahren. Sie war gerade damit beschäftigt, ihre blutjungen Wangen mit einer Puderquaste zu betupfen, als der Hagere zu ihr sagte: »Jeannette, – ich glaube, wir bekommen Gesellschaft, die uns sehr gelegen kommt. Halten Sie sich für einen guten Fang bereit.« Seine Stimme schnarrte wie auf einem Exerzierplatz.
Das Mädchen war aufgestanden und schaute auch zum Fenster hinaus.
»Sehen Sie dort die aufgebockte Kutsche?« Der Herr wies mit der Hand in die Richtung des Reisegefährts: »Schauen Sie, der Postillion hat Radschaden. Das kann für die Fahrgäste unter Umständen längere Zeit dauern, bis sie weiterreisen können. Die beiden Jünglinge neben dem Wagen scheinen sich zu kennen. Sie sind gut gekleidet und von prächtiger Statur. An die halten Sie sich; – ich will mein Glück versuchen. Sie können sich wieder ein gutes Geld verdienen. Kommen Sie und spielen Sie Ihre weiblichen Verführungskünste aus, – haben Sie mich verstanden?«
Er ergriff seinen Dreispitz, setzte ihn auf und sprach dabei weiter: »Während Sie sich schon in unseren Wagen setzen, werde ich versuchen, die jungen Herren zur Weiterfahrt bei uns einzuladen.«
Getrennt gingen die beiden über den großen Hof der Post-station.
Das Umspannen war an vielen Wagen in vollem Gange. Kutscher schrien und führten die Pferde in verschiedene Richtungen. Die Passagiere mit ihrem Gepäck liefen durcheinander.
»Guten Tag, die Herren, wie ich sehe, hat Ihr Wagen einen beträchtlichen Radschaden«, der Hagere verbeugte sich leicht vor Thomas und Alexander.
»Verzeihen Sie, wenn ich Sie so einfach anspreche, aber ich dachte, vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein.«
Er nahm stramme Haltung an: »Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Baron von Kaminski.« Wieder verbeugte er sich leicht: »Wohin soll die Reise denn gehen?«
»Zunächst nach Frankfurt. Wir wollen in Mannheim Station machen, um dann morgen weiterzufahren«, antwortete Thomas. »Wenigstens war es so geplant«, setzte er hinzu.
»Ei Wetter, das trifft sich ja ausgezeichnet, ich reise auch nach Frankfurt und wollte in Mannheim übernachten. Zwei Plätze sind in meinem Wagen noch frei. Darf ich sie höflichst einladen, mit mir zu reisen?« er schwenkte einladend seinen Hut.
»Herzlichen Dank für Ihr großmütiges Anerbieten. Wenn wir Ihnen nicht zur Last fallen, gern.« Thomas war überrascht von der Hilfsbereitschaft des Fremden.
»Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle: Thomas Blankenburg ist mein Name, und das ist mein Bruder Alexander.«