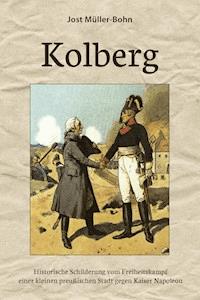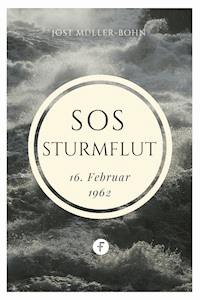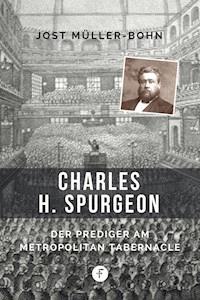Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: 2. Weltkrieg
- Sprache: Deutsch
Im Mittelpunkt dieses Buches stehen die Erlebnisse eines Kameramanns, der während des Krieges Wochenschaufilme vom Frontgeschehen drehen musste. Mit der Kamera in der Hand dokumentiert er die rauen Realitäten des Krieges – doch hinter der Linse beginnt er, sich selbst und seine Überzeugungen in Frage zu stellen. Sein Fahrer, ein gläubiger Christ, begegnet dem Chaos des Krieges mit einer inneren Ruhe, die den Kameramann zunehmend fasziniert. Als sie eines Tages einem gefangenen sowjetischen Politoffizier begegnen, entbrennt eine lebhafte Diskussion zwischen dem überzeugten Atheisten und dem gläubigen Fahrer. Die Gespräche über Leben, Tod und den Sinn des Daseins lassen den Kameramann nicht mehr los. Mitten im Grauen des Krieges, zwischen zerstörten Städten und menschlichem Leid, beginnt er zu erkennen: Glaube ist nicht nur eine Weltanschauung – er ist eine Kraft, die selbst in den dunkelsten Zeiten Hoffnung schenkt. Eine Geschichte über Zweifel, Suche und die leise, aber tiefgreifende Begegnung mit Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Blitzkrieg zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern
Erinnerungen aus dem 2. Weltkrieg
Jost Müller-Bohn
Impressum
© 2014 Folgen Verlag, Wensin
Autor: Jost Müller-Bohn
Cover: Eduard Rempel, Düren
Lektorat: Mark Rehfuss
ISBN: 978-3-944187-29-7
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
Im Blitzkrieg zwischen Hakenkreuz und Sowjetstern ist früher als Buch im St.-Johannis-Verlag, Lahr, erschienen.
Inhalt
Reise in die Vergangenheit – 50 Jahre danach
Vorwärts nach Moskau
Paradiesischer Garten
Im Vorhof der Hölle
Reise in die Vergangenheit – 50 Jahre danach
Da sitze ich im Führerhaus eines der ersten Lastkraftwagen mit Hilfsgütern, privaten Geschenksendungen und Lebensmittelpaketen für die Aktion: »HELFT RUSSLAND!«
Noch vor dem Weihnachtsfest 1990 sollen diese umfangreichen Spenden die russischen Hilfsbedürftigen erreichen.
Obwohl ich nun bereits im Rentenalter bin und als Behinderter nicht mehr so beweglich wie damals, treibt mich doch eine Sehnsucht zu helfen in das Land, in dem ich vor fast 50 Jahren die schrecklichen Eindrücke meines damals so jungen Lebens erhalten habe. Damals zogen wir als Sieger und Besatzungsmacht in dieses große Land ein. Heute kommen wir als Samariter und Geber für notleidende Brüder und Schwestern der freikirchlichen Gemeinde in Smolensk.
Damals sangen wir das Landknechtslied: »Nach Ostland geht unser Ritt, hell flattert die Fahne im Winde …« oder hörten das Schlachtlied der Deutschen Wehrmacht: »Von Finnland bis zum Schwarzen Meer, vorwärts, vorwärts, vorwärts nach Russland marschieren wir …« Heute nun, fast 50 Jahre nach dem Kriegsausbruch, bewegt uns eine große Dankesschuld gegenüber denen, die in soziale Not geraten sind.
An der polnischen sowie danach an der russischen Grenze werden die Zollpapiere nur noch der Form halber kontrolliert. Keine Grenzposten nörgeln über irgendwelche Verfahrensfehler, niemand wird schikaniert oder bedroht, alle russischen Zöllner begrüßen uns äußerst höflich, ja sogar freundschaftlich. Dort, wo sonst kirchliche Hilfsgüter oft stunden- oder sogar tagelang warten mussten, oftmals auch beschlagnahmt wurden, können wir nun bereits nach einer halben Stunde weiterfahren. In der Abfertigungshalle des sowjetischen Grenzgebäudes bei Brest ruft uns ein russischer Zolloffizier zu: »Ich freue mich, dass diese Hilfe spontan von einfachen deutschen Menschen kommt und als ein Zeichen des Friedens und der Freundschaft zwischen Deutschen und Russen anzusehen ist. Hoffentlich gibt es nie wieder Krieg zwischen unseren Völkern! – Der Friede ist doch so gut für alle!«
Diese unbürokratische und freundliche Abfertigung haben wir einer großen politischen Veränderung in der Sowjetunion zu verdanken, nämlich der sogenannten »Perestroika«, einer Veränderung des politischen Systems schlechthin.
Wenige Wochen zuvor war es nach jahrzehntelanger Trennung zur Wiedervereinigung beider Teile Deutschlands gekommen. Nicht nur die Friedensgebete in Leipzig, sondern die in allen Teilen Deutschlands waren erhört worden. Ohne jegliches Blutvergießen konnten durch Gottes Gnade die Menschen aus Ost und West zueinander kommen. Der sogenannte »Eiserne Vorhang« – die schreckliche Trennungsmauer – ist niedergerissen worden. Man konnte diesen geschichtlichen Ereignissen in ihrer bestürzenden Eile kaum folgen. Dem deutschen Volke war wie durch ein Wunder die staatliche Einheit in Freiheit geschenkt worden. Millionen Menschen weinten vor Freude und Ergriffenheit.
Jetzt fahre ich als Helfer in das Land, das während des Zweiten Weltkrieges unter den Kämpfen am meisten gelitten hatte.
Die holprige Strecke der »Autobahn« nach Smolensk ist schneefrei. In den Ortschaften, die wir schon im Krieg durchfahren haben, stehen vor den Geschäften lange Menschenschlangen. Zu beiden Seiten der Straße schleppt die Bevölkerung ihre notdürftig erstandenen Lebensmittel nach Hause. Alle tragen Taschen, viele haben kleine, fast leere Rucksäcke auf dem Rücken wie die Menschen in den Jahren nach Kriegsschluss. Alte Menschen durchsuchen Müllkippen nach Brauch- oder Essbarem. Wie nur konnte ein Notstand 45 Jahre nach Kriegsende in diesem Riesenreich, das als die Kornkammer Europas bekannt war, überhaupt entstehen? Angesichts solcher Bilder sind wir maßlos erschrocken. Nach drei Tagen Fahrt erreichen wir endlich die Gegend von Smolensk, wir haben ca. 1700 km zurückgelegt. Die alte, ehrwürdige Stadt, die auf eine 1000-jährige Geschichte zurückblicken kann, liegt auf den Hügeln am Dnjepr.
Am Abend des 15. August 1812 erreichten hier seinerzeit die Truppen Napoleons die Stadt mit den 36 Türmen, die aus der berühmten Wallmauer hervorragten. Mehr als 100.000 Franzosen belagerten damals die Stadt. Mit 150 Kanonen legten sie ganze Stadtteile in Schutt und Asche. Zwei Tage lang währte 1812 der Kampf um Smolensk, ehe die Franzosen durch das Flammenmeer einziehen konnten.
Am 16. Juli 1941 eroberten die deutschen Panzertruppen des Generalobersten Guderian die Stadt. Als die Rote Armee am 25. September 1943 Smolensk zurückerobert hatte, standen von den einst 8.000 Häusern nur noch ca. 700, alle Industriebetriebe waren zerstört.
Bei der Eroberung der Stadt durch die Deutschen war ich als Sonderführer einer Propagandakompanie hierhergekommen. Damals war die Kathedrale mit ihren goldenen Kuppeln nach Jahrzehnten erstmals wieder überfüllt. Heute konnte man auf einem Plakat gegenüber dem Gotteshaus in riesigen Buchstaben lesen: »Ruhm der Heldenstadt Smolensk«.
Im Hof des Museums des »Großen Vaterländischen Krieges« stehen noch heute Panzer und Geschütze aus vergangener, aber unvergessener Zeit.
Es wird schon dunkel in Smolensk, die fünf goldenen Zwiebeltürme der Kathedrale leuchten im Abendlicht.
Wie benommen stehe ich an dem Platz, an dem ich vor fast 50 Jahren als deutscher Soldat meine Filmaufnahmen gemacht habe.
Große und gewaltige Erinnerungen steigen in mir auf – Bilder des Krieges, die wohl verdrängt, aber nicht vergessen sind.
Nach fast 50 Jahren gibt es hier wieder antisemitische Parolen und Bedrängnisse. Zehntausende sowjetische Juden fliehen aus ihrer Heimat nach Israel. Heute weiß ich, die jahrtausendealten Prophezeiungen der Heiligen Schrift erfüllen sich zunehmend. Das Volk Gottes wird aus allen Nationen der Erde heimgeführt, gerade durch die politisch negativen Entwicklungen mit Verfolgungen und Pogromen. Obwohl sich das Land Israel durch die islamische Revolution wieder in höchster Kriegsgefahr befindet, strömen die Juden zu Hunderttausenden aus dem großen Land des Nordens in ihre alte, angestammte Heimat, in das Land der Väter.
Wiederholt sich hier der mächtige Exodus, der nach Kriegsschluss in Europa begann?
Die einst leidenschaftlichen Gespräche zwischen dem ehemaligen sowjetischen Politoffizier Iwan Sadko und dem überzeugten Christen Reinhold Wegmann werden wieder in mir lebendig. Die unselige Vergangenheit steht bald wieder vollständig vor meinem Inneren.
Vorwärts nach Moskau
Sonntag, den 22. Juni 1941
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt:
»An der sowjetrussischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen. Ein Versuch des Feindes, nach Ostpreußen einzufliegen, wurde unter schweren Verlusten abgewiesen. Deutsche Jäger schossen zahlreiche rote Kampfflugzeuge ab.«
So tönte es aus Tausenden von Rundfunkgeräten im Gebiet des Großdeutschen Reiches und bei den Einheiten des Heeres, der Luftwaffe und Marine.
Hinter diesen wenigen Sätzen verbarg sich die Ungeheuerlichkeit einer rasenden Materialschlacht deutscher und sowjetischer Heeresgruppen, Armeen und Luftflotten.
»Der Schleier ist gefallen«, meinte der Chef der Propagandakompanie: »Mephisto hat den Satan hinters Licht geführt. Vor zwei Wochen konnten wir noch aus sogenannten geheimnisvollen Quellen erfahren, Goebbels hätte in der Ministerkonferenz die Anwesenden über die militärische und politische Lage, welche in naher Zukunft eintreten werde, ins Bild gesetzt. Der Führer habe sich entschieden, eine Landung deutscher Truppen in England zu wagen und die eventuelle Operation im Osten abzusagen …« Er lächelte hämisch: »Da hat der Goebbels den Deutschen aber einen gewaltigen Bären aufgebunden – einen ›roten Bären‹ kann man wohl sagen.«
Sehr nachdenklich und mit bitterem Unterton fügte er hinzu: »Nun, Schicksal, nimm deinen Lauf – den härtesten seit Kriegsbeginn …«
Mit diesem Satz entließ uns der Chef der Propagandakompanie am ersten Tag des fürchterlichsten Teils des Krieges.
In dieser Situation war ich als Kriegsberichterstatter zur Propagandakompanie gekommen. Als Sonderstaffel z. b. V.1 unter standen wir dem Armeekommando direkt. Am Vorabend des großen Russlandkrieges wurden wir Augenzeugen des gigantischen Aufmarsches einer schlagkräftigen Millionenarmee der Deutschen Wehrmacht.
Leise zogen gut ausgerüstete Einheiten in ihre neuen Bereitschaftsstellungen, knirschende Wagenräder und gedämpfte Geräusche der Panzer und Sturmgeschütze waren zu hören. Gespenstisch schob sich eine bis an die Zähne bewaffnete Armee an die Grenze des sowjetischen Riesenreiches. Schon drei Tage vorher hatten wir uns als schnelle, bewegliche Einheit der Propagandakompanie das Gelände angesehen. In den dunklen Wäldern Ostpreußens lagen, gut getarnt, die Infanteriedivisionen, die Panzerregimenter, die Sturmbataillone der Pioniere, ja alle Waffengattungen des Heeres.
Ein drückend heißer Tag ging zu Ende. Die Sonne verschwand hinter den weiten Kiefernwäldern am schmalen Horizont. Von einer Abendstille konnte keine Rede sein. In einem alten Rittergut hatte sich der Armeegefechtsstand eingerichtet. Vor dem großen, alten, schmiedeeisernen Tor herrschte geschäftiges Kommen und Gehen. Kradmelder jagten den Sandweg herauf. Stabsoffiziere und Ordonnanzen kamen über den gepflegten Hof am Herrenhaus. Mit unserem Kübelwagen2 fuhren wir zum Befehlsempfang.
Von einem Stabsoffizier erfuhren wir den Tagesbefehl des Führers: »Soldaten der Ostfront!«
Wie bitte? Seit wann gab es denn eine Ostfront?
Die Propagandakompanie wusste es seit einiger Zeit, und doch fiel nun zum ersten Mal dieses schreckliche Wort: Ostfront. Gleich darauf sollte jedermann auch etwas »von dem qualvollen Seelenzustand« des Führers hören.
»Von schweren Sorgen bedrückt, zu monatelangem Schweigen verurteilt, ist nun die Stunde gekommen, in der ich zu euch, meine Soldaten, offen sprechen kann …« Mit bitterem Hohnlachen vernahmen es die Offiziere, die sogenannten Sonderführer der Propagandakompanie, die Männer also, die eigentlich das Gras wachsen hören sollten, mussten sich wieder einmal den erfundenen Vorwand anhören: »Russische Einheiten seien auf deutsches Reichsgebiet vorgedrungen. Sie konnten erst nach längerem Feuergefecht zurückgetrieben werden.« Die gleiche Propagandalüge wie vor zwei Jahren, als der Krieg gegen Polen vom Zaun gebrochen wurde.
Wenn solche Übergriffe stattgefunden hätten, wäre die Propagandakompanie längst an Ort und Stelle gewesen, um von diesem Unternehmen ausreichend Aufnahmen herzustellen. Welch ein unglaublicher Blödsinn, von dauernden Verletzungen des Grenzgebietes im Osten zu sprechen.
Weiter las unser Kompaniechef:
»In diesem Augenblick, Soldaten der Ostfront, vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt je gesehen hat …« Ja, das war uns »überraschenderweise« schon seit Wochen bekannt.
Die letzten Sätze des Tagesbefehls »Möge uns allen in diesem Kampfe der Herrgott helfen!« war bei Hitler eine vielbenutzte Redensart; geradezu eine Pflichterfüllung seiner Rhetorik.
Unsere Aufgabe bestand nun darin, am folgenden Tag sofort nach dem Beginn der Offensive im Osten, die ersten Bilder von der neuen »Ostfront« zu filmen. Damit waren wir vorerst entlassen.
Mit unserem Filmwagen und den beiden Motorrädern warteten wir an diesem denkwürdigen Tag auf die vorrückende Infanterie, die auch bald in gespenstisch düsteren Zügen an uns vorüberzog. Bei diesen Lichtverhältnissen war es unzweckmäßig, die Kamera laufen zu lassen. Wir konnten keinen Meter drehen.
Wie gelähmt saßen wir herum. Vielleicht geschieht doch noch ein Wunder? Die Situation schien uns so unwirklich. Morgen sollte es einen neuen »Kriegsschauplatz« geben, es war kaum auszudenken. Welch entscheidende Minuten in der großen Weltgeschichte – noch könnte ja alles aufgehalten werden; noch bestünde die Möglichkeit, die Panzerwagen zurückzubeordern. Wie viele Schmerzen und Leiden würden Millionen erspart bleiben. Wie viele Menschenleben könnten erhalten bleiben, wenn nicht ein machtbesessener Gewaltmensch von dämonischen Gedanken beherrscht wäre, auf Erden eine neue Herrenrasse züchten zu wollen?
Millionen von Soldaten starrten wie hypnotisiert in das sich anbahnende Inferno; sie mussten ohnmächtig in das herannahende Völkermorden blicken, unfähig, jetzt noch etwas dagegen tun zu können. Was war der Mensch gegenüber diesen finsteren Mächten des Schreckens?
Über Kartoffeläcker und Kornfelder hinweg wälzten sich die mächtigen Heersäulen der deutschen Armee voran. Mit abgedunkelten Scheinwerfern fuhren motorisierte Divisionen in die Bereitschaftsstellungen. Jeder Panzer hatte zusätzlich noch zehn volle Benzinkanister am Turm verstaut und außerdem einen Anhänger mit drei Tonnen Benzin im Schlepp. Es waren also nicht nur »kleine Grenzgefechte« geplant. Diese Kraftstoffreserve reichte fast für den Weg bis nach Moskau. Zu dieser Zeit war strengste Funkstille befohlen, kein Funkspruch ging aus den Antennen, um die sowjetischen Abhörstellen nicht misstrauisch zu machen.
Die Armbanduhren tickten, die Zeiger rückten unaufhaltsam auf dem Leuchtzifferblatt voran. In stundenlangen, mühseligen Schleichmärschen waren die Truppen an die sowjetische Grenze herangekommen. Pionierkompanien warteten schon, um nach dem ersten, gewaltigen Feuerschlag schnell an besonderen Übergangsstellen Behelfsbrücken zu bauen.
Noch fünf schicksalsschwere Minuten. Jeder hatte ein merkwürdiges Gefühl im Kehlkopf. Man spürte den Herzschlag bis hinauf an die Kragenkante. Noch stand am anderen Flussufer der Beobachtungsturm des bisherigen Verbündeten und des ab sofort zu vernichtenden Feindes. Am Himmel dämmerte das erste Morgenlicht, sonst herrschte wunderbare Stille – es schwieg die ganze Welt. Ich dachte daran, wie Hitler und seine Paladine in Berlin, wahrscheinlich noch wach sitzend, auf die ersten Erfolgsmeldungen warteten. Millionen ahnungsloser Volksgenossen schliefen, wie immer, in der Erwartung eines sogenannten »Terrorangriffs« der Engländer oder anderer Feindflugzeuge.
Jetzt rückten die Zeiger auf 3.15 Uhr. In diesem Moment zuckte ein gigantischer Blitz auf einer Breite von über 1000 km in den anbrechenden neuen Tag. Soweit das Auge reichte, heulte es beim Blitzen der Abschüsse über die Grenzen nach Russland. Aus Tausenden von Geschützrohren fauchte eine todbringende Fracht über die Grenzeinheiten der Roten Armee. Der Scheinfriede war gestorben. Der Krieg begann. Die erste schreckliche Todeswalze fiel über ein ahnungsloses Volk her.
Wir lagen hinter einem Divisionsgefechtsstand an einem kleinen Hügel. Über uns orgelte es Tod und Verderben. Unzählige Granaten aller Kaliber heulten vorüber. Erste bellende Abschüsse vermischten sich mit einem krachenden Heulen und Gurgeln aus Tausenden von Geschützrohren. Alles, was mir vor das Objektiv kam, filmte ich: Die voranschreitende Feuerwalze, Einschläge von Hunderten von Granaten jenseits des Flusses und die sowjetischen Beobachtungstürme, die nacheinander fielen. Rechts und links wimmelte es von stürmenden Infanterieeinheiten. Über Gräben, Äcker und Mulden sprangen sie voran. Alle Klangfarben des Krieges tönten ineinander vom hellen Maschinengewehrfeuer bis zum dumpfen Grollen der Eisenbahngeschütze.
Jetzt rückte die Feuerwalze vor, von Punkt zu Punkt. Gegen eine erste, feindliche Bunkerlinie wurden Flammenwerfer eingesetzt. Hell peitschten die Salven aus den Maschinenpistolen, das Gewehrfeuer tackerte unaufhörlich. Finstere Dämonen schienen los zu sein, Tod und Verderben spien sie über das Land.
»Sprung auf! Marsch, marsch!«, hallte es neben uns. Mit meinem Kamera-Assistenten Franz Beck rannte ich übers Feld. Wir schleppten an die 50 Pfund schwere Geräte mit uns.
Plötzlich fiel ein gezielter Schuss in unserer Nähe. Heckenschützen griffen uns aus dem Hinterhalt an. Vor uns richtete sich ein Feldwebel der Infanterie mit ausgebreiteten Armen auf. Aus seiner Hand entfiel ihm das Gewehr; es schien, als rufe er ein letztes Amen! Wie ein Stein plumpste er auf die Erde. Der erste Tote, den wir in diesem neuen Krieg sahen. Zur gleichen Zeit ließen Tausende ihr Leben. – Was ist der Mensch? – Nur ein Hauch, ein Schatten!
Wir hatten keine Gewehre, nur unsere kleinen Dienstpistolen; welch ein Glück, dass wir uns nicht an diesem Mordgeschäft aktiv beteiligen mussten.
»Sturmgeschütze vor!«, brüllte ein Offizier. Da rollten die schwerfälligen Kolosse schon heran. Das Feuer des Feindes flaute ab. Wir erhoben uns aus der Deckung. Vor uns lag die zerschundene Kreatur – der gefallene Feldwebel. Mein Kamera-Assistent Franz Beck beugte sich über den Unbekannten und rief ihn an. Schnell ließ ich die Kamera laufen. Doch solche Bilder waren im Propagandaministerium nicht gefragt – nein, den zerschlagenen Feind, zerschossene Kampfwagen, verlassene Stellungen und zurückgelassenes Material des Feindes sollten wir filmen.
Meter um Meter belichtete ich – Bilder eines Tages, der die Weltgeschichte verändern sollte; für Jahre, vielleicht auch für Jahrzehnte?
Am Abend waren wir schon ganz alte Soldaten, voller Eindrücke des Grauens und ahnten nicht, wie viele Jahre solch ein Entsetzen andauern sollte.
Der Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht vom Montag, dem 23. Juni 1941 lautete kurz und bündig:
»Im Osten verlaufen die Kämpfe des Heeres und der Luftwaffe gegen die Rote Armee planmäßig und erfolgreich.«
Absichtlich wurden die ungeheuerlichen Offensiv-schlachten heruntergespielt. Zunächst sollte es nur nach einem örtlichen Vergeltungsschlag aussehen. Unsere Aufgabe war es, an den »Neuen Germanenzug gegen den jüdisch-bolschewistischen Todfeind« zu erinnern. Propaganda-Minister Goebbels erklärte in der Ministerkonferenz: »Wie der Kampf ausgeht, ist für uns klar. Er kann nur mit einem Sieg der deutschen Waffen enden. Die Presse hat jetzt die entscheidende Aufgabe, Herz und Gefühl der Heimat so zu lenken, dass die Front sich auch jetzt wieder auf die Heimat verlassen kann.«
In der Nacht lagen wir in einer russischen Bauernkate. Die Bewohner waren geflohen. Es war ein sehr einfaches Holzhaus mit mächtigen Balken an der Außenwand. Die Innenwände bestanden aus Brettern. Nun saß ich in einer richtigen Wohnung mit heilen Fensterscheiben, Tischen und Stühlen und auch richtigen Bauernbetten. Keine Sprungfedermatratzen, sondern nur gefüllte Strohsäcke auf Brettern, aber was macht das schon. Schnell beschriftete ich die belichteten Filmrollen. Franz Beck hatte jeweils kurze Notizen von den einzelnen Motiven und Kameraeinstellungen gemacht.
Heinz Wockenfuß, der Wortberichter, stellte sich einen kleinen Tisch ans Fenster, kramte seine Reiseschreibmaschine hervor und begann, die ersten Fronteindrücke zu Papier zu bringen. Mit großem Wohlbehagen steckte ich die sandigen Füße in einen mit Wasser gefüllten, hölzernen Waschzuber und beobachtete die Dorfstraße. Die Holzhäuser entlang der breiten Straße, wenn man den ausgefahrenen, erdigen Fahrweg überhaupt als eine Straße bezeichnen darf, sahen urromantisch aus. In der Nähe des Friedhofs stand der hochaufragende Ziehbrunnen. Er wurde laufend belagert von nachrückenden Einheiten.
Durst und Hitze bereiteten den Infanteristen die größte Pein. Mühsam quälte sich der Nachschub durch den pulvrigen Sand.
In einer Ecke, unter einem Heiligenbild, hockte der Obergefreite Reinhold Wegmann, unser Kraftfahrer, ein besonnener, in sich gekehrter Einzelgänger – fast ein Sonderling. Vor dem Essen faltete er stets seine Hände und schloss die Augen, ehe er den ersten Bissen in den Mund nahm. Wir respektierten diesen schweigsamen Kameraden, weil er sich als äußerst zuverlässig und stets hilfsbereit erwies. Irgendwann wollte ich ihn gewiss ansprechen, um etwas über seinen Glauben zu erfahren.
Am Abend konnte ich die russischen Mädchen beobachten, wie sie mit ihren Trageimern zum Dorfbrunnen zogen, um Wasser zu schöpfen. Ein friedvolles Bild. Am Brunnen waren einige Soldaten den hübschen Mädchen behilflich, das Heraufziehen der schweren Eimer mit Wasser zu bewerkstelligen.
Zu später Nachtstunde erfuhren wir, dass es den deutschen Truppen an der ganzen Front gelungen war, tief in die feindlichen Grenzbefestigungen einzubrechen.
In den frühen Morgenstunden wurden die Fahrzeuge beladen. Dichter Nebel lag über dem Gelände. In der Ferne heulten irgendwo Hunde. Sonst herrschte friedvolle Stille ringsumher. Die Wege waren plattgewalzt und breitgefahren. Die Vormarschstraßen mussten wir oft in Serpentinen mühsam hangaufwärts fahren. Wir fuhren in Richtung Norden. Bald hatten wir die Vorausabteilung einer Panzerdivision erreicht. Alle Fahrzeuge trugen ein großes weißes G, als taktisches Zeichen der Panzergruppe des Generalobersten Guderian – genannt der »schnelle Heinz«.
Zur Rechten wie zur Linken an einer kleinen Holzbrücke standen getarnte Kettenfahrzeuge mit aufgesessenen Panzergrenadieren.
Die schnellen Truppen bestimmten das Tempo. Panzerkolonne auf Panzerkolonne rollte ostwärts. »Nicht kleckern, sondern klotzen«, hieß die Parole des Panzergenerals Guderian.
Die ersten Gefangenen wurden vorbeigeführt. Schnell sprangen wir vom Wagen: Mit der Handkamera filmte ich diese glatzköpfigen jungen Männer – nur einige trugen Stahlhelme, andere schienen im Schlaf überrascht zu sein; sie liefen in Unterwäsche vorbei.
»Vorwärts, vorwärts!« hieß die Parole – die erste orthodoxe Kirche mit den Zwiebeltürmen sahen wir in der Ferne. Der Ort war teilweise zerstört, eine ganze Häusergruppe niedergebrannt. In einem Haus konnte man noch den Herd inmitten von Trümmern sehen. Ein Kaminstumpf ragte aus dem Wirrwarr. Ein älterer Mann und seine Frau hockten davor, der Herd rauchte. Es wurde mäßig warm – ein herrlicher Morgen. Die windschiefen Holzhäuser mit den urigen Strohdächern waren zerfallen, nur die Dorfkirche stand weiß und leuchtend auf einem Hügel. Sonderführer Wockenfuß ließ halten. Behände sprangen wir aus dem Kübelwagen, die große Kamera wurde auf das Stativ gesetzt und bald schnurrte das Filmgerät, während pausenlos die deutschen Wehrmachts-kolonnen an uns vorüberzogen.
Reinhold Wegmann lief zur Kirche hinüber. Als er in die Tür trat, nahm er ehrfurchtsvoll seine Feldmütze vom Kopf und faltete die Hände.
Vor den prunkvollen Gemälden knieten viele Zivilisten, jung und alt. Die Frauen trugen weiße Kopftücher. Obwohl Wegmann kein Wort Russisch verstand, murmelte er ein Gebet, nein, nicht das »Vaterunser«, wohl einen selbstverfassten Psalm. Im Kirchenschiff stank es nach Weihwasser, Schweiß und Knoblauch. Beeindruckende Gesichter voller Andacht und Demut – echte Tolstoigestalten. Eine Vielzahl von Motiven bot sich an. Ich verbrauchte fast einen ganzen Film. Ob diese Bilder überhaupt gefragt waren, wusste ich nicht – vielleicht wanderten sie unveröffentlicht ins Archiv.
»Wo steckt denn der Wegmann?«, brüllte Sonderführer Wockenfuß.
»Es geht weiter – Menschenskinder, wir sind doch hier nicht zur Hochzeit geladen!«
Nach einer Stunde erreichten wir eine befestigte Straße. Endlich kamen wir etwas schneller voran. Neben der Steinstraße zogen auf einem sandigen Feldweg lange Kolonnen von Gefangenen – breite slawische Gesichter, stumpfsinnig wirkende Gestalten mit wulstigen Lippen, alle kahlköpfig, stets einen zusammengeschnürten Beutel auf dem Buckel.
An einer gesprengten Brücke staute sich der Verkehr – sollte man auf den Bau einer Pionierbrücke warten? Plötzlich wurde die Straße freigemacht – schwere Artillerie eröffnete das Feuer, um das jenseitige Ufer sturmreif zu schießen, für unsere Fotoapparate und Filmkameras eine Fülle von Motiven. Jetzt erschienen zwanzig Tauchpanzer – ein Feldwebel auf dem Turm dirigierte das Fahrzeug bis an eine flache Flussstelle. Danach verschwand er im Turm und schloss die Luke.
Gleich rollte der tonnenschwere Panzer ins Wasser, das über dem Turm zusammenschlug.
»Mensch, kick doch mal, der spielt ja U-Boot!«, staunte Franzl. »Hat man schon so wat jesehen?« Panzer um Panzer tauchte in den Fluss ein, nur ein dünnes Stahlrohr für die Frischluftversorgung von Besatzung und Motor ragte aus den Wellen und deutete auf den Unterwassermarsch der Panzer. Die Blasenbahnen der Auspuffgase blubberten hoch.
Ich filmte, was das Zeug hielt, mit allen mir nur zur Verfügung stehenden Kameras hintereinander. Nun krochen die ersten Stahlkolosse am anderen Ufer empor. Wie geheimnisvolle Wassertiere kamen sie ans Land. Die Lukendeckel flogen auf. Die Kommandanten erschienen wieder und brüllten: »Panzer, marsch!«
Der Übergang mit schwerem Gerät hatte geklappt. Ich glaube, wir haben heute eine gewaltige Filmausbeute. Um die Mittagszeit erreichten wir den vorgeschobenen Gefechtsstand der Armee. Vor einer strohbedeckten Bauernkate hielten zwei Personenwagen des Stabes. Ein hoher Offizier stand dort, umgeben von seinen Stabsoffizieren, Ordonnanzen und Meldern. An den Wagen ragten hohe Antennen zum Himmel. Der Befehlshaber diktierte gerade die nächsten Befehle an seine Fronttruppen. Die goldenen Lorbeerblätter auf karmesinrotem Spiegelgrund verrieten den General. Wieder griffen wir nach dem Fotoapparat und der Handkamera. Wir konnten unsere Filmkassetten gerade den Kurieren übergeben, da erfuhren wir von einem waghalsigen Unternehmen einer Vorausabteilung, das am kommenden Tag in der Frühe in Richtung Dünaburg starten sollte. Sonderführer Wockenfuß hatte mit einem Kommandeur verhandelt. Nach Sonnenaufgang kam der Befehl: »Alles fertigmachen – in wenigen Minuten bricht hier eine Vorausabteilung auf! Gefechtsauftrag:
Durchbruch bis zu den Brücken bei Dünaburg. Jeder Widerstand ist mit Gewalt zu brechen!«
Am Dorfausgang trafen wir die Panzerspitze und die Fahrzeuge der Vorausabteilung. Mit laufendem Motor standen die Schützenpanzer abfahrbereit am Straßenrand.
»Wir fahren bis an die Spitze vor«, kommandierte Heinz Wockenfuß. »Unter allen Umständen mogeln wir uns dort in eine Lücke hinein, sonst bekommen wir nichts Gescheites in die Linse. Ein guter Rücken kann wohl entzücken, aber nicht bei der Propagandakompanie.«
Jetzt rollte die Spitze der 8. Panzerdivision an. Von einem Spähwagen rief ein waschechter Berliner: »Hurra, hurra – die Wochenschau ist da!« Die Spitze preschte auf der sogenannten »Fernstraße« in Richtung Leningrad ab. Wir hatten einen Ehrenplatz bekommen. Als Filmberichter fuhren wir an dritter Stelle. Der erste Wagen war eine Selbstfahrlafette mit einem 2 cm-Flak-Geschütz. 200 Sprenggranaten pro Minute konnten die Kanoniere dem Feind entgegenjagen. Kradschützen mit schweren Beiwagenmaschinen und MG umgaben uns.
Die Ketten rasselten, die Motoren brummten – die Kolonne kam zügig voran. Die Panzerkommandanten lehnten sich an die Turmöffnung und suchten mit scharfen Ferngläsern die Umgebung ab. Durch sumpfige Senken, über sandige Hügel, durch Wälder und Kornfelder bewegte sich der gepanzerte Konvoi. Der Himmel wölbte sich hellblau über der schnellen Vorausabteilung.
Ein Hauptmann im vorderen Wagen führte die Spitze. Er gab der ihm nachfahrenden Kolonne präzise Fahranweisungen. Franzl hatte bereits das Teleobjektiv auf seine Leica geschraubt; ich hatte meine Handkamera, die unverwüstliche Ariflex-Kamera, in der Hand. Es war uns bekannt, dass wir uns mitten durch zwei sowjetische Armeen hindurchlancieren sollten. In der ersten Stunde war es eine fast traumschöne Fahrt durch wogende Kornfelder rechts und links. Das gleißende Sonnenlicht brachte die federnden Ähren zum Glänzen. Auf grünen Weiden standen die Kühe und glotzten uns mit großen Augen an. Hier und da standen Bauern auf dem Felde. Sie winkten uns freundlich zu. Offensichtlich waren sie in gutem Glauben, wir seien sowjetische Verbände.
»Junge, Junge, wenn die wüssten, det hier ›Lützows wilde, verwegene Jagd‹ vorbeirast und tief ins Hinterland braust. Wenn det so weiterjeht, sind wir bald in Dünaburg«, meinte Franzl. Die Wegweiser geben uns recht: Noch zehn Kilometer bis Dünaburg – noch acht – noch vier; es war ein merkwürdiger Zug. Alles wirkte unheimlich.
Aus dem Fahrzeug an der Spitze erhob der Kommandant die Hand. »Achtung«, rief er und winkte nach rechts: »Alles rechts ran und halt!«
An den haltenden Fahrzeugen vorbei schob sich eine merkwürdige Kolonne. Vier Beutelastwagen der Sowjets – die Fahrer und Beifahrer in russischen Uniformen. Die Stabsoffiziere am Straßenrand grinsten, wir auch; denn wir gehörten bereits zu den Eingeweihten. Wir wussten nämlich, was es mit dem geheimnisvollen Konvoi für eine Bewandtnis hatte – es waren Angehörige des sogenannten Regiments »Brandenburg«, kurz die »Brandenburger« genannt, einer Spezialtruppe aus ehemaligen Volksdeutschen, die die russische Sprache und den Umgangston gut beherrschten. Diese geheimnisvolle Truppe unterstand dem Chef des deutschen militärischen Geheimdienstes, nämlich Admiral Canaris, direkt.
Die vier sowjetischen Beutewagen hielten noch einmal an, um letzte Instruktionen vom Kommandeur der Vorausabteilung entgegenzunehmen.
Ein Hauptmann blickte auf uns: »Na, meine Herren von der Propagandakompanie, wie wär's? Das gibt die besten Bilder, aber auch die gefährlichsten. Oberleutnant Knaak wird Sie gewiss einladen zu einer Spritztour durch die feindlichen Linien und zu einem Stadtbummel im sowjetischen Dünaburg. Plätze sind gewiss noch frei!«
Der Oberleutnant nickte mit dem Kopf. Ich stieß Beck in die Seite: »Wie steht's, Franzl? – Solch eine Gelegenheit gibt's vielleicht im ganzen Krieg nicht mehr!«
Etwas skeptisch sagte er: »Also jut, Helm ab zum Jebet! Ein höchst brisantes ›Himmelfahrtskommando Marke Heldenklau.‹« Schnell stopften wir die Taschen mit Filmen voll und setzten den Stahlhelm auf. Wir stiegen auf die Beutefahrzeuge zu den Brandenburgern. Meine Handkamera hatte ich sorgsam zwischen die Knie genommen. Ich saß, umgeben von den seltsamen Soldaten, unter der Zeltplane des zweiten Lastwagens. Jetzt rollten wir an und fuhren im rasanten Tempo über das sogenannte »Dünaknie« und mitten durch die Stadt.
»Da, vor uns die Brücken!«, schrie einer der Offiziere von der Brandenburger Division. Über die Straßenbrücke, mitten in Dünaburg, flutete der Verkehr wie im Frieden – wackelige Panjewagen, alte Traktoren, Männer mit Handwagen, Frauen mit Kindern, barfuß und vielem Gepäck. Über die Eisenbahnbrücke schob sich gerade ein Güterzug – das alte Dampfross schnaubte und pfiff. Unsere Männer fuhren an den sowjetischen Brückensicherungen vorbei. Die Fahrer in den russischen Uniformen riefen den Feldwachen Witze zu: »Germanski kapuutt – alle Fritzen3 sind in die Flucht geschlagen. Bis nach Dünaburg kommt kein bewaffneter Deutscher – so wahr Stalin lebt!« Ein spöttisches Lachen war zu hören.
Die Motoren heulten auf – die Wagen rollten weiter durch die Vorstadt, an vielen Fußgängern und Straßenbahnen vorbei. Die Russen winkten siegesgewiss.
Sobald der Wagen hielt, filmte ich durch ein Loch in der Leinwand, und zwar Bilder für die Deutsche Wochenschau. Bilder direkt aus dem russischen Hinterland. Vor uns lag die große Straßenbrücke – Leutnant Knaak rief: »Vorwärts! Vollgas und drauf!«
Die zweite Brückenwache wollte die Fahrzeuge kontrollieren, doch unser Leutnant befahl: »Weiter! – Keine Verhandlungen!« Jetzt erhielten wir Feuer von den Wachen!
»Alles raus und auf die Brücke marsch, marsch!«, rief der Zugführer. Die Wache wurde überwältigt, die Sprengladung zerschnitten und in Deckung gegangen. Ich hatte mich hinter einen Kilometerstein gesetzt; den Stein benutzte ich als Unterlage für die Kamera.
In aller Seelenruhe ließ ich die Ariflex surren. Neben mir lag ein verkleideter Brandenburger und zielte mit dem Maschinengewehr in die Richtung, woher das Feuer der Russen kam. Solche brisanten Bilder wünschten sich wohl alle Filmkameramänner der Propagandakompanien. Sie würden einem kaum wieder so schnell geboten.
Aus Versehen ging ein Teil der Sprengladung an der Eisenbahnbrücke in die Luft, aber die Brücke blieb passierbar. Bald stießen auch die Panzerwagen der 8. Division nach. Kurze Zeit später konnte dem kommandierenden General von Manstein die Funkmeldung abgesetzt werden:
»Handstreich auf Stadt und Brücke von Dünaburg geglückt. Straßenbrücke unversehrt. Eisenbahnbrücke durch Sprengung leicht beschädigt, aber passierbar!«
Franzl war ganz aus dem Häuschen: »Junge, Junge, det war ein echter Indianerstreich Marke Wildwest in Reinkultur! Da wird sich Goebbels aber freuen!«
Er verstaute das wertvolle Filmmaterial in die Kästen und den Filmbeutel. Hochbeladen stiegen wir später in unseren Filmwagen und fuhren unter Begleitschutz eines Kradmelders in die rückwärtigen Quartiere.
Erst am 29. Juni wurde in einer Sondermeldung des Oberkommandos der Wehrmacht bekannt gegeben:
»26. Juni 1941
In kühnem Vorstoß erreichten unsere im baltischen Raum operierenden Truppen die Düna. Der Strom wurde an mehreren Stellen überschritten. Die Stadt Dünaburg fällt in deutsche Hand. Alle Versuche des Feindes, diesen Vormarsch durch verzweifelte Gegenangriffe zu verhindern, scheiterten an der Tapferkeit unserer Soldaten. «
Am Nachmittag erreichte unsere Staffel ein kleines Dorf; ein Nest von elf verstreuten Hütten mit zwei Ziehbrunnen, die in der Dorfmitte neben einem verwitterten Kolchosenstall ihre langen Hebebalken zum Himmel richteten. Wir nisteten uns in einem verlassenen Blockhaus mit stark verschmutztem Strohdach ein. Bald herrschte hier Hochbetrieb. Die Wortberichter hämmerten ihre neuesten Frontberichtseindrücke in die Schreibmaschinen. Wir Film- und Bildberichter verfassten Bildunterschriften oder gaben Schnitt- und Textanweisungen für unsere ersten hundert Meter von belichtetem Filmmaterial vom Frontgeschehen.
Noch vor Beginn der Dämmerung brausten die Kradmelder mit dem wertvollen Propagandamaterial zum nächsten Feldflughafen, damit die Berichte, Bilder und Filme noch rechtzeitig zu der Kuriermaschine nach Berlin kamen. Franzl hatte mit seiner Leica mehr als hundert Bilder geschossen; er füllte unsere Kamerabehälter mit frischem Filmmaterial auf: »Menschenskind, ick hab'n Sauhunger«, stöhnte Franzl. »Seit heute früh hab' ick nischt Essbaret die Kehle runterrutschen jespürt.« Mit süßsaurer Miene blickte er mich an und drückte dabei seine linke Hand in die Magengegend. »Jibt et denn hier überhaupt nischt zu beißen?«
Walter Häberle, Obergefreiter und zweiter Kraftfahrer des Kübelwagens, ein echter Schwabe, meinte: »Jo moinscht, die Russa stellat unseretwega an Spezialkoch a?«
»Ne, det nu jerade nich, aber zwischen die Häuser von dieses Nest is doch keen Mensch zu sehn. Ob die Iwans aus Angst vor uns Reißaus jenommen haben?«
»Dr Stalin hot gwiss koi Propaganda für de Deitsche g'macht.« »Denn woll'n wa mal sehn, ob hier nischt zu finden is«, meinte Franzl.
So machten wir uns auf den Weg, um den Ort auszukundschaften. Unser Staffelführer, Sonderführer und Hauptmann Wockenfuß, Reinhold Wegmann, der Kradfahrer, und Boris Fenzlau, der das Krad im Seitenwagen fuhr, blieben im Quartier zurück.
Franzl rief in jedes Fenster: »Hallo, is hier jemand? Is denn keen Aas hier zu finden?«
Schließlich erschien ein Bauer. Sehr vorsichtig und voller Misstrauen kam er aus einer windschiefen Scheune heraus. Als er uns erblickte und feststellte, dass wir keine Waffen bei uns trugen, rief er ein paar russische Worte durch die offene Tür. Jetzt erschien seine Frau, umringt von mehreren Kindern – das jüngste hielt sie auf dem Arm. Alle gingen barfuß, nur der Bauer trug ziemlich zerschlissene Stiefel.
Franzl schnatterte in echtem Berliner Dialekt auf sie ein. Er konnte kein einziges russisches Wort, umso lebhafter und urwüchsiger waren seine Gesten. Er versuchte den Russen klarzumachen, dass wir etwas Essbares auftreiben wollten.
»Du, Panjinka«, sagte er zu der Frau, »du nischt für uns zu essen?« Dabei schaufelte er mit der rechten Hand im Geiste etwas Essbares in seinen Mund, der unentwegt Schnappbewegungen machte. Nach und nach kamen aus den Scheunen und Häusern die übrigen Bauern mit ihren Kindern. Franzl kauderwelschte weiter:
»Gag – gag – gag – gag – tuk – tuk – tuk – tuk – kikeriki!«, krähte Franzl. »Jibt et denn hier keene Eier?« Schließlich kapierten die Russen, was wir wollten und holten aus ihren Verstecken eine beträchtliche Anzahl von Eiern hervor. Auch ein grobes Landbrot überreichten sie uns. Zu guter Letzt schenkten sie uns noch zwei Hühner, Kartoffeln, Tomaten und Weißkohl. Sie brachten uns das Essen bis zum Quartier.
Die Kinder verloren als erste ihre Scheu, sie reichten uns ihre kleinen Finger und drückten ihre kahlen, kleinen Köpfe an unsere Hände. An einer offenen Feuerstelle wurde jetzt gebraten und gebrutzelt. Schnell holte ich meine Filmkamera vor und drehte diese urwüchsige Szene; herrliche Bilder, wie bei der Aufführung von Wallensteins Lager aus dem Dreißigjährigen Krieg.
Die Bauern umlagerten mit ihren Frauen unsere Kochstelle und palaverten lebhaft. Wir boten ihnen für das Essen Geld an, aber sie lehnten es ab. Dankbar ergriff eine Russin meine Hand und begann sie zu küssen. Diese demütige Geste war mir unangenehm, da ich so etwas überhaupt nicht gewohnt war. Als die Mahlzeit zubereitet war, stellten wir unter freiem Himmel Tische auf, nahmen die letzten Schüsseln, die wir auftreiben konnten und setzten uns mit den Bewohnern auf die Kisten, Baumstämme und Hocker. Reinhold faltete nach seiner Gewohnheit die Hände und begann zu beten. Die Russen bekreuzigten sich, während die Männer ihre Mützen abnahmen. Ein gemeinsames »Amen« war zu vernehmen.
»Was mag in den Köpfen dieser einfachen Bauern jetzt vorgehen? Menschen, die seit Jahrzehnten unter einem strengen atheistischen System lebten, beteten mit deutschen Soldaten unter freiem Himmel!«, dachte ich so bei mir.
Weshalb war es der bolschewistischen Ideologie, trotz aller Machtbefugnis bis hinein in das familiäre Leben der Menschen, nicht möglich, den Glauben an Gott auszulöschen? Bei irgendeiner günstigen Gelegenheit wollte ich unseren Kraftfahrer Reinhold Wegmann darüber unter vier Augen befragen.
Lange Zeit saßen wir beieinander. Die Russen begannen zu singen: Volkslieder, schwermütige Melodien und auch Choräle. Dieses inbrünstige Singen ging mir unter die Haut. Alles schien ihnen aus dem Herzen zu kommen. Erst als der Mond hinter einem fernen Wald sein mildes Licht hervorbrachte, verabschiedete sich die Bevölkerung dieses kleinen, unscheinbaren Ortes von uns.
So freundlich, wie wir von den Bewohnern empfangen worden waren, so feindselig wurden wir von den einheimischen Mücken geplagt. Unzählbar waren die Seen, die Sümpfe, die Wassertümpel und die toten Flussarme. Träge floß in einiger Entfernung das Wasser der Düna dahin. In dieser Gegend weitete sich der Fluss kilometerweit über eine enorme Landfläche aus. Kilometerweit raschelte das Schilf, das bis an den äußersten Rand eines europäischen Urwaldes reichte. Eine unsagbar günstige Brutstätte mit Myriaden von Mücken. Hier entschlüpften die Schwärme von jungen Quälgeistern. Diese unwirklichen Sumpfniederungen wurden nie von eines Menschen Fuß betreten. Besonders nachts stürzten sie sich auf uns, saugten süßes, rotes Blut, stachen und quälten uns bis an den frühen Morgen.
Als ich in der Morgendämmerung erwachte, saß Wegmann, unser Kraftfahrer, schon am Fenster. Er hatte seine Augenlider geschlossen und bewegte tonlos die Lippen. Vor ihm, auf einer grauen Holzkiste, lag seine Bibel und ein anderes Büchlein.
»Seltsam«, dachte ich, »dass es so etwas noch im 20. Jahrhundert gibt, einen Mann, der ohne Scheu sein Morgengebet spricht und stets die Bibel bei sich trägt.« Sonst war er ein angenehmer und sehr zuverlässiger Mann. Mir kamen seltsame Gedanken. Was würde solch ein Soldat wohl machen, wenn er angegriffen würde? Konnte er seinen Feind einfach niederschießen? Fragen über Fragen stiegen in mir auf. Ich wollte ihn aber jetzt auf keinen Fall stören. Seine stete Gelassenheit, seine unbeschreibliche Ruhe machte auf uns alle einen wohltuenden Eindruck. Auch unser Staffelführer, Hauptmann Wockenfuß, ließ diesen Einzelgänger in Ruhe.
Draußen wurde es lebendig. Boris Fenzlau kam mit dem Chef zurück. Mitten in der Nacht war dieser zu dem vorgeschobenen Gefechtsstand der Armee gefahren. Er war zur Lagebesprechung und zum Befehlsempfang beim Nachrichten-chef der Armee befohlen worden. Nun erschien er mit einem NS-Presseoffizier, der der Propagandakompanie die Zielrichtung unseres Auftrages übermitteln sollte.
Der gut gekleidete Schulungsoffizier ratterte seinen Vortrag herunter:
»Alles, was Millionen deutscher Soldaten heute gesehen, ist ein einziges Bild niedrigsten, sozialen Lebensstandards: Angefangen von den erbärmlichen Behausungen und verlausten Wohnungen, von den verwahrlosten Straßen, verdreckten Dörfern bis zur tierischen Stumpfheit ihres ganzen Daseins.«
Ich blickte mich im Kreis der Bild-, Film- und Wortberichter um. Ihre Mienen waren wie versteinert.
»Der Kampf im Osten bedeutet die Befreiung der Menschheit von diesem Verbrechen. Die Aufgabe der deutschen Presse wird es nunmehr sein, in einem durchschlagenden Aufklärungsfeldzug die vorstehend umrissenen Gesichtspunkte in grundlegenden eigenen Ausführungen, in der Heranschaffung von Beweismaterial in Wort und Bild und in plastischer Aufmachung herauszuarbeiten. Eine besondere Rolle wird dabei die eindrucksvolle Gegenüberstellung der menschenunwürdigen Zustände in der Sowjetunion gegenüber dem sozialen Fortschritt, dem kulturellen Hochstand und der gesunden Lebensfreude des arbeitenden Menschen im national-sozialistischen Deutschland einnehmen. Einer guten Bildauswahl, in der die vertierten bolschewistischen Typen dem freien und offenen Blick des deutschen Arbeiters, die verdreckten Sowjetbaracken den deutschen Arbeitersiedlungen, die grundlosen Morastwege den deutschen Reichsstraßen und Autobahnen gegenübergestellt werden, kommt dabei große Bedeutung zu.«
Nun wussten wir, worauf es ankam. Es galt, nichts von der Schwere der kriegerischen Handlungen zu berichten, sondern eine politische Schwarz-Weiß-Malerei vorzunehmen. Das Gesicht von Heinz Wockenfuß, unserem Staffelführer, sprach Bände.
Nach der Verabschiedung des Schulungsoffiziers gab Wockenfuß die Befehle des Armeenachrichtenführers kurz und klar bekannt: »Die Heeresgruppe Nord ist zum Vormarsch angetreten. Unser Auftrag ist uns bekannt; wir folgen der kämpfenden Truppe und halten die Bilder der Offensive fest.« – Also doch keine politischen Klischees, sondern Aufnahmen von der Realität eines gnadenlosen Kampfes.
Glutrot kam die Sonne am Horizont empor; der Tag schlich quälend heiß herauf. Wir saßen in unserem Film-Kübelwagen, begleitet von zwei Kurieren auf ihren BMW-Solo- und Beiwagenmaschinen. Widerliche Staubwolken hüllten uns ein. Unsere Kehlen trockneten schnell aus. Die Augenlider brannten, während wir uns im gemäßigten Tempo die schnurgerade Straße entlangbewegten. Diese sogenannte Rollbahn war jetzt die Schlagader der Armee. Sie führte uns nach Nord-Osten. Überall sahen wir Spuren der Kämpfe; niedergebrannte Gehöfte, aus dem Boden gerissene Bäume, Granattrichter. Von den ausgebrannten Holzhäusern waren nur noch die steinernen Kamine geblieben, die himmelan ragten. Immer wieder ließen wir Reinhold Wegmann den Wagen anhalten und filmten die Stätten des Grauens.
Bald kamen wir durch hügeliges, reizvolles Gelände; dann fuhren wir wieder stundenlang durch niedrigen Wald. Am Waldesrand erblickte ich eine Gruppe von russischen Frauen, die gerade damit beschäftigt waren, unter Aufsicht von deutschen Soldaten Gräber auszuheben. Ich bat Reinhold Wegmann anzuhalten und sprang mit meiner Handkamera aus dem Wagen.
Am Boden lagen zwölf deutsche Infanteristen, die durch Maschinengewehrsalven gefallen waren. Den jungen Gefallenen entfernte man die Erkennungsmarken von den blutverquollenen Nacken. Den Verheirateten streifte man zusätzlich ihre Eheringe von den Fingern. Danach wurden ihre Uniformtaschen geleert und die kleinen Habseligkeiten in fein säuberliche Säckchen gelegt. »So sieht also der Heldentod aus«, sagte ich zu Reinhold Wegmann, »irgendwo in Russlands Weite zusammengeschossen, blutverschmiert in eine Zeltplane gewickelt, schnell registriert und dann in die Grube geschmissen.« Ich war neugierig, wie dieser Bibelleser wohl reagieren würde.
Sehr ruhig und bestimmt antwortete er: »Herr Leutnant, es steht in der Heiligen Schrift geschrieben: ›Der Mensch hat keine Macht, den Geist aufzuhalten, und hat keine Macht über den Tag des Todes, und keiner bleibt verschont im Krieg und das gottlose Treiben rettet den Gottlosen nicht.‹«
Ich war erstaunt über die gute Bibelkenntnis dieses einfachen Mannes.
»Wer hat denn die Macht über den Tag des Todes?«, forschte ich.
»›Der Tod ist der Sünde Sold‹, – Herr Leutnant, ›die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.‹ – Jesus Christus sagte es seinen Jüngern in aller Deutlichkeit: ›Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.‹«
»Und diese Macht reicht nicht aus, das verbrecherische Treiben und dieses jahrtausendealte Morden zu beenden?«, fragte ich den Gefreiten. »Irgendwo ist doch hier ein Missverhältnis. Aber jetzt ist nicht die Zeit, Wegmann, wir wollen uns ein andermal darüber unterhalten.«
»Zu Befehl, Herr Leutnant«, sagte er, dann stiegen wir in den Filmwagen und fuhren weiter. Der Wagen schaukelte über stark ausgefahrene Vormarschwege der Armee, rüttelte durch tiefe Rinnen und sandig ausgemahlene Furchen. Wir konnten von Glück sprechen, dass der staubtrockene Boden den Rädern genügend Halt gab. Wegmann war ein ausgezeichneter Fahrer, er hielt den Wagen immer auf den Kuppen, um zu verhindern, dass die Achsen auf die Erde kamen und wir schließlich festsaßen. Dadurch kamen wir natürlich nur höchstens 30 bis 40 Kilometer pro Stunde voran.
Gefährlich wurde das Fahren beim Überholen von langen Kolonnen. Dabei kam unser leichter Geländewagen oft ins Schlingern. Öfter ließ ich den Wagen halten und filmte die vorwärts strebende Armee. Viele Fahrzeuge wurden von zuverlässigen Pferden gezogen. Wir überholten einen Fliegerfunkwagen, ein hochrädriges Monstrum, scheinbar ein ehemaliger französischer Verpflegungskarren. Plötzlich rutschte der Pferdewagen von der Straße ab! Ein Pferd überschlug sich dabei in den Strängen und verfing sich in einem Fernkabel, das längs am Straßenrand lag. Jetzt war die Hölle los! Die nachkommenden Fahrzeuge blieben stecken. Die Kutscher fluchten und brüllten wild. Offiziere versuchten, das Knäuel auseinanderzubringen. Mit neuen Pferden und einem zweiten Paar als Vorspann zogen die Männer von der Luftwaffe die Kane aus ihrer bedrohlich schiefen Lage.
Meine Filmkamera surrte. Ich wollte diese, zum Teil urkomisch wirkende Situation unbedingt festhalten, obwohl mir Hauptmann Wockenfuß prophezeite: »Solche Szenen werden niemals in irgendeiner Wochenschau gezeigt werden. Helden will Goebbels sehen oder bolschewistische Untermenschen.«
Weiter ging's. Wir fuhren durch ärmliche Dörfer. Sie erinnerten mich an Gemälde von niederländischen Malern wie Pieter Breughel, Adrian Brouwer, Paulus Potter, Jacob van Ruisdael und Isaak van Osteade. So musste es wohl in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges ausgesehen haben. Bald erreichten wir die Grenze zwischen Lettland und der Sowjetunion. Die Wege wurden zusehends schlechter und gefährlicher, außerdem war das Gebiet minenverseucht. Diese Minen galten nicht etwa uns, sondern waren zur Sicherung innerhalb Russlands gedacht. Wir mussten also um die von unseren Pionieren aufgestellten Warnungstafeln Slalom fahren. Dann kam die eigentliche Grenze von Zentralrussland; hier hörte der Weg vollkommen auf. Wir befanden uns im ehemaligen Niemandsland. Die baltischen Staaten waren von Hitler an Stalin verschachert worden. Es war ein unheimliches Gefühl. Pioniereinheiten hatten eine Art Knüppeldamm durch den Sumpf und das unbeschreibliche Gestrüpp gelegt. Zwischen einem 30 Meter breiten Todesstreifen, einem Gebiet mit wilder Vegetation, holperten unser Filmwagen und die Motorräder voran. Nach etwa 300 Metern tauchte zwischen den Bäumen eine Kette verlassener russischer Wachtürme auf.
Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Eine unheimliche Stille und Verlassenheit bedrückte uns. Ich ließ halten und filmte diesen gespenstischen Todesstreifen, nicht ahnend, dass sich nach diesem Krieg eine gleiche »Staatszuchthauslinie« einige Jahrzehnte durch ganz Deutschland ziehen sollte.
»Det sind die Bilder, die der Herr Reichspropajanda-minister sich wünscht – Endstation Zuchthaus. Freiheit ade!«, meinte mein Kamera-Assistent Franzl.
»›Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit‹, hat ein großer Deutscher gesagt«, entgegnete ich.
»Und wat is denn notwendig, Herr Leutnant?«, wollte Franzl wissen.
Ich zuckte mit den Achseln: »Das sollten wir eher unseren Freund Wegmann fragen«, dabei blickte ich ihn provozierend an.
»Eine unabhängige Freiheit gibt es überhaupt nicht, Herr Leutnant«, erklärte unser Fahrer. »Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Man kann nicht Gott dienen und dem Satan, so etwa hat es Jesus gesagt.«
In Ruhe und Überlegenheit konnte dieser einfache Mann antworten, so klar, so logisch und auch überzeugend. Ich war einfach fasziniert von der Erkenntnis dieses Mannes.
»Bitte – da haben Sie die Antwort, Herr Unteroffizier«, sagte ich zu Franz Beck, der mich ganz verschmitzt ansah.
»Det heißt also, man kann nicht Hitler und Stalin zugleich dienen?«, stichelte Franz.
»Hitler und Stalin haben mit Jesus Christus überhaupt nichts zu tun, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt«, konterte Wegmann.
»Wir haben trotzdem jetzt keine Zeit, über Freiheit und Unfreiheit und über Hitler oder Stalin zu diskutieren. Weiter geht's«, rief Hauptmann Wockenfuß.
Endlich kamen wir auf fest ausgebaute Straßen. Von der Feldgendarmerie wurden wir gewarnt, denn die Gegend sei noch nicht von versprengten sowjetischen Einheiten gesäubert.
Wir fuhren über hügeliges Land, durch kleine Schluchten und größere Waldstücke. Zu unserer Rechten erblickten wir im freien Gelände ein größeres Gehöft.
»Dort drüben, auf diesem Bauernhof, machen wir Quartier«, befahl Hauptmann Wockenfuß.
»Aber bitte, größte Vorsicht wegen der versprengten Sowjeteinheiten«, setzte er noch hinzu.
Durch fettes Weideland kamen wir dem Gehöft näher; kein Mensch war weit und breit zu sehen. Das massiv gebaute Herrenhaus mit den Stallungen musste noch aus der Zarenzeit stammen. Der Hof war leer, nicht eine Katze strich umher. Auch die Ställe waren entweder ausgeplündert oder evakuiert.
Polternd stiegen wir die Treppe hoch zu den Zimmern. Die Betten waren aufgeschnitten, so dass die Federn bei jedem Schritt und Luftzug umherflogen. Manche Tür schien durch harte Soldatenstiefel eingetreten, die Schränke ausgeplündert zu sein. Der wertlose Inhalt lag zerstreut auf den Fußböden. Wir fanden im ganzen Haus nichts Essbares, die Küche sah wie ein Schlachtfeld aus – Geschirr und Töpfe lagen zerschlagen oder verbeult in der Gegend herum.
Überall stank es, überall waren auch Haufen von Menschenkot. In manchen Gläsern sahen wir trüben Urin.
»Wer hat wohl diese Sauerei angerichtet?«, fragte wütend der Hauptmann.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Truppen es waren …«, schimpfte der Chef.
Franzl frotzelte: »Also doch die sowjetischen Untermenschen? Vielleicht hat das Propagandaministerium gar nicht so unrecht?«
»Blödsinn!«, wetterte Wockenfuß. »Primitive Elendsgestalten gibt es in jeder Armee.«
»Leutnant, lassen Sie das Haus säubern! Wir wollen dieses Gehöft als unser Standquartier einrichten. Ich fahre inzwischen mit Häberle zum Hauptquartier und auf dem Rückweg noch bei der Feldküche vorbei. – Lassen Sie aber das Haus sichern, denn man weiß nicht, ob das Gebiet völlig feindfrei ist.«
»Zu Befehl, Herr Hauptmann«, sagte ich und fort brauste der Filmwagen sowie das Motorrad mit Seitenwagen. Die Fahrzeuge sollten aufgetankt werden.
Jetzt waren wir zu viert, Franzl Beck, Reinhold Wegmann, Walter Häberle und ich. Wir hatten die Aufgabe, das Haus einzurichten und die Sicherung des Gehöftes zu übernehmen. Wir waren gerade dabei, die hohen Stroh- und Heuhaufen nach versteckten Lebensmitteln zu durchstöbern, als Walter Häberle angerannt kam und fast atemlos und zitternd vor Aufregung rief: »Herr Leutnant, Kosaken greifen an! – Eine ganze Schwadron Kosaken.«
»Alle Mann zu mir!«, rief ich und stieg im Herrenhaus unter den Dachstuhl, um mit meinem scharfen Fernglas die Feinde zu beobachten. Zunächst sah ich, wie ein Vortrupp von 20 Mann aus dem Wald hervorkam. Sie ritten in breiter Schützenlinie auf das Feld hinaus und hielten etwa 800 Meter vor unserem Gehöft, saßen ab und beobachteten die Umgebung nach allen Seiten. Danach kamen ca. 150 Kosaken im flotten Galopp übers Gelände. Sie hielten ihre Gewehre quer über dem Hals ihrer zottigen Pferdchen. In der Höhe ihres Vortrupps saßen sie ab und lagerten sich im Gras. Ihre Pferde begannen sofort zu weiden.
»Das hat uns gerade noch gefehlt, vier Kameramänner und Kraftfahrer gegen eine Schwadron Kosaken. Vorwärts, alle Klamotten hinüber in die Scheune! – So geräuschlos wie nur möglich, und dann in volle Deckung!«
Mit großer Geschwindigkeit packten wir alles zusammen und schlichen uns hinüber in die Scheune.
»Alle Mann im Stroh verstecken und so nah wie nur möglich an die Außenwand!«, befahl ich.
Nach wenigen Augenblicken hatten wir uns wie die Ratten im Stroh verkrochen. Wir waren uns darüber im klaren, dass wir auf keinen Fall mit dieser Übermacht in irgendeinen Kampf verwickelt werden durften. Wir deckten uns gegenseitig mit Stroh zu. Ich zupfte den Lehm und das Moos zwischen dem Balken an der Außenwand heraus, um den Feind durch dieses Loch beobachten zu können. Sorglos hatten sich die Kosaken ins Gras gelegt, während ihre Pferde friedlich weideten.
Plötzlich kam Bewegung in die Gruppe der Kosaken! Aus dem Wald preschten drei Reiter hervor. Schnell schob ich mein Fernglas vor die Augen und erblickte einen hohen Offizier mit zwei Adjutanten. Beim näheren Hinsehen erkannte ich einen sowjetischen General. Der Kommandant der Schwadron ritt auf den General zu und salutierte mit gezogenem Degen. Ich hatte das stärkste Teleobjektiv an die Handkamera gesetzt und filmte quasi hinter den Linien der Sowjets in aller Seelenruhe.
Franzl flüsterte: »Mensch, mir laust der Affe. Det wär doch een jefundenes Fressen, wenn wa den hohen Herren jefangennehmen könnten. Valleicht der erste sowjetische Jeneral. Det jibt een Ritterkreuz.«
»Halt doch deine Fresse!«, konterte ich in echtem Berliner Dialekt zurück. »Du willst wohl gleich von den Iwans durch den Fleischwolf gedreht werden?«
Während ich noch mit Franzl schimpfte, sah ich etwa dreißig Kosaken in den Sattel steigen und in breiter Front gegen unser Gehöft vorgehen.
»Auf keinen Fall schießen«, befahl ich. »Ruhig Blut, wir sind noch nicht entdeckt, denn der größte Teil der Russen bleibt ja im Gras liegen. Es fällt kein Schuss ohne meinen Befehl! Verstanden!«
Inzwischen ritten die Kosaken mit ihrem General und seinem kleinen Anhang durch das Tor in den Hof. Keine fünf Meter kamen sie an meiner Kameralinse vorüber. Unentwegt ließ ich meine Ariflex laufen. Nie im Leben werde ich wieder solche Bilder in die Kamera bekommen, dachte ich, während mir das Herz vor Angst schmerzte.
Die Kosaken suchten zunächst das Gehöft ab; mir rann der Schweiß im Nacken, an den Schläfen und den Rücken hinunter. Minuten wurden jetzt zur Ewigkeit. Der General sprang vom Pferd und klopfte dem Wallach den Hals. Das Pferd wurde nervös – ob es uns witterte? Meinen Puls fühlte ich an der Halsschlagader. Das Herz klopfte so stark, dass ich meinte, die Russen könnten mich hören.
Der General übergab einem Pferdehalter sein braunes Pferd und schritt mit den Offizieren in das Haus. In den Wohnzimmern des Herrenhauses begannen die Russen zu lachen, offensichtlich hatten sie den menschlichen Kot in den Schüsseln entdeckt. Im Hof scharrten die Pferde.
Ich wagte kaum zu atmen. Jede Bewegung verursachte im Stroh ein Knistern. Die Hitze wurde für uns unerträglich. Im dicksten Gewühl des Heus lag Reinhold Wegmann, neben mir; er wirkte ganz konzentriert. Seine Augen glänzten, seine Hände hielt er gefaltet – er bewegte seine Lippen. Ich wusste, er betete. Eigentümlich, beim Anblick dieses Mannes wurde ich direkt ruhig. Aus ihm strahlte eine geheimnisvolle Kraft. Jetzt begann ein Strohhalm an meiner Nase zu kitzeln. Das Kribbeln wurde unerträglich. Ich kniff mir mit Daumen und Zeigefinger die Nasenflügel zusammen und massierte anschließend den Nasenrücken. Das Stroh knisterte unter meiner Bewegung. Das leiseste Geräusch schien anzuwachsen. Mein Atmen dünkte mich wie das Brausen eines Windes. Jeder Nerv fieberte – gleich werden wir entdeckt, gleich kommt unser Ende!
Vier frontunerfahrene Männer der PK-Kompanie können es niemals mit zweihundert Kosaken aufnehmen. Was würde aber geschehen, wenn unverhofft unser Filmwagen mit dem Seitenkrad zurückkäme? Wie sollten wir unsere Kameraden warnen oder ihnen Feuerschutz geben?
Am Herrenhaus öffnete sich ein Fenster, der General trat ans Fenster und schaute auf den Hof. Wieder surrte meine Kamera, jetzt konnte ich von dem Kosakenkommandeur quasi ein Passbild machen.
Plötzlich kam unerwartet Hilfe vom Himmel her. Über das Feld jagten deutsche Tiefflieger und eröffneten das Feuer auf die ahnungslosen Kosaken. Die Pferde auf der Wiese bäumten sich auf und stürmten mit lautem Gewieher davon, die Kosaken hinter ihnen her. Auf dem Boden der Wiese wälzten sich Verwundete, andere blieben tot liegen. Auch im Gehöft kam alles in Bewegung. Mit gezogener Pistole rannte der General aus dem Herrenhaus. Ich ließ meine Kamera unentwegt laufen. Der ganze sowjetische Stab schwang sich auf die Pferde und galoppierte über das Feld, um dem nächsten Tieffliegerangriff zu entrinnen.
Wir atmeten auf: »Junge, Junge, det war valleicht een Abenteuer – ick hab schon jedacht, meen letztes Stündchen hätte jeschlagen. Mir is richtig zum Kotzen zumute«, jammerte Franzl.
Der Häberle krabbelte auch aus dem Heu: »Jetzt isch elles vorüber – endlich könne mr unser Quartier einrichte.« Er klopfte sich die Heureste vom Uniformrock.
Reinhold Wegmann hatte sich am schnellsten gefasst: »Wer kümmert sich denn um die verwundeten Kosaken?«, fragte er mich.
»Wir sind zu viert – ich kann niemanden dazu abstellen. Außerdem könnten die geflohenen Russen jederzeit zurückkehren, dann wären wir hoffnungslos verloren!«
Vom Feld her hörte ich jämmerliche Schreie der Verwundeten. Unverhofft kam einige Minuten danach Hilfe. Aus dem Wald schwärmten deutsche Infanteristen aus; sie nahmen die überlebenden Russen gefangen und schafften die verwundeten Kosaken fort.
Schnellstens ließ ich ein weißes Laken an eine Heuharke binden, dann winkten wir unseren Kameraden zu.
Ein Leutnant mit einigen Schützen kam auf uns zu. »Wie kommen Sie denn ins feindliche Hinterland?«, wollte er von uns wissen.
»Wir hatten uns in dieser Scheune versteckt, als plötzlich die Kosaken aus dem Wald kamen.«
»Meine Zeit, da haben Sie aber Gottes Schutzengel bei sich gehabt«, lachte der Offizier, »im ganzen Wald wimmelt es noch von Sowjets. Mit zwei Kompanien säubern wir dieses Gebiet. Zur Sicherung des Gehöftes lasse ich Ihnen fünf Mann hier.«
»Danke, Kamerad, wir erwarten in Kürze unseren Tross.«
»Dann schicken Sie mir meine Männer hinterher.« Damit verabschiedete sich der Leutnant und ging zu seiner Einheit zurück.
»Mit dem Schutzengel hat er unbedingt recht; wat meinste, Reinhold?«, wollte Franzl von Wegmann wissen.
»Ja, wenn der Leutnant nicht nur eine undefinierbare Schicksalsmacht gemeint hat. Martin Luther hat einst gesagt: ›Engel sind Gottes Diener – sie geleiten uns überall im Leben und im Sterben und schützen uns. Um ihren Schutz sollen wir Gott täglich bitten und ihm dafür danken.‹«
»Wie soll ick det verstehn?« Franzl verzog ironisch seinen Mund. »Du jlobst doch nich etwa im zwanzigsten Jahrhundert an kleene Engelchen, die mit Spatzenflügeln um einen kleinen See herumtanzen?«
»Nein, das wäre dann ein Märchenglaube. So haben die Maler des Mittelalters uns die Engel gezeichnet. König David hat diese dienstbaren Geister Gottes anders beschrieben: ›Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes.‹«
»Nee, dat hört sich doch ooch wie'n Märchen an«, Franzl blieb hartnäckig.
Mir wurde das Gespräch irgendwie peinlich: »Verschieben wir dieses Thema doch auf ein andermal«, empfahl ich. »Außerdem sollten wir jetzt so schnell wie möglich unser Quartier herrichten.«
Bald darauf kam der Tross der Propagandakompanie mit zwei großen Lastwagen, drei Filmkübelwagen und vier Kradmeldern. Auch die Feldküche hatte uns erreicht. Mit großem Heißhunger löffelten wir die Erbsensuppe, in der große Mengen von Schweinefleisch herumschwammen. Im Herrenhaus schwirrte es nun von Wort- und Bildberichtern, Kamera-Assistenten, Laborpersonal, Schreibern und anderen Technikern.
Heinz Wockenfuß hatte uns zur Regiebesprechung zusammengerufen. Zweck unserer Zusammenkunft war, einen Plan festzulegen, wie wir aus den vielen tausend Metern Zelluloid, die wir in diesen ersten Tagen des Russlandfeldzuges gedreht hatten, einen größeren Dokumentarfilm mit dem Titel »Der Blitzkrieg im Osten« zusammenstellen könnten. Vor allem müsste ein geeignetes Drehbuch hergestellt werden. Dieser Auftrag war jetzt rückwirkend gar nicht so einfach, denn wer lieferte uns die Zwischenschnitte und den geeigneten Ton?
Wortberichter konnten, unabhängig von komplizierten Geräten und ohne auf die Beleuchtungsverhältnisse Rücksicht nehmen zu müssen, in jeder Stubenecke einen Kampfbericht in glühenden Farben schildern. Ein Filmmann brauchte dazu, selbst unter Einsatz seines Lebens, Stunden und Tage. Ein Bildberichter drückt einfach seinen Auslöseknopf an seinem Fotoapparat und kann später den erläuternden Text dem Foto hinzufügen. Ein Filmberichter aber muss bei den Aufnahmen an die Montage und den Szenenablauf denken, wenn die Kamera läuft.
So war ich froh, schon einige Szenen gedreht zu haben, um sie als Zwischenschnitte benutzen zu können. Trotzdem wollten wir noch einiges Filmmaterial abdrehen.
»Wegmann!«, rief ich.
»Herr Leutnant?«
»Hören Sie zu! Wir fahren zurück nach Dünaburg und machen Aufnahmen.«
»Zu Befehl, Herr Leutnant! Der Wagen ist aufgetankt.«
Mit Franz Beck fuhren wir zu dritt in die eroberte Stadt zurück. Wir kamen durch Orte, in denen man die grausame Zerstörungsgewalt des Krieges sehen konnte. Niedergebrannte und zerschossene Häuser, viele stehengebliebene russische Fahrzeuge, Pferdewagen, Geschütze, unzählige Maschinengewehre und Stahlhelme. An einem freien Platz stand ein seltsames Ding. Auf einem russischen Lastwagen war ein drehbares Gestell mit scheinbar acht Ofenrohren montiert – eine sogenannte »Stalinorgel«, ein sehr gefährliches Geschütz, wie sich später herausstellte. Alles wurde von mir gefilmt. In Dünaburg schauten wir uns die festungsartige Zitadelle an. Sie stammte noch aus der Zarenzeit. Neben einem groß angelegten Gouverneurspalast stand die herrliche barocke, weiße Garnisonskirche mit ihren Doppeltürmen. Die Bolschewisten hatten das Gotteshaus sowohl in ein Kino als auch in eine Turnhalle verwandelt. Nur die äußere Form der Kathedrale erinnerte noch an das alte, gläubige Russland. Die wunderbare Inneneinrichtung des Bauwerks war ausgeplündert worden.
Als ich Reinhold Wegmann auf diesen Vandalismus aufmerksam machte, gab er mir zur Antwort: »Man kann wohl Gotteshäuser, Kirchen, Kathedralen mit dem gesamten Inventar vernichten, aber nicht den lebendigen Glauben an Jesus Christus, ›denn Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind‹, hat der Apostel Paulus verkündigt, als er einst die große Kulturstadt Athen besuchte.«
»Sagen Sie, Wegmann, sind Sie ein Bibelforscher oder haben Sie Theologie studiert?«, wollte ich wissen.
»Nein, Herr Leutnant, ich bin nur ein entschiedener Christ, der täglich in seiner Bibel liest«, kam es ganz natürlich und bescheiden aus seinem Munde. Das geheimnisvolle Leben dieses Mannes interessierte mich von Tag zu Tag mehr.
Wieder packten wir die Kamera, das Stativ und die Filmkiste ein. Als wir in die Vorstadt kamen, verpestete ein süßlicher Gestank die Luft. Am Ufer der Düna stand ein ausgebrannter russischer Panzer. In den Trümmern eingeklemmt lagen in Verwesung übergehende russische Soldaten. Uns wurde übel. Schnell brausten wir davon. Auf einem anderen Weg wollten wir nun unser Standquartier erreichen.
Nach stundenlanger Fahrt sagte Franzl: »Mensch, mir laust der Affe, ick jlobe, wir haben uns verirrt!« Riesige Wälder umgaben uns. Kein Mensch war weit und breit zu sehen, niemand konnte uns sagen, was hinter diesen schrecklichen Wäldern lag. Der unermesslich große Wald wurde immer dunkler. Unsere Gewehre lagen griffbereit neben den Sitzen. Das Gebiet wurde immer einsamer, viele Baumsperren mussten wir umfahren – der nordeuropäische Urwald wurde immer unheimlicher. Wir mussten jeden Augenblick auf eine Überraschung gefasst sein.
Bald breitete sich Dämmerung aus. Es wurde Nacht. Wir mussten anhalten und uns auf eine unangenehme Nacht im Freien einrichten.
Inzwischen war der Mond in seiner kalten Pracht aufgegangen. Hinter den wuchtigen, hohen Bäumen erzeugte er eine fantastische Szenerie. Die Mücken plagten uns bis zur Weißglut; zuweilen schlossen wir unsere Augenlider. Im niederen Gebüsch knackte es; von den Blättern tröpfelte der Nachttau. In der Ferne hörten wir gellende Abschüsse. Es war eine gespenstische Nacht.
Diese mondverzauberte Nacht und das grausam feindselige Land – welch unfassbarer Gegensatz. Ich bekam panische Angst.
Zwischen den Büschen und Baumstämmen zog der Nebel milchig wie ein Leichenschleier auf.
Mir kamen Worte aus dem Nachtlied von Matthias Claudius in den Sinn: »… und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar.«
Ich war vom Sitzen völlig steif geworden, deshalb stieg ich aus dem Kübelwagen aus und vertrat mir die Füße. Ich knetete meine klammen Hände. Die Kühle und die Feuchtigkeit der Nacht drangen durch die Uniform und durch das verschwitzte Unterzeug. Ich spürte, wie ein Schauer über meinen Rücken lief. Franzl schnarchte leise auf dem hinteren Sitz des Fahrzeugs. Jetzt stieg auch Reinhold Wegmann aus dem Wagen. »Wie steht's, werden wir aus diesem Schlamassel gesund herauskommen?«, fragte ich ihn.
»Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt«, deklamierte er und fuhr fort: »Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn; der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.« Dabei blickte Wegmann zum Himmel empor, als wolle er, wie Abraham, die Sterne zählen.
Es muss etwas Geheimnisvolles sein, vom Glauben so erfasst und durchdrungen sein Leben zu gestalten, dachte ich.
Diese Hochsommernacht war kurz und empfindlich kühl. Die ersten Vögel begannen ihr trautes Morgengezwitscher. Aber dann waren noch andere Geräusche zu hören. Ein Stampfen von Pferden, ein stetes Knirschen und Quietschen von harten Rädern.
Wir konnten noch nichts sehen. Mit einem Satz sprang ich zum Wagen: »He, Franzl, aufwachen! Wahrscheinlich Kosaken im Anmarsch«, sagte ich. Franzl war im Augenblick hellwach! Beide griffen wir zu den Gewehren. Ich nahm die Knarre von Reinhold Wegmann in die Hand. Hinter einer Senke kamen zwei Pferde langsam empor, dann sahen wir einen Panjewagen, der uns hoch bepackt entgegenkam.
»Zivilisten ...«, raunte mir Franzl zu.
»Wir wollen vorsichtig sein. Die Russen sind oft hinterhältige Kämpfer«, warnte ich.
»Stoi!«, rief ich, mit entsichertem Gewehr, indem ich auf die Russen zuging.
Die Russen erhoben ihre Hände, nur das kleinste Kind nicht, das auf dem Arm der Mutter saß. Ein kleiner, gebeugter Mann, der das Gefährt leitete, sprach mit schwerem, rollendem Akzent eines Russen: »Wir nix Soldatka ...«
»Sprichst du deutsch?«, fragte ich den Mann mit seinem dunklen, knorrigen Gesicht.
»Ja, ein wänig!« Er hatte vertrauenerweckende Augen, einen dunklen, langen Bart und breite, knotige Hände – seine Kleidung war schäbig und abgetragen, offensichtlich hatte ich einen Kleinbauern oder einen Arbeiter von einer Kolchose vor mir.
Die Frau, die mit ihren fünf Kindern und den wenigen Habseligkeiten auf dem Wagen saß, bekreuzigte sich.
Reinhold Wegmann, der auch herangekommen war, fragte die Frau, indem er zum Himmel deutete: »Du beten zu Jesus Christus?«
Das Gesicht der Frau entspannte sich. Staunend, ehrfürchtig nickte sie und sagte: »Jessus Chrestos, Jessus Chrestos – alles gutt.« Danach bekreuzigte sie sich wieder.