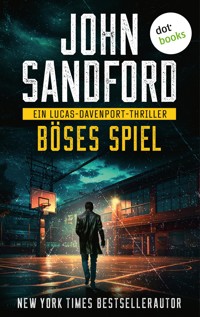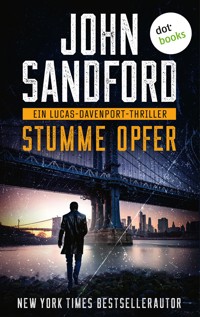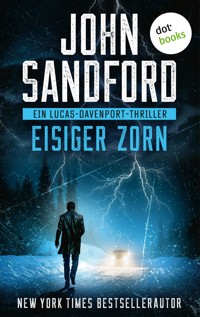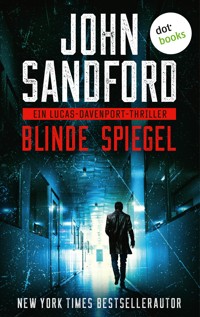
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Er labt sich an deiner Angst: Der rasante Thriller »Blinde Spiegel« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Seine Obsession sind die brechenden Blicke von Sterbenden, das letzte Flackern des Augenlichts … Zwei Serienmörder erschüttern die Twin Cities und verlangen dem Polizisten Lucas Davenport alles ab: Während der eine ein entstelltes Gesicht voller Narben trägt, ist der andere auffallend gutaussehend; ein meisterhafter Manipulator, der von allen Aspekten des Todes fasziniert ist. Aber der abgebrühte Ermittler muss es nicht nur mit diesen zwei perfiden Gegenspielern aufnehmen – sondern auch mit seinen eigenen Dämonen. Wird dieser Fall ihn in den Abgrund stürzen? »Temporeich, unglaublich spannend, ausgezeichnet!« Los Angeles Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »Blinde Spiegel« von John Sandford – der spektakuläre dritte Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von Michael Connelly und Lee Child. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Ähnliche
Über dieses Buch:
Seine Obsession sind die brechenden Blicke von Sterbenden, das letzte Flackern des Augenlichts … Zwei Serienmörder erschüttern die Twin Cities und verlangen dem Polizisten Lucas Davenport alles ab: Während der eine ein entstelltes Gesicht voller Narben trägt, ist der andere auffallend gutaussehend; ein meisterhafter Manipulator, der von allen Aspekten des Todes fasziniert ist. Aber der abgebrühte Ermittler muss es nicht nur mit diesen zwei perfiden Gegenspielern aufnehmen – sondern auch mit seinen eigenen Dämonen. Wird dieser Fall ihn in den Abgrund stürzen?
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Die Website des Autors: https://www.johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: https://www.facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: https://www.instagram.com/johnsandfordauthor/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
***
eBook-Neuausgabe März 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »Eyes of Prey« bei G. P. Putnam’s Sons, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1991 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1992 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/hxdbzxy und AdobeStock/Ana
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-058-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Blinde Spiegel« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Blinde Spiegel
Ein Lucas-Davenport-Thriller 3
Aus dem Amerikanischen von Klaus Fröba
dotbooks.
Kapitel 1
Carlo Druze war ein eiskalter Mörder.
Nichts entging seinen angespannten Sinnen, während er den Bürgersteig hinunterschlenderte, unter ihm die alten, abgetretenen Pflastersteine und knirschender Sand, über ihm das kahle Geäst der Eichenbäume. Vorhin, hinter der letzten Straßenecke, nicht weit von seinem Wagen, hatte Zigarrengeruch in der kalten Nachtluft gehangen. Dreißig Schritte weiter wehte ihn süßlicher Duft an, Deodorant oder billiges Parfüm. Jetzt hallte aus einem Zimmer im zweiten Stock ein Mötley-Crüe-Song. Großer Gott, wenn’s sogar hier unten auf der Straße so dröhnte, mußte der Lärm da oben ohrenbetäubend sein.
Zwei Häuserblocks weiter, auf der rechten Seite, tauchte ein cremefarbener Schatten am hell erleuchteten Fenster auf. Er behielt das gelbe Viereck im Auge, aber da rührte sich nichts mehr. Eine verirrte Schneeflocke wirbelte vorbei, dann noch eine.
Druze empfand nichts, wenn er mordete. Was aber nicht hieß, daß er dumm gewesen wäre. Er war auf der Hut. Er würde sein Leben nicht hinter Gefängnismauern verbringen. Und so bummelte er, die Hände in den Taschen vergraben, die Straße hinunter: einer, der spätabends noch frische Luft schnappen will. Aber er hielt Augen und Ohren offen. War innerlich auf dem Sprung. Der schwarze Skianorak reichte ihm bis zu den Ohren, vorn hatte er ihn bis unter die Nase gezogen. Die Schirmmütze war tief in die Stirn gedrückt. Falls ihm jemand begegnete, jemand, der seinen Hund ausführte, oder ein später Jogger: mehr als Druzes Augenpartie bekam er nicht zu sehen.
Als er das Ende der Baumreihe erreicht hatte, lag das Haus vor ihm, sein Ziel, dahinter die Garage. Die Straße war menschenleer, nichts rührte sich. Ein paar Abfalleimer standen wie riesige Pilzröhren aus Plastik herum. Im Erdgeschoß brannte hinter vier Fenstern Licht, oben hinter zweien, die Garage lag im Dunkeln.
Druze drehte sich nicht um, das hätte nicht zu seiner Rolle gepaßt. Kaum anzunehmen, daß irgendein Nachbar ihn beobachtete, aber man wußte ja nie. Ein einsamer alter Mann, der – eine Wolldecke um die hageren Schultern gelegt – am Fenster lehnte und in die Dunkelheit starrte ... Druze sah ihn im Geiste irgendwo dort oben stehen. Also Vorsicht. Wer hier wohnte, hatte Geld. Und Druze war ein Fremder in der Nacht. Was hier nicht hergehörte, machte die Leute argwöhnisch. Die Cops konnten im Nu da sein.
Mit einem schnellen Schritt, als hätte er nur gerade einen Augenblick verschnaufen wollen, trat Druze in den Schatten der Bäume und ging auf die Garage zu. Sie war durch einen verglasten Windfang mit dem Haus verbunden. Und die Tür zwischen der Garage und diesem Glastunnel wurde nie abgeschlossen, das wußte er.
»Wenn sie nicht in der Küche ist, sitzt sie im Wohnzimmer vor der Glotze«, hatte Bekker gesagt. Sichtlich erregt, die Vorfreude spiegelte sich auf seinem Gesicht wider. An der krakeligen Wellenlinie auf der Skizze konnte man noch sehen, wie sehr ihm die Hand gezittert hatte, während er den Grundriß auf ein Blatt aus dem Notizblock zeichnete und mit Bleistift den Weg über den Flur markierte. »Mein Gott, wenn ich doch bloß dabeisein und alles mit ansehen könnte.«
Druze zog die Kordel mit dem Schlüssel aus der Tasche und band sie sich, damit er den Schlüssel auf keinen Fall drinnen im Haus verlieren konnte, an die Gürtelschnalle. Mit seiner behandschuhten Linken versuchte er, den Türknauf zu drehen. Abgeschlossen. Na gut, dafür hatte er ja den Schlüssel. Er zog die Tür hinter sich zu, stand im Dunkeln, lauschte. Ein Rascheln? Eine Maus? Nur der Wind, der über die Dachziegel strich. Er wartete, horchte in die Nacht.
Druze war ein Gnom. Weil er als Kind schwere Verbrennungen erlitten hatte. In manchen Alptraumnächten rumorten die Erinnerungen in ihm. Dann lag er halb schlafend, halb wachend da, krümmte sich vor Angst und verhedderte sich in den Laken, als ahnte er, daß der Spuk sich nun wiederholte. Genauso grauenhaft wie damals, als er – schon vom Feuer eingehüllt – in seinem Kinderbettchen aufgewacht war. Überall lodernde Flammen, Feuerzungen, die ihm über die Hände liefen, übers Gesicht, in die Nasenlöcher hinein. Die verzweifelten Schreie seiner Mutter, während sie Wasser und Milch über ihm auskippte. Und sein Vater, der wild mit den Armen ruderte und herumbrüllte. Was alles nichts half.
Ins Krankenhaus hatten sie ihn erst am nächsten Morgen gebracht. Seine Mutter hoffte, sie könnten sich die Kosten sparen. So hatte sie ihn, weil er die ganze Nacht über schrie und weinte, mit Schweinefett eingerieben. Aber dann hatten sie morgens, als es hell wurde, seine Nase gesehen und ihn doch weggebracht.
Vier Wochen im Bezirkskrankenhaus. Vier Wochen, in denen er vor Schmerzen gewimmert hatte. Jedes Mal, wenn die Schwestern ihn aus dem Verbandszeug wickelten und badeten. Und bei jeder Hauttransplantation. Sie hatten ihm Haut von den Hüften ins Gesicht verpflanzt. Ein Ausdruck, den er nie vergessen konnte. Egal, wie lange es schon her war, er hatte sich ihm ins Hirn gegraben. Verpflanzt hatten sie die Haut.
Als sie fertig waren, sah er besser aus. Aber nicht gut. Ein zusammengestoppeltes Gesicht, eine Maske, wie von einem unsichtbaren Nylonstrumpf überzogen. Und mit der Haut war es nicht viel anders: ledernes Flickwerk, rauh und ausgebleicht wie ein alter Fußball. Die Nase hatten die Ärzte ihm gerichtet, so gut sie’s konnten. Aber sie war zu kurz, die Nasenlöcher ragten nach vorn wie tote Scheinwerfer. Die Lippen waren dünn und hart, sie fühlten sich ständig trocken an. Daher kam Druzes Angewohnheit, dauernd daran herumzulecken. Er merkte gar nicht mehr, daß seine Zunge alle paar Sekunden nach vorn schnellte, wie bei einer Eidechse.
Ein ganz neues Gesicht hatten die Ärzte ihm gegeben, nur die Augen waren noch seine Augen.
Mattschwarz und ohne Glanz – wie die verwitterte Farbe in den Augen des Indianers, der auf den Werbeplakaten für Zigarren zu sehen war. Manchmal glaubten die Leute, wenn sie ihm zum ersten Mal begegneten, er sei blind. Aber daran lag es nicht. Die Augen waren nur der Spiegel seiner Seele. Jener Seele, die Druze damals in der Brandnacht für immer verloren hatte.
Stille. Kein lautes Wort, kein Telefonläuten drang in die Garage. Druze stopfte den Schlüssel in die Hosentasche und zog eine Röhre aus mattiertem Aluminium aus der Jacke: eine knapp zehn Zentimeter lange Stablampe. Er stellte den Lichtstrahl so ein, daß er kaum streute, und zwängte sich am Auto und all dem abgestellten und aufgereihten Gartenplunder vorbei. Bekker hatte ihn vorsorglich darauf hingewiesen, daß sie Hobbygärtnerin war. Die halbe Garage war vollgestopft mit Spaten, Rechen, Hacken, Pflanzstäben, Blumentöpfen und Tonscherben, Säcken mit Dünger und Torfballen. Ordentlich nebeneinander aufgereiht ein Rasenmäher, ein Vertikutiergerät und eine Schneefräse. Es roch nach Erde und Benzin, ein saures, moderiges Gemisch, das ihn an seine Kindertage erinnerte. Er war auf einer Farm aufgewachsen, im Wohnwagen, dessen einzige Energiequelle Propangas war und den sie nicht da aufstellen durften, wo der Farmer mit seiner Familie lebte, sondern ganz weit hinten, beim Hühnerstall. Ihm brauchte keiner was zu erzählen über Gemüsegärten, öltropfende alte Landmaschinen und den Gestank von Mist und Dung.
Die Tür, die von der Garage in den Windfang führte, war zu, aber nicht abgeschlossen. Der verglaste Gang war nicht ganz zwei Meter breit und genauso vollgestopft wie die Garage. »Sie benutzt den Windfang als Gewächshaus«, hatte Bekker gesagt. »Paß vor allem auf die Tomaten auf, das Zeug steht da überall rum. Ohne Lampe kommst du nicht durch. Aber von der Küche oder vom Wohnzimmer aus kann sie den Lichtschein nicht sehen. Nur das Fenster auf der linken Seite mußt du im Auge behalten, das ist das Arbeitszimmer. Obwohl sie da bestimmt nicht ist. Da treibt sie sich nie rum. Du wirst keine Schwierigkeiten haben.«
Bekker war einer von denen, die alles genau planen und sich an ihrer eigenen Pingeligkeit berauschen. Ganz plötzlich, während er Druze anhand der Grundrißskizze den Weg erklärte, hatte er mit der Bleistiftspitze irgendwo halt gemacht und angefangen zu lachen. Ein Lachen, das viel über ihn verriet. Rauh und krächzend. Wie das Quaken einer Kröte in Todesangst, wenn sie den Flügelschlag der Eule spürt.
Druze hatte keine Schwierigkeiten mit dem Glastunnel; der Lichtschimmer hinter dem Fenster am gegenüberliegenden Ende wies ihm den Weg. Und er war zwar kräftig gebaut, aber nicht dick. Präzise gesagt: Er war ein Athlet. Er verstand sich aufs Jonglieren, aufs Tanzen, er konnte über ein Seil balancieren oder einen Salto drehen, und zwar so, daß er in der Luft die Hacken zusammenschlug und anschließend so leichtfüßig aufsetzte, daß jeder geschworen hätte, außer dem Hackenknallen wäre nichts, aber auch gar nichts zu hören gewesen. Als er ungefähr in der Mitte des Windfangs angekommen war, hörte er eine Stimme und blieb stehen.
Ein Singsang. Niedlich und einfältig, wie von einer Halbwüchsigen im High-School-Chor. Eindeutig eine Frauenstimme. Den Text konnte er nicht verstehen. Die Melodie kam ihm bekannt vor, aber der Titel fiel ihm nicht ein. Irgendwas aus den Sechzigern. Vielleicht ein Lied von Joan Baez.
Er spürte, wie die Anspannung in ihm wuchs. Wie er sich konzentrierte. Keine Frage, daß er mit ihr fertigwurde. Stephanie Bekker umzubringen, war kein Problem. Nicht schwieriger, als einem Huhn den Kopf abzuhacken oder einem Ferkel die Kehle durchzuschneiden. Nur ein Schweinchen, sagte er sich. Und Fleisch ist Fleisch ...
Da war dieser andere Mord gewesen, vor ein paar Jahren. Er hatte Bekker, als sie beim Bier zusammensaßen, davon erzählt. Nicht so, wie man zugibt, schon mal jemanden umgebracht zu haben. Einfach so, wie man irgendeine Geschichte erzählt. Zumal ihm das Ganze jetzt, nachdem ein paar Jahre ins Land gegangen waren, sowieso nicht mehr wie ein richtiger Mord, sondern eher wie ein belangloses Ereignis vorkam. Es hätte auch eine halb vergessene Szene aus einem Film sein können, den er, wie ihm plötzlich wieder einfiel, irgendwann im Autokino gesehen hatte. Und er wußte nicht mal, wie der Film ausgegangen war.
Ein Mädchen in einer Absteige in New York. Vielleicht eine gewerbsmäßige Nutte. Jedenfalls eine Drogensüchtige. Sie hatte ihm was von ihrem Shit abgegeben. Und weil’s nicht drauf ankam, hatte er sie umgebracht. Nur so. Fast, als wär’s ein Experiment. Um zu sehen, ob es irgendwelche Empfindungen bei ihm auslöste. Nein, es hatte nichts ausgelöst.
Wie sie hieß, wußte er nicht. Wahrscheinlich hätte er nicht mal die Absteige wiedergefunden, falls es die noch gab. Nachträglich hätte er auch nicht genau sagen können, wann es gewesen war. Irgendwann im Sommer, an einem heißen Tag, an dem Gestank in der Luft lag. Er erinnerte sich an den Müll auf den Bürgersteigen und an den Geruch von verfaultem Gemüse.
»Hat mir weiter nichts ausgemacht«, hatte er gesagt, weil Bekker ihm keine Ruhe ließ und dauernd Fragen stellte. »War nicht so, als ob ich ... Ach, Scheiße, es war gar nichts. Mal abgesehen davon, daß dem kleinen Miststück die Luft weggeblieben ist.«
»Hast du sie auch geschlagen?« hatte Bekker wissen wollen. Und ihn angestarrt wie einer, der sich auskennt. »Hast du sie ins Gesicht geschlagen?«
Und in dem Augenblick, schätzte Druze, waren sie Freunde geworden. Er erinnerte sich daran, als wäre es gestern gewesen. Die Bar, der Zigarettenqualm, die Collegemädchen am anderen Ende des Tresens, vier junge Dinger, die Pizza aßen und dauernd was zu kichern hatten ... Bekker im apricotfarbenen Mohairsweater. Stand ihm gut, das Ding, betonte sein Gesicht.
»Ich hab’ ihr ein paar reingehauen und sie dann gegen die Wand geschleudert.« Er hatte das nur gesagt, um Eindruck zu schinden. Was auch ein ganz neues Gefühl für ihn war. »Als sie am Boden lag, hab’ ich sie von hinten gepackt, ihr den Arm um den Hals gehebelt und ... krrrks ... das war’s dann. Hat ihr das Genick gebrochen. Hört sich an, wie wenn man in ein Stück Knorpel beißt. Dann hab’ ich mir die Hosen hochgezogen und gesehen, daß ich zur Tür rauskam.«
»Weil du Schiß gehabt hast.«
»Nein. Jedenfalls nicht, nachdem ich draußen war. So was ist ganz einfach. Was wollen die Cops schon machen? Du schiebst ab, und wenn du erst mal um die nächste Ecke bist, haben sie keine Chance mehr. In so einer Gegend kann’s zwei Tage dauern, bis jemand gefunden wird. Und dann auch nur, weil er die Luft verpestet. Nee, Schiß hab’ ich nicht gehabt. Ich bin nur – na ja, ich bin nur ein bißchen schneller gegangen.«
»Mann, das ist ’n Ding.« Bekkers Begeisterung hatte ihm wie Applaus in den Ohren geklungen. Ein schönes Gefühl. Applaus, der nur ihm galt. Beifall für den Solisten. Irgendwie war’s ihm so vorgekommen, als hätte Bekker auch was auf der Pfanne gehabt, auch so eine Art Geständnis, aber er war nicht damit rausgerückt. Hatte nur gefragt: »Hast du’s irgendwann noch mal gemacht?«
»Nein. Es ist ja nicht ... Es macht eben Spaß.«
Und Bekker hatte dagesessen, ihn eine Weile stumm angestarrt und dann lächelnd gesagt: »Eine verdammt gute Story, Carlo. Verdammt gut.«
Viel empfunden hatte er nicht dabei, damals, bei dem Mädchen. So wie er jetzt nicht viel dabei empfand, als er durch den dunklen Windfang schlich und ihr mit jedem Schritt näherkam. Angespannte Konzentration, so was wie Lampenfieber. Aber nichts, was ihn davon abhielt, seinen Job zu erledigen.
Am Ende des Ganges war wieder eine Tür, aus Holz, mit einem Glaseinsatz in Augenhöhe. Falls sie am Tisch zu tun hatte, drehte sie ihm den Rücken zu, hatte Bekker gesagt. Wenn sie sich am Spülbecken, am Herd oder am Kühlschrank aufhielt, konnte sie ihn überhaupt nicht sehen. Die Tür ließ sich so gut wie lautlos öffnen. Aber anschließend durfte er keine Zeit verlieren, weil sie bestimmt den kalten Luftzug spürte.
Was war das für ein Lied? Die melodiöse Stimme hüllte ihn ein, ein faszinierendes Raunen in der Nacht. Langsam näherte er sich dem Glaseinsatz, schielte nach innen. Am Tisch war sie nicht, da sah er nur die beiden Holzstühle. Er packte den Türknauf, schob den rechten Fuß nach vorn, wischte die Gummisohle am linken Hosenbein ab, dann wiederholte er das Ganze mit dem linken Fuß. Falls Kies an den Sohlen der Turnschuhe klebte, hätte das leise Knirschen auf den Fliesen ihn verraten. Die Idee stammte von Bekker, und Druze war der letzte, der gute Tipps in den Wind schlug. Der Türknauf drehte sich millimeterweise, von Druzes Fingerhandschuh geführt. Sobald er drin war, würde der Schließmechanismus die Tür hinter ihm zuziehen. Und sie sang: Tam-ta, Angelina, tam-ta. Good-bye, Angelina, good-bye? Ein schöner Sopran, glockenhell.
Bekker hatte recht gehabt, die Tür bewegte sich geräuschlos. Warmer Hauch schlug ihm entgegen. Spülwasser plätscherte.
Druze schlich sich näher heran. Kein Knirschen auf den Fliesen. Die Tür glitt hinter ihm zu. Vor ihm lag der Frühstückstresen. Weiß gesprenkelte Keramik, eine Kugelvase mit einer kurzstieligen Rose, ein Kaffeegedeck, am anderen Ende eine grüne Flasche. Ein Souvenir aus Mexiko, hatte Bekker gesagt, mundgeblasen, schwer wie Stein und mit einem griffigen, robusten Hals.
Druze ging schneller, ein huschender schwarzer Schatten. Und plötzlich sah er sie, links drüben, an der Spüle. Sie wandte ihm den Rücken zu, sang weiter ihr kleines Lied. Ihr schwarzes Haar fiel locker auf die Schultern, der Morgenrock aus blauer Seide schmiegte sich weich um ihre Hüften. Im letzten Augenblick spürte sie ihn kommen und fuhr herum. Vielleicht hatte sie den Luftzug wahrgenommen oder ein Rascheln gehört.
Irgend etwas stimmte nicht. Ausweichen konnte er nicht mehr, seine Bewegung trug ihn direkt auf Bekkers Frau zu. Und dennoch wußte Druze, daß irgend etwas nicht stimmte.
Ein Mann im Haus. Unter der Dusche. Schon unterwegs nach unten.
Stephanie Bekker fühlte sich kuschelig warm, noch ein wenig feucht, weil sie auch unter der Dusche gewesen war. Zwischen den Schulterblättern hatte sich das Wasser zu einer winzigen Lache gesammelt, grub sich ein Rinnsal am Rückgrat entlang ... Ihre Brustwarzen waren ein bißchen wund, nicht weiter schlimm, aber er hätte sich besser noch mal rasieren sollen ... Sie lächelte vor sich hin. Bist wohl als Baby nicht lange genug gestillt worden, du Nimmersatt?
Sie spürte den Luftzug hinter ihrem Rücken. Ihr Liebster. Sie wollte sich lächelnd zu ihm umdrehen. Aber es war nicht ihr Liebster, der hinter ihr stand. Es war der Tod. »Wer ... wer ...«, stammelte sie. Und glasklar wirbelten Bilder aus der Vergangenheit durch ihren Kopf. All die hoffnungsfrohen Zukunftsträume. Die schönen alten Zeiten an verträumten Seeufern. Der Cockerspaniel, ihr bester Freund in Kindertagen. Das schmerzverzerrte Gesicht ihres Vaters nach der Herzattacke. Der Augenblick, als sie erfahren hatte, daß sie nie Kinder bekommen würde ...
Und ihr Zuhause. Die Fliesen in der Küche. Die alten Orientteppiche, ihr ganzer Stolz. Die handgeschmiedeten Blumenständer. Die Rose in der fein geschwungenen Vase, rot wie Blut ...
Alles vorbei.
Irgend etwas stimmte nicht.
»Wer ...?« Nur das eine, gestammelte Wort. Während sie sich – die Augen fragend aufgerissen, das Lächeln wie festgefroren um die Lippen – halb umdrehte. Über ihr wirbelte die Flasche, ein schwerer Louisville-Kolben aus grünem Glas. Ihre Hand zuckte nach oben. Zu spät. Zu zierlich. Zu schwach.
Die Flasche zerschmetterte ihr die Schläfe. Ein Knacken, nein, fast nur ein feuchtes Knistern. Wie das Geräusch einer zerknüllten, vom Regen triefenden Zeitung, die sich an der Hauswand verfangen hat. Ihr Kopf knickte nach hinten, sie sackte in sich zusammen, als hätten sich ihre Knochen in Luft aufgelöst. Mit dem Hinterkopf schlug sie gegen die Arbeitsplatte. Der heftige Aufprall schleuderte sie nach vorn, riß sie vollends herum. Und so stürzte sie rücklings zu Boden.
Druze warf sich über sie, drückte sie mit seinem Gewicht nieder, stemmte ihr die Hände gegen die Brust, fühlte die Brustwarzen in seinen Handflächen.
Und schlug mit der Flasche zu. Schlug sie ihr ins Gesicht. Ins Gesicht. Immer wieder ins Gesicht ...
Schlug zu, bis das grüne Glas zersplitterte. Hielt kurz inne, sog keuchend die Luft ein, warf den Kopf zurück. Seine Miene verzerrte sich, seine Hand packte den Flaschenhals wie einen Messergriff. Und so stieß er von oben zu und bohrte ihr den Zackenrand in die Augenhöhlen.
»Besorg’s ihr richtig«, hatte Bekker verlangt. Wie ein Trainer, der über Drei-Vierer-Reihen oder rückwärts gestaffelte Verteidigung redet, mit ausholenden Gesten, als wolle er gleich in Begeisterungsschreie ausbrechen. »Nimm sie ran wie ein dreckiger Junkie. O Gott, ich wünschte wirklich, ich könnte dabeisein. Und nimm dir ihre Augen vor. Die Augen, hörst du? Sieh zu, daß du sie da erwischst.«
»Weiß schon, was ich machen muß«, hatte Druze nur gesagt.
Aber Bekker hatte nicht aufgehört zu drängen. »Vor allem die Augen darfst du nicht auslassen.« Halb vertrockneten Speichel im Mundwinkel. Wie immer, wenn ihn die Erregung mitriß. »Nimm dir ihre Augen vor, mir zuliebe.«
Irgend etwas stimmte nicht.
Ein Geräusch, nur ganz kurz, dann war es verstummt. Schon während er auf sie einschlug und ihr die scharfen Splitter der zerbrochenen Flasche in die Augen trieb, war ihm das mit dem Negligé durch den Kopf gegangen. Den dünnen Seidenfetzen hätte sie in einer kalten, windigen Aprilnacht nicht getragen, wenn sie allein im Haus gewesen wäre. Frauen haben ein angeborenes Rollenbewußtsein, ein sicheres Gespür für den Balanceakt zwischen dem, was bequem ist, und dem, was die jeweils gegebene Situation erfordert. So wäre sie, ganz allein im Haus, nicht herumgelaufen.
Er schlug zu, hörte das dumpfe Poltern auf der Treppe und stemmte sich ein Stück hoch. Halb saß er, halb stand er, den Kopf seitwärts gedreht, die Flasche mit der Hand umklammert – der kauernde Golem. Am Fuß der Treppe kam der Mann um die Ecke, ein Badehandtuch um die Hüften geschlungen. Auffallend groß, nicht gerade dick, aber ein bißchen hatte er schon angesetzt. Schütteres blondes Haar, ungekämmt, an den Schläfen noch naß, auf der Brust schon ergraut. Blasse Haut – ein Sonnenanbeter war er nicht, die gerötete Schulterpartie kam vom heißen Duschwasser.
Einen Wimpernschlag lang erstarrte er, murmelte »Oh, mein Gott« und machte blitzschnell kehrt. Druze kam hoch, wollte hinter ihm her, merkte aber, wie es ihm plötzlich die Füße wegzog. Das Blut auf dem Küchenboden war kaum zu sehen, rot auf Rot. Die Beine rutschten ihm weg, er landete rücklings auf Stephanie Bekkers Kopf. Ihre zermalmten Gesichtszüge drückten blutige Spuren auf seine schwarze Jacke. Der andere, ihr Liebhaber, war schon wieder oben. Wenn er sich im Schlafzimmer einschloß ... Es war ein altes Haus mit soliden Eichentüren, da kam Druze nicht so schnell durch. Und vielleicht wählte er jetzt schon die Telefonnummer, die neun-eins-eins ...
Druze ließ die Flasche fallen, rappelte sich hoch, trabte auf die Tür zu. Er war mitten im Windfang, als hinter ihm die Tür zuschlug. Wie ein Schuß. Er zuckte zusammen. Türenknall, hämmerte es beruhigend in seinem Hirn. Trotzdem fing er unwillkürlich zu rennen an. Stampfte durch Tomatenpflanzen. Die Stablampe fand er erst, als der Glastunnel schon hinter ihm lag. Wenigstens rechtzeitig für die dunkle Garage. Sekunden später war er draußen unter den Straßenbäumen. Er zwang sich, langsam auszuschreiten. Geh ganz normal. Ganz normal.
Zehn Sekunden bis zum Bürgersteig. Kragen hoch, dick vermummt. Und er kam zum Wagen, ohne daß er jemanden gesehen hätte, kein Aas. Eine Minute, nachdem er Stephanie Bekker verlassen hatte, rollte der Wagen los.
Halt dich da raus, Mann.
Nicht nachdenken. Alles war bis ins letzte ausgefeilt, alles lief sehr gut. Keine Extratouren, halt dich genau an den Plan. Rund um den See, raus zur France Avenue, Richtung Highway 12, zurück zum Kreisel, auf die I-94 und dann runter nach St. Paul.
So, jetzt konnte er nachdenken.
Er hat mein Gesicht gesehen. Was war das überhaupt für ein Arsch? Rosig und rund. Und so erschrocken, daß er sich bald in die Hose gemacht hätte. Druze klatschte vor Ärger die flache Hand aufs Lenkrad. Wie konnte das passieren? Bekker ist so ein ausgekochter Hund, und trotzdem ...
Allein fand er nie raus, wer der Kerl mit dem Badehandtuch gewesen war. Aber Bekker wußte es vielleicht. Oder konnte sich’s wenigstens vorstellen. Druze warf einen Blick auf die Autouhr: 10:40. Noch zehn Minuten bis zum vereinbarten Anruf.
Er nahm die nächste Ausfahrt, hielt am Super-America-Store und griff nach dem Beutel mit den Vierteldollarmünzen, den er vor dem Beifahrersitz abgelegt hatte. Damit die Dinger ihm nicht lose in der Tasche rumklimperten, während er durchs Haus schlich. An der Frontseite war ein öffentliches Telefon angebracht. Druze bohrte sich den Zeigefinger ins Ohr, um es gegen den Straßenlärm abzuschirmen, und wählte eine Nummer in San Francisco, auch ein Münztelefon. Die Stimme vom Band forderte ihn auf, Quarters einzuwerfen. Druze fütterte den Schlitz. Es läutete durch. Und drüben an der Westküste meldete sich Bekker.
»Ja?«
Druze sollte eigentlich auch nur ja sagen. Oder nein, je nachdem. So war es vereinbart. Statt dessen sagte er: »Da war auf einmal ein Kerl da.«
»Was?« So verdutzt hatte er Bekker noch nie gehört.
»Sie hatte mit einem rumgefickt. Ich war gerade mit ihr fertig, da kam der Knilch die Treppe runter. Hatte nur ’n Handtuch um.«
»Was?« Nein, nicht nur verdutzt. Sprachlos war er.
»Komm zu dir, zur Hölle noch mal! Und frag nicht dauernd so dämlich ›was?‹. Wir haben ein Problem am Hals.«
»Was ist ... mit der Frau?« Na also. Er beruhigte sich allmählich. Dachte sogar daran, keine Namen zu nennen.
»Was die betrifft: ja. Kannste groß schreiben. Aber der Arsch hat mich gesehen. Nur ’ne Sekunde. Und ich hatte den Anorak an und die Mütze auf. Aber bei meinem Gesicht ... Keine Ahnung, wieviel er erkennen konnte.«
Schweigen, einen langen Atemzug lang. Dann sagte Bekker: »Darüber können wir jetzt nicht reden. Ich ruf’ dich an. Heute Nacht noch oder morgen, je nachdem wie sich das weiter entwickelt. Das mit der Frau – da bist du ganz sicher?«
»Ja doch. Positiv.«
»Dann ist das wenigstens erledigt.« Bekker hörte sich zufrieden an. »Über die andere Sache denke ich nach.«
Und weg war er.
Als er wieder losfuhr, summte Druze verbissen die ersten Takte vor sich hin: Tam-ta, Angelina, good-bye, Angelina ... Nein, ganz falsch. Die verdammte Melodie ging ihm bestimmt nicht mehr aus dem Sinn, bis er sie drauf hatte. Tamta-ta, Angelina. Vielleicht am besten, wenn er beim Sender anrief und bat, daß sie das Lied für ihn spielten. Machte einen ja wahnsinnig, dauernd daran rumzupusseln.
Er lenkte den Wagen auf die Interstate 94, nahm die Abzweigung zum Highway 280, weiter auf die I-35-West, zur I-694. Und hielt sich Richtung Westen. Fuhr schnell, zu schnell. Hin und wieder brauchte er das, um sich innerlich abzukühlen. Es gefiel ihm, wenn der Wind durch einen Spalt im Seitenfenster pfiff. Und im Radio die Oldie-Goldies dudelten. Tam-ta ...
Auf der Rückseite des Anoraks trocknete Stephanie Bekkers blutige Totenmaske. Praktisch nichts mehr zu sehen. Und Druze wußte sowieso nichts von den verräterischen Spuren.
Stephanie Bekkers Liebhaber hatte, als er sich vor der Dusche abtrocknete, ein seltsames Plumpsen gehört. Es klang nicht normal, irgendwie arhythmisch, nach Gewalt. Aber an die Möglichkeit, daß sie das Opfer eines Überfalls sein und in diesem Augenblick auf dem Küchenfußboden sterben könnte, hatte er nicht den Bruchteil einer Sekunde gedacht. Vielleicht rückte sie einen von ihren schweren antiken Lehnstühlen in eine andere Ecke. Oder eine Schublade klemmte, und sie hämmerte mit der Faust auf die Arbeitsplatte. Weiß Gott, was ihm im ersten Augenblick durch den Kopf gegangen war.
Er band sich ein Handtuch um und ging nach unten, um nach dem Rechten zu sehen. Und platzte in einen wahr gewordenen Alptraum hinein. Ein Mann mit der Fratze einer Mißgeburt kauerte über Stephanie, hielt den Flaschenhals wie einen Dolch, die Zacken an der Bruchstelle waren voller Blut. Und ihr Gesicht ... Was hatte er vorhin im Bett zu ihr gesagt, vor kaum einer Stunde? Du bist wunderschön, hatte er gesagt. Oder vielmehr gemurmelt, ein bißchen verlegen. Und ihr zärtlich mit den Fingerspitzen die Lippen gestreichelt. So verführerisch schön ...
Und nun hatte er sie auf dem Boden liegen sehen. Hatte auf dem Absatz kehrtgemacht und war nach oben gerannt. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Das war’s, was die eine Stimme in ihm sagte. Aber da gab es noch eine zweite Stimme, die versteckt in seinem Hinterkopf nistete und hartnäckig wiederholte: Du feiger Hund.
Zitternd vor Angst rannte er die Stufen hinauf und konnte die Schlafzimmertür gar nicht schnell genug hinter sich zuschlagen und verriegeln. Sich abriegeln gegen den Horror dort unten. Als er hörte, wie der Kerl durch den Windfang rannte, griff er zum Telefon und drückte die ersten Tasten, die Neun und eine Eins. Doch dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er zog den Finger weg. Lauschte. Keine Nachbarn, niemand schrie durch die Nacht. Keine Polizeisirene. Nichts. Er starrte das Telefon an, legte den Hörer auf. Denn vielleicht ...
Er zog die Hose an.
Schlug mit der Faust gegen die Türfüllung. Wartete darauf, daß draußen einer die Schulter gegen die Tür rammte. Nichts. Er stieg die Treppe hinunter, barfuß, lautlos. Nichts. Ging zögernd in die Küche. Da lag sie, Stephanie, rücklings hingestreckt, mit gespreizten Gliedern. Keiner konnte ihr mehr helfen. Ihr Gesicht war zermalmt, ihr Kopf nur noch eine unförmige Masse, ringsum auf den Fliesen eine Blutlache. Der Mörder war hineingetreten, hatte eine Spur hinterlassen, die Spur von einem Turnschuh, Absatz und Ballen. Eine Spur, die zur Tür führte.
Stephanie Bekkers Liebhaber bückte sich. Er wollte ihr den Finger auf die Halsschlagader legen, den Puls fühlen. Aber im letzten Augenblick zuckte er zurück. Stephanie war tot. Und er sah im Geiste die Cops draußen vor dem Haus, sah sie näherkommen, sah sie schon nach der Tür langen. Sie würden ihn hier finden, über die Leiche gebeugt wie der große Unbekannte in einem Perry-Mason-Film. Und ihn am Schlafittchen packen, weil sie ihn für den Mörder hielten.
Er drehte sich um. Starrte auf die Haustür. Nichts. Da draußen rührte sich nichts.
Er eilte die Stufen hoch, seine Gedanken überschlugen sich. Stephanie hatte niemandem etwas über ihre Affäre erzählt, das hatte sie ihm hoch und heilig versichert. Die Leute, mit denen sie befreundet war, kamen aus Universitätskreisen, aus der Kunstszene, wohnten in der Nachbarschaft. Wenn man da auch nur ein Sterbenswörtchen über eine Beziehung verlauten ließ, schlug der Klatsch bald hohe Wellen. Das wußten sie beide. Und sie wußten, daß es das gesellschaftliche Aus für sie gewesen wäre.
Der Skandal hätte ihn die Stellung gekostet. Und bei Stephanie war es vor allem die Angst vor ihrem Mann. Weiß der Himmel, wie der reagiert hätte. Das Ganze war eine Riesendummheit. Aber nachdem sie sich einmal darauf eingelassen hatten, wollten und konnten sie nicht mehr Schluß machen. Seine Ehe siechte sowieso nur noch dahin. Und ihre war schon lange tot.
Er schluchzte. Nahm sich zusammen. Schluchzte wieder. Richtig geweint hatte er zum letzten Mal als Kind, und nun konnte er nicht mehr weinen. Nur trockenes Keuchen schüttelte seine Brust. Kummer, Wut, Angst. Reiß dich zusammen. Er begann sich anzuziehen, war gerade bei den Hemdknöpfen, als sein Magen rebellierte. Er stürzte ins Bad, mußte sich übergeben.
Kniete minutenlang vor der Toilette und würgte, bis ihm die Tränen kamen. Als der Krampf endlich vorbei war, stemmte er sich hoch und zog sich weiter an. Bis auf die Schuhe, weil ihm einfiel, daß er möglichst jedes Geräusch vermeiden mußte.
Er überzeugte sich, daß er auch wirklich nichts vergessen hatte. Brieftasche, Schlüsselbund, Taschentuch, Kleingeld, Krawatte, Jackett, Mantel und Handschuhe. Er setzte sich aufs Bett, zwang sich, gründlich nachzudenken, wo er überall gewesen war. Was er angefaßt hatte. Den Knauf an der Haustür. Den Küchentisch. Den Teller und den Löffel, als er den Kirschauflauf gegessen hatte. Den Türgriff im Schlafzimmer und im Bad. Die Wasserhähne. Den Klodeckel.
Er nahm einen von Stephanies Baumwollschlüpfern aus der Kommode, ging nach unten, fing mit der Haustür an, arbeitete sich systematisch weiter durchs Haus. In der Küche vermied er krampfhaft, dahin zu schauen, wo sie lag. Aber aus den Augenwinkeln nahm er doch immer irgend etwas wahr, ein Bein, einen Arm ... Weil er ja nicht ganz wegschauen konnte, sondern einen Bogen um die Blutlache schlagen mußte.
Schlafzimmer und Bad. Als er die Dusche auswischte, fiel ihm der Abfluß ein. Körperhaare. Er lauschte. Alles ruhig. Soviel Zeit muß sein. Der Stöpsel war festgeschraubt. Er löste die Schraube mit einer Münze, langte mit einem Bausch Toilettenpapier so tief wie möglich in den Abfluß, hielt anschließend den Strahl der Dusche darüber. Das Papier warf er ins Klo, zog zweimal die Spülung. Körperhaar ... das Bett. Auf dem Weg ins Schlafzimmer merkte er, daß es ihn schon wieder schüttelte. Pure Verzweiflung. Bestimmt vergaß er irgendwas. Er zog die Laken ab, warf sie auf den Boden, suchte frische Bettwäsche. Fünf Minuten brauchte er, bis beide Betten frisch bezogen waren und die Kissen und Bettdecken ordentlich aufgeschüttelt dalagen. Er wischte über den Nachttisch und die Buchablage am Kopfende, stand da, sah sich um.
Genug.
Er rollte den Schlüpfer in die abgezogenen Laken, zog sich die Schuhe an und ging, das Bündel Bettwäsche unter dem Arm, nach unten. Schnell noch ein Blick in die Diele, ins Wohnzimmer, in die Küche. Seine Augen huschten über Stephanie.
Fertig, es gab nichts mehr zu tun. Er zog den Mantel über und stopfte sich das Bündel Bettlaken vor den Bauch. Normalerweise zeichnete sich da nur der übliche Hüftspeck ab, jetzt sah er aus wie einer, der einen Kugelbauch vor sich herschiebt. Gar nicht schlecht, falls ihn jemand sah.
Er zog die Haustür hinter sich zu, überquerte den Vorplatz, trat auf die Straße und ging an der Häuserzeile entlang. Vorbei an vielen Häusern bis dahin, wo sein Wagen stand. Sie hatten immer auf Diskretion geachtet, vielleicht zahlte sich das jetzt aus. Die Nacht war kalt. Schneegestöber. Und keine Menschenseele begegnete ihm.
Er fuhr den Hügel hinunter, rund um den See, bog in die Hennepin Avenue ab und entdeckte ein Münztelefon. Er hielt an. Streifte sich den Baumwollschlüpfer über die Finger, bevor er den Quarter anfaßte. Und kam sich ein wenig wie ein heimlichtuerischer Narr vor, als er den Schlüpfer um die Sprechmuschel wickelte, ehe er sagte, was er zu sagen hatte.
»Eine Frau ist ermordet worden ...«
Er sagte noch, daß sie Stephanie Bekker hieß, und nannte die Adresse. Und als der Mann in der Einsatzzentrale ihn bat, er solle dranbleiben, hängte er ein, wischte sorgfältig den Hörer ab und ging zum Wagen zurück. Nein. Er ging nicht, er schlich. Verstohlen wie eine Ratte. Weil sie ihm ja doch nicht geglaubt hätten. Er legte die Stirn aufs Lenkrad, schloß die Augen. Und obwohl er sich innerlich dagegen wehrte, fing er an, seine Chancen durchzurechnen.
Der Mörder hatte ihn gesehen. Und er war bestimmt kein Junkie gewesen. Oder einer von den Scheißkerlen, die sich ein Zufallsopfer suchten, irgendwann zwischen Mitternacht und Morgengrauen. Er hatte kräftig ausgesehen, gut im Futter. Und wie einer, der genau weiß, was er tut. Einer, dem durchaus zuzutrauen war, daß er ihn nicht so ohne weiteres laufen ließ.
Ihm wurde klar, daß es ein Fehler gewesen war, der Polizei nicht mehr zu sagen. Jetzt konzentrierten sie sich womöglich auf ihn, Stephanies Liebhaber. Er hätte sie auf die Spur des Mörders führen müssen. Daß Stephanie Geschlechtsverkehr gehabt hatte, würden sie bald herausfinden. Der amtliche Leichenbeschauer stellte das schnell fest.
Mein Gott, hatte sie sich gewaschen? Ja, natürlich. Aber auch gründlich genug? Oder fanden sie noch genug Samenspuren für eine DNA-Bestimmung?
Da war nun auch nichts mehr zu machen. Aber er konnte der Polizei Hinweise geben, die ihnen vielleicht halfen, den Mörder zu finden. Eine schriftliche Erklärung, die er so lange fotokopieren mußte, mal heller, mal dunkler eingestellt, bis sämtliche Merkmale, die Rückschlüsse auf den Schreibmaschinentyp zuließen, ausreichend verwischt waren.
Aus der Nacht tauchte Stephanies Gesicht vor ihm auf.
Eben hatte er noch gegrübelt, und plötzlich sah er sie vor sich. Den Kopf zur Seite gedreht, die Augen geschlossen, friedlich im Schlaf. Und er verrannte sich in den Gedanken, er müsse nur zurückgehen, um sie in der Tür stehen zu sehen und zu wissen, daß alles nur ein schrecklicher Traum gewesen war.
Wieder schüttelte ihn trockenes Schluchzen.
Und wie er so dasaß, fiel ihm, Stephanies Liebhaber, ein Name ein. Bekker? Hatte er ihr das angetan? Er ließ den Motor an.
Bekker.
Kein menschliches Wesen, das da über den Küchenfußboden kroch. Leere Höhlen, wo die Augen gewesen waren. Die Hirnschale eingeschlagen. Alles voller Blut. Kein menschliches Wesen. Nur ein Lebewesen. Und es hatte ein Ziel: das Telefon. Denn es gab nichts anderes mehr. Nicht den Mann, der über sie hergefallen war. Nicht ihren Liebsten. Nicht mal Zeit blieb ihr. Es gab nur den Schmerz und die glatten Fliesen und irgendwo das Telefon.
Das Lebewesen schleppte sich bis zur Wand, an der das Telefon hing. Reckte sich. Reckte sich höher ... und schaffte es nicht. Als die Männer vom Rettungsdienst kamen, als Glas splitterte und die Feuerwehrleute ins Haus eindrangen, starb das Wesen.
Das Bündel geschundenes Fleisch, das einst Stephanie Bekker gewesen war, hörte noch jemanden »Gott im Himmel« sagen, dann existierte es nicht mehr. Der blutige Abdruck einer Hand, fünfzehn Zentimeter unter dem Wandtelefon, war alles, was von ihm blieb.
Kapitel 2
Del war ziemlich groß, ziemlich knorrig und ziemlich ungehobelt. Er lümmelte die Beine auf die halbrunde Bank in der Sitznische und zeigte, als ihm die Jeans über die Knöchel rutschten, seine braunen Lederschuhe. Ausgelatscht, dreckig, mit altmodischen Hakenösen. Schuhe wie die eines hergelaufenen Bauernburschen, fand Lucas.
Er trank den Rest Cola-light und schielte zur Tür. Nichts.
»Die Pißnelke läßt sich Zeit«, meinte Del. Die Farbe seines Gesichts wechselte von Gelb zu Rot, im Rhythmus der Budweiser-Leuchtreklame im Fenster.
»Der wird schon kommen.« Lucas warf dem Barmann einen Blick zu, deutete auf seine Cola-Dose. Der nickte, bückte sich, griff in den Kühlschrank. Ein Fettwanst mit einer senffarbenen Schürze vor dem Bauch. Kam angewatschelt wie eine schwangere Ente.
»Macht ’nen Buck«, grunzte er, und Lucas gab ihm eine Dollarnote. Der Dicke musterte die beiden Männer, sah im ersten Augenblick aus, als hätte er eine Frage auf den Lippen, im zweiten, als hätte er sie runtergeschluckt, und steuerte wieder seinen Platz hinter dem Tresen an.
Es lag, wie Lucas die Situation beurteilte, nicht etwa daran, daß sie nicht hierher gepaßt hätten. Was den Barkeeper an Del und ihm stutzig machte, war wohl eher die uralte Frage, ob und wie Topf und Deckel zusammenpassen.
Del war in Jeansblau, oben und unten, dazu ein mausgraues Sweatshirt, bei dem hinten der Einnäher rausguckte, ein Stirnband in verschlungenen Farben, offenbar ein zweckentfremdeter Schlips, und die derben braunen Treter. Lucas trug einen ledernen Fliegerblouson über einem Kaschmirsweater, khakifarbene Freizeithosen und Cowboystiefel. Sein dunkles Haar fiel locker nach vorn, sein Gesicht war kantig, hart geschnitten und – jetzt, nach den langen Wintermonaten – auffallend blaß. Fast so blaß wie die Narbe, die sich von der Augenbraue bis zur Wange zog und besonders gut zu sehen war, wenn er mit den Zähnen mahlte. Dann wurde sie zu einem weißen Strich.
Ihre Sitznische lag am Fenster, das mit einer Silberfolie überzogen war, so daß man von drinnen nach draußen sehen konnte, aber nicht umgekehrt. Wo immer die Gitter der Klimaanlage Platz ließen, standen Blumenkästen mit Plastikpetunien auf der Fensterbank. Daß es so aussah, als wäre die falsche Blütenpracht in ein merkwürdiges, irgendwie an Katzenstreu erinnerndes Granulat gebettet, lag an Del. Er schob sich alle paar Minuten einen Kaugummi zwischen die Zähne und deponierte das ausgekaute Gummi unter den Plastikblumen. Und das immerhin schon seit einer geschlagenen Stunde.
»Der kommt bestimmt«, wiederholte Lucas, hörte sich aber nicht so an, als wäre er sicher. »Bleibt ihm gar nichts anderes übrig.«
Donnerstagabend, prasselnde Regenschauer, in der Bar war so gut wie nichts los. Drei Huren, zwei schwarze und eine weiße, saßen dichtgedrängt auf ihren Barhockern, tranken Bier und blätterten gemeinsam ein Mirabella-Magazin durch. Die bonbonfarbenen Regenmäntel aus durchsichtigem Vinyl hatten sie sich wie Sitzkissen untergeschoben. Nutten sind immer auf dem Sprung und trennen sich nicht gern von ihrem Regenschutz.
Hinten am Tresen saß eine Weiße, ganz allein. Sie hatte blondes gekräuseltes Haar, wäßrig grüne Augen und einen Mund wie ein breiter dünner Strich, der ununterbrochen zuckte und zitterte. Die Schultern hielt sie nach vorn gebeugt, als erwarte sie jeden Augenblick einen Schlag ins Genick. Auch eine Hure. Eine, die den Gin in sich reinkippte wie ein Kesselflickerweib.
Die Männer, die in der Bar herumlungerten, interessierten sich nicht für die Nutten. Zwei Typen – an ihren tarnfarbenen Hüten, mehr noch an der ledernen Klappmesserscheide, die dem einen am Gürtel baumelte, leicht als Shitdealer auszumachen – spielten Tischbowling. Zwei andere, die aussahen, als wären sie in der Nachbarschaft zu Hause, unterhielten sich am Tresen mit dem Barkeeper. Und dann saß da noch ein verdrossener Alter herum, vor sich ein Glas Roggenwhisky und eine Schüssel mit Erdnüssen. Er futterte die Dinger weg, als sollten sie ihn für den Rest seines Lebens satt machen. Dabei hatte er eine feste Prozedur entwickelt: ein Schluck Whisky, ein Häufchen Erdnüsse, danach ein paar Sekunden wütendes Gebrabbel unter den Aufschlägen seines Überziehers. Die restliche Kundschaft, ein halbes Dutzend Männer und eine Frau, saßen – locker im Gewirr aus altersschwachen Stühlen und Tischen mit Brandflecken verteilt und halb von dicken Schwaden aus Zigarettenqualm eingehüllt – im offenen Nebenraum hinter dem Tresen und verfolgten ein Baseball-Endspiel im Fernsehen.
»Viel Gescheites haben die in letzter Zeit im Fernsehen nicht gebracht«, sagte Lucas. Eigentlich nur, damit ihre Unterhaltung in Gang kam. Denn Del druckste offensichtlich schon den ganzen Abend an irgend etwas herum, war aber bis jetzt noch nicht damit rausgerückt.
»Das reißt sowieso keinen mehr vom Hocker«, sagte Del. »Heutzutage sind alle auf anderes Zeug aus. Soll, hab’ ich gehört, Schnee heißen und von der Westküste kommen.«
»Verdammter Schnee«, murmelte Lucas kopfschüttelnd.
Sein Blick fiel aufs Fenster, hakte sich am eigenen Spiegelbild fest. Gar nicht so schlecht, fand er. Weil man da weder die grauen Strähnen sah, die sich ins dunkle Haar mogelten, noch die tiefen Ringe unter den Augen oder die Furchen, die sich allmählich links und rechts der Nase bis runter zu den Mundwinkeln gruben. Vielleicht sollte er sich so ein Stück Glas mit Silberfolie als Rasierspiegel anschaffen.
Del deutete mit dem Kopf auf die betrunkene Nutte am Ende des Tresens. »Wenn er uns noch länger warten läßt, mußt du, glaub’ ich, der Mieze was nachschieben.« Lucas hatte ihr einen Zwanziger zugesteckt, mehr als ein Häufchen Kleingeld war davon nicht mehr übrig.
»Er kommt«, behauptete Lucas stur. »Der Nacktarsch hält sich doch für den Größten.«
Del grinste. »Randy? Davon kann er lange träumen.«
Lucas blieb dabei. »Wirst schon sehen. Der läßt sie nicht ungeschoren hier rumsitzen.«
Die Nutte war der Lockvogel. Del hatte sie vor zwei Tagen in ihrem Revier im Südteil von St. Paul aufgestöbert und ihr eine uralte Geschichte unter die Nase gerieben, Ladendiebstahl in Minneapolis oder so was. Und Lucas hatte das Gerücht ausgestreut, daß Randy mit gepanschtem Koks dealte und daß sie ihn verpfiffen hätte. Tatsächlich steckte eine ganz andere Geschichte dahinter. Einer von Lucas’ Flüstertüten war das Gesicht zerfetzt worden. Randy hatte es getan, und die Nutte hatte ihn dabei beobachtet.
»Schreibst du eigentlich immer noch Gedichte?« fragte Del nach einer Weile.
»Gelegentlich wäre schon zuviel gesagt«, antwortete Lucas.
Del zog eine Grimasse. »Hättest weitermachen sollen.«
Lucas starrte auf die Plastikblumen. »Werd’ allmählich zu alt dazu.« Es klang wehmütig. »Wer Gedichte schreiben will, muß jung genug sein. Oder einfältig genug.«
»Na, hör mal, du bist drei, vier Jahre jünger als ich.«
»Trotzdem, der Lack ist ab!« sagte Lucas. Der spaßige Unterton, der ihm eigentlich vorgeschwebt hatte, gelang ihm nicht so recht.
Del nickte grimmig. »Alles klar.« Er wußte selber am besten, warum er so ausgemergelt aussah. Er kam nun mal ohne Speed nicht mehr aus, hin und wieder mußte es auch eine Portion Charly sein. Berufskrankheit. Und wer einmal genascht hat, kommt nie wieder ganz los. Bloß, bei Del ... Wenn es irgendwas gab, was sein Gesicht prägte, dann waren es die Tränensäcke. Auch an den Haaren sah man’s: borstig, schmuddelig. Weil er sich gehenließ. Wie eine räudige Straßenkatze, die instinktiv spürt, daß sie’s nicht mehr lange macht. »Steckt an, wenn man dauernd mit solchen Arschlöchern zu tun hat.«
»Wie oft hatten wir das Thema schon am Wickel?«
»So um die hundert Mal«, sagte Del, aber ehe er weiterreden konnte, brandete hinten im Fernsehraum begeisterter Jubel auf, und eine Männerstimme dröhnte: »Habt ihr gesehen, wie’s den Nigger umgehauen hat?« Eine von den schwarzen Nutten am Tresen sah hoch, ihre Augen verengten sich, doch dann schluckte sie ihren Kommentar herunter und vertiefte sich wieder in ihr Magazin.
Del machte dem Barkeeper ein Zeichen. »Zwei Bier. Leinies, wenn’s geht.«
Der Dicke nickte, und Lucas vermutete: »Du glaubst nicht mehr dran, daß Randy kommt?«
»Wenn, dann dauert’s«, meinte Del. »Und noch so ’n Coke, und ich brauch’ ’ne Blasentransplantation.«
Das Bier kam. Del fing ganz beiläufig an. »Hast du von dem Mord oben auf dem Hügel gehört? Gestern. Die Frau, die einer in ihrer Küche totgeschlagen hat?«
Lucas nickte. Das war’s also, was Del schon die ganze Zeit loswerden wollte. »Mhm. Hab’s in den Nachrichten gesehen. Und in der Dienststelle wurde auch darüber geredet.«
»Sie war meine Kusine.« Del schloß die Augen. Ließ den Kopf in den Nacken fallen. Sah auf einmal leergebrannt aus. »Wir sind zusammen aufgewachsen. Haben uns immer unten am Fluß rumgetrieben. Bei ihr hab’ ich zum ersten Mal nackte Titten gesehen, in natura, mein’ ich.«
Lucas musterte ihn. »Deine Kusine?« Cops machten gewöhnlich ihre Witzchen über den Tod. Je grausamer der Tod, desto rüder die Scherze. So was wie ein innerer Blitzableiter. Man mußte sich gehörig am Riemen reißen, wenn es Verwandte betraf.
»Haben Karpfen geangelt – Mann, kannst du dir das vorstellen?« Del schwang herum, lehnte den Kopf an die Fensterbank. Verklärte Vergangenheit. Sein bärtiges Gesicht floß in die Länge. Es hatte, fand Lucas, Ähnlichkeit mit einem der alten Fotos: James Longstreet nach der Schlacht bei Gettysburg. »Drüben am Ford-Damm, nicht weit von deiner Ecke. Zweige als Angelruten, Nylonfäden dran und Mehlklößchen als Köder. Sie klettert auf den Felsen rum, rutscht auf nassem Moos aus, landet im Wasser ...«
»Geht schnell, wenn man nicht aufpaßt.«
»Sie war – na, so fünfzehn. Hat ’n T-Shirt angehabt, nichts drunter«, erzählte Del. »Und wie sie wieder rauskommt, klebt ihr das Ding auf der Haut. Du, sag’ ich, ich kann sowieso alles sehen, kannst den Fummel auch ausziehen. War nicht ernst gemeint, aber sie hat’s gemacht. Mann, sie hatte Nippel ... Wie Buschröschen, dasselbe zarte Pink. Ich bin wochenlang mit ’nem Steifen rumgelaufen, sag’ ich dir. Stephanie hieß sie.«
Lucas sagte lange nichts, studierte nur Dels Gesicht. Schließlich fragte er: »Bist du für den Fall eingeteilt?«
Del hob mit einer hilflosen Bewegung die Hände. »Nee. Sowas liegt mir nicht, hab’ keine Spürnase. Ich war heute den ganzen Tag bei meiner Tante und meinem Onkel. Die sind fix und fertig. Können einfach nicht kapieren, daß ich auch nichts machen kann.«
Lucas fragte: »Was denn machen? Was erwarten sie denn?«
»Daß ich ihren Mann festnehme. Er ist Arzt an der Uni-Klinik, Pathologe.« Del nahm einen Schluck Bier. »Michael Bekker.«
»Stephanie Bekker?« Lucas runzelte die Stirn. »Kommt mir irgendwie bekannt vor.«
»Ja, sie war in der Politik aktiv. War vor ’n paar Jahren in der Arbeitsgruppe für Bürgerrechtsfragen, da hast du vielleicht mal von ihr gehört. Aber der springende Punkt ist, daß ihr Alter zur Tatzeit in San Francisco war.«
»Und damit aus allem raus ist«, sagte Lucas.
»Dahinterstecken kann er trotzdem.« Del beugte sich vor. »Mir ist das Alibi zu glatt. Und wenn du mich fragst, der hat irgendwo ’n Sprung in der Schüssel.«
»Was willst du damit sagen?«
»Bekker hat ’n Knacks weg. Ich sag’ ja nicht, daß er’s war, der sie umgebracht hat. Aber er hätt’s gut sein können.« Am Tresen schob einer dem Keeper eine Handvoll Scheine hin, murmelte was von »Wir rechnen später ab«. Und verschwand mit drei Gläsern Bier nach hinten, wo der Fernseher lief.
»Hätte er denn ein Motiv gehabt?« wollte Lucas wissen.
Del zuckte die Achseln. »Das übliche. Geld. Er hält sich für ’n As und kann nicht kapieren, warum er’s zu nichts bringt.«
»Zu nichts bringt? Ich denke, er ist Arzt?«
»Du weißt, was ich meine. Arzt – da müßte er im Geld schwimmen. Aber er ist bei der Uni angestellt. Siebzig-, achtzigtausend im Jahr. Pathologen sind nicht so gefragt.«
»Mhm.«
Draußen vor dem Einwegfenster blieb ein Pärchen stehen, eng unter dem Regenschirm aneinandergekuschelt. Glaubten sich unbeobachtet und steckten sich einen Joint an. An der Ecke machten sie noch mal halt, diesmal offenbar, weil er sich für den Wagen interessierte, der dort parkte. Lucas’ Porsche.
»Braucht eben jeder seine Vitamine«, meinte Del.
Lucas wandte ihm den Kopf zu. »In der Dienststelle hieß es ... Da soll ein Kerl bei deiner Cousine gewesen sein?«
Del legte die Stirn in Falten. »Ja, hat uns auch überrascht. Es war einer da. Sie haben gebumst, sagt der Polizeiarzt. Eine Vergewaltigung war’s nicht. Und dann hat auch noch einer nachts angerufen und den Mord gemeldet.«
»Streit nach einem Schäferstündchen?«
»Glaub’ ich nicht. Der Mörder kam anscheinend durch die Hintertür und ist, nachdem er sie umgebracht hat, auf demselben Weg wieder verschwunden. Sie hat an der Spüle gestanden. Die Jungens haben Spuren von Spülmittel gefunden, im Becken und an ihren Händen. Kein Hinweis, daß sie sich gewehrt hat. Hatte wahrscheinlich gar keine Gelegenheit dazu. Sie spült Geschirr ab – und bong.«
»Hört sich nicht nach Streit mit ihrem Macker an.«
»Nein. Und einer von der Mordkommission fand’s komisch, daß der Mörder ... Ich meine, wenn wir mal davon ausgehen, daß es nicht ihr Loverboy war, wie kann der Kerl dann so dicht rankommen, ohne daß sie was hört? Hat sich rausgestellt, daß die Türangeln ziemlich frisch geölt waren. Muß vor ’n paar Wochen passiert sein.«
»Aha. Bekker.«
»Ja. Aber viel gibt das natürlich nicht her.«
Lucas ging alles noch mal in Gedanken durch. Ein plötzlicher Regenschauer trommelte gegen die Scheibe. Doch so schnell, wie der Spuk begonnen hatte, war er auch wieder vorbei. Eine Frau mit einem roten Schirm stemmte sich gegen den Wind.
»Hör zu«, sagte Del, »ich erzähl’ dir den ganzen Scheiß nicht zum Spaß. Ich hab’ gehofft, du kümmerst dich drum.«
»Ach, Mann ... Mit Mord hab’ ich nicht viel am Hut. Und ...« Eine fahrige, verlegene Handbewegung. »Und besonders erfolgreich war ich in letzter Zeit auch nicht gerade.«
»Das ist was anderes. Du brauchst einen interessanten Fall, daran liegt’s.« Dels ausgestreckter Zeigefinger zielte auf Lucas’ Gesicht. »Du bist verdammt beschissen drauf, weißt du das? Beschissener als ich. Und das will was heißen.«
»Danke«, murmelte Lucas. Und als er gerade zu einer Frage ansetzen wollte, tauchten draußen vor dem Fenster zwei Gestalten auf. Eine junge Kaffeebraune im lohfarbenen Trenchcoat, mit einem farblich abgestimmten, breitkrempigen Hut. Neben ihr ein Weißer, so ein blasses Bürschchen mit einem Tirolerhut.
Lucas fuhr hoch. »Randy.«
Del guckte raus, packte Lucas am Arm. »Bleib ganz ruhig, ja?«
Lucas hatte auf einmal Kies auf den Stimmbändern. »Sie war meine beste Informantin. Fast so was wie ’ne Freundin.«
»Hühnerkacke. Behalt die Nerven.«
»Warte, bis er drin ist. Dann gehst du auf ihn zu. Ich halt’ mich hinter dir, mich erkennt er auf Anhieb.«
Randy kam als erster herein, die Hände tief in den Manteltaschen. Einen Augenblick blieb er stehen, posierte wie ein Gockel. Aber keiner beachtete ihn. Zwölf Sekunden vor Spielende. Die Celtics lagen um einen Punkt zurück, hatten den Ball. Alle starrten auf den Bildschirm, außer der Nutte, die zuviel Gin in sich reingekippt hatte, und dem alten Knotterer, der seine Erdnüsse futterte und Gott weiß was in den Überzieher brabbelte.
Die Kaffeebraune kam nach, schloß die Tür hinter sich.
Lucas drückte sich hinter Del aus der Sitznische, sah ihm über die Schulter. Sagenhaft, die Kleine, dachte er, bevor der den Kopf einzog. Warum hängt die sich bloß an so ein Stück Scheiße?
Randy Whitcomb war siebzehn und ein eingebildeter Typ. Hatte immer eine Kanone und ein Messer dabei. Und manchmal sah man ihn mit einem Gehstock aus Schlehenholz herumflanieren, die Hand auf den Goldknauf gestützt. Längliches Gesicht, mit Sommersprossen gepflastert. Rotes, borstiges Haar. Die beiden mittleren Schneidezähne gespreizt wie bei einem Biber. Er schüttelte sich wie ein Köter, sein Tweedmantel – für den er zu jung, zu mickrig und zu dämlich war – sprühte Tropfen nach allen Seiten. Ging zur Bar, auf die betrunkene Nutte zu, baute sich auf, wartete, daß sie hochsah. Tat sie aber nicht. Seine Hand kam mit einem Dosenöffner aus der Manteltasche, den ließ er über den Tresen schlittern, mitten in den Stapel Münzen, der vor ihr lag.
»Marie ...« Wie leises Locken. Aber mit einem Unterton, der den Barkeeper aufhorchen ließ. Del und Lucas rückten näher. Randy sah gar nicht hin, fixierte nur die Hure. Und flötete zuckersüß: »Marie-Baby, ich höre, du hast den Bullen was gesungen...«
Marie machte Anstalten, vom Hocker zu klettern. Mit huschenden Augen, die Lucas suchten. Der Barhocker kippte nach hinten, sie wollte sich am Tresen festhalten, wippte sekundenlang wie auf einer Schaukel. Und Randy schlenderte mit wiegenden Schritten auf sie zu. Ahnte nicht, daß Lucas hinter ihm war. Bis ihn ein Faustschlag in den Rücken traf und hart gegen den Tresen prallen ließ.
»He, he«, machte der Barkeeper. Und im selben Moment, als Glas splitterte und Marie endgültig nach hinten kippte, hatte Del die Dienstmarke in der Hand.
»Polizei«, rief er, »jeder bleibt, wo er ist.« Er zog einen kurzläufigen schwarzen Revolver aus dem Hüftholster, brachte ihn vor sich in Anschlag, hoch genug, daß jeder ihn sehen konnte.
»Deine Freunde, die Bullen, Randy Ernest Whitcomb ...« Lucas hakte dem Jungen den linken Fuß unter den Knöchel. Hielt ihn, halb über die Bar gedrückt, mit einer Hand fest, langte nach den Handschellen. »Du bist festgenommen wegen ...«
»Nein«, schrie Randy, knickte wie ein Taschenmesser zusammen, trat nach hinten aus und traf Lucas an der Wange. Nur flüchtig, kein gezielter Tritt. Aber weh tat’s trotzdem, Lucas taumelte.
Randy rollte sich über den Tresen, krabbelte auf allen vieren bis zum Ende der Theke und hatte, als er wieder auftauchte, eine Wodkaflasche in der Hand. Die im nächsten Augenblick auf Dels Schädel landete. Dann rannte er auf den Hinterausgang zu. Lucas wußte zwar, daß die Tür abgeschlossen war, blieb ihm aber dicht auf den Fersen. Randy rammte die Schulter dagegen und wirbelte, als auch der zweite Versuch erfolglos geblieben war, mit wilden Augen herum. Das Ding in seiner Hand blitzte gefährlich. Ein Schlitzmesser, der neueste Hit in der Szene. Sah harmlos aus, wie ein Kugelschreiber, solange so ein Fuzzy das Röhrchen in der Brusttasche stecken hatte. Wenn er’s aufspringen ließ, kam ein fünfzehn Zentimeter langes, tückisch scharfes Skalpell zum Vorschein.
»Komm, du Scheißbulle«, johlte Randy mit überschnappender Stimme, speichelsprühend und mit weit aufgerissenen Augen. »Komm, du Arschgesicht, ich schlitz’ dich auf.«
»Wirf das verdammte Messer weg«, schrie Del. Lucas warf rasch einen Blick nach hinten, sah Del mit dem Revolver auf Randys Kopf zielen und hatte das beruhigende Gefühl, daß die Welt wieder im Lot war. Der Dicke hinter der Bar preßte die Hände auf die Ohren. Weiß der Henker, wann er die Erfahrung gemacht hatte, daß ihm schon nichts passieren würde, solange er nichts hörte. Marie hatte sich hochgerappelt, starrte auf ihre Hände und fing jämmerlich an zu krakeelen, als sie sah, daß sie bluteten. Die beiden Shitdealer standen auf einmal nicht mehr am Tischbowling, und der eine, der mit dem hüpfenden Adamsapfel, fummelte am Gürtel herum, genau da, wo die lederne Messerscheide hing.
Randy brüllte weiter, tänzelte nervös. »Los, du Arsch, schieß doch. Ich bin nämlich noch ’n Heranwachsender, ihr blöden Säue.«
»Wirf das verdammte Messer weg«, schrie Del noch einmal und schielte zu Lucas hinüber. »He, Mann, was nu?«
»Laß ihn mir«, sagte Lucas. Deutete mit einer schnellen Kopfbewegung zur Seite. »Paß auf den Shitdealer auf, der hat auch ’n Messer.« Und dann fixierte er, während Del herumschnellte, den rothaarigen Jungen. »Du ziehst gern ’ne große Nummer ab, Randy?«
»Ich schieb’ auch gern ’ne Nummer«, gröhlte Randy. Streckte obszön die zusammengerollte Zunge raus. »Biste scharf auf mich? Mußt’s nur sagen, Mann.«
»Tja, Jungchen, dann mußt du in Zukunft von deinen Erinnerungen leben«, sagte Lucas. »Weil ich dir nämlich gleich dein eigenes Schlitzmesser durch die Eier bohre. Du hast Betty einen Dosenöffner durchs Gesicht gezogen. Und ich hab’ sie zufällig gemocht. Darum bin ich hinter dir her.«
»Okay, Davonport, und jetzt hast du mich, wie?« brüllte Randy. »Komm her, hol mich.« Er mimte den braven Jungen, Hände schön nach unten, wie sie’s ihm in der Besserungsanstalt beigebracht hatten, aber die Hand mit dem Schlitzmesser lauerte.
Daumenregel für Bullen: Laß keinen mit einem Messer näher als drei Schritte an dich ran, sonst kriegst du’s verpaßt. Sogar ’ne Kanone hilft da nichts. Nicht mal, wenn du abdrückst.
»Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig.« Del. Er war mit dem Shitdealer beschäftigt.
»Wo ist das Mädchen?« rief Lucas ihm zu, ohne Randy aus den Augen zu lassen. Die Arme halb oben, wie ein Boxer.
»Steht an der Tür.«
»Hol sie.«
»He, Mann ...«
»Hol sie. Ich hab’ die Arschgeige im Griff.«
Und dann ging er direkt auf Randy los. Täuschte mit der Rechten einen Schwinger an, lockte Randys Linke hoch. Und als dessen rechte Hand hochschnellte, packte er den Jungen blitzschnell am Kragen, stieß ihn zurück und schlug mit der Rechten zu. Randy wurde gegen die Wand geschleudert. Er brachte zwar noch mal das Messer hoch, aber inzwischen traktierte Lucas seinen Kopf schon wie einen Punchingball.
»Lucas ...« hörte er Del von hinten schreien.
Musik in der Luft. Himmelblau. Harfen und Pauken. Der Kopf des Jungen hämmerte gegen die Wand. Lucas’ Arme arbeiteten wie Kolben. Ellbogen in Brusthöhe. Eine lange, wunderschöne Kombination. Die kein Ende mehr nahm. Eins-zwei, eins-zwei-drei, eins-zwei ... Das Messer flog auf den Boden, rutschte weg.
Lucas wich zurück. Das heißt, er hatte es vor. Kam aber nicht weit. Dels Arm umklammerte seinen Hals. Riß ihn nach hinten.
Die Harfen und Pauken verstummten, die Welt drehte sich wieder normal. Die Leute in der Bar waren aufgesprungen, starrten auf Lucas und Del. Aufgereihte Gesichter. Nebeneinander geklebt wie Briefmarken. Hinten lief das Baseball-Spiel weiter. Die Anfeuerungsrufe in der Übertragung hörten sich auf einmal kläglich an, wie ein halbverschlucktes Echo.
»Mein Gott.« Dels Atem ging keuchend. Und was dann kam, sagte er eine Spur zu laut, zu betont. »Ich dachte schon, er hat dich erwischt. Keiner rührt das Scheißmesser an, sonst bucht’ ich ihn ein. Wir brauchen die Fingerabdrücke. «
Er hielt Lucas immer noch fest. Bis der schließlich murmelte: »Ist ja gut, Mann, alles in Ordnung.«
Del sah ihn an. »Dir ist nichts passiert?« Und bewegte lautlos die Lippen. Zeugenaussagen. Fragte laut: »Oder hat er dich doch mit dem Messer erwischt?«
»Ich glaube, ich bin okay.«
»Noch mal Schwein gehabt«, sagte Del. Und wieder betont laut: »Der Junge war übergeschnappt. Habt ihr gesehen, wie der mit dem Messer auf ihn losgegangen ist? Wie ein Irrer. Hab’ noch nie erlebt, daß einer so durchdreht ...« Den Zeugen in den Mund legen, was sie aussagen sollen.
Lucas drehte sich nach Randy um. Der saß auf dem Boden, den Kopf an die Wand gelehnt, das Gesicht blutig.
»Wo ist seine Freundin abgeblieben?« fragte Lucas.
»Vergiß das Flittchen«, sagte Del. Er ging auf Lucas zu, zog ihm die Hände nach vorn. »Ich dachte schon, du bist hinüber, du blöder Hund.«