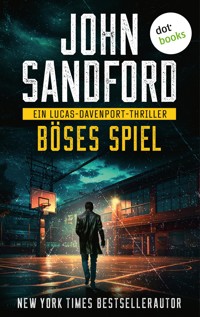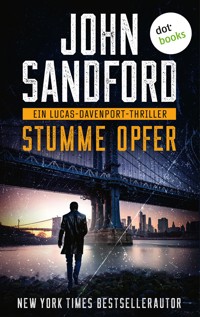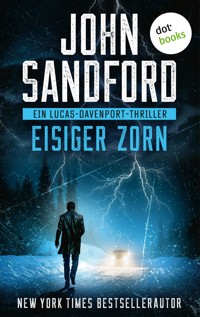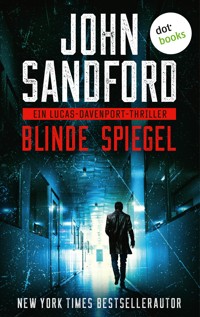4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Er ist die Verkörperung der Rache: Der rasante Thriller »Das Ritualmesser« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Miethai, abgeschlachtet in Minneapolis; ein aufstrebender Politiker, hingerichtet in Manhattan; ein Richter, exekutiert in Oklahoma … Eine Serie von brutalen Morden in den Twin Cities und New York versetzt die örtliche Bevölkerung in Angst und Schrecken. Allen Opfern wurde mit einem Ritualmesser die Kehle durchgeschnitten – und sie alle waren bekannt für ihren Hass auf amerikanische Ureinwohner. Lucas Davenport, Spezialist für die Aufdeckung von Serienmorden und ein exzentrischer Einzelgänger, ist gezwungen, sich zusammen mit der attraktiven Polizistin Lily Rothenburg auf die Spur mehrerer verdächtiger Indigener zu begeben. Er ahnt nicht, dass der Killer längst seine Spur aufgenommen hat … und aus dem Jäger schon bald der Gejagte werden wird! »John Sandford schreibt hochkarätige Psychothriller.« BILD Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »Das Ritualmesser« von John Sandford – der spektakuläre zweite Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von Lee Child und Jussi Adler-Olsen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Miethai, abgeschlachtet in Minneapolis; ein aufstrebender Politiker, hingerichtet in Manhattan; ein Richter, exekutiert in Oklahoma … Eine Serie von brutalen Morden in den Twin Cities und New York versetzt die örtliche Bevölkerung in Angst und Schrecken. Allen Opfern wurde mit einem Ritualmesser die Kehle durchgeschnitten – und sie alle waren bekannt für ihren Hass auf amerikanische Ureinwohner. Lucas Davenport, Spezialist für die Aufdeckung von Serienmorden und ein exzentrischer Einzelgänger, ist gezwungen, sich zusammen mit der attraktiven Polizistin Lily Rothenburg auf die Spur mehrerer verdächtiger Indigener zu begeben. Er ahnt nicht, dass der Killer längst seine Spur aufgenommen hat … und aus dem Jäger schon bald der Gejagte werden wird!
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Die Website des Autors: johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: instagram.com/johnsandfordauthor/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
***
eBook-Neuausgabe März 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1990 unter dem Originaltitel »Shadow Prey« bei G. P. Putnam’s Sons, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Der indianische Schatten« im Goldmann Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1990 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/ana, Oleg
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-928-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Ritualmesser« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Das Ritualmesser
Ein Lucas-Davenport-Thriller 2
Aus dem Amerikanischen von Joachim Körber
dotbooks.
Am Anfang ...
Sie hielten zwischen zwei Müllcontainern in einer Gasse. Carl Reed stand mit einer Bierdose in der Hand Schmiere. Larry Clay zog das betrunkene Indianermädchen aus, warf ihre Kleidungsstücke auf den Boden des Rücksitzes und zwängte sich zwischen ihre Beine.
Die Indianerin fing an zu heulen. »Herrgott, die hört sich wie ein Scheißjagdhund an«, sagte Reed, ein Junge aus Kentucky.
»Sie ist eng«, grunzte Clay. Reed lachte und sagte: »Beeil dich«, und warf die leere Bierdose in Richtung der Müllcontainer. Sie prallte von der Seite ab und fiel auf die Gasse.
Clay war in vollem Galopp, als das Heulen des Mädchens schriller wurde und sich zu einem Schrei entwickelte. Er legte ihr eine große Hand übers Gesicht und sagte: »Halt die Klappe, du Nutte«, aber es gefiel ihm. Eine Minute später war er fertig und kroch von ihr runter.
Reed zog den Pistolengurt aus und legte ihn hinter dem Blinklicht aufs Autodach. Clay stand auf der Gasse und sah an sich hinunter. »Sieh dir das Scheißblut an«, sagte er.
»Verdammt«, sagte Reed, »du hast 'ne Jungfrau entkorkt.« Er duckte sich auf den Rücksitz und sagte: »Hier kommt Daddy ...«
Im Radio des Streifenwagens ließ sich nur der Polizeifunk einstellen, daher hatten Clay und Reed stets ein Transistorradio dabei, das Reed in einem PX in Vietnam gekauft hatte. Clay holte es hervor, schaltete ein und suchte nach etwas Anständigem. Der Nachrichtensender brabbelte etwas, daß Robert Kennedy Lyndon Johnson herausgefordert hatte. Clay drehte weiter und fand schließlich einen Country-Sender, wo sie »Ode to Billy Joe« spielten.
»Bist du bald fertigt« fragte er, während der Song von Bobbie Gentry in die Gasse hallte.
»Halt doch ... dein ... dummes ... Maul ...«, sagte Reed.
Das Indianermädchen sagte nichts.
Als Reed fertig war, hatte Clay die Uniform schon wieder an. Sie nahmen sich noch einige Momente Zeit, um dem Mädchen ein paar Sachen anzuziehen.
»Mitnehmen oder hierlassen?« fragte Reed.
Das Mädchen saß benommen auf der Gasse, umgeben von weggeworfenen Werbeprospekten, die aus den Mülltonnen geweht worden waren.
»Scheiß drauf«, sagte Clay. »Laß sie hier.«
Schließlich waren sie nur betrunkene Indianerweiber. Das sagten alle. Und es war ja nicht so, daß man ihnen etwas nahm. Sie hatten danach nicht weniger als davor. Verdammt, es gefiel ihnen.
Und darum meldeten sich Streifenwagen aus ganz Phoenix, wenn ein Funkspruch rausging. »Betrunkenes Indianerweib. Muß nach Hause gefahren werden. Wer?«
Hieß es »betrunkener Indianer«, also ein Mann, hätte man denken können, jeder Streifenwagen der Stadt wäre von einer Klippe gestürzt. Kein Piepser. Aber ein betrunkenes Indianerweib? Das führte zu einem Verkehrsstau. Viele waren fett, viele waren alt. Aber manche nicht.
Lawrence Duberville Clay war der jüngste Sohn eines reichen Mannes. Die anderen Clay-Söhne waren im Familienbetrieb tätig: Chemikalien, Kunststoffe, Aluminium. Larry ging nach dem College zur Polizei von Phoenix. Seine Familie war schockiert, außer dem alten Herrn, der das Geld machte. Der alte Herr sagte: »Laßt ihn gehen. Mal sehen, wie er sich anstellt.«
Larry Clay fing damit an, daß er sich das Haar lang wachsen ließ, bis über die Schultern, und mit einem 56er Ford durch die Stadt kreuzte. Binnen zwei Monaten hatte er überall in der Hippie-Gemeinde Freunde. Fünfzig langhaarige Blumenkinder wurden wegen Drogenkonsum festgenommen, ehe der Drogenfahnder mit dem neuen Gesicht bekannt wurde.
Danach kam der Streifendienst, die Bars, die Nachtclubs, die Imbißlokale, die rund um die Uhr geöffnet hatten; und die betrunkenen Indianerweiber auflesen. Als Cop konnte man viel Spaß haben. Larry Clay hatte ihn.
Bis er verletzt wurde.
Er wurde so brutal zusammengeschlagen, daß die ersten Cops, die am Tatort eintrafen, ihn für tot hielten. Sie brachten ihn zur Notaufnahme, und die Ärzte brachten ihn wieder in Ordnung. Wer waren die Täter? Drogendealer, sagte er. Hippies. Rache. Larry Clay war ein Held, sie machten ihn zum Sergeanten.
Als er aus dem Krankenhaus kam, blieb Larry noch so lange bei der Polizei, bis er bewiesen hatte, daß er kein Feigling war, dann hörte er auf. Er arbeitete im Sommer und absolvierte das Jurastudium in zwei Jahren. Zwei weitere Jahre verbrachte er im Büro des Staatsanwalts, dann eröffnete er eine Privatkanzlei. 1972 bewarb er sich um einen Platz im Senat seines Bundesstaats und gewann.
Seine Karriere kam richtig ins Rollen, als ein Spieler Ärger mit dem IRS bekam. Als Gegenleistung für etwas Verständnis gab der Spieler den Steuerfahndern eine Liste der Polizisten, die er im Laufe der Jahre geschmiert hatte. Die Sache stank zum Himmel. Die Stadtväter wurden nervös, sahen sich um und fanden einen jungen Mann, der mit beiden Beinen fest auf der Erde stand. Ein junger Mann aus guter Familie. Ehemaliger Polizist, Anwalt, Politiker.
Säubern Sie die Polizeitruppe, sagten sie zu Lawrence Duberville Clay. Aber nicht übertreiben ...
Er machte genau, was sie wollten. Sie zeigten sich dankbar.
1976 wurde Lawrence Duberville Clay zum jüngsten Polizeichef in der Geschichte des Departments. Fünf Jahre später kündigte er und nahm das Amt eines Assistenten des Generalbundesanwalts in Washington an.
Ein Schritt zurück, sagten seine Brüder. Wartet nur ab, sagte der alte Herr. Und der alte Herr konnte helfen; die richtigen Leute, die richtigen Clubs. Geld, falls erforderlich.
Als das FBI von einem Skandal gebeutelt wurde – Bestechung bei internen Ermittlungen –, wußte die Verwaltung, an wen sie sich wenden mußte. Der Junge aus Phoenix hatte einen Ruf. Er hatte die Polizei von Phoenix gesäubert, und er würde das FBI säubern. Aber er würde es nicht übertreiben.
Mit zweiundvierzig wurde Lawrence Duberville Clay zum jüngsten FBI-Direktor seit J. Edgar Hoover ernannt. Er wurde das Aushängeschild der Verwaltung im Kampf gegen das Verbrechen. Er brachte das FBI der Bevölkerung und der Presse nahe. Während einer Drogenrazzia in Chicago schoß ein AP-Fotograf das Porträt eines erschöpften Clay, der die Ärmel bis über die Ellbogen hochgekrempelt und einen müden Gesichtsausdruck hatte. In einem Schulterhalfter unter der Achsel trug er eine riesige halbautomatische Pistole Marke Desert Eagle. Das Bild machte ihn berühmt.
Nicht viele Menschen erinnerten sich an seine erste Zeit in Phoenix und die Nächte, die er mit der Jagd auf betrunkene Indianerweiber verbracht hatte.
Während dieser Nächte in Phoenix hatte Larry Clay Geschmack an jungen Dingern gefunden. Sehr jungen Dingern. Und manche waren so betrunken gar nicht gewesen. Und manche waren auch gar nicht so scharf auf Nummern auf dem Rücksitz gewesen. Aber wer glaubte schon einem Indianerweib – in Phoenix, Mitte der sechziger Jahre? Bürgerrechte waren etwas für die Schwarzen im Süden, nicht für Indianer oder Chicanos im Südwesten. Vergewaltigungen bei Verabredungen war nicht einmal eine Vorstellung, und der Feminismus war kaum am Horizont zu sehen.
Aber das Mädchen in der Gasse ... sie war zwölf und ein wenig betrunken, aber nicht so betrunken, daß sie nicht sagen oder sich erinnern konnte, wer sie ins Auto gezerrt hatte. Sie erzählte es ihrer Mutter. Ihre Mutter dachte zwei Tage darüber nach und erzählte es dann zwei Männern, die sie im Reservat kennengelernt hatte.
Die beiden Männer erwischten Larry Clay vor seinem Apartment und prügelten ihn mit einem echten Louisville Slugger windelweich. Brachen ihm ein Bein und beide Arme und eine Menge Rippen. Brachen ihm die Nase und schlugen ihm ein paar Zähne aus.
Es waren keine Drogendealer, die Larry Clay zusammenschlugen. Es waren zwei Indianer, als Abrechnung für eine Vergewaltigung.
Lawrence Duberville Clay kriegte nie heraus, wer sie gewesen waren, aber er vergaß auch nie, was sie ihm angetan hatten. Im Laufe der Jahre zahlte er es Indianern als Staatsanwalt, als Senator, Polizeichef und Assistent des Generalbundesanwalts heim, wenn sich ihm die Gelegenheit bot.
Er zeigte es ihnen allen.
Und er vergaß sie auch nicht, als er Direktor des FBI wurde, die eiserne Faust in jedem Indianerreservat der Nation.
Aber es gab auch Indianer mit einem guten Gedächtnis.
Wie die Männer, die ihn in Phoenix erwischt hatten.
Die Crows.
Kapitel 1
Ray Cuervo saß in seinem Büro und zählte sein Geld. Er zählte sein Geld jeden Freitagnachmittag zwischen fünf und sechs Uhr. Er machte kein Geheimnis daraus.
Cuervo besaß sechs Mietshäuser, die im Indian Country südlich der Minneapolis Loop verteilt waren. Das billigste Apartment vermietete er für neununddreißig Dollar pro Woche. Das teuerste lag bei fünfundsiebzig. Wenn er die Miete kassieren kam, akzeptierte Cuervo weder Schecks noch Entschuldigungen. Wenn man sein Geld Freitagnachmittags bis vierzehn Uhr nicht hatte, schlief man auf der Straße. Geschäft, wie Cuervo jeder Menge armer Schweine erzählte, war Geschäft.
Manchmal ein gefährliches Geschäft. Cuervo hatte stets eine verchromte Charter Arms Special Kaliber .38 in die Hose gesteckt, wenn er die Miete kassieren ging. Die Waffe war alt. Der Lauf war abgeblättert, der Kolben unmodisch klein. Aber sie funktionierte, und die Patronen waren immer neu. Man konnte das glänzende Messing in den Öffnungen des Zylinders funkeln sehen. Kein Schaustück, sagten seine Mieter. Eine Schußwaffe. Wenn Cuervo die wöchentlichen Einnahmen zählte, hatte er die Waffe neben seiner rechten Hand auf dem Schreibtisch liegen.
Cuervos Büro war ein Kabuff am Ende der Treppe im dritten Stock. Das Mobiliar war nüchtern und billig: ein schwarzes Telefon mit Wählscheibe, ein Schreibtisch aus Metall, ein Aktenschrank aus Holz und ein Drehstuhl aus Eiche auf Rollen. An der Wand linker Hand hing ein vier Jahre alter Badeanzug-Kalender der Zeitschrift Sports Illustrated. Cuervo blätterte ihn nie weiter als April, der Monat, wo man die braunen Nippel der Braut durch das nasse T-Shirt sehen konnte. Gegenüber dem Kalender hing eine Pinnwand aus Kork. Ein Dutzend Urlaubskarten waren an dieser Pinnwand festgesteckt, dazu zwei verblaßte Autoaufkleber. Auf einem stand SCHEISSE KOMMT VOR, auf dem anderen GEFÄLLT DIR MEIN FAHRSTIL? WÄHL 1-800-FRISS-SCHEISSE. Cuervos Frau, Tochter eines Landarbeiters aus Kentucky, die einen Mund wie Stacheldraht hatte, nannte das Büro ein Scheißloch. Ray Cuervo kümmerte das nicht. Immerhin war er ein Slumlord.
Cuervo machte ordentliche Stapel mit dem Geld, Einser, Fünfer und Zehner. Einen verstreuten Zwanziger steckte er in die Tasche. Münzen zählte er, schrieb die Summen auf und warf sie in eine Kaffeedose Marke Maxwell House. Cuervo war ein dicker Mann mit kleinen schwarzen Augen. Wenn er das feiste Kinn hob, sprangen aus seinem roten Nacken drei fette Speckwülste hervor. Wenn er sich nach vorn lehnte, traten an den Seiten, unter den Armen, drei weitere Speckwülste vor. Und wenn er furzte, was häufig vorkam, lüpfte er unbewußt eine Arschbacke vom Stuhl, um den Druck zu verringern. Er fand diese Bewegung weder unmöglich noch ungehörig. Wenn eine Frau im Zimmer war, sagte er »Hoppla«. Wenn er sich nur in männlicher Gesellschaft befand, sagte er nichts. Furzen war Männersache.
Wenige Minuten nach fünf Uhr am 5. Oktober, einem für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Tag, fiel die Tür unten an der Treppe zu, und ein Mann kam hoch. Cuervo legte die Fingerspitzen an die .38er Charter Arms und stand halb auf, damit er den Besucher sehen konnte. Der Mann auf der Treppe sah nach oben, und Cuervo entspannte sich.
Leo Clark. Ein alter Kunde. Wie die meisten Indianer, die eine von Cuervos Wohnungen mieteten, pendelte auch Leo immer zwischen den Reservaten hin und her. Er war ein harter Mann, das schon, mit einem Gesicht wie Granit, aber Cuervo hatte nie Ärger mit ihm.
Leo machte auf dem zweiten Treppenabsatz eine Pause, holte Luft und kam die letzte Treppe hoch. Er war ein Sioux, Mitte Vierzig, Einzelgänger und von der Sommersonne braungebrannt. Lange schwarze Zöpfe hingen ihm auf den Rücken, am Gürtel trug er eine Silberarbeit der Navajos. Er kam irgendwo aus dem Westen: Rosebud, Standing Rock oder so.
»Leo, wie geht’s?« sagte Cuervo, ohne aufzusehen. Er hatte Geld in beiden Händen und zählte. »Brauchst du ’ne Wohnung?«
»Leg die Hände in den Schoß, Ray«, sagte Leo. Cuervo sah hoch. Leo hatte eine Pistole auf ihn gerichtet.
»Och, Mann, laß das doch«, stöhnte Cuervo und richtete sich auf. Er sah seine Waffe nicht an, dachte aber an sie. »Wenn du ein paar Kröten brauchst, leih ich sie dir.«
»Kann ich mir denken«, sagte Leo. »Zwei zu eins.« Cuervo betätigte sich nebenbei ein bißchen als Kredithai. Geschäft war Geschäft.
»Komm schon, Leo.« Cuervo warf das Bündel Geldscheine wie zufällig auf den Schreibtisch, damit er die Schußhand frei bekam. »Möchtest du deine alten Tage im Knast verbringen?«
»Wenn du noch eine Bewegung machst, schieß ich dir Löcher in den Kopf. Das ist mein Ernst, Ray«, sagte Leo. Cuervo sah dem anderen Mann ins Gesicht. Es war so kalt und dunkel wie das einer Maya-Statue. Cuervo bewegte sich nicht mehr.
Leo kam um den Schreibtisch herum. Keine drei Schritte waren zwischen ihnen, aber das runde Loch von Leos Pistole war starr auf Ray Cuervos Nase gerichtet.
»Bleib ganz still sitzen. Keine falsche Bewegung«, sagte Leo. Als er hinter dem Stuhl stand, sagte er: »Ich werde dir Handschellen anlegen, Ray. Ich möchte, daß du die Arme hinter die Stuhllehne streckst.«
Cuervo befolgte die Anweisung, drehte den Kopf und sah nach, was Leo vorhatte.
»Schau nach vorne«, sagte Leo und tippte mit dem Lauf der Pistole an Cuervos Ohr. Cuervo sah starr geradeaus. Leo wich zurück, schob die Pistole in den Bund seiner Hose und holte ein Obsidianmesser aus der Tasche. Das Messer bestand aus zwanzig Zentimeter wunderschön gearbeitetem schwarzen vulkanischen Glas von einer Klippe im Yellowstone Nationalpark. Die Kanten waren geschliffen, es war scharf wie ein Skalpell.
»He, Ray?« sagte Leo und trat näher hinter den Slumlord. Cuervo furzte aus Angst oder Verdrossenheit, und der üble Gestank füllte das Zimmer. Er machte sich nicht die Mühe, »Hoppla« zu sagen.
»Ja?« Cuervo sah starr geradeaus. Er überlegte. Seine Beine waren in der Knieöffnung unter dem Schreibtisch. Es würde ihm schwerfallen, sich schnell genug zu bewegen. Spiel mit, dachte er, noch ein paar Minuten. Wenn Leo die Handschellen anlegte, gelang ihm vielleicht die richtige Bewegung. Die Waffe funkelte fünfzig Zentimeter vor seinen Augen auf dem Schreibtisch.
»Das mit den Handschellen war gelogen, Ray«, sagte Leo. Er packte Cuervos Haar über der Stirn und riß den Kopf zurück. Dann schlitzte Leo mit einer einzigen kraftvollen Bewegung Ray Cuervos Kehle von einem Ohr zum anderen auf.
Cuervo stand halb auf, riß sich los und griff hilflos mit einer Hand zum Hals, während die andere hektisch auf dem Schreibtisch nach der .38er Charter Arms tastete. Doch dabei wußte er schon, daß er es nicht schaffen würde. Blut spritzte aus der durchschnittenen Halsschlagader wie aus einem Gartenschlauch und besudelte das grüne Laub der Dollars auf dem Tisch, die Sports IIlustrated-Brautmit den Titten, den braunen Linoleumboden.
Ray Cuervo zuckte und wand sich und fiel, wobei er die Maxwell-House-Kaffeedose vom Schreibtisch stieß. Münzen klirrten und schepperten und rollten im Büro herum; ein paar kullerten die Treppe hinunter. Cuervo lag mit dem Gesicht auf dem Fußboden, und sein Gesichtsfeld schrumpfte zu einem trüben, engen Loch, das sich zuletzt auf Leo Clark konzentrierte, dessen Gesicht gleichgültig im Zentrum der zunehmenden Dunkelheit blieb. Dann war Ray Cuervo tot.
Leo wandte sich ab, als Cuervos Blasen- und Schließmuskel erschlafften. Auf dem Schreibtisch lagen zweitausendfünfunddreißig Dollar. Leo schenkte ihnen keine Beachtung. Er wischte das Obsidianmesser an seiner Hose ab, steckte es wieder in die Tasche und zog das Hemd über die Pistole. Dann ging er die Treppe hinunter und zu Fuß die sechs Blocks zu seinem Apartment. Er war mit Cuervos Blut besudelt, aber niemand schien es zu bemerken. Die Cops bekamen nur eine äußerst vage Beschreibung. Ein Indianer mit Zöpfen. In Minneapolis lebten fünftausend Indianer mit Zöpfen.
Die meisten waren hocherfreut, als sie die Nachricht über Ray Cuervo hörten.
Scheißindianer.
John Lee Benton haßte sie. Sie waren noch schlimmer als die Nigger. Wenn man einem Nigger sagte, er solle dann und dann kommen, und er kam nicht, hatte er eine Entschuldigung. Einen Grund. Selbst wenn es dummes Zeug war.
Indianer waren anders. Man sagt einem, er soll um zwei Uhr da sein, und er kommt nicht. Dann kommt er am nächsten Tag um zwei und denkt, daß das genügt. Er tut nicht so, als würde er das denken. Er denkt es wirklich.
Die Psychofritzen im Knast nannten das eine kulturelle Anomalie. John Lee Benton nannte es eine Unverschämtheit. Die Psychofritzen sagten, die einzige Lösung wäre Ausbildung. John Lee Benton hatte ganz allein eine andere Methode gefunden.
Benton hatte sieben Indianer unter seinen Bewährungsklienten. Wenn sie sich nicht planmäßig bei ihm meldeten, nutzte er die Zeit, die er normalerweise für das Gespräch gebraucht hätte, um die Papiere auszufüllen, die sie wieder nach Stillwater brachten. In zwei Jahren hatte er neun Männer in den Bau zurückgeschickt. Jetzt hatte er einen Ruf. Die Scheißindianer machten einen großen Bogen um ihn. Wenn man auf Bewährung rauskam, sagten sie untereinander, sollte man nicht zu John Lee Bentons Schützlingen gehören. Das war die todsichere Rückfahrkarte.
Benton gefiel sein Ruf.
John Lee Benton war ein kleiner Mann mit großer Nase und mausgrauem Haar, das er über wäßrige blaue Augen kämmte. Er trug einen quadratisch geschnittenen, strohblonden Schnauzer. Wenn er sich morgens im Badezimmerspiegel betrachtete, dachte er immer, daß er jemandem ähnlich sah, wußte aber nicht genau, wem. Einem berühmten Mann. Früher oder später würde es ihm einfallen.
John Lee Benton haßte Schwarze, Indianer, Mexikaner, Juden und Asiaten mehr oder weniger in dieser Reihenfolge. Sein Haß auf Schwarze und Juden war ein Familienerbe, das ihm sein Daddy vermacht hatte, während er in den Arbeiterslums von St. Louis aufwuchs, die laufend größer wurden. Die Antipathie gegen Indianer, Mexikaner und Asiaten hatte er sich selbst angeeignet.
Jeden Montagnachmittag saß Benton in einem stickigen Büro im Indianerzentrum an der Franklin Avenue und redete mit seinen Arschlöchern. Er sollte sie Klienten nennen, aber drauf geschissen. Sie waren Verbrecher und Arschlöcher, jeder einzelne.
»Mr. Benton?«
Benton sah auf. Betty Sails stand in der Tür. Sie war eine schüchterne Indianerin mit grauem Gesicht, einer Hochfrisur, und sie war die Empfangsdame für alle Büros.
»Ist er da?« fragte John Lee schroff und ungeduldig. Er war ein Mann, der Haß ausschwitzte.
»Nein, er ist nicht da«, sagte Betty Sails. »Aber ein anderer Mann möchte Sie sprechen. Ein Indianer.«
Benton runzelte die Stirn. »Ich habe heute keine Termine mehr.«
»Er sagte, es ginge um Mr. Cloud.«
Herr im Himmel, wahrhaftig eine Entschuldigung. »Na gut. Lassen Sie mir zwei Minuten Zeit, dann schicken Sie ihn rein«, sagte Benton. Betty Sails ging hinaus, und John Lee Benton sah noch einmal Clouds Akte durch. Das war zwar nicht nötig, aber es gefiel ihm, den Indianer warten zu lassen. Zwei Minuten später stand Tony Bluebird in der Tür. Benton hatte ihn noch nie gesehen.
»Mr. Benton?« Bluebird war ein untersetzter Mann mit engstehenden Augen und kurzgeschnittenem Haar. Er trug ein Baumwollhemd über einem ungegerbten Lederriemen. An dem Lederriemen baumelte ein Obsidianmesser, das Bluebird auf der Haut unter dem Brustbein spüren konnte.
»Ja?« Benton ließ Zorn in seine Stimme einfließen.
Bluebird holte eine Pistole hervor. »Legen Sie die Hände in den Schoß, Mr. Benton.«
Drei Menschen sahen Bluebird. Betty Sails sah ihn kommen und gehen. Ein Junge, der aus der Sporthalle kam, ließ einen Basketball fallen, den Bluebird mit einem Fuß bremste, aufhob und zurückwarf, als Betty Sails gerade zu schreien anfing. Auf der Straße sah ihn Dick Yellow Hand, siebzehn und verzweifelt auf der Suche nach einem Schuß Crack, zur Tür herauskommen und rief: »He, Bluebird.«
Bluebird blieb stehen. Yellow Hand kam zu ihm und kratzte sich in seinem dünnen Bart. »Siehst schlecht aus, Mann«, sagte Bluebird.
Yellow Hand nickte. Er trug ein schmutziges T-Shirt mit einem verblaßten Bild von Mick Jagger. Seine drei Nummern zu großen Jeans hatte er mit einem Stück Wäscheleine um die Taille gebunden. Seine Ellbogengelenke und Arme sahen aus wie Strohhalme. Zwei Schneidezähne fehlten ihm. »Mir geht’s beschissen, Mann. Weißt du, ich könnte ’n paar Mäuse brauchen.«
»Sorry, Mann, ich hab kein Geld«, sagte Bluebird. Er steckte die Hände in die Taschen und zog sie leer wieder heraus.
»Macht nichts«, sagte Yellow Hand enttäuscht.
»Hab letzte Woche deine Mama gesehen«, sagte Bluebird.
»Draußen im Reservat.«
»Wie geht’s ihr?«
»Gut. Sie hat geangelt. Lachse.«
Sails’ hysterische Schreie wurden laut, als jemand die Tür des Indianerzentrums aufmachte.
»Freut mich für Mama«, sagte Yellow Hand.
»Ich glaube, ich muß weiter«, sagte Bluebird und machte sich auf den Weg.
»Okay, Mann«, sagte Yellow Hand. »Bis bald.«
Bluebird schlenderte dahin, ließ sich Zeit, seine Gedanken waren anderswo. Wie hatte sie geheißen? Es war schon Jahre her. Anna? Sie war eine hübsche Frau mit vollen Brüsten und warmen braunen Augen. Sie hatte ihn gern gehabt, dachte er, aber sie waren beide verheiratet gewesen und nichts war je passiert; nur eine Art Seelenverwandtschaft, die sie im tiefsten Indian Country von Minneapolis über Gartenhecken hinweg verspürt hatten.
Annas Mann, ein Chippewa aus Nett Lake, saß im Gefängnis von Hennepin County. Eines Abends hatte er betrunken einen Cola-Automaten rot und weiß im Fenster einer Tankstelle leuchten sehen. Er hatte ein Stück Beton durch das Fenster geworfen, war reingeklettert und hatte den Automaten mit dem Betonbrocken geknackt. Etwa tausend Vierteldollarstücke hatten sich auf den Boden ergossen, hatte jemand Bluebird erzählt. Annas Mann hatte sie immer noch mühsam einen nach dem anderen aufgesammelt, als die Cops kamen. Er war auf Bewährung gewesen, der Einbruch eine Verletzung der Auflagen. Er hatte sechs Monate zusätzlich zur restlichen Zeit der letzten Haftstrafe bekommen.
Anna und ihr Mann hatten nie Geld gehabt. Er versoff das meiste, und sie half ihm wahrscheinlich dabei. Essen war immer knapp. Niemand hatte etwas zum Anziehen. Aber sie hatten einen Sohn. Der war zwölf, ein vierschrötiges, verschlossenes Kind, das die Abende vor dem Fernseher verbrachte. Eines Samstagsnachmittags, wenige Wochen nachdem sein Daddy ins Gefängnis gebracht worden war, ging der Junge zur Lake Street Bridge und sprang in den Mississippi. Eine Menge Leute sahen ihn, und die Polizei fischte ihn schon fünfzehn Minuten später wieder raus. Tot.
Bluebird hatte es erfahren und war zum Fluß gegangen. Anna war da, hatte die Arme um die Leiche ihres Sohnes geschlungen, sah mit diesen schmerzerfüllten Augen zu ihm auf und ... was?
Das alles gehörte dazu, Indianer zu sein, dachte Bluebird. Das Sterben. Das konnten sie jedenfalls besser als die Weißen. Zumindest häufiger.
Als Bluebird das Zimmer verließ, nachdem er Benton die Kehle durchgeschnitten hatte, sah er dem Mann ins Gesicht und dachte, daß es ihm irgendwie bekannt vorkam. Wie ein berühmter Mann. Jetzt, während er auf dem Gehweg dahinschlenderte, Yellow Hand hinter sich ließ und an Anna dachte, erschien Bentons Gesichts vor seinem geistigen Auge.
Hitler, dachte er. John Lee Benton sah genau wie ein junger Adolf Hitler aus.
Ein junger toter Adolf Hitler.
Kapitel 2
Lucas Davenport hatte sich auf ein Brokatsofa im hinteren Teil eines Antiquariats gefläzt und aß ein Roastbeefsandwich. Auf dem Schoß hatte er eine zerlesene Ausgabe von T. Harry Williams’ Biographie von Huey Long.
T. Harry hatte es gut gemacht, überlegte Lucas. Der Mann im weißen Anzug inmitten der Longites, die vor dem Büro des Gouverneurs standen. Der Schuß. Der Kingfish-Trefferi, die Schreie, die Panik. Die amoklaufenden Polizisten.
»Roden und Coleman feuerten fast gleichzeitig, doch Colemans Kugel traf den Mann wahrscheinlich zuerst«, schrieb T. Harry. »Mehrere andere Wachen hatten die Waffen gezogen und ballerten drauflos. Der Mann brach zusammen und fiel mit dem Gesicht nach unten vor die Wand des Flurs, aus dem er gekommen war. Dort lag er mit dem Gesicht auf einem Arm und bewegte sich nicht und war offensichtlich tot. Aber einigen der Wachen genügte das nicht. Sie standen wahnsinnig vor Trauer oder Wut über dem Leichnam und schossen die Waffen in ihn leer. Später stellte man fest, daß er dreißig Schußlöcher im Rücken und neunundzwanzig in der Brust hatte (viele von ihnen waren Einschuß- und Austrittswunden derselben Kugel) sowie zwei im Kopf. Das Gesicht war teilweise weggeschossen, der weiße Anzug war buchstäblich zerfetzt und blutgetränkt.«
Mord war nie so sauber wie im Fernsehen. So brutal er auf dem Bildschirm auch sein mochte, im wirklichen Leben war er schlimmer. Im wirklichen Leben lag stets eine leere Hülle da, deren Seele fort war, die Haut schlaff, die Augen wie Gewehrkugeln. Und damit mußte man sich beschäftigen. Jemand mußte den Leichnam fortschaffen, jemand mußte das Blut aufwischen. Jemand mußte den Mörder fassen.
Lucas rieb sich die Augenbraue, wo die Narbe sie kreuzte. Die Narbe war Folge eines Angelunfalls. Ein Draht des Vorspanns war von einem Baumstamm zurückgeschnappt und hatte sich in seinem Gesicht vergraben. Die Narbe war keine Entstellung: Die Frauen, die er kannte, sagten, er würde dadurch freundlicher aussehen. Die Narbe war prima; sein Lächeln war furchteinflößend.
Er rieb sich die Augenbraue und wandte sich wieder dem Buch zu. Er sah nicht wie ein Lesetyp aus, wie er so auf dem Sofa saß und die Augen im trüben Licht zusammenkniff. Er hatte die Aura der Straße um sich. Seine Hände, die bis sechs Zentimeter unter dem Handgelenk mit dunklem Flaum bedeckt waren, wirkten klobig und groß, wenn er das Taschenbuch umblätterte. Seine Nase war mehr als einmal gebrochen gewesen, und der kräftige Hals mündete in breiten Schultern. Sein Haar war schwarz mit vereinzelten grauen Strähnen.
Er blätterte das Buch mit einer Hand um und griff mit der anderen unter das Jackett, um die Waffe im Halfter zurechtzurücken.
›Kingfish, was ist los?‹
›Jimmy, mein Junge, ich bin getroffen worden‹, stöhnte Huey ...«
Lucas’ Funkgerät piepste. Er nahm es und drückte auf den Lautstärkeregler. Eine Frauenstimme sagte: »Lieutenant Davenport?«
»Am Apparat.«
»Lucas, Jim Wentz braucht Sie drüben im Indianerzentrum wegen dem Burschen, dem sie die Kehle aufgeschlitzt haben. Er hat einen Zeugen, den Sie sich ansehen sollen.«
»Gut«, sagte Lucas. »Zehn Minuten.«
Es war ein wunderschöner Tag, einer der schönsten eines strahlenden Herbstes. Ein Mord würde ihn kaputt machen. Morde waren normalerweise die Folge aggressiver Dummheit in Verbindung mit Alkohol und Wut. Nicht immer. Aber fast immer. Wenn Lucas die Wahl hatte, hielt er sich davon fern.
Vor dem Antiquariat blieb er einen Moment auf dem Bürgersteig stehen, gewöhnte die Augen an die Sonne und verschlang den letzten Bissen Sandwich. Als er damit fertig war, warf er die Sandwichtüte in einen Abfalleimer und ging über die Straße zu seinem Auto. Ein Bettler schlurfte den Gehweg entlang, sah Lucas, sagte: »Hab für Sie auf Ihr Auto aufgepaßt.« und streckte die Hand aus. Der Bettler war Stammgast, ein Schizophrener, den sie aus der staatlichen Klinik rausgeworfen hatten. Er kam ohne seine Medikamente nicht aus, nahm die Psychopharmaka aber nicht aus freien Stücken. Lucas gab ihm einen Dollar und setzte sich in den Porsche.
Die Innenstadt von Minneapolis ist ein Schaukasten moderner Architektur, Blocks aus Glas und Chrom und weißem Marmor. Mittendrin kauert die alternde rote Warze des Rathauses. Lucas schüttelte den Kopf, als er daran vorbeifuhr, links und darauf rechts abbog und die Interstate kreuzte. Die Glitzerfassade blieb zurück und wich einem heruntergekommenen Stadtteil alter Betonklötze, die in Mietwohnungen aufgeteilt worden waren, Schrottautos und bankrotter Geschäfte. Indian Country. Vor dem Indianerzentrum parkten ein halbes Dutzend Streifenwagen, und Lucas stellte den 911 am Bordstein ab.
»Drei Zeugen«, sagte der Detective von der Mordkommission zu ihm. Wentz hatte ein flaches, teigiges, skandinavisches Gesicht. Seine unteren Vorderzähne waren bei einer Schlägerei abgebrochen; er trug Kronen, deren silberne Kappen glitzerten, wenn er sprach. Er zählte die drei Zeugen an den Fingern ab, als würde er Lucas’ Rechenkünsten nicht trauen.
»Die Dame am Empfang«, sagte er. »Hat ihn zweimal gesehen und sagt, sie kann ihn identifizieren. Dann ein Junge aus der Gegend. Er hat Basketball gespielt und sagt, der Mann hatte überall auf der Hose Blut. Kann ich mir vorstellen. Das Büro hat wie ein verdammter Swimmingpool ausgesehen.«
»Kann der Junge ihn identifizieren?« fragte Lucas.
»Er behauptet ja. Er sagt, er hätte dem Typen genau ins Gesicht geguckt. Hat ihn schon in der Gegend gesehen.«
»Wer ist Nummer drei?«
»Auch ein Junge. Ein Junkie. Er hat den Mörder vor dem Haus gesehen und mit ihm gesprochen. Wir glauben, sie kennen sich, aber er macht den Mund nicht auf.«
»Wo ist er?« fragte Lucas.
»In einem Streifenwagen.«
»Wie habt ihr ihn gefunden?«
Wentz zuckte die Schultern. »Kein Problem. Die Sekretärin – die den Leichnam gefunden hat – hat neun-eins-eins angerufen, dann ist sie ans Fenster, um frische Luft zu schnappen. Ihr war schwindlig. Wie auch immer, sie hat den Jungen und den Mörder im Gespräch auf dem Bürgersteig gesehen. Als wir hier ankamen, war der Junge da vorne. Stand nur da. Wahrscheinlich ausgerastet. Wir haben ihn einfach ins Auto gesetzt.«
Lucas nickte, schritt den Flur entlang und betrat das Büro. Benton lag mit dem Gesicht nach oben in einer großen purpurnen Blutlache auf dem Fliesenboden. Er hatte die Arme starr von den Seiten weggestreckt, als wäre er gekreuzigt worden. Seine Beine waren weit gespreizt, die blutbefleckten Lederschuhe zeigten in Winkeln von fünfundvierzig Grad voneinander weg. Hemd und Mantel waren vollgesogen mit Blut. In der Blutlache waren Fuß- und Knieabdrücke, wo die Notärzte ihre Spuren hinterlassen hatten, aber kein medizinischer Abfall. Normalerweise lagen Verpackungen von Spritzen, Mull, Binden und Druckverbänden überall herum. Bei Benton hatten sie sich diese Mühe gespart.
Lucas roch den kupferartigen Blutgeruch, während der Detective hinter ihm eintrat.
»Sieht nach dem Typen aus, der auch Ray Cuervo umgelegt hat«, sagte Lucas.
»Vielleicht«, sagte Wentz.
»Ihr solltet zusehen, daß ihr ihn erwischt, sonst pinkelt euch die Presse an«, sagte Lucas freundlich.
»Gibt Schlimmeres«, sagte der Cop von der Mordkommission. »Wir haben eine ungefähre Beschreibung von dem Mann, der Cuervo abgemurkst hat. Er hatte Zöpfe. Alle sagen, der hier hat kurze Haare gehabt.«
»Könnte es geschnitten haben«, schlug Lucas vor. »Vielleicht hat er es mit der Angst bekommen ...«
»Ich hoffe es, aber irgendwie paßt das nicht.«
»Wenn es zwei Typen sind, gibt es Mordsstunk ...« Lucas’ Interesse war geweckt.
»Weiß ich, verdammt, weiß ich.« Wentz nahm die Brille ab und strich sich mit einer müden Hand über das Gesicht. »Herrgott, bin ich müde. Meine Tochter hat letzten Samstag das Auto kaputt gefahren. In der Stadt, beim IDS Building. Ihre Schuld, hat eine Ampel übersehen. Ich versuche, mit der Versicherung und der Werkstatt klarzukommen, und dann passiert diese Scheiße. Zwei Stunden später, und ich wär’ weg gewesen ...«
»Ist sie okay?«
»Ja, ja.« Er setzte die Brille wieder auf die Nase. »Das habe ich auch als erstes gefragt. Ich sag: ›Bist du okay?‹ Sie sagt: ›Ja.‹ Ich sag: ›Ich komm hin und bring dich um.‹«
»Solange sie nur okay ist«, sagte Lucas. Die Spitze seines rechten Schuhs stand in der Blutlache; er trat ein paar Zentimeter zurück. Er sah Bentons Gesicht verkehrt herum. Er dachte, daß Benton einer berühmten Persönlichkeit ähnlich sah, aber da das Gesicht auf dem Kopf stand, konnte er nicht sagen, wem.
» ...mein Augapfel«, sagte Wentz. »Wenn ihr etwas passieren würde ... Sie haben jetzt auch ein Kind, richtig?«
»Ja. Eine Tochter.«
»Armer Teufel. Warten Sie ein paar Jahre ab. Sie wird Ihren Porsche zu Schrott fahren, und dann gehört der Versicherung Ihr letztes Hemd.« Wentz schüttelte den Kopf. Verdammte Töchter. Es war fast unmöglich, mit ihnen zu leben, und eindeutig unmöglich, ohne sie zu leben. »Hören Sie, Sie kennen den Bengel vielleicht, den wir im Auto haben. Er hat gesagt, wir sollen uns nicht an ihm vergreifen, weil Davenport sein Freund ist. Wir glauben, er ist einer von Ihren Spitzeln.«
»Ich geh nachsehen«, sagte Lucas.
»Wir sind für jede Hilfe ...« Der Mann von der Mordkommission zuckte die Schultern.
»Klar.«
Draußen fragte Davenport einen Streifenpolizisten nach dem Junkie und wurde zum letzten Auto der Reihe geführt. Ein anderer Streifenpolizist saß am Steuer, hinter ihm eine kleine, dunkle Gestalt; die beiden waren durch ein Stahlgitter voneinander getrennt. Lucas beugte sich durch das offene Beifahrerfenster, nickte dem Streifenpolizisten zu und sah auf den Rücksitz. Der Junge rutschte nervös hin und her und hatte eine Hand in sein dunkles Haar geschoben. Yellow Hand.
»He, Dick«, sagte Lucas. »Wie läuft’s denn so im K Mart?«
»O Mann, Davenport, holen Sie mich hier raus.« Yellow Hands Augen waren groß und ängstlich. Er zappelte schneller herum. »Ich hab nichts getan, Mann. Keinen Scheißdreck.«
»Die Leute von K Mart würden sich darüber gern mit dir unterhalten. Sie haben gesagt, du bist mit einem CD-Player zur Tür gerannt ...«
»Scheiße, Mann, das war ich nicht ...«
»Stimmt. Aber ich will dir was sagen: Du nennst mir einen Namen, und ich laß dich laufen«, sagte Lucas.
»Ich weiß nicht, wer er war, Mann«, quietschte Yellow Hand.
»Dummes Zeug«, grunzte der uniformierte Beamte auf dem Fahrersitz. Er kaute auf einem Zahnstocher und sah Lucas an. Er hatte ein breites, irisches Gesicht, aber einen Teint wie Pfirsich und Sahne. »Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat, Lieutenant? Er hat gesagt: ›Aus mir kriegst du nichts raus, Pißkopf.‹ Das hat er gesagt. Er weiß, wer es war.«
»Stimmt das?« fragte Lucas Yellow Hand.
»Scheiße, Mann, ich hab ihn nicht gekannt«, winselte Yellow Hand. »Er war nur so ein Scheißtyp ...«
»Indianer?«
»Ja, Indianer, aber ich hab ihn nicht gekannt ...«
»Quatsch«, sagte der Mann in Uniform.
Lucas wandte sich dem Uniformierten zu. »Sie halten ihn hier fest, okay. Wenn ihn jemand wegschaffen will, dann sagen Sie, ich habe befohlen, ihn hier zu lassen.«
»Okay. Klar. Wie Sie wollen.« Dem Uniformierten war es einerlei. Er saß in der Sonne und hatte eine ganze Tasche voll Pfefferminzzahnstocher.
»Bin in zwanzig Minuten wieder da«, sagte Lucas.
Elwood Stone saß dreißig Meter von dem halfway house entfernt. Eine gute Stelle; die Freigänger konnten ihr Kokain auf dem Heimweg kaufen. Manche der Freigänger hatten einen knappen Zeitplan: Sie drückten die Stechuhr, wenn Feierabend war, und durften nur eine bestimmte Zeit brauchen, um nach Hause zu kommen. Sie hatten nicht genug Zeit, überall in der Stadt herumzulaufen und nach Stoff zu suchen.
Lucas sah Stone im selben Augenblick, wie Stone Lucas’ Porsche sah. Der Dealer rannte die Straße in südlicher Richtung hinab, aber hier befanden sich fast nur zwei- und dreistöckige Mietshäuser und Pensionen ohne Gassen dazwischen, in denen man verschwinden konnte. Lucas fuhr neben ihm her, bis Stone schwer atmend aufgab und sich auf eine Treppe eines der Mietshäuser setzte. Als Stone sich hinsetzte, fiel ihm ein, daß er den Beutel Crack ins Unkraut hätte werfen sollen. Jetzt war es zu spät.
»Stone, wie geht es dir?« fragte Lucas liebenswürdig, während er um die Schnauze des 911 herum ging. »Hört sich an, als wärst du ’n bißchen außer Form.«
»Leck mich, Davenport. Ich will einen Anwalt.« Stone kannte ihn gut.
Lucas setzte sich neben den Dealer auf die Treppe, lehnte sich nach hinten, legte den Kopf zurück und genoß die Sonnenstrahlen. »Du bist in der High School die 440 Yards gelaufen, richtig?«
»Leck mich, Davenport.«
»Ich kann mich noch an den Wettkampf gegen Sibley erinnern, sie hatten diesen weißen Jungen, wie hieß er doch noch? Turner? Der Junge konnte rennen. Herrje, man sieht nicht so viele weiße Jungs ...«
»Leck mich, ich will einen Anwalt.«
»Turners Alter ist reich, richtig?« sagte Lucas im Plauderton. »Und er schenkt dem Jungen eine Corvette. Turner fährt damit nach Norden und knallt gegen einen Brückenpfeiler, weißt du noch? Sie mußten ihn mit Klebeband zusammenflicken, damit sie überhaupt was beerdigen konnten.«
»Leck mich, ich hab ein Recht auf einen Anwalt.« Stone fing an zu schwitzen. Davenport war ein Killer.
Lucas schüttelte mit einem Bühnenseufzer den Kopf. »Ich weiß nicht, Elwood. Darf ich dich Elwood nennen?«
»Leck mich ...«
»Manchmal ist das Leben ungerecht. Weißt du, woher ich komme? Genau wie der junge Turner. Und nehmen wir mal deinen Fall, Elwood. Im Strafgericht sitzen nur Bürokraten. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben das Strafmaß für Rauschgiftbesitz mit Verkaufsabsicht geändert. Weißt du, wie das Strafmaß für einen dreifachen Rückfalltäter bei Besitz mit Verkaufsabsicht aussieht?«
»Ich bin kein Scheißanwalt ...«
»Sechs Jahre, mein Freund. Minimum. Ein süßer Kerl wie du ... dein Arschloch wird aussehen wie der Tunnel der I-94, wenn du wieder rauskommst. Scheiße, vor zwei Monaten wärst du noch mit zwei Jahren davongekommen.«
»Leck mich, Mann, ich will ’nen Anwalt.«
Lucas beugte sich dicht zu ihm und fletschte die Zähne. »Und ich brauch Stoff. Jetzt. Gib mir etwas Stoff, und ich zieh Leine.«
Stone sah ihn durch und durch fassungslos an. »Sie? Brauchen Stoff?«
»Klar. Ich muß einen Typ in die Mangel nehmen.«
Das Licht in Stones Augen erlosch. Erpressung. Das ergab einen Sinn. Daß Davenport das Zeug wirklich selbst rauchte, das ergab keinen Sinn. »Ich kann gehen?«
»Du kannst gehen.«
Stone dachte einen Moment darüber nach, dann nickte er, stand auf und kramte in der Hemdentasche. Er holte ein Glasröhrchen mit einem schwarzen Plastikstöpsel heraus. Darin befanden sich fünf Klumpen Crack.
»Wieviel brauchen Sie?« fragte er.
»Alles«, sagte Lucas. Er nahm Stone das Röhrchen weg. »Und laß dich nicht mehr in der Nähe von diesem halfway house blicken. Wenn ich dich noch mal hier erwische, reiß ich dir den Arsch auf.«
Die Assistenten des Gerichtsmediziners schleiften Bentons Leichnam gerade aus dem Indianerzentrum, als Lucas wieder dort eintraf. Ein Kameramann vom Fernsehen lief vor der Bahre her, die mit dem zugedeckten Toten auf dem Bürgersteig entlang rollte, dann machte er einen gekonnten Seitensprung und schwenkte über die Gesichter einer kleinen Schar Schaulustiger. Lucas ging an dieser Schar vorbei und die Reihe der Streifenwagen entlang. Yellow Hand wartete ungeduldig. Lucas ließ von dem Streifenpolizisten die Hintertür aufmachen und stieg zu dem Jungen ein.
»Warum gehen Sie nicht rüber ins 7-Eleven und holen sich einen Doughnut«, schlug Lucas dem Cop vor.
»Nee. Zu viele Kalorien«, sagte der Cop. Er machte es sich wieder auf dem Vordersitz bequem.
»Hören Sie, machen Sie schleunigst einen Abgang, kapiert?« fragte Lucas verzweifelt.
»Oh. Klar. Ja. Ich geh mir einen Doughnut holen«, sagte der Uniformierte, der den Wink mit dem Zaunpfahl endlich kapiert hatte. Man erzählte sich Gerüchte über Davenport ...
Lucas sah dem Polizisten nach, dann drehte er sich zu Yellow Hand um.
»Wer war der Typ?«
»Och, Davenport, ich kenne den Typen nicht ...« Yellow Hands Adamsapfel hüpfte rechtschaffen.
Lucas holte das Glasröhrchen aus der Tasche und drehte es so in den Fingern, daß der Junge die schmutzig weißen Klümpchen Crack sehen konnte. Yellow Hand leckte sich mit der Zunge die Lippen, während Lucas langsam den Plastikstöpsel abschraubte und die fünf Klümpchen auf die Handfläche fallen ließ.
»Das ist guter Stoff«, sagte Lucas beiläufig. »Ich habe ihn Elwood Stone beim halfway house abgenommen. Kennst du Elwood? Seine Mama braut das Zeug selbst. Sie bekommt es von den Kubanern an der Westside von St. Paul. Echt guter Stoff.«
»Mann. O Mann. Tun Sie das nicht.«
Lucas hielt einen kleinen Klumpen zwischen Daumen und Zeigefinger. »Wer war es?«
»Mann, ich kann nicht ...« Yellow Hand litt Qualen und verdrehte seine dünnen Finger. Lucas drückte den Klumpen zusammen, stieß die Tür mit dem Ellbogen auf und ließ die Krümel wie Sand in einem Stundenglas auf den Boden rieseln.
»Bitte nicht.« Yellow Hand war entsetzt.
»Noch vier«, sagte Lucas. »Ich brauche nur einen Namen, dann kannst du abzischen.«
»O Mann ...«
Lucas nahm den nächsten Klumpen, hielt ihn Yellow Hand dicht vors Gesicht und drückte gerade langsam zu, als Yellow Hand hervorstieß: »Halt.«
»Wer?«
Yellow Hand sah zum Fenster hinaus. Jetzt war es warm, aber man konnte die Kälte der Nacht schon spüren. Der Winter kam. Schlimme Zeit für einen obdachlosen Indianer.
»Bluebird«, murmelte er. Sie kamen aus demselben Reservat, und er hatte den Mann für vier Brocken Crack verraten.
»Wer?«
»Tony Bluebird. Er hat ein Haus an der Franklin.«
»Was für ein Haus?«
»Scheiße, ich weiß die Nummer nicht ...«, winselte er. Seine Augen zuckten hin und her. Die Augen eines Verräters.
Lucas hielt den Klumpen wieder vor Yellow Hands Gesicht. »Los doch, los doch ...«
»Kennen Sie das Haus, wo der alte Bursche die Verandapfeiler mit Punkten bemalt hat?« Yellow Hand sprach jetzt hastig, weil er es schnell hinter sich bringen wollte.
»Ja.«
»Zwei weiter. Richtung Fernsehgeschäft.«
»Hat der Typ schon mal Ärger gehabt? Bluebird?«
»O ja. Hat ein Jahr in Stillwater gesessen. Einbruch.«
»Was noch?«
Yellow Hand zuckte die Schultern. »Er kommt aus Fort Thompson. Im Sommer ist er dort, im Winter arbeitet er hier. Ich kenne ihn nicht gut, er war nur im selben Res. Hat ’ne Frau, glaub ich. Ich weiß nicht, Mann. Er kennt meine Familie. Er ist älter als ich.«
»Hat er eine Waffe?«
»Weiß nicht. Er ist kein Freund. Aber ich hab nie gehört, daß er Streit gehabt hätte oder so.«
»Gut«, sagte Lucas. »Wo wohnst du?«
»Im Point. Oberster Stock, mit ein paar anderen Typen.«
»War das nicht eines von Ray Cuervos Häusern? Ehe er abgestochen worden ist?«
»Ja.« Yellow Hand starrte das Crack auf Lucas’ Handfläche an.
»Okay.« Lucas ließ die vier verbliebenen Klumpen wieder in das Röllchen kullern und gab es Yellow Hand. »Steck dir das in eine Socke und sieh zu, daß du wieder ins Point kommst. Wehe dir, du bist nicht da, wenn ich vorbeikomme.«
»Ich bin da«, sagte Yellow Hand eifrig.
Lucas nickte. Die hintere Tür des Streifenwagens hatte keinen Griff und er hatte sorgfältig darauf geachtet, daß sie nicht ins Schloß gefallen war. Jetzt stieß er sie auf, stieg aus, und Yellow Hand rutschte herüber und stieg neben ihm aus. »Will nur hoffen, daß das stimmt. Mit diesem Bluebird«, sagte Lucas und stieß mit einem Finger gegen Yellow Hands schmale Brust.
Yellow Hand nickte. »Er war es. Ich hab mit ihm gesprochen.«
»Okay. Hau ab.«
Yellow Hand entfernte sich hastig. Lucas sah ihm einen Augenblick nach, dann ging er über die Straße zum Indianerzentrum. Er fand Wentz im Büro des Direktors.
»Wie geht es unserem Zeugen?« fragte der Polizist.
»Er ist auf dem Heimweg.«
»Was?«
»Er bleibt in der Nähe«, sagte Lucas. »Er behauptet, der Mann, den wir suchen, ist ein gewisser Tony Bluebird. Wohnt an der Franklin. Ich kenne das Haus, und er ist vorbestraft. Wir müßten ein Foto bekommen können.«
»Verdammt«, sagte Wentz. Er griff zum Telefon. »Das muß ich gleich durchgeben.«
Lucas hatte nichts mehr zu tun. Mord war Sache der Mordkommission. Lucas war für die Beschaffung von Informationen zuständig. Er hatte ein Netz von Straßentypen, Kellnerinnen, Barkeepern, Friseuren, Spielern, Nutten, Zuhältern, Buchmachern, Autohändlern, Koksdealern, Briefträgern, ein paar Einbrechern. Die Gauner waren kleine Fische, aber sie hatten Augen und Ohren. Lucas hatte immer einen Dollar oder eine Drohung parat, was jeweils erforderlich war, einen Spitzel zum Auspacken zu bringen.
Er hatte nichts mehr damit zu tun, aber nachdem Yellow Hand den Namen ausgespuckt hatte, blieb Lucas noch eine Weile und verfolgte, wie die Polizeimaschinerie arbeitete. Das war manchmal das reinste Vergnügen. Wie jetzt. Als der Cop von der Mordkommission im Revier anrief, passierte mehreres gleichzeitig.
Eine Rückfrage in der Identifikationsabteilung ergab, daß Yellow Hands Informationen stimmten, und ein Foto von Tony Bluebird wurde zum Indianerzentrum gebracht.
Gleichzeitig versammelte sich die Emergency Response Unit von Minneapolis auf dem Parkplatz eines Spirituosenladens eine Meile von Bluebirds mutmaßlicher Unterkunft entfernt.
Während sich die ERU versammelte, ergab eine weitere Rückfrage beim E-Werk, daß Bluebird tatsächlich in dem Haus wohnte, das Yellow Hand angegeben hatte. Vierzig Minuten, nachdem Yellow Hand Bluebirds Namen preisgegeben hatte, schlenderte ein großer Farbiger in Armeejacke und Blue Jeans an Bluebirds Haus vorbei die Straße entlang zum Nachbarhaus, trat auf die Veranda, klopfte, zeigte seine Marke und bat um Einlaß. Die Bewohner kannten keinen Bluebird, aber die Mieter kamen und gingen.
Ein anderer Detective, ein Weißer, der aussah, als wäre er mit einem Rußbeutel durch die Hölle gejagt worden, klopfte im Haus vor dem von Bluebird an und zog dasselbe Spiel durch.
»Ja, Tony Bluebird, so heißt der Kerl«, sagte der ältere Mann, der die Tür aufgemacht hatte. »Was hat er angestellt?«
»Wir sind nicht sicher, ob er was angestellt hat«, sagte der Detective. »Haben Sie den Mann in letzter Zeit gesehen? Ich meine heute?«
»Klar doch. Ist keine halbe Stunde her, da ist er heimgekommen und ins Haus gegangen.« Der alte Mann zupfte sich nervös an der Unterlippe. »Ich schätze, er ist immer noch drinnen.«
Der weiße Polizist meldete sich und bestätigte Bluebirds Anwesenheit. Dann beobachteten er und der Farbige durch die Fenster der Nachbarhäuser eingehend Bluebirds Domizil und gaben ihre Erkenntnisse dem Leiter der ERU durch. Wenn sie einen Mann eingekreist hatten, versuchten sie normalerweise Kontakt herzustellen, üblicherweise telefonisch. Aber bei Bluebird dachten sie, er könnte durchgedreht sein. Vielleicht eine Gefahr für Geiseln oder sich selbst. Sie beschlossen, ihn rauszuholen. Die Männer der ERU fuhren in neutralen Lieferwagen zu einer zweiten Anlaufstelle drei Blocks von Bluebirds Haus entfernt.
Während das alles passierte, identifizierte Betty Sails Bluebird aus einer ganzen Reihe Fotos. Der Basketballspieler bestätigte die Identität ebenfalls.
»Guten Spitzel haben Sie da, Lucas«, sagte Wentz bewundernd. »Kommen Sie mit?«
»Warum nicht.«
Die ERU-Leute fanden eine nicht einsehbare Stelle an der Hintertür von Bluebirds Haus. Die Tür hatte kein Fenster, und bei dem einzigen Fenster daneben waren die Rollos heruntergelassen. Sie konnten sich zur Tür schleichen, sie aufbrechen und wären im Haus, noch ehe Bluebird mitbekam, daß sie da waren.
Das hätte auch funktioniert, wäre Bluebirds Vermieter nicht so geldgierig gewesen. Der Vermieter hatte das Haus illegal in zwei Wohnungen aufgeteilt. Diese Unterteilung folgte praktischen, keinen ästhetischen Gesichtspunkten: Die Tür, die den vorderen Teil des Hauses mit dem hinteren verband, war mit einer zwei Zentimeter starken Spanplatte zugenagelt worden.
Als der Einsatzleiter »Los« sagte, warf einer der ERU-Männer eine Leuchtgranate durch Bluebirds Seitenfenster. Die Explosion und der grelle Lichtblitz würden jeden ein paar Augenblicke starr vor Schreck machen – so lange, daß das ERU-Team Zeit hatte, ihn zu überwältigen. Als die Granate losging, schoß ein zweiter Mann mit einer Schrotflinte die Hintertür auf, worauf der Einsatzleiter gefolgt von drei Männern ins Haus stürmte.
Eine junge Mexikanerin lag dösend auf dem Sofa und hatte ein Baby auf dem Bauch. Ein älteres Kind im Krabbelalter saß in einem baufälligen Laufstall. Die Mexikanerin hatte das Baby gesäugt, ihre Bluse war offen, die Brüste entblößt. Sie schrak als Reaktion auf die Leuchtgranate und den Schuß hoch und riß vor Angst Mund und Augen auf.
Der Einsatzleiter sicherte einen Korridor, der größte Mann des Teams warf sich gegen die Spanplatte, trat zweimal dagegen und gab auf.
»Wir sind ausgesperrt, wir sind ausgesperrt!« schrie er.
»Gibt es einen Weg nach vorne?« fragte der Einsatzleiter die Mexikanerin. Die immer noch benommene Frau verstand ihn nicht, worauf der Einsatzleiter seine Männer nahm und mit ihnen um das Haus herum stürmte.
Ihr Angriff dauerte zehn Sekunden, und sie hofften immer noch, ihn sauber über die Bühne zu bekommen, als eine Frau vorne im Haus schrie. Danach fielen mehrere Schüsse, ein Fenster zersplitterte, und der Einsatzleiter nahm an, daß Bluebird eine Geisel hatte. Er blies den Angriff ab.
Komische Sache mit dem Sex, dachte der Einsatzleiter.
Er stand mit dem Rücken an der abblätternden weißen Seitenwand des Hauses, hatte die Schrotflinte in der Hand, und Schweiß lief ihm übers Gesicht. Der Angriff war chaotisch gewesen, das Ergebnis – die Schießerei – etwas, das er fürchtete, nämlich ein Feuergefecht aus nächster Nähe mit einem Irren, bei dem man fürchten mußte, daß einem plötzlich der Lauf einer Pistole in der Nase steckte. Dennoch stand ihm dauernd die schmale Brust der Mexikanerin vor Augen, sein Hals war zugeschnürt, und er konnte sich kaum auf den Kampf um Leben und Tod konzentrieren, den er leiten sollte ...
Als Lucas eintraf, hatten zwei Streifenwagen vor Bluebirds Haus Stellung bezogen, auf der anderen Straßenseite, und Männer der ERU warteten auf den Veranden der Häuser rechts und links von dem Bluebirds. Dahinter hatte sich ein Sperrkommando verschanzt. Trommelmusik tönte aus dem Haus.
»Reden wir mit ihm?« fragte Lucas den Einsatzleiter.
»Wir haben ihn angerufen, aber das Telefon haben wir verloren«, antwortete der Einsatzleiter. »Die Telefongesellschaft sagt, es funktioniert nicht mehr. Wir glauben, daß er die Leitung rausgerissen hat.«
»Wie viele Menschen sind da drinnen?«
Der Einsatzleiter zuckte die Achseln. »Die Nachbarn sagen, er hat eine Frau und zwei Kinder im Vorschulalter. Keine Ahnung, ob sonst noch jemand.«
Ein Fernsehwagen fuhr am Ende der Straße vor, wo ein Streifenpolizist ihn aufhielt. Am anderen Ende des Blocks erschien ein Reporter des Star Tribune; an seiner Seite stapfte ein Fotograf. Eine Frau von dem Fernsehteam unterbrach ihren Streit mit dem Streifenpolizisten lange genug, um auf Lucas zu deuten und zu rufen. Als Lucas sich umdrehte, rief sie seinen Namen, und Lucas kam bedächtig den Block hinunter. Nachbarn wurden auf dem Bürgersteig zusammengetrieben. In einem Haus fand eine Geburtstagsparty statt; ein halbes Dutzend Kinder ließen Heliumballons über den Köpfen der zusammenströmenden Menge schweben. Sah wie Karneval aus, dachte Lucas.
»Was geht hier vor, Davenport?« rief die Fernsehreporterin an dem Streifenpolizisten vorbei. Die Reporterin war eine Schwedin der athletischen Abart, hohe Wangenknochen, schmale Hüften und blutroter Lippenstift. Neben ihr stand ein Kameramann, der die Kamera auf Bluebirds Haus gerichtet hatte.
»Der Mord heute im Indianerzentrum? Wir glauben, wir haben den Täter da drinnen gestellt.«
»Hat er Geiseln?« fragte die Reporterin. Sie hatte keinen Notizblock.
»Wissen wir nicht.«
»Können wir näher ran? Irgendwie? Wir brauchen einen besseren Winkel ...«
Lucas sah über das abgesperrte Gebiet.
»Wie wäre es, wenn wir versuchen, euch in die Gasse dort drüben zwischen den Häusern zu bekommen? Ihr wärt weiter weg, hättet aber direkten Blick auf ...«
.»Da passiert was«, sagte der Kameramann. Er beobachtete Bluebirds Haus durch das Teleobjektiv seiner Kamera.
»Oh, Scheiße«, sagte die Reporterin. Sie versuchte, sich an dem Streifenpolizisten vorbei neben Lucas zu drängen, doch der Polizist blockte sie mit der Hüfte ab.
»Wir sehen uns später«, sagte Lucas über die Schulter und drehte sich um.
»Kommen Sie, Davenport ...«
Lucas schüttelte den Kopf und ging weiter. Der Einsatzleiter der ERU auf der Veranda des Hauses links schrie etwas zu dem von Bluebird hinüber. Er bekam eine Antwort, trat etwas zurück und nahm ein Sprechfunkgerät in die Hand.
»Was?« fragte Lucas, als er wieder beim Einsatzkommando war.
»Er hat gesagt, er schickt seine Familie raus«, sagte ein Polizist über Funk.
»Ich ziehe alle zurück«, sagte der Einsatzleiter. Während sich Lucas aufs Dach des Streifenwagens stützte, um besser sehen zu können, schickte der Einsatzleiter einen Streifenpolizisten an der Reihe geparkter Autos entlang, um die ERU-Männer und die uniformierten Beamten zu informieren, daß Leute aus dem Haus kamen. Einen Augenblick später wurde ein weißes Handtuch aus der Tür geschwenkt, worauf eine Frau herauskam, die ein Baby trug. Ein zweites Kind, etwa drei Jahre alt, zog sie am Arm hinter sich her.
»Los doch, los doch, alles in Ordnung«, rief der Detective. Sie drehte sich noch einmal um, dann schritt sie schnell und mit gesenktem Kopf auf dem Bürgersteig zwischen den Autos hindurch.
Lucas und der Einsatzleiter gingen hin, um sie zu vernehmen.
»Wer sind Sie?« fragte der Einsatzleiter.
»Lila Bluebird.«
»Ist das Ihr Mann da drinnen?«
»Ja.«
»Ist jemand bei ihm?«
»Er ist ganz allein«, sagte die Frau. Tränen strömten ihr übers Gesicht. Sie trug ein Männerhemd und Shorts aus einem elastischen schwarzen Stoff mit Troddeln. Das Baby klammerte sich an ihrem Hemd fest, als wüßte es, was vor sich ging; das andere Kind hing an ihrer Hand. »Er hat gesagt, ich soll Ihnen ausrichten, er kommt in einer Minute raus.«
»Ist er betrunken? Crack? Crank? Irgend so was?«
»Nein. Wir haben weder Alkohol noch Drogen im Haus. Aber etwas stimmt nicht mit ihm.«
»Was soll das heißen? Ist er übergeschnappt? Was ...«
Die Frage wurde nie zu Ende gesprochen. Die Tür von Bluebirds Haus wurde aufgestoßen, und Tony Bluebird lief auf den Rasen und rannte, was das Zeug hielt. Er hatte den Oberkörper entblößt, ein Obsidianmesser hing ihm an einer Lederschnur um den Hals. Er hatte zwei Adlerfedern an den Kopfschmuck gesteckt und Pistolen in beiden Händen. Zehn Schritte von der Veranda entfernt riß er sie hoch und eröffnete das Feuer auf die Männer in unmittelbarer Nähe, wobei er immer weiter auf die Polizisten zulief. Die Cops schossen ihn in Fetzen. Das Gewehrfeuer richtete ihn erst auf und warf ihn dann um.
Nach einem Augenblick fassungslosen Schweigens fing Lila Bluebird an zu wimmern, und das ältere Kind klammerte sich ängstlich an ihrem Bein fest und weinte. Der Funker rief nach den Notärzten. Drei Polizisten gingen auf Bluebird zu, ihre Pistolen auf die Leiche gerichtet, und stießen seine Waffen außer Reichweite.
Der Einsatzleiter sah Lucas an und bewegte einen Augenblick den Mund, ehe er etwas herausbrachte. »Herrgott noch mal«, sagte er. »Was sollte das denn bloß?«
Kapitel 3
Wilder Wein überzog die Weiden, die zehn bis fünfzehn Meter zur Wasseroberfläche hinabhingen. Im trüben Licht von der Mendota Bridge sah die Insel wie ein Dreimastschoner mit schwarzen Segeln aus, der durch die Mündung des Minnesota River in den Mississippi kreuzte.
Zwei Männer schritten zur Sandbank an der Spitze der Insel. Sie hatten früher am Abend ein Feuer entfacht, Wiener Würstchen auf spitzen Stöcken über den Flammen gegrillt und Dosen Spaghetti-O’s gewärmt. Das Feuer war zu Asche niedergebrannt, doch der Geruch von verbranntem Kiefernholz hing noch in der kühlen Luft. Dreißig Meter vom Ufer entfernt verbarg sich ein Zelt unter den Weiden.
»Wir sollten nach Norden ziehen. Dort wäre es jetzt schön, bei den Seen«, sagte der größere.
»Es ist zu warm. Zu viele Moskitos.«
Der große Mann lachte. »Dummes Zeug, Moskitos. Wir sind Indianer, Pißkopf.«
»Die verdammten Chippewa würden unsere Skalps holen«, wandte der kleinere mit humorvollem Unterton ein.
»Unsere doch nicht. Wir töten ihre Männer und vögeln ihre Frauen. Trinken ihr Bier.«
»Ich trink kein Gerstensaft«, sagte der kleinere. Es herrschte einen Augenblick behagliches Schweigen zwischen ihnen. Der kleinere holte tief Luft, ließ sie als deutlichen Seufzer ausströmen und sagte: »Zuviel zu tun. Wir können uns nicht nach Norden verdrücken.«
Das Gesicht des kleineren Mannes war ernst geworden. Der große Mann konnte es nicht sehen, spürte es aber. »Ich wünschte, ich könnte für Bluebird beten«, sagte der große Mann. Nach einem Augenblick fügte er hinzu: »Ich hatte gehofft, er würde es länger machen.«
»Er war nicht klug.«
»Er war spirituell.«
»Stimmt.«
Die Männer waren Mdewakanton Sioux, Vettern, am selben Tag an den Ufern des Minnesota River geboren. Einer war auf den Namen Aaron Sunders, der andere Samuel Close getauft worden, aber nur die Bürokraten nannten sie so. Für alle anderen, mit denen sie in Berührung kamen, waren sie die Crows, nach Dick Crow, dem Vater ihrer Mütter.
Später in ihrem Leben gab ihnen ein Medizinmann Dakota-Vornamen. Die Namen waren unmöglich zu übersetzen. Manche Dakota sprachen von Light Crow und Dark Crow. Andere sagten Sun Crow und Moon Crow. Wieder andere behaupteten, die einzig sinnvolle Übersetzung wäre Spiritual Crow und Practical Crow. Aber die Vettern nannten sich Aaron und Sam. Wenn ein paar Dakota und Möchtegern-Weiße fanden, daß die Namen nicht eindrucksvoll genug waren, war das ihr Problem.
Der große Crow war Aaron, der spirituelle Mann. Der kleine Crow war Sam, der praktische. Hinten auf ihrem Pickup hatte Aaron einen Armeespind voller Kräuter und Rinden. In der Kabine hatte Sam zwei .45er, einen Louisville Slugger und einen Geldgürtel. Sie betrachteten sich als eine Persönlichkeit in zwei Körpern, wobei jeder Körper einen einzelnen Aspekt enthielt. So war es schon seit 1932, als die Töchter von Dick Crow und ihre beiden kleinen Söhne vier Monate lang auf engstem Raum in einem Segeltuchzelt gehaust hatten, fast verhungerten, fast erfroren und darum kämpften, am Leben zu bleiben. Von Dezember bis März hatten die Vettern in einem Pappkarton voller zerrissener Wolldecken aus Armeebeständen gehaust. Diese vier Monate hatten ihre beiden Persönlichkeiten zu einer verschmolzen. Sie waren seit fast sechzig Jahren so gut wie unzertrennlich, abgesehen von der Zeit, die Aaron im Bundesgefängnis abgesessen hatte.
»Ich wünschte, wir würden etwas von Billy hören«, sagte Sam Crow.
»Wir wissen, daß er dort ist«, sagte Aaron Crow leise.
»Aber was treibt er? Es sind jetzt drei Tage, und nichts.«
»Du machst dir Sorgen, daß er wieder angefangen hat zu trinken. Brauchst du nicht, er läßt es bleiben.«
»Woher weißt du das?«
»Ich weiß es.«
Sam nickte. Wenn sein Vetter sagte, daß er es wußte, dann wußte er es. »Ich mache mir Sorgen, was passiert, wenn er zuschlägt. Die New Yorker Cops sind bei so was verdammt gut.«
»Hab Vertrauen zu Billy«, sagte Aaron. Aaron war dünn, aber nicht gebrechlich: drahtig, hart, wie Dörrfleisch. Er hatte hundert schroffe Ebenen im Gesicht, die eine hohe Nase umgaben. Seine Augen waren wie schwarze Murmeln. »Er ist schlau. Er wird es richtig machen.«
»Das hoffe ich. Wenn er gleich geschnappt wird, ist das Fernsehen zu schnell fertig mit dem Fall.« Sam hatte ein breites Gesicht mit Lachfalten um ein feistes, weiches Kinn. Sein Haar war braun meliert, die Augen tief und nachdenklich. Er hatte einen Bauch, der über einen breiten Gürtel mit einer Türkisschnalle hing.
»Wenn Leo sich beeilt, nicht. Er müßte morgen in Oklahoma sein, wenn sein Auto durchhält«, sagte Aaron. »Wenn die beiden ... Anschläge ... unmittelbar aufeinander folgen, drehen sie beim Fernsehen durch. Und die Briefe sind fertig«
Sam schritt zum Ufer, sah einen Moment auf das Wasser, drehte sich dann wieder um und sprach über den Sandstreifen.
»Ich finde, die beiden ersten waren ein Fehler. Das mit Bluebird war eine Verschwendung, dieser zweite Mord. Diese Morde haben nicht die Wirkung, die wir brauchen ...«