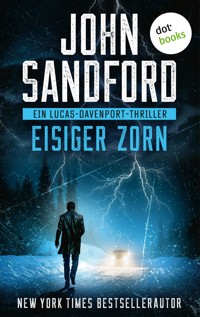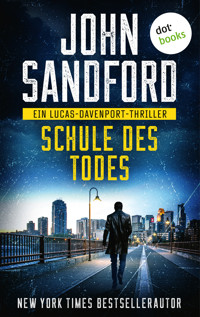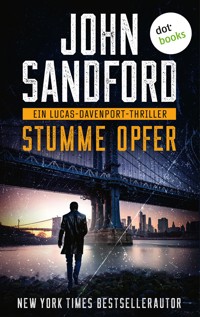
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
Sein Hass kennt keine Grenzen: Der rasante Thriller »Stumme Opfer« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Im Staatsgefängnis von New York wartet Michael Bekker, ein brillanter Mediziner und drogenabhängiger Psychopath, auf sein Urteil. Er ist besessen von der Idee, die »Strahlung« zu erforschen, die im Augenblick des Todes vom menschlichen Auge ausgeht. Doch dann passiert das Undenkbare: Kurz vor der Urteilsverkündung gelingt ihm die Flucht. Nur einer ist in der Lage, Bekker zu stoppen: Lucas Davenport, der den psychotischen Killer einst nach einer halsbrecherischen Jagd festgenommen hat. Er weiß, dass Bekker zu allem entschlossen ist – und so setzt er sein eigenes Leben aufs Spiel, um den »Augenschlitzer« zu fassen … »John Sandford versteht es wie kein Zweiter, mit seinen Thrillern Schockwellen durch die Leser zu jagen.« New York Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »Stumme Opfer« von John Sandford – der spektakuläre vierte Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von David Baldacci und Jussi Adler-Olsen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im Staatsgefängnis von New York wartet Michael Bekker, ein brillanter Mediziner und drogenabhängiger Psychopath, auf sein Urteil. Er ist besessen von der Idee, die »Strahlung« zu erforschen, die im Augenblick des Todes vom menschlichen Auge ausgeht. Doch dann passiert das Undenkbare: Kurz vor der Urteilsverkündung gelingt ihm die Flucht. Nur einer ist in der Lage, Bekker zu stoppen: Lucas Davenport, der den psychotischen Killer einst nach einer halsbrecherischen Jagd festgenommen hat. Er weiß, dass Bekker zu allem entschlossen ist – und so setzt er sein eigenes Leben aufs Spiel, um den »Augenschlitzer« zu fassen …
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Die Website des Autors: johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: instagram.com/johnsandfordauthor/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
***
eBook-Neuausgabe April 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »Silent Prey« bei G.P. Putnam’s Sons, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1993 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Marquicio Pagola und AdobeStock/ana
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-008-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Stumme Opfer« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Stumme Opfer
Ein Lucas-Davenport-Thriller 4
Aus dem Amerikanischen von Klaus Fröba
dotbooks.
Kapitel 1
Durch das Chaos in Bekkers Hirn zuckte es wie ein jäher Blitz.
Das Schwurgericht.
Er schnappte danach, wie man eine Fliege mit der hohlen Hand fängt.
In sich zusammengesackt saß er auf der Anklagebank und ließ – mit einem Blick, so leblos wie die Kunststoffkugeln in einem Puppengesicht – die leeren blauen Augen durch den Gerichtssaal wandern. Einen Atemzug lang hakte der Blick sich am Lichtschalter fest, ehe er sich nach unten tastete, zur Steckdose, und schließlich an der Reihe der Gesichter entlangglitt, die ihn anstarrten.
Man hatte ihm das Haar kurz gestutzt, der übliche Gefängnisschnitt, den Bart aber stehenlassen. Ein Akt der Barmherzigkeit, denn was sonst hätte die rosafarbenen Narben verdecken sollen, die ihm wie das Muster eines Schnittbogens ins Gesicht gezeichnet waren? Im unteren Drittel des Bartes schimmerte als rotes Oval der Mund. Die feuchten Lippen klappten auf, schlossen sich wieder, klappten auf – unablässig, wie bei einem Aal, der in der Reuse gefangen ist und nach Luft schnappt.
Bekker spürte dem Gedanken nach. Das Schwurgericht.
Hausfrauen, Rentner, Gestrandete, die von der Fürsorge lebten. Das sollten Gleichgestellte sein – Leute, die aus der gleichen sozialen Schicht kamen wie er? Lächerlich. Er war Doktor der Medizin. Beruflich anerkannt und geachtet. Eine Koryphäe. Da konnte er doch nur den Kopf schütteln.
Ausführungen ...?
Von vorn kam das. Die Richterin, die schwarze Krähe, hatte es gesagt. Und nun bahnten sich die Worte taumelnd ihren Weg in sein Gehirn. »Können Sie den Ausführungen folgen, Mr. Bekker?«
Was...?
Der Pflichtverteidiger, dieser glatthäutige Idiot, zupfte ihn am Ärmel. »Stehen Sie auf.«
Was...?
Die Anklagevertreterin starrte zu ihm hinüber, Haß im Blick. Haß, den er körperlich spüren konnte. Und er öffnete sein Gehirn einen Spalt weit und ließ den Haß zurückfluten. Dich hätte ich gern mal in den Fingern, nur fünf Minuten. Sollst mal sehen, wie schnell ich dich mit einem scharfen Skalpell aufschlitzen würde. Zip, zip – und schon wärst du gespreizt wie eine Auster. Aufgeklappt wie eine gottverdammte Muschel.
Die Staatsanwältin spürte, daß etwas in ihm vorging. Bei der mußte man aufpassen. Sechshundert Männer und Frauen hatte sie schon hinter Gitter gebracht. Aber das Weib mit seinen albernen Drohungen und verworrenen Antragsbegründungen konnte ihm gestohlen bleiben. Was hier herauskam, stand sowieso fest. Eine Farce, das Ganze. Lohnte sich nicht, auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Dahinvegetieren in Hennepin, in den Käfigen des Bezirksgefängnisses. Und verkümmern ohne seine Medikamente.
Aber nun war die Stunde gekommen.
Sein Blut floß immer noch zu langsam. Quälte sich zähflüssig wie Erdbeermarmelade durch die Adern. Er wollte dagegen ankämpfen, war allerdings auf einmal mehr damit beschäftigt, niemanden merken zu lassen, wieviel Anstrengung ihn das kostete.
Konzentration.
Der Gerichtssaal war mit fahlbraunem Holz getäfelt. Vorn der Richtertisch auf einem Podest. Rechts das Geviert der Geschworenen und der Tisch der Anklagevertreterin. Mitten im Raum die Anklagebank, gegenüber dem Richtertisch. Ein Geländer trennte den hinteren Teil des Raumes ab. Vierzig Zuschauerstühle, hart und unbequem, am Boden festgeschraubt. Eine Stunde vor Beginn der Verhandlung waren dort schon alle besetzt gewesen. Die Hälfte der Plätze hatte man für die Presse reserviert, die anderen ergatterten diejenigen, die zuerst gekommen waren. Und die ganze Zeit über, während hier vorn geredet und geredet wurde, konnte er die Gaffer da hinten seinen Namen raunen hören. Bekker, Bekker, Bekker.
Die Geschworenen schoben sich nach draußen, einer hinter dem anderen. Ohne auch nur einmal zu ihm herüberzuschauen. Das Gesocks, das angeblich der gleichen sozialen Schicht angehörte wie er, zog sich zurück. Und wenn sie sich ausgequatscht hatten, kamen sie zurück und sprachen ihn schuldig. Schuldig des mehrfachen, vorsätzlichen Mordes. Genauso würde es kommen. Und dann brachte die Krähe am Richtertisch ihn hinter Gitter.
Der Typ in der Nachbarzelle, der Schwarze, hatte es ihm vorhergesagt. »Die nageln dir ’n Arsch fest, Alter. Nach Oak Park stecken sie dich. In ’nen beschissenen Käfig, so groß wie ’n beschissener Kühlschrank. Und mit ’m Fernsehauge drin, das dich keine Sekunde losläßt. Nicht mal, wenn du dir ’n Arsch abwischst. Die sehen das alles. Machen sogar Aufzeichnungen davon. Aus Oak Park ist noch keiner rausgekommen. Ist ’n echter Scheißladen.«
Aber da würde er nicht hingehen. Der Gedanke fraß sich immer tiefer in ihn hinein. Er schüttelte sich. Rang mit sich, um sich nichts anmerken zu lassen.
Konzentration...
Er fing bei sich selbst an, mit dem Bereich zwischen Schritt und Nabel. Die verdammten Sporthosen kniffen um die Hüften herum. Der Einwegrasierer drückte ihm von hinten hart gegen die Hoden. Weiter oben störte die Sox-Mütze, die er – wohin sonst mit dem Ding? – unter den Gürtel gesteckt hatte. Gegen die Tauschwährung Zigaretten gab’s im Knast einfach alles. Das Lächerlichste waren die weißen Laufschuhe. Schweißfüße bekam er davon. Die weißen Socken aus den guten alten Tagen, noch mit dem eingewebten Äskulapstab an den Seiten – und dazu diese albernen weißen Laufschuhe! Nicht mal ein ausgemachter Idiot lief freiwillig so herum.
Kürzlich hatten sie ihm angeboten, er könne, wenn er wolle, seine eigenen Schuhe tragen, maßgeschneidert und luftgepolstert. War ihnen wohl plötzlich eingefallen, daß jeder bis zum Beweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten hat. Aber das hatte er abgelehnt. Was sie natürlich nicht begreifen konnten. Ausdruck seiner exzentrischen Persönlichkeit, eine andere Erklärung fiel denen nicht ein. Weiße Schuhe mit Kunststoffsohlen und dazu einen Siebenhundert-Dollar-Anzug ... Weil sie eben keine Ahnung hatten.
Konzentration.
Nun standen sie alle. Die Krähe fixierte ihn. Der Pflichtverteidiger, der Blödmann, zupfte schon wieder. Und dann kam Raymond Shaltie, beugte sich über ihn ...
»Los, komm hoch«, blaffte er ihn an.
Ausgerechnet der. Deputy bei Gericht, im Halbtagsjob. Zu fett um die Hüften, die graue Uniformjacke spannte.
Bekker sah hoch. »Wie lange?« fragte er den Anwalt. Wollte es fragen. Mußte um jedes Wort kämpfen. Die Zunge lag ihm dick und faul im Mund.
»Pssst ...«
Die Richterin redete gerade. Sah zu ihnen herüber.
»... Sie sich bitte bereit. Wenn Sie in meinem Büro hinterlassen, wo Sie telefonisch zu erreichen sind, werden wir Sie verständigen, sobald die Geschworenen soweit sind.«
Der Anwalt nickte. Sah starr geradeaus. Vermied jeden Blickkontakt mit ihm. Bekker hatte keine Chance. Und das war diesem verdammten Pflichtverteidiger gerade recht. Der wollte gar nicht, daß er eine Chance hatte. Für ihn war Bekker ein Irrer. Einer, der hinter Gitter gehörte. Für immer und ewig – und noch ein paar Tage dazu.
»Wie lange?« wiederholte Bekker seine Frage. Die Richterin war inzwischen weg, hatte sich zurückgezogen, die Krähe. Die würde ich mir gern mal vornehmen.
»Schwer zu sagen. Das wird weitgehend vom Abstimmungsergebnis der Geschworenen abhängen.« Typischer Pflichtverteidiger, vom Gericht bezahlt. Dem ging’s nur um sein Honorar.
Du weißt genau, was die entscheiden, du Arsch.
Shaltie griff nach seinem Arm. »Los, komm.« Grub ihm die Finger hart ins Nervenzentrum über dem Ellbogen. Ein alter Trick. Im Knast machten die Typen das immer so. Wollten sich auf die Weise Respekt verschaffen. Aber Shaltie, wenn er’s auch nicht ahnte, tat Bekker einen Gefallen damit.
Der scharfe Schmerz jagte ihm durchs Blut, hart und schnell wie rhythmisches Händeklatschen. Er blickte sich gehetzt um. Innerlich kalt wie eine Hundeschnauze. Das Chaos in seinem Hirn war auf einmal gebändigt. Er hatte es geschafft, die Gedanken, die sonst unablässig kreisten und sich ineinander verschlangen, in eine Ecke zu pferchen. Da rasten sie nun wie Ratten, die keinen Ausschlupf finden. Und er hatte Platz zum Denken.
»Bitte«, stammelte er wie ein verwirrtes Kind, »bitte, ich muß mal...«
Shaltie nickte. »Okay.«
Ray Shaltie war kein Unmensch. Zwei Jahrzehnte arbeitete er jetzt schon bei Gericht. Da lernt man eine Menge, und vieles glättet sich. Er hatte gelernt, daß auch die hartgesottensten Kerle irgendwie menschliche Wesen sind. Sogar Bekker, der bestimmt einer von den übelsten Burschen war. Ja, das mit dem menschlichen Wesen wollte Shaltie nicht einmal so einem absprechen. Denn sein Glaube lehrte ihn: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein ... Bekker war auf Abwege geraten, aber er blieb trotzdem ein Mensch. Und wie er ihm jetzt in weinerlichem Singsang etwas vorstammelte – daß die Hämorrhoiden ihm zu schaffen machten und daß Gefängnisse das reinste Gift dafür sei, dauernd Nudelgerichte und Käse und Brot, lauter Pampe, nichts Richtiges zum Kauen ... Wer hätte das besser verstanden als Shaltie, der selbst genug Ärger mit den Knötchen am Mastdarmende hatte.
Ja, ja, er mußte mal. Schon gut.
Während der Verhandlungstage war das immer so gewesen, jeden Nachmittag. Raymond Shaltie nahm ihn am Arm und führte ihn um das Viereck der Geschworenenplätze herum bis zur Tür. Bekker bewegte sich mit schlurfenden Schritten, stierte trübe ins Leere. An der Tür hielt Shaltie ihn fest, drehte ihn um. Brav wie ein Lämmchen, der Kerl, offensichtlich ganz woanders, weit weg in einer fernen Welt. Shaltie legte ihm Handschellen und die Fußfesseln an. Der zweite Deputy, der am Türrahmen gestanden und Bekker nicht aus den Augen gelassen hatte, sah keinen Grund mehr, warum er nicht davonschlendern und sich endlich seinem Lunchpaket widmen sollte.
Bekker blickte hoch. »Es wird höchste Zeit.«
»Ja, ja«, sagte Shaltie, »wir schaffen’s schon noch.«
Suppenspritzer auf der Krawatte, stellte Bekker fest. Und auf den Schultern Schuppen. Ein einfältiger Trottel.
Shaltie führte ihn auf den Flur. Bekker schlurfte mit stolpernden Trippelschritten neben ihm her. Knapp sechzig Zentimeter, mehr Raum gaben die Fußketten ihm nicht. Der schmale Flur führte zum Treppenhaus, ein Stockwerk tiefer lagen die Arrestzellen. Links vor dem Treppenhaus befand sich die Toilette, nur für Männer, kein Zugang für Besucher. Ein winziges Loch, Waschbecken, Urinal und hinter der Schwingtür das Sitzklo.
Shaltie kam mit in den Vorraum. »Okay, nun kannst du«, sagte er. Mit deutlich warnendem Unterton. Ärger wollte er nicht haben, dafür war er zu alt.
»Ja«, murmelte Bekker. Seine blaßblauen Augen schienen fast in den Höhlen zu verschwinden. Aber hinter den Augenhöhlen arbeitete ein hellwacher Verstand, der Adrenalinstoß brachte das Gehirn auf Hochtouren wie eine Dosis reinstes Amphetamin. Bekker drehte sich um, reckte Shaltie die Arme hin. Der Deputy schob den Schlüssel ins Schnappschloß und nahm dem Häftling die Handschellen ab. Ein eindeutiger Verstoß gegen die Vorschriften. Aber was hätte er machen sollen? Mit gefesselten Händen kann sich nun mal keiner den Hintern abwischen. Ganz davon abgesehen, daß Bekker sowieso keine Fluchtchance gehabt hätte – aus einem der oberen Stockwerke im Gerichtsgebäude, mit Ketten an den Fußgelenken. Zumal ihn in der Stadt jedes Kind auf Anhieb erkannt hätte, sein Gesicht mit dem wildwuchernden Bart starrte einen jetzt während der Prozeßtage von jedem Zeitungskiosk an.
Bekker verschwand schlurfend hinter der Schwingtür, schob von innen den Riegel vor, ließ die Hose herunter und setzte sich auf die Kloschüssel. Die Augen glasklar, der Blick hart.
Im Gefängnis durften sie aus Sicherheitsgründen nur Einwegrasierer mit der fest eingeschweißten Klinge benutzen; sie hatten extra einen Automaten aufgestellt, aus dem man die Dinger kostenlos ziehen konnte. Einen davon hatte sich Bekker für seine Zwecke präpariert. Den Griff abgebrochen, so daß bis auf einen kurzen Stumpf nur der Klingenkopf übriggeblieben war. Den so lange zu verstecken, bis die Gefangenen aus dem Waschraum geführt wurden, war kein Problem gewesen. Später hatte er die erste Gelegenheit dazu benutzt, mit einem Streichholz die Kanten am Griffstumpf rund zu schmelzen, damit das Ding beim Tragen nicht drückte. Was besonders unangenehm gewesen wäre, weil ihm als beste Lösung einfiel, sich den Klingenkopf mit einem Pflaster unter die Hoden zu kleben. Jetzt, in der winzigen Klozelle, zog er den Pflasterstreifen ab und fing an, mit der Klinge im Bartgestrüpp herumzuschneiden.
Er hatte sich den Bart stehenlassen, um das zernarbte Gesicht dahinter zu verbergen. Er, ausgerechnet er mußte sein einst so wunderschönes Antlitz verstecken – klassisch nordisch geschnitten, makellos, mit dezenter Blässe, gekrönt vom rosenfarbenen Oval eines schöngeschwungenen Mundes. Und all das war nun – den kläglichen Versuchen der Ärzte zum Trotz – für alle Zeiten verwüstet. Zu einer häßlichen Fratze hatte der Kerl ihm das Gesicht zerschlagen.
Davenport. Schnapp dir Davenport.
Und schon begannen die Phantasien in ihm zu wuchern. Davenport aufschlitzen. Ihm mit dem Messer das Gesicht schälen, Zentimeter um Zentimeter die Haut abziehen ...
Er kämpfte dagegen an. Phantasien waren etwas für die einsamen Tage im Gefängnis. Er knipste die Gedanken an Davenport aus und konzentrierte sich auf die Rasur. Schnell und hart fuhr die Klinge durchs Bartgewirr. Sie kratzte so schmerzhaft auf der trockenen Haut, daß er unwillkürlich aufstöhnte.
Shaltie, draußen vor der Schwingtür, spitzte die Ohren. »Bald fertig da drin?« rief er. Kein reines Vergnügen, hier herumzustehen, es stank nach Ammoniak, Chlor, Harn und nassen Lappen.
»Gleich, Ray.« Bekker ließ den Klingenkopf in der Jackentasche verschwinden und fing an, sich mit dem Halter für das Toilettenpapier zu beschäftigen. Ursprünglich war er mit vier Schrauben an der Wand festgeschraubt gewesen. Zwei davon hatte Bekker gleich an den ersten drei Verhandlungstagen herausgedreht und durchs Klo gespült. Die beiden anderen hatte er gelockert, gestern probeweise herausgezogen und anschließend wieder in die Dübellöcher zurückgeschoben. Jetzt kostete ihn das Ganze nur noch einen Handgriff. Raus mit den Schrauben, in die Kloschüssel damit, spülen. Die Metallrolle schmiegte sich wie ein stählerner Boxhandschuh um seine Hand.
»Fertig, Ray.« Er stand auf, zog die Hose hoch, streifte die Jacke von den Schultern, hängte sie sich über die Stahlhand und drückte die Wasserspülung. Tief durchatmen. Kopf runter, als gäbe es noch was am Hosenschlitz zu fummeln. Tür auf, rausschlurfen.
Shaltie wartete mit den Handschellen auf ihn. Sommersprossen, wabbelige Kinnpartie, nicht gerade der Schnellste, wenn’s darum ging, eine Situation zu begreifen.
»Umdrehen«, sagte Shaltie. Und schien, als er Bekkers Gesicht sah, doch etwas zu ahnen. »He, du...«
Bekker straffte sich. Die Jacke rutschte ihm vom Arm. Seine Hand schnellte hoch wie ein Peitschenstiel. Seine Lippen brachen auf, im fluoreszierenden Licht der Neonleuchten schimmerten die Zähne perlweiß.
Shaltie zuckte zurück, hob abwehrend den rechten Arm. Zu spät, viel zu spät. Die Stahlrolle traf ihn über dem Ohr. Er taumelte, kippte nach hinten, schlug mit dem Kopf gegen das Waschbecken, sackte zusammen und rutschte zu Boden.
Und schon war Bekker über ihm. Reckte die Stahlfaust, schlug zu. Hoch mit der Faust, zuschlagen, hoch. Er hörte es knacken. Shalties Hirnschale. Und er sah das Blut spritzen.
Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen.
Trommelfeuer der Worte entzündete ein loderndes Feuer in der Schaltstelle seines Gehirns. Er versuchte es zu löschen, rang um Beherrschung, ahnte aber, daß ihm das, solange ihm der Geruch des frischen Blutes in die Nase stieg, nicht gelingen würde. Das Stakkato der Stahlfaust brach ab, wenigstens soweit hatte er sich wieder in der Gewalt. Und dann wurde ihm bewußt, daß er mit der anderen Hand bereits Shalties Kehle umklammert hielt. Er zog die Hand weg, kam hoch in die Hocke, legte sich, immer noch verwirrt, den Finger auf die Lippen und ermahnte sich laut: »Pst ... Pst...«
Schließlich richtete er sich auf. Das Blut rann ihm nun wie Wasser durch die Adern. Nein, wie Dampf. Alles in ihm war voller Dampf.
Und jetzt? Die Außentür. Er hüpfte hin, drehte den Knauf. Verschlossen. Gut so. Zurück zu Shaltie, der rücklings auf dem gefliesten Boden lag. Aus der gebrochenen Nase blubberten schaumige Blutblasen. Bekker wußte, wo die Schlüssel waren, er hatte gesehen, wie Shalties Hand sie in die rechte Hosentasche geschoben hatte. Ein Griff. Richtig. Er hatte die Schlüssel. Die Schlösser der Fußfesseln schnappten auf. Er war frei. Frei.
Halt, nichts überstürzen. Ein Blick in den Spiegel. Sein Gesicht war übel zugerichtet. Er fischte den Klingenkopf aus der Jackentasche, spritzte sich mit der hohlen Hand Wasser ins Gesicht, rieb schmierigen Sud aus dem Seifenspender dazu und schnitt mit der Klinge die Bartreste ab.
Shaltie? Der lag reglos da, atmete flach, stöhnte dumpf. Aus der Blutlache, die sich um seinen Kopf ausbreitete, drang der süßliche Geruch bis zu Bekker hin.
Fertig. Er warf den Klingenkopf in den Abfalleimer. Bückte sich, faßte Shaltie unter den Achseln, zog ihn durch die Schwingtür, wuchtete ihn auf die Kloschüssel und lehnte ihn gegen die Wand. Der Deputy röchelte leise, wieder blubberten ihm Blutblasen aus der Nase. Bekker sah gar nicht hin. Für so was hatte er jetzt keine Zeit.
Er zog die Hose aus und stülpte sich die Designermütze auf den kurzgeschorenen Schädel. Mit der Hose wischte er draußen im Vorraum das Blut auf, dann hängte er sie wie eine Decke über den Deputy, dazu die Jacke, das Hemd und den Schlips. Wieder ein Blick in den Spiegel. Grünes T-Shirt, rote Gymnastikshorts, weiße Laufschuhe, Sportkappe. Ein Jogger. Das Gesicht sah schlimm aus. Aber alle, die ihn während der letzten Wochen gesehen hatten, ein paar Cops, Rechtsanwälte, Justizangestellte, kannten ihn nur mit Bart. Die guckten bestimmt nicht zweimal hin, wenn ihnen ein Jogger über den Weg lief.
Davenport.
Der Gedanke ließ ihn erstarren. Wenn der da draußen herumlungerte – zum Beispiel, weil er sich das Urteil der Geschworenen anhören wollte –, war Bekker ein toter Mann.
Aber was half’s? Er schob den Gedanken beiseite, atmete tief ein. Noch einmal durch die Schwingtür, hinter der Shaltie auf der Kloschüssel saß. Bekker verriegelte die Tür von innen, schob sich, auf dem Rücken liegend, durch die wadenhohe Spalte zwischen Tür und Fliesenboden, stemmte sich hoch.
»Gottverdammte Scheiße«, fluchte er laut. Fäkalsprache, so was lernt man im Knast. Dauert nicht lange, da kommt einem das ganz von selbst über die Lippen.
Er legte sich wieder auf den Rücken, rutschte denselben Weg zurück, griff hoch und nahm Shaltie die Brieftasche aus der Uniformjacke. Zwölf Dollar. Und eine Kreditkarte, Visa. Na ja, zur Not mußte die es eben tun. Geldprobleme können ganz schön nerven. Er schob sich die Brieftasche in die Unterhose, kroch zurück, ging zur Außentür, lauschte.
Hinten hörte er Shaltie röcheln und blubbern. Er spielte kurz mit dem Gedanken, noch mal unter der Tür durchzukriechen und den Deputy mit seinem Gürtel zu erwürgen. All die Demütigungen der letzten Wochen, die unsägliche Qual, als sie ihm die Medikamente weggenommen hatten ... Aber er hatte keine Zeit. Er mußte sich beeilen, mußte weg. Nur deshalb ließ er Shaltie lebend zurück.
Er entriegelte den Türknauf, streckte den Kopf vor, warf einen Blick auf den Flur. Leer. Weiter zur nächsten Tür – die zentrale Lobby. Ein halbes Dutzend Leute, Besucher, alle weiter hinten, bei den Fahrstühlen. Um die konnte er einen Bogen schlagen, die Treppe lag auf der anderen Seite, das Exit-Schild, direkt neben dem Glaskasten mit dem Feuerwehrschlauch, wies ihm den Weg.
Noch mal tief durchatmen. Und los. Mit gebeugtem Kopf durchquerte er die Halle. Ein Justizangestellter, der die Lunchpause zum Joggen nutzte. Mit festem Schritt aufs Treppenhaus zu. Jede Sekunde darauf gefaßt, daß ihn jemand beim Namen rief. Daß einer mit dem Finger auf ihn zeigte. Oder hinter ihm hergerannt kam.
Er war im Treppenhaus. Allein. Wer nahm schon von so weit oben die Treppe?
Er rannte die Stufen hinunter. Zählte die Stockwerke. Im sechsten hörte er weiter unten eine Tür zuschlagen. Also nahm doch einer die Treppe, irgendwo unter ihm. Er ging auf Zehenspitzen weiter, bis das Geräusch sich wiederholte: Tür auf, Tür zu. Er konnte wieder an Tempo zulegen.
Im zweiten Stock blieb er kurz am Fenster stehen. Gedrängel vor dem Haupteingang, ständiges Kommen und Gehen. Okay, noch ein Stockwerk. Er eilte die letzten Stufen hinunter und kam an einer Stahltür vorbei. Kein Hinweis, wohin sie führte. Er probierte es. Und stand im Freien. Draußen auf der Plaza. Im hellen Sommersonnenschein. Umfächelt von einer Brise, die nach Popcorn und Tauben roch. Vor ihm eine Bank, auf der eine Frau saß, neben ihr ein Kind. Sie schnitt einen Apfel auf, das Kind streckte die Hand danach aus.
Bekker joggte mit gesenktem Kopf an ihr vorbei. Ein Fitneßfanatiker, der sich selbst vom Verkehrsgewühl nicht abschrecken ließ. Knie hoch, auch wenn die Hitze ihm den Schweiß aus allen Poren trieb.
Er rannte, wie von Furien gehetzt.
Kapitel 2
Lucas jagte den Wagen über das Asphaltband, eine Hand am Lenkrad, eine auf dem Schaltknüppel, linken Fuß über der Bremse, rechten auf dem Gaspedal. Noch war er in Wisconsin. Bei Tylors Falls, auf der St.-Croix-Brücke, nahm er den Fuß vom Gaspedal, weil an der Grenze nach Minnesota gewöhnlich die Bullen lauerten. Als die Brücke hinter ihm lag, gab er wieder Gas. Volle Pulle – der Sonne und den Zwillingsstädten entgegen.
Westlich von Stillwater fädelte er sich auf den Highway 36 ein. Mittagszeit, wenig Verkehr, Pickups und Kombiwagen zockelten an der Kulisse aus Viehweiden, Scheunen und Stallungen entlang. Acht Meilen östlich der Interstate 694 donnerte er haarscharf an einem roten Taurus vom Staatlichen Gesundheitsdienst vorbei. Er schielte auf den Tacho. Hundertsieben Meilen.
Zum Teufel, was ist eigentlich mit dir los?
Nur so ins Blaue gefragt, aber er hätte die Antwort wirklich gern gewußt. Gestern, spätnachmittags, hatte er plötzlich die Tür seiner Blockhütte am See hinter sich zugeknallt und war losgefahren, achtzig Meilen nach Norden, bis Duluth. Ein paar Bücher kaufen, hatte er sich eingeredet. Als ob das Mekka der Leseratten ausgerechnet im Hinterland von Wisconsin läge. Schön, er hatte tatsächlich ein paar Bücher gekauft, aber anschließend war er in einem Schuppen gelandet, der sich Wee Blue Inn nannte. Der richtige Ort, um was gegen den Durst zu tun, so wie er war: dunkelblaues Hemd, Seidenjacke, khakifarbene Freizeithose und braune Mokassins, keine Socken. Und da war dann dieser Binnenschipper aufgetaucht, von einem der Erzfrachter vermutlich, betrunken oder high oder beides, weiß der Henker. Jedenfalls hatte der Kerl das Maul nicht halten können und über die nackten Füße in den Mokassins gelästert. Einen Augenblick, einen vielversprechenden Augenblick lang hatte es danach gerochen, daß der Süßwassermatrose gleich eine gewaltige Tracht Prügel beziehen würde. Leider war der Barkeeper zurückgekommen, ehe Lucas loslegen konnte.
Mal wieder einen richtigen Kampf in einer Bar, das war’s, was er gebraucht hätte. An den Cops, die anschließend auftauchen würden, so sicher wie das Amen in der Kirche, war ihm weniger gelegen. Also gut, er hatte sich seine Bücher unter den Arm geklemmt und war mit dem Vorsatz, morgen den ganzen Tag zu angeln, in die Hütte am See gefahren. Morgen – das wäre heute gewesen. Und statt zu angeln, raste er nun zurück nach St. Paul und Minneapolis.
Die ersten Häuser tauchten auf, Vorposten der Schlafstädte. Er kramte im Handschuhfach nach dem Radardetektor, klemmte ihn an der Sonnenblende fest und schob den Steckkontakt in die Buchse des Zigarettenanzünders. Die Straße war verdammt schlecht, aber der Porsche schluckte die Schlaglöcher, kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Ein Druck aufs Radio, Cities 97. Little Feat spielte gerade ›Shake Me Up‹. Schön hart, schön heiß. Genau der richtige Begleitsound zu dem Tempo, mit dem Lucas demonstrierte, daß er sich einen Dreck um Geschwindigkeitsbegrenzungen scherte.
Unter der Brücke flog das Band der Interstate vorbei, der Verkehr wurde zähflüssiger. Hundertachtzehn, hundertneunzehn. Verflucht, daß hier eine Ampel war, hatte er vergessen. Und von rechts bog eine blaue Limousine auf den Highway ein. Lucas fing zu wedeln an – links, rechts, links, abbremsen, Gas geben, knapp an der Limousine vorbei, dann auf einmal nur eine Daumenbreite zwischen dem Porsche und einem Kombi ... Die blonde Matrone am Steuer starrte ihn erschrocken an, ihm gefror das Blut in den Adern, als er die verdutzten Kindergesichter sah – lauter kleine Blondköpfe auf den Rücksitzen.
Das Bild brannte sich in Lucas’ Gehirn ein. Er schnaufte, nahm den Fuß vom Gas, ordnete sich rechts ein. Runter auf hundert, auf neunzig, achtzig. Durch die nördlichen Ausläufer von St. Paul, vor ihm tauchte die Ausfahrt des Highway 280 auf. Als er noch zu den Cops gehört hatte, war er auf die Schleichwege ausgewichen, unten am See entlang. Jetzt, frei und unabhängig, hätte er Zeit gehabt, alle Zeit der Welt. Aber nein, jetzt tat er so, als müsse er um jede Minute kämpfen.
Ein herrlich warmer Tag, Sonnenlicht dümpelte auf den Straßen und zauberte drüben im Westen Licht-und-Schatten-Spiele auf die Glasfassaden der Hochhäuser von Minneapolis.
Und plötzlich der Streifenwagen.
Lucas sah ihn im Rückspiegel langsam um die Ecke gleiten, ohne Blaulicht, ohne Sirene. Tacho? Sechzig. Fünf Meilen über dem Limit, damit mußte er eigentlich durchkommen. Auf einen Porsche waren die Bullen allerdings immer scharf. Er bremste ab. Der Streifenwagen hängte sich dran, kroch ihm fast in den Auspuff. Wieder ein Blick in den Rückspiegel: Der Cop las sein Kennzeichen ab und hatte das Mikro vor dem Mund. Und dann flackerte rotes und blaues Licht, die Sirene jaulte auf. Lucas knurrte unwillig, fuhr rechts ran, ließ den Wagen ausrollen. Der Streifenwagen klebte ihm an der hinteren Stoßstange.
St.-Paul-Cops, den einen erkannte er wieder, sie hatten früher ein paarmal dienstlich miteinander zu tun gehabt. Auch in der Bar bei ihm um die Ecke waren sie sich hin und wieder über den Weg gelaufen. Wie hieß er doch gleich? Kelly ... Kelly Larsen? Lucas sah ihn aussteigen. Bulliges Gesicht, Sonnenbrille. Kam zu ihm nach vorn. Aber mit leeren Händen. Okay, jedenfalls kein Strafzettel. Komisch war bloß, daß er’s so eilig hatte. Lucas öffnete die Wagentür, schwang die Beine aus dem Auto.
»Davenport – Himmelarsch, hab mir doch gleich gedacht, daß das Ihre Scheißkarre sein muß.« Larsen legte den Daumen aufs Porschedach. »Wir suchen Sie wie ’ne Stecknadel im Heuhaufen.«
»Was ist denn los?«
»Der Scheißkerl Bekker ist ausgebrochen. Zwei hat er bis jetzt zusammengeschlagen.«
»Wie?« Lucas Davenport schnappte nach Luft. Auf einmal war die Lässigkeit, die seine Kleidung demonstrierte, nur noch Fassade.
»Zwei von unseren Leuten haben sich bei Ihnen zu Hause auf die Lauer gelegt. Sie gehen davon aus, daß Bekker hinter Ihnen her ist.« Larsen stand da wie ein Preisboxer, die Daumen in den Gürtel gehakt, und den mißtrauischen Blicken nach, mit denen er die Umgebung absuchte, schien er jeden Augenblick damit zu rechnen, daß Bekker unter dem nächsten Kanaldeckel hervorgekrochen kam.
»Dann sehe ich wohl besser zu, daß ich nach Hause komme.«
Als er sich wieder in den Verkehr eingefädelt hatte, griff Lucas zum Autotelefon und drückte die Durchwahlnummer für das Polizeipräsidium Minneapolis. Mit einem Anflug von Genugtuung. Er brauchte das Telefon eigentlich nicht, benutzte es kaum. Aus einer Laune heraus hatte er sich das Ding einbauen lassen – damals, als er aus dem Police Department ausgeschieden war, im Hochgefühl der neugewonnenen Freiheit. Im Grunde so sinnlos wie die Gold-und-Stahl-Rolex am linken Handgelenk. Statussymbole, mit denen er zeigen wollte, daß für ihn in Erfüllung gegangen war, wovon vermutlich alle Cops träumten: Unabhängigkeit, Erfolg. Und aus dem früheren Hobby mit den Computerspielen war ja tatsächlich ein lukratives Geschäft geworden. Computersimulation von polizeitaktischen Problemen. Davenport Games & Simulations. Mit ständig steigenden Verkaufszahlen. Nicht mehr lange, und er mußte sich umsehen, wo er Büroräume anmieten konnte.
Das Mädchen in der Vermittlung meldete sich. »Minneapolis.« »Geben Sie mir Harmon Anderson.«
»Lucas, sind Sie das?« Melissa Yellow Bear.
»Ja, ich bin’s«, antwortete er und grinste in sich hinein. Na bitte, doch noch jemand, der sich an ihn erinnerte.
»Harmon wartet schon auf Ihren Anruf. Sind Sie zu Hause?«
»Nein, ich rufe vom Wagen aus an.«
Yellow Bear klang ein bißchen atemlos. »Sie wissen schon, was passiert ist, ja?«
»Mhm.«
»Seien Sie vorsichtig, Honey. Ich stell Sie durch.«
Dann war Anderson dran. Er hielt sich nicht lange mit der Vorrede auf. »Del und Sloan sind bei dir zu Hause, Sloan hat sich den Schlüssel bei deinen Nachbarn besorgt. Aber ich glaube, die beiden verschwenden nur ihre Zeit. Der Kerl hat sich bis jetzt nicht blicken lassen. Obwohl schon drei Stunden vergangen sind.«
»Und Dels Wohnung? Er und Bekker sind verschwägert.«
»Da haben wir auch ein paar Männer hingeschickt. Aber Bekker ist einstweilen irgendwo untergetaucht. Vorläufig steckt er die Nase nicht raus.«
»Wie hat er’s denn geschafft, aus dem Gerichtsgebäude...«
»Sloan wird dir das alles erklären«, fiel ihm Anderson ins Wort. »Ich muß los. Hier geht’s zu wie im Irrenhaus.«
Aufgelegt. Polizeiarbeit geht vor, keine Zeit für Plaudereien mit Zivilisten. Lucas bog in die University Avenue ab, folgte ihr bis Vandalia, über die I-94 und runter zur Cretin. Am Mississippi entlang, unter schattenspendenden Bäumen und trotzdem in brütender Hitze. Keine Zeit für Davenport.
Zwei Blocks vor seinem Haus nahm er die Geschwindigkeit zurück, schaltete, suchte die Umgebung ab, bog in eine Seitenstraße ein, einen Häuserblock zu früh. Eine Wohngegend, in der jemand, wenn er sich verstecken wollte, schon in eines der Häuser eindringen mußte. Die Gärten waren offen, Bäume und Sträucher boten sich in üppiger, leuchtender Blütenpracht an, Beete mit Stechapfelbüschen, helle Tupfen dazwischen: Tulpen, Iris, Narzissen, pinkfarbene Pfingstrosen und überall das Gelb der Löwenzahnblüten, die allen Ausrottungsversuchen hartnäckig trotzten. Keine Chance, sich irgendwo zu verkriechen, zumal an einem so schönen warmen Tag, an dem überall in den Gärten geharkt und an den Häusern gewerkelt wurde und sich an jedem zweiten Garagentor spielende Kinder nach dem Baseballkorb reckten. Zu viele Leute im Freien. Und zu viele wachsame Augen, um mir nichts, dir nichts in eines der Häuser einzubrechen. Er wendete, bog um die Ecke, ließ den Porsche langsam auf das Haus zurollen.
Ein bißchen zusammengestückelt, aber sehr hübsch, hatte die Immobilienmaklerin damals gesagt. Stein und Holz, ein großer Kamin, alter Baumbestand, eine Doppelgarage. Er drückte die Fernbedienung für das Garagentor, wartete am Ende der Zufahrt, bis es ganz oben war. Und sah aus den Augenwinkeln, wie sich hinter einem der Fenster eine Gardine bewegte.
Als er den Porsche in die Garage fuhr, tauchte Sloan an der Tür auf, die von der Garage ins Haus führte. Hager, mit hohen, hartkonturierten Wangen und tief eingesunkenen Augen. Lucas stieg aus, Sloan hatte inzwischen Gesellschaft bekommen, Del stand hinter ihm, aus dem Gürtel ragte der Griff der handlichen 9-mm-Pistole. Del hatte schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Ein Gesicht wie Schmirgelpapier. Der Straßendienst und die Drogen hatten ihn geschafft.
»Was, zum Teufel, ist eigentlich passiert?« Lucas mußte den Lärm überschreien, mit dem das Tor wieder zukippte.
»Scheißen wollte er gehen. Hat er jedenfalls behauptet. Und ein ausgelutschter alter Deputy hat ihm die Handschellen abgenommen!« brüllte Sloan zurück, dann hörte das Tor zu rumpeln auf. »Hat er jeden Nachmittag so gemacht, immer in den Verhandlungspausen. Hat jedem erzählt, er hätte Hämorrhoiden. Na ja, der Deputy sollte ihn eigentlich runter in die Zelle bringen, aber dann haben sie erst mal auf dem Klo haltgemacht. Bekker hat den Halter fürs Toilettenpapier losgeschraubt. Aus Stahl, das Ding. Und damit hat er den alten Knaben zusammengeschlagen.«
»Tot?« fragte Lucas.
»Noch nicht. Aber das Gehirn ist verletzt. Wenn er Glück hat, kommt er mit ’ner Querschnittslähmung davon.«
»Hab gehört, daß er noch einen zusammengeschlagen hat?«
»Ja, aber das war später«, sagte Del und erzählte, daß ein paar Leute, während sie vor einem der Gerichtssäle warteten, Bekker gesehen hatten, ohne allerdings zu wissen, mit wem sie es zu tun hatten. Draußen auf der Plaza war er auch gesehen worden, in Shorts, als Jogger, der sich eilig seinen Weg zwischen Sonnenhungrigen und Tauben hindurch gebahnt hatte.
»Wir haben seine Spur zehn Blocks weit verfolgen können«, berichtete Del, »bis zu einem Großmarkt. Dort hat er sich einen Betonbrocken geschnappt und den Angestellten am Versandschalter niedergeschlagen. Hat ihm die Kleidung und die Brieftasche weggenommen. Von da ab haben wir seine Spur verloren.«
»Wie geht’s dem Mann aus dem Großmarkt?«
»Beschissen.«
»Ein Wunder, daß Bekker ihn nicht gleich totgeschlagen hat.«
»Ich nehme an, daß er’s dafür zu eilig hatte«, sagte Del. »Alles sieht so aus, als wüßte er genau, wohin er will. Deshalb sind wir sofort hergekommen. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto weniger glaube ich, daß er’s auf dich abgesehen hat. Du hast ihn schon mal grün und blau geprügelt.«
»Bei einem Irren weiß man nie, was er tut«, meinte Lucas.
»Bist du berechtigt, eine Waffe zu tragen?« fragte Sloan.
Lucas schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Okay, wir besorgen dir ’ne Genehmigung, falls wir ihn nicht sehr schnell schnappen.«
Sie fanden ihn nicht.
Lucas verbrachte die beiden folgenden Wochen damit, seine alten V-Leute aufzusuchen. Früher hatte er von denen Gott weiß was erfahren können, aber jetzt war keiner mehr sonderlich erpicht darauf, sich mit ihm zu unterhalten. Sah so aus, als hätten alle etwas Besseres zu tun.
Er holte einen 45er Colt Gold Cup aus dem Keller, reinigte ihn, schob Patronen in die Trommel und legte sich die Pistole unters Bett. Tagsüber nahm er das Ding im Porsche mit, sorgfältig versteckt, aber griffbereit. Er mochte den Revolver, er lag schwer in der Hand und roch nach Waffenfett. Er liebte den Geruch, andere behaupteten, sie bekämen Kopfschmerzen davon, alles Veranlagungssache. In einer Kiesgrube in Wisconsin ballerte er eine Stunde lang auf mannsgroße Ziele, dann waren die beiden Schachteln Übungsmunition leer.
Zwei Tage nach Bekkers Flucht fanden Nachbarn die Leiche der Antiquitätenhändlerin Katherine McCain. Sie war mit Bekkers Frau befreundet gewesen. Bekker kannte sich gut in ihrem Haus aus, vor dem Mord an seiner Frau war er hin und wieder mit ihr dort gewesen. Er wußte also auch genau, daß Katherine allein lebte. Er hatte ihr vor dem Haus aufgelauert, sie mit einem Hammer erschlagen und ihr mit einem Messer die Augen ausgestochen. Seine alte Paranoia, ihr Geist könne ihn aus dem Jenseits mit Blicken verfolgen. Dann hatte er ihren Wagen genommen und war damit verschwunden.
Der Wagen war schließlich in einem Parkhaus am Flughafen von Cleveland gefunden worden. Was ja wohl hieß, daß Bekker auf und davon war. Lucas verstaute die 45er wieder im Waffenschrank im Keller. Der Schein, der ihn dazu berechtigt hätte, eine Waffe zu tragen, war nie bei ihm angekommen. Sloan hatte vergessen, sich darum zu kümmern. Und nach einer Weile war es unwichtig geworden.
Mit Frauen spielte sich nichts ab. Keine grundsätzliche Entscheidung, aber zur Zeit war es eben so, und einstweilen hatte Lucas nicht die geringste Lust, das zu ändern. Er versuchte es mit Angeln. Und eine Woche lang mit Golf. Half alles nichts. Nicht gerade amüsant, aber wahr: In seinem Leben sah es ähnlich aus wie in seinem Kühlschrank. In dem lagen ein Sechserpack Diätbier, drei Dosen Cola light und eine Tube Senf, bei der das garantierte Frischhaltedatum längst überschritten war.
Nachts, wenn er wachlag, und das kam oft genug vor, spukte ihm Bekker durch den Kopf. Er konnte nicht vergessen, wie es war, einen Kerl wie Bekker zu jagen und einzukreisen. Das war’s, was ihm fehlte. Nicht das Police Department, die endlosen Palaver und die politischen Intrigen. Nur die Jagd, die Spannung.
Sloan rief zweimal bei ihm an, meinte, es sähe ganz danach aus, daß Bekker irgendwo untergetaucht wäre. Auch Del rief an, meinte, sie müßten bald mal wieder ein Bier zusammen trinken.
Ja, ja, sagte Lucas. Und wartete.
Bekker war ein Scheißkerl.
So einer tauchte irgendwann, irgendwo wieder auf.
Kapitel 3
Louis Cortese war dem Tode nahe.
Grelles Licht strahlte sein wachsbleiches Gesicht unbarmherzig an und legte einen schmutziggelben Schleier über das trübe Weiß der Augäpfel. Die verzerrten Lippen erinnerten an die Grimassen, die man Hofnarren auf manchen Darstellungen mittelalterlicher Szenen schneiden sieht.
Bekker beobachtete den Mann fasziniert. Er drückte den Auslöser, hinter ihm klickte und summte die automatische Kamera im Rhythmus der Serienaufnahmen. Die Schwingen des Todes senkten sich über den Raum, Louis Corteses Leben versickerte Tropfen um Tropfen in einem Plastikbehälter.
Bekkers Verstand vermochte alles, er konnte Quelle sprudelnder Energie sein, Rechenmaschine, Textverarbeitungssystem, Zentrum gespeicherten anatomischen Wissens oder einfach nur leere Höhle – alles. Nur, anders als früher, nicht mehr alles auf einmal.
Drei Monate Hennepin-County-Gefängnis hatten ihn von Grund auf verändert. Weil seine Folterknechte ihm die Medikamente weggenommen, das Gehirn weichgekocht und die elektromagnetischen Verbindungen aufgeknackt hatten, die unabdingbare Voraussetzung sind für die Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken.
In der Einsamkeit seiner Zelle, ausgestreckt auf der Pritsche, hatte er es bildlich vor sich gesehen: Sein Gehirn als Springballautomat – eines von den altmodischen Spielgeräten, die man mitunter noch in den Lions-Clubs findet. Man wirft eine Münze ein, und der Automat spuckt einen bunten Gummiball aus. Nur, man weiß im voraus nie, welche Farbe er haben wird.
Die Erinnerung an Ray Shaltie, an den Augenblick der Flucht – das war eine der Farben. Seine Lieblingsfarbe, er jauchzte innerlich auf, wenn er sie aus dem Automaten kullern sah. Ein berauschendes Erlebnis, wie Breitwandkino mit Stereoton aus überdimensionierten, voll aufgedrehten Lautsprechern. Und er konnte den Film anhalten, an jeder beliebigen Stelle. Konnte den Augenblick aus der Vergangenheit zurückholen. Ray Shaltie... Die Stahlfaust ... Das Bersten der Schädeldecke...
Bekker. Gegenwart.
Er saß im verchromten Stahlstuhl und beobachtete Corteses Todeskampf. Sein Blick huschte zwischen den Monitoren und dem Gesicht des Sterbenden hin und her. Ein durchsichtiger Kunststoffschlauch leitete das Blut aus Corteses Halsschlagader in den Plastikbehälter auf dem Boden. Rubinrot wie gekochte Rote Bete. Bekkers empfindliche Nüstern blähten sich, sogen den Geruch auf. Und plötzlich fing Corteses Herzschlag zu hüpfen an, er konnte es auf dem EKG ablesen. Bekker hüpfte innerlich in fiebernder Ungeduld mit. Corteses Bewußtsein nahm Abschied von dieser Welt, das Sein kehrte sich nach außen, begab sich auf die letzte Wanderschaft, die ihn ... Ja, wohin würde sie ihn führen?
Nun, vielleicht war es nur eine Wanderschaft ins Nichts.
Möglicherweise war Corteses Sein nichts als eine Gasblase, die aus dem kosmischen Sodawasser an die Oberfläche stieg – mit keiner anderen Bestimmung als derjenigen, lautlos zu zerplatzen. Ein Gedanke, der ihn so erregte, daß seine Augenbrauen unkontrolliert zu zucken begannen und nicht stillstehen wollten. Hastig griff Bekker mit beiden Händen zu und versuchte, die bebenden Hautpartien glattzustreichen.
Irgend etwas mußte es geben, irgend etwas mußte sich hinter dem schwarzen Vorhang verbergen, sonst ... Sonst hätte das bedeutet, daß auch sein Leben eines Tages einfach verdämmerte ... Eine unerträgliche Vorstellung.
Ein Alarmsignal auf dem Kontrollmonitor, der den Kreislauf anzeigte. Und ein zweites Signal, diesmal das EKG. Zwei hohe Töne, die sich zu einem vermischten. Bekker – die linke Hand weiterhin auf der Stirn, weil das Flattern in den Augenbrauen nicht aufhörte – starrte fasziniert auf die Monitore. Corteses Herz stand still. Bekker spürte, wie sich die Muskelstränge in seinem Rücken verkrampften, bis hinunter zum Gesäß. Gespannte Erwartung, erregte Vorfreude.
Er schielte zum dritten Monitor hinüber. Das Elektroenzephalogramm, die Messung der Hirnströme. Die hektisch verlaufende Zackenlinie, die noch vor ein paar Sekunden flimmernd über den Bildschirm gezuckt war, wurde flacher, immer flacher...
Er spürte, daß Cortese ihm entglitt. Fühlte es deutlich: Corteses Sein ging dahin. Noch konnte er es nicht messen, aber eine innere Stimme sagte es ihm. Eine Stimme, der er traute. Ein Gefühl, das ihn einhüllte wie ein Mantel. Er zog ihn fester um die Schultern, mummte sich tiefer in den Mantel, verbarg sich darin. Und drückte wieder den Auslöser. Hörte den Motor der Automatik arbeiten. Das Klicken, das Summen mindestens ein halbes Dutzend Fotos.
Und dann war es soweit, das geheimnisvolle Etwas schlüpfte davon. Bekker sprang auf, beugte sich über Cortese, bis seine Augen kaum eine Handbreite von den Augen des Sterbenden entfernt waren. Es gab einen Zusammenhang, die Augen und der Tod, irgendwie gehörte das zusammen ...
Cortese hatte sich fortgestohlen. An einen Ort, an den Bekker ihm nicht folgen konnte. Der Körper, sterbliche Hülle des Ichs, fühlte sich weich und schlaff an.
Die Dramatik des Augenblicks wühlte Bekker auf. Sein Atem ging keuchend wie ein Blasebalg. Er starrte auf die verchromte Tür des Aktenschranks, starrte in sein Spiegelbild. Sah sein verwundetes Gesicht, das Gesicht der Sünde, wie er es nannte. Sah die tiefen Furchen, die die Pistole ihm ins Fleisch gegraben hatte. Und seine Stimme schraubte sich in schwindelnde Höhen, als er leise wimmerte: »Er ist fort.«
Aber noch nicht ganz. Bekker spürte das Kribbeln im Rücken, merkte, wie die Wirbelsäule sich straffte, fühlte den Finger der Angst, der ihn berührte. Er fuhr herum. Und da waren die Augen, die ihn in ihren Bann schlugen. Der Blick des Toten hielt ihn fest. Corteses Augen waren weit offen, natürlich, Tote starren immer aus weit offenen Augen ins Leere. Und Corteses Augen ließen sich nie mehr schließen, Bekker hatte ihm vorsorglich die Lider weggeschnitten, damit sie dem Sterbenden nicht zufielen, ehe der entscheidende Moment gekommen war.
»Hör auf!« sagte er scharf. Cortese blieb stumm. Aber sein Blick hielt Bekker fest.
»Hör auf!« schrie er den Toten an. Laut und schrill, die Stimme schnappte über. Corteses Blick hielt ihn fest.
Bekker griff nach dem Skalpell, näherte sich auf Zehenspitzen dem Kopfende des Tisches, beugte sich über den Toten und schnitt ihm die Augen aus. Eine Sache von Sekunden, er hatte Erfahrung damit. Er schälte die Augäpfel aus den Höhlen, wie man das Gelbe aus einem gekochten Ei löffelt. Und als das glasige Augenwasser über Corteses Wangen lief, sah es aus, als weine der Tote geronnene Tränen.
Der Dicke blieb an der Kreuzung stehen, wartete auf Grün, wippte auf den Hacken. Der Dünne schnippte den Zigarettenstummel weg, winzige Glutfunken tanzten auf dem Bürgersteig.
Der Strom von Fahrzeugen, die quer an ihnen vorbeizogen, nahm kein Ende. Verbeulte Toyotas, klapprige Fords, Dodges mit eingedrückten Kotflügeln, Pickups, Wohnmobile, grafittibesprühte Lastwagen, Busse, die stinkende Dieselwolken in die Luft bliesen, dazwischen wieselflinke Taxis, die drängelnd ausscherten und sich mit angetippter Hupe Platz schufen. Ganz New York war in Lärm gehüllt: Unter der Erde mischten sich das dumpfe Rumpeln der Züge und der Singsang aus dampfenden Rohren miteinander, auf den Straßen lärmten ratternde Preßlufthämmer mit dröhnenden Motoren um die Wette, und wenn all diese Geräusche plötzlich verstummt wären, hätte es immer noch den Wirrwarr aus Millionen von Stimmen gegeben, ganz zu schweigen vom unablässigen Summen ungezählter Klimaanlagen. Quälender Lärm, der keinen Ausweg fand, weil die Hitzeglocke über der Stadt ihn gefangenhielt.
»Scheißhitze«, sagte der Dicke. Er schwitzte am ganzen Körper, im Nacken, unter den Achseln, sogar die Fußsohlen schienen zu schwimmen. Der Dünne begnügte sich mit einem kurzen Nicken. Und der Dicke dachte wieder einmal, daß er’s nicht leicht hätte mit demjenigen, den sie ihm mitgegeben hatten. Und fand keinen Trost in dem Gedanken, daß das nichts Neues war. Seit fast vierzig Jahren ging das schon so. Irgendwie waren die Kerle immer ein Problem, damit mußte er sich wohl oder übel abfinden.
Das grüne Männchen über ihren Köpfen leuchtete auf. Der Dicke und der Dünne überquerten die Straße. Der Ampelmast auf der anderen Straßenseite war mit Taubenkot bekleckert, knapp zwei Meter hoch reichten die Werbeposter und Veranstaltungshinweise, die – in drei, vier Lagen übereinandergeklebt – längst vergilbt und eingerissen waren, darüber zwei Straßenschilder und ein Bushalteschild. Die Totempfähle unserer modernen Gesellschaft. Wann werden sie den ersten davon in einem Museum ausstellen?
»Dollar...« Eine Frau reckte dem Dicken die Hände hin, die eine offen und hohl gekrümmt, die Finger der anderen um einen schmutzigen handgeschriebenen Zettel gekrallt: »Helfen Sie mir! Meine Kinder haben Hunger!« Er ging weiter. Kinder – das konnte sie sonst jemandem erzählen! Mitte Vierzig, ausgemergelte Beine, die nackten Füße mit offenen Wunden übersät, die Augen wie mit weißem Musselin verhängt, keine Zähne mehr.
»Ich hab mal ’n Buch über Schanghai gelesen«, erzählte der Dicke. »Da wurde beschrieben, wie’s vor ’m Zweiten Weltkrieg zugegangen ist. Hast du gewußt, daß Betteln dort ’n richtiger Beruf gewesen ist?« Der Dünne sah starr geradeaus, gab keine Antwort. »Der springende Punkt ist, daß du auf die ganz normale Tour nicht einen lausigen Penny gekriegt hast. Mußtest dir schon was Besonderes ausdenken. Tja, da haben sie dann Kindern die Augen ausgebrannt oder mit ’m Hammer die Arme zerschmettert. Die konnten gar nicht erbärmlich genug aussehen, verstehst du? Weil nämlich, wenn sie die nicht so zugerichtet hätten, daß jeder Mitleid hat, hätten die keine Chance gehabt. Die ganze beschissene Stadt war ja voll mit Bettlern.«
Der Dünne sah zu ihm hinüber, sagte immer noch nichts.
»Und wir sind auch bald soweit. Wer läßt denn noch was springen, wenn an jeder Straßenecke einer steht und die Hand aufhält?« Der Dicke drehte sich um, warf einen Blick zurück auf die Frau.
»Dollar«, hörte er sie betteln, »Dollar...«
Der Dicke machte sich Sorgen. Er ahnte, was dem Dünnen durch den Kopf ging. O Mann, wie der vor sich hinstierte, Angst im Blick, und in sich hinein grübelte ...
Der Dicke hielt eine lange, flache Pappschachtel in der Hand. Nicht sonderlich schwer, aber ziemlich sperrig. Er blieb einen Schritt zurück, versuchte, ob er besser zurechtkäme, wenn er sich die Schachtel unter den Arm klemmte.
»Von mir aus ...«, begann er, brach aber nach den ersten Worten ab und ließ den Rest im Ungewissen hängen.
Er griff hoch, wollte sich im Gesicht kratzen. Verdammt, ging nicht. Wegen der dünnen fleischfarbenen Chirurgenhandschuhe, die er übergestreift hatte. Na gut, dann eben nicht.
Das Apartmenthaus tauchte auf, drüben auf der anderen Straßenseite, gegenüber dem Steakhaus. Der Dicke fischte mit der freien Hand den Schlüssel aus der Tasche.
»Ich kann’s nicht tun«, sagte der Dünne.
»Wir müssen’s tun, Gott im Himmel! Wenn nicht, können wir unser Testament machen, jeder von uns.«
»Hör zu, ich...«
»Ruhig, erst mal weg von der Straße.«
Sie betraten das Haus, der Dicke drückte die Tür hinter sich zu. Eine gelbe 60-Watt-Birne warf schummeriges Licht auf das Entree und den Flur. Die Treppe befand sich gleich vorn rechts, der Dicke setzte den Fuß auf die erste Stufe. Der Dünne blieb zögernd stehen, drehte sich zur Haustür um und gab sich schließlich, weil der Dicke einfach weiterging, einen Ruck und folgte.
Im ersten Stock wandte sich der Dicke nach rechts, ging auf eine Apartmenttür zu und schloß sie auf. Halbdunkel, nur durch die Lamellen der Jalousetten drang gelblicher Lichtschimmer. Es roch nach abgestandener Luft, Kaffeesatz und vertrockneten Pflanzen. Die Besitzer des Apartments waren verreist. Erst Rom, um den Papst zu sehen, dann weiter ins Heilige Land. Im Juli! Da brannte es denen doch glatt das Hirn weg! Wenn sie eines hatten. Was wenig wahrscheinlich war bei jemandem, der ausgerechnet im Juli ins Heilige Land reist.
Der Dünne warf hinter sich die Tür ins Schloß. »Hör zu ...«
»Wenn du’s nicht tun willst, warum bist du dann überhaupt mitgekommen?«
»Dir zuliebe. Obwohl du’s warst, der uns die Sache eingebrockt hat. Aber ich will nicht, daß du Ärger kriegst.«
»Ach Gottchen, nee...« Der Dicke ging kopfschüttelnd zum Fenster, zog eine der Jalousetten hoch und sagte unwirsch: »Na los, schnapp dir das Gewehr.«
»Nein, ich sag doch, daß ich ...«
»Okay, dann mach ich’s selber«, blaffte der Dicke ihn ärgerlich an. »Himmelarsch, wenn’s so ist, kannst du genausogut die Kurve kratzen. Na los, verschwinde!« Der Dicke war dreiundzwanzig Jahre und zwei Tage älter als der Dünne. Das Gesicht vernarbt und verwüstet. Einer, der ein Leben auf der Straße hinter sich hatte. Er griff nach der Pappschachtel. »Los, hau schon ab!«
Der Dünne zögerte. Starrte zu ihm herüber.
Die Schachtel war einen Meter fünfzig lang und achtzig Zentimeter breit, aber nicht mehr als zwanzig Zentimeter tief. Die Verpackung für einen Spiegel, hätte man denken können, oder für ein schmales Bild. Tatsächlich lag ein Colt Army-Rifle-15 darin, mit aufgeschraubtem Mündungsfeuerdämpfer, zwanzigschüssigem Magazin, Zielfernrohr und lasergesteuertem Entfernungsmesser. Ursprünglich eine halbautomatische Waffe. Ein Mechaniker in Providence hatte daran herumgebastelt, jetzt konnte man von Einzel- auf Dauerfeuer umstellen.
Der Dicke hatte einen Nachmittag lang damit geübt. Auf Milchkannen aus Plastik, jede mit knapp einer Gallone Fassungsvermögen, so daß das Ziel der Größe nach ungefähr einem Brustkorb entsprach. Die ideale Simulation.
Er schnitt mit dem Taschenmesser den Bindfaden auf, streifte ihn ab, öffnete den Karton und nahm das Gewehr aus der Schaumgummiverpackung. Die Zielfernrohre waren heute nicht mehr so zuverlässig wie in den guten alten Zeiten, aber was sollte man machen? Das volle Magazin lag neben der Waffe, der Dicke hatte jede einzelne Patrone sorgfältig abgewischt. Mit denselben dünnen Handschuhen, die er auch trug, als er das Magazin in die Halterung drückte. Keine Fingerabdrücke, ein eisernes Gesetz.
»Bring die Couch her«, sagte er, »mach schnell.«
»Nein. Er ist... Ich meine, wenn’s kein Cop wäre...«
»Was ist auf einmal mit dir los? Du hast doch bis jetzt nie Skrupel gehabt?«
»Die anderen waren Dreckskerle. Aber der hier... Er hat doch keinem was getan. Und er ist ein Cop.«
»Er ist ein gottverdammter Computerarsch. Eine Wanze, die eine Menge gute Jungens in den Knast gebracht hat. Und nur, weil sie getan haben, was getan werden mußte. Hast du dir eigentlich schon mal klargemacht, was uns blüht, wenn wir auffliegen? Was mich betrifft, ich halt’s da drin nicht eine Woche aus. Wenn sie kommen und mich holen wollen, schieb ich mir ’ne gottverdammte Pistole in den Mund und drück ab, das kann ich dir schriftlich geben. Ich denk gar nicht dran, mich hinter Gitter...«
»Großer Gott!«
Der Dicke stand am Fenster, einen Schritt weit zurück im Zimmer, und richtete das Zielfernrohr auf das Restaurant gegenüber. An der Türverglasung klebte das Visa-Emblem, direkt unter dem Schriftzug mit dem Namen der Steakhaus-Kette und dem Firmenlogo. Der Titelsong aus einer alten Fernsehserie ging ihm durch den Kopf: Eine Waffe und die Weite – auf diese Karte setzt ein echter Kerl ...
Er richtete das Zielfernrohr auf das Visa-Zeichen, schaltete mit einem Daumendruck den Entfernungsmesser ein, der rote Laserpunkt hüpfte ins Zentrum des Fadenkreuzes.
»Der Kerl ist doch der letzte Dreck«, knurrte er vor sich hin. Sein Kopf, vierkantig wie ein Benzinkanister, fing unmotiviert zu rucken an. Die lächerlich kleinen Ohren schienen irgendwie nicht zu diesem mächtigen Schädel zu gehören, sie sahen eher aus wie angeklebte Dörrobstscheiben.
»He!« Der Dünne deutete auf die Straße. Der Dicke fuhr herum. Drüben auf der anderen Seite wurde die Tür des Restaurants aufgestoßen.
»Stop!« haspelte der Dünne. »Der Falsche.«
»Seh ich selber«, raunzte der Dicke.
Der Kerl stand vor dem Steakhaus, weißes Tennishemd, weiße Hose, weiße Schuhe, und pulte in den Zähnen. Der Zahnstocher war wie ein kleines Schwert geformt. Das Firmenlogo, der Dicke wußte Bescheid, gestern abend hatte er sich zusammen mit dem Dünnen in dem Lokal umgesehen. Und dabei auch erfahren, wann derjenige, auf den sie es abgesehen hatten, üblicherweise kam: Freitag abend, wenn sie das Special im Angebot hatten, New York Strip mit Folienkartoffel und Sauerrahm, dazu ein Krug Faßbier.
Der Weißgekleidete schlenderte die Straße hinunter. »Verdammte Schwuchtel«, murmelte der Dicke hinter ihm her und schwenkte den Lauf wieder zurück auf das Visa-Zeichen.
Bekker seufzte.
Vorbei, alles erledigt.
Er drehte sich um, Corteses Leichnam hatte nichts Faszinierendes mehr für ihn. Er spürte die Spannung bis in die letzten Fasern seines Gehirns. Scharf und gefährlich. Hastig klopfte er die Hemdtaschen ab. Nichts. Von jäher Angst befallen, stürmte er in den Flur. Gott sei Dank. Auf der Ablage der schäbigen Garderobe, unter dem Spiegel, lagen seine Pillen, zwar kaum noch eine Handvoll, aber fürs erste genügte es. Er griff danach, tänzelte unruhig und stopfte sich zwei, drei von den bunten Dingern in den Mund. Ein Genuß, der scharfe, bittere Geschmack beim ersten Biß, höllisch gut. Aber ... Er drehte sich zur Garderobe um. Höllisch gut, aber höllisch wenig. Morgen würde er noch damit auskommen, länger nicht. Er mußte sich etwas einfallen lassen.
Er ging ins Arbeitszimmer, schaltete drei Monitore aus, das flimmernde Grün ertrank in stumpfem Schwarz. Die Schirme hatten ohnehin nur noch gerade, horizontale Linien angezeigt. Corteses Leiche würdigte er auch jetzt keines Blickes. Abfall, den er so schnell wie möglich loswerden mußte.
Vorher, bevor der Tod eingetreten war...
Der Automat spuckte einen Springball aus. Becker erstarrte, sein Verstand klinkte sich aus, die Gedanken drifteten ins Leere.
Louis Cortese – dunkelhaarig, einszweiundachtzig groß, zweiundachtzig Kilo schwer, siebenunddreißig Jahre – alles penibel in Bekkers Notizbuch vermerkt. Elektroingenieur, Examen an der Purdue University. In der Anfangsphase – das war, als Cortese sich noch nicht mit dem Gedanken abgefunden hatte, daß er sterben müsse, sondern dauernd versucht hatte, sich durch plappernde Geschwätzigkeit und kriecherisches Getue lieb Kind zu machen –, damals, in der ersten Phase, vor der Operation der Augenlider, hatte er Bekker erzählt, er sei ein Fisch. Eine Information, die Bekker nichts sagte, uninteressant für ihn war.
Corteses Leiche lag auf einer verchromten Arbeitsplatte. Bekker hatte sie in einem Spezialgeschäft für Restaurantbedarf erstanden, drüben in Queens, für sechshundertfünfzig Dollar. Die Platte war auf einem ausrangierten Bibliothekstisch verankert, Bekker hatte ein Stück von den Tischbeinen absägen müssen, damit das Ganze die richtige Arbeitshöhe bekam. Der Balkenstrahler an der Decke mit den drei Spotlichtern warf kaltes, gleißendes Licht auf den Operationstisch.
Der Umstand, daß er seine Forschungen am lebenden Objekt betrieb, erforderte einige zusätzliche Maßnahmen. Er hatte Eisenringe am Tisch festgeschraubt, Corteses rechtes Handgelenk mit braunem Nylonseil an einen Ring gefesselt, das Seil schräg nach oben gezogen, über Corteses Schulter, durch einen Eisenring unter dem Nacken des Objekts geschlungen, über die rechte Schulter zurückgeführt und auf der linken Seite des Arbeitstisches festgezurrt. Eine äußerst wirkungsvolle Fesselung, Cortese lag wie in einem Nelsongriff, dessen Wirkung durch die Fesseln um die Taille, an den Knien und an den Fußgelenken verstärkt wurde.
Der linke Unterarm, in dem der Katheter für die Kreislaufkontrolle steckte, wurde zusätzlich durch Klebeband flach auf der Arbeitsplatte gehalten; es war sehr wichtig, daß der Arm völlig ruhig lag. Zwischen Corteses Zähnen steckte ein Knebel aus Hartgummi, der die Kiefer weit gespreizt hielt und die Atemwege blockierte, aber das Forschungsobjekt konnte ja durch die Nase atmen. Jedenfalls bestand auf diese Weise keine Gefahr, daß Cortese laut zu schreien anfing. Ein paarmal hatte er es versucht, mehr als ein dumpfes Wimmern war nicht daraus geworden. Meistens hatte er sowieso nur still dagelegen.
Am oberen Tischende waren die Monitore installiert. Das Rack hatte Becker in einem Discountladen erstanden, wo es allerdings unter irgendeiner pompösen Bezeichnung angeboten worden war, Super-Entertainment-Heimstudio – oder so ähnlich. Für das Herz der Anlage, die Monitore und deren Zubehör, waren natürlich nur Geräte aus dem Fachhandel in Frage gekommen. Er konnte die Körpertemperatur, den Kreislauf, den Herzschlag und die Hirnströme überwachen. Den fünften Monitor für neuro-intrakranielle Lokalisierungen hatte er bis jetzt noch nicht benutzt.
Auch sonst war der Raum gut ausgestattet, Bekker hatte viel Zeit investiert und eine Woche lang gearbeitet, schalldämpfende Platten an den Wänden und an der Decke angebracht und in dezentem Altweiß gestrichen, den Teppichboden geklebt, ein schönes Königsblau, die verchromten Stahlmöbel aufgestellt und alles sorgfältig mit Desinfektionslösung abgewaschen. Die Monitore zu beschaffen, war am schwierigsten gewesen. Ein gewisser Whitechurch aus dem Bellevue hatte sie ihm schließlich besorgt – für zweitausend in bar. Die Geräte hatten gerade in der Werkstatt gestanden, generalüberholt und wieder tadellos in Ordnung.
Er seufzte tief.
Eine Information auf einem der Monitore... Was ist denn? Wenn es ihm nur nicht so schwergefallen wäre, sich zu konzentrieren ...
Die Körpertemperatur. Vierundachtzig Grad Fahrenheit.
Vierundachtzig?
Das konnte doch nicht stimmen? Er schielte nach der Digitalanzeige der Uhr. Neun-null-sieben...
O Gott, er war schon wieder weggewesen.
Verwirrt rieb er sich den Nacken. Manchmal driftete er einfach weg, mitunter eine Stunde lang. In den kritischen Minuten, während er mit äußerster Konzentration arbeitete, passierte ihm das zum Glück nicht. Trotzdem, er mußte darauf achten. Immer dieses laute Seufzen, wenn er zurückkam ...
Er ging zu den beiden Aufnahmegeräten. Stellte fest, daß die Bandanzeige nicht übereinstimmte, der eine Recorder zeigte 504 an, der andere 509. Er spulte beide Bänder auf 200 zurück und drückte die Wiedergabetaste des einen Gerätes.
...nur geringfügige Reaktion nach unmittelbarer Stimulation, gemessener Ausschlag lediglich ein Millimeter ...
Seine eigene Stimme, heiser vor Erregung. Er schaltete den Recorder aus, drückte die Wiedergabetaste des anderen.
...Irisreflex äußerst schwach, unmittelbar nach der Reizeinwirkung starkes Abfallen der Anzeige auf dem Monitor Zwei...
Bekker seufzte, riß sich zusammen, warf – aus Sorge, er sei schon wieder weggewesen – rasch einen Blick auf die Uhr. Nein, alles in Ordnung, neun-null-neun. Er mußte aufräumen, den Leichnam wegschaffen, den Film aus der Kamera nehmen. Und er durfte auch nicht vergessen, sich zu notieren, was ihm zur Auswahl der Studienobjekte durch den Kopf gegangen war. Eine Menge Arbeit. Aber die mußte warten. Er konnte jetzt einfach nicht. Das PCP wirkte noch nicht. Er lauschte in sich hinein: heitere Gelassenheit. Das typische Gefühl nach einer Phase erfolgreicher, zufriedenstellender Arbeit ...
Ein Seufzen.
Er schielte auf die Digitalanzeige, spürte, wie ihn erneut die Angst befiel. Neun-zwo-fünf. Neun Uhr fünfundzwanzig? Großer Gott, er war irgendwo weit fort gewesen. Mitten in der Bewegung erstarrt, die Knie schmerzten ihm davon. Das passierte zu oft. Er brauchte mehr Medikamente. Kokain von der Straßenecke – gut und schön, aber das Zeug wirkte nicht präzise genug.
Und plötzlich: Ding.
Er drehte sich um. Der schrille Ton kam von hinten. Hörte sich fast an wie eine Klingel. Das übliche Signal, wenn die alte Frau da oben den Knopf drückte.
Ding.
Bekker runzelte die Stirn, stellte sich vor die Wechselsprechanlage, räusperte sich und drückte die Sprechtaste.
»Mrs. Lacey?«
»Meine Hände tun so weh.« Aufgeregt, schrill, brüchig. Alt. Sie war dreiundachtzig, schwerhörig, auf einem Auge fast blind. Die Arthritis machte ihr zu schaffen, und es wurde immer schlimmer. »Entsetzlich weh.«
»Ich bringe Ihnen eine Tablette hoch. Bin gleich da«, sagte er. »Aber, Mrs. Lacey ... Es sind nur noch drei da. Ich werde wohl morgen zusehen müssen, daß ich irgendwo ...«
»Wieviel?« krächzte sie dazwischen.
»Dreihundert Dollar.«
»Ach du meine Güte!« Sie klang erschüttert, die Stimme brach ihr fast.
»Das ist nicht so einfach heutzutage, Mrs. Lacey.«
Ja, ja, das wußte sie. Seit drei Jahrzehnten hatte sie sich daran gewöhnt, daß die Kerle auf der Straße immer mehr verlangten. Aber legal gab’s das Zeug ja nicht zu kaufen. Weder Morphium noch Marihuana.
»Pflegekraft mit Wohnrecht« nannte die alte Frau den Job, den sie ihm angeboten hatte. Eine nicht ganz zutreffende Bezeichnung, denn strenggenommen war sie kein Pflegefall. Er verstand seine Aufgabe anders. Gleich in den ersten Tagen hatte er Edith Lacey auf einen Artikel über Bankzusammenbrüche im Wall Street Journal hingewiesen. Sie war zu Tode erschrocken. Ihre Sozialversicherung, die ungefähr vierhunderttausend Dollar Erspartes, das Haus – alles schien auf einmal gefährdet, wenn man sich nicht mal mehr auf die Banken verlassen konnte...