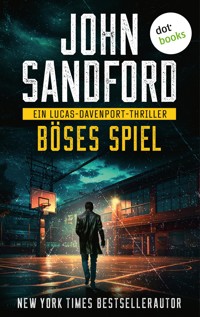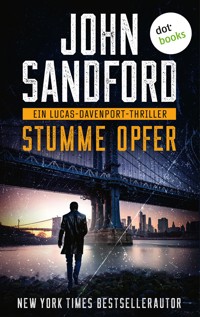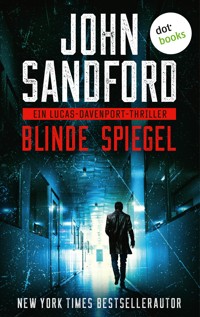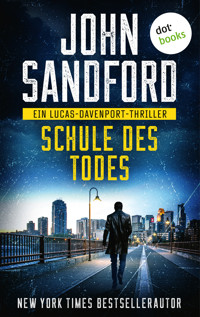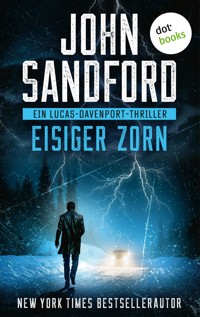
5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
Ein Inferno in dunkelster Nacht: Der rasante Thriller »Eisiger Zorn« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Zuerst tötet er den Vater. Dann die Mutter. Und dann das Kind. – Es ist der härteste Winter, den Wisconsin je erlebt hat. Aber nicht die frostige Witterung lässt den hiesigen Sheriff erschaudern, sondern die Kaltblütigkeit, mit der ein berühmt-berüchtigter Killer die dreiköpfige Familie LaCourt umgebracht hat. Ex-Polizist Lucas Davenport, ein Spezialist beim Aufspüren von Serienmördern, bietet der örtlichen Polizei seine Hilfe an. Aber diese Jagd treibt ihn an seine äußersten Grenzen, denn die Wälder von Wisconsin sind so dunkel-archaisch wie das Böse selbst. Während Schneestürme toben und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, muss Lucas den »Eismann« zur Strecke bringen, der sich als sein bisher grausamster Gegner erweisen könnte … »Sandford ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens!« Washington Post Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »Eisiger Zorn« von John Sandford – der spektakuläre fünfte Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von Dean Koontz und Mark Dawson. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Zuerst tötet er den Vater. Dann die Mutter. Und dann das Kind. – Es ist der härteste Winter, den Wisconsin je erlebt hat. Aber nicht die frostige Witterung lässt den hiesigen Sheriff erschaudern, sondern die Kaltblütigkeit, mit der ein berühmt-berüchtigter Killer die dreiköpfige Familie LaCourt umgebracht hat. Ex-Polizist Lucas Davenport, ein Spezialist beim Aufspüren von Serienmördern, bietet der örtlichen Polizei seine Hilfe an. Aber diese Jagd treibt ihn an seine äußersten Grenzen, denn die Wälder von Wisconsin sind so dunkel-archaisch wie das Böse selbst. Während Schneestürme toben und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, muss Lucas den »Eismann« zur Strecke bringen, der sich als sein bisher grausamster Gegner erweisen könnte …
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Die Website des Autors: johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: instagram.com/johnsandfordauthor/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
***
eBook-Neuausgabe April 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Winter Prey« bei bei G.P. Putnam’s Sons, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1994 unter dem Titel »Eisnacht« bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1993 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1994 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/plampy, Iakov Kalinin und AdobeStock/ana
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-082-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eisiger Zorn« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Eisiger Zorn
Ein Lucas-Davenport-Thriller 5
Aus dem Amerikanischen von Elke vom Scheidt und Joachim Körber
dotbooks.
Kapitel 1
Der Wind pfiff über den gefrorenen Lauf des Shasta Creek, zwischen den schwarzen Mauern aus Fichten hindurch. Die dünnen, nackten Erlen und die geschmeidigen jungen Birken bogen sich. Nadelspitze Kristalle jagten durch die Luft und schliffen wie Sandpapier Arabesken in den treibenden Schnee.
Der Eismann folgte dem Flußlauf zum See hinunter; er richtete sich sowohl nach seinem Gefühl als auch nach der Zeit und nach bekannten Wegmarken. Als das Leuchtzifferblatt seiner Taucherarmbanduhr zeigte, daß sechs Minuten vergangen waren, begann er, nach der toten Fichte Ausschau zu halten. Zwanzig Sekunden später wurde ihr vom Wind gegerbter Stamm vom Scheinwerferlicht des Schneemobils eingefangen und glitt dann wieder davon wie ein geisterhafter Anhalter.
Jetzt. Sechshundert Meter, Kompaß auf 360...
Zeit Zeit Zeit...
Fast wäre er gegen die westliche Uferböschung des Sees gefahren, die vom Haus herabfiel, Weiß auf Weiß, und sich plötzlich vor ihm erhob. Er zog eine Kurve, verlangsamte die Fahrt und folgte dem Verlauf des Seeufers. Das künstliche Blau eines Hoflichts wurde durch den fallenden Schnee sichtbar, und er zog den Schlitten am Ufer hoch und stellte den Motor ab.
Der Eismann schob das Visier des Helms hoch und blieb lauschend sitzen. Er hörte nichts als den auf seinen Anzug und Helm rieselnden Schnee, das Ticken des abkühlenden Motors, seinen eigenen Atem und den Wind. Er trug eine wollene Schneemütze mit Löchern für Augen und Mund. Der Schnee blieb in der weichen Wolle hängen, und nach einem Augenblick begann Schmelzwasser durch die Augenöffnungen und über seine Wangen zu laufen. Er war dem Wetter und der Fahrt entsprechend gekleidet: Der Schneeanzug hielt Wind und Nässe ab, die Beinlinge steckten in schweren Stiefeln, die Ärmel endeten in dicken Fäustlingen, und der Anzugkragen war direkt mit dem schwarzen Helm verbunden. Er war buchstäblich in Wolle und Nylon verpackt, und doch drang die Kälte durch die Nähte und dünneren Stellen und nahm ihm den Atem...
Ein Paar Schneeteller war hinter seinem Sitz auf dem Gepäckträger befestigt, zusammen mit einem in Zeitungspapier gehüllten Messer. Er drehte sich im Sattel zur Seite, holte eine Miniatur-Taschenlampe aus seinem Parka und richtete ihren Lichtstrahl auf den Gepäckständer. Seine Fäustlinge waren zu dick, um damit arbeiten zu können; er streifte sie ab und ließ sie an den Ärmelklammern hängen.
Der eisige Wind traf seine nackten Finger, als er die Schneeteller vom Gepäckträger löste. Er ließ sie zu Boden fallen, trat in die Bindungen, ließ sie zuschnappen und zog rasch die Fäustlinge wieder an. Seine Hände waren der Kälte kaum eine Minute ausgesetzt gewesen, und doch fühlten sie sich schon steif an.
Die Handschuhe wieder an den Händen, stand er auf und prüfte den Schnee. Die oberste Schicht war weich, aber die bittere Kälte hatte den Untergrund hart gefroren. Er sank fast nicht ein. Gut.
Wieder läuteten die Glocken in seinem Kopf: Zeit.
Er hielt inne, um ruhig zu werden. Das ganze komplizierte Uhrwerk seiner Seele war in Gefahr. Er hatte schon einmal getötet, aber das war fast zufällig passiert. Er hatte rings um die Leiche ein Selbstmordszenarium improvisieren müssen.
Und es hatte beinahe funktioniert.
Gut genug funktioniert, um die Gefahr auszuschließen, daß sie ihn fassen würden. Diese Erfahrung hatte ihn verändert, ihm einen Geschmack von Blut, einen Geschmack von wirklicher Macht gegeben.
Der Eismann warf den Kopf zurück wie ein Hund, der Witterung aufnimmt. Das Haus lag hundert Fuß weiter oben am Hang. Er konnte es nicht sehen; bis auf den entfernten Schein der Hoflampe lag es in tiefer Dunkelheit. Er nahm das Messer vom Gepäckträger und begann, den Abhang hinaufzusteigen. Das Messer war ein schlichtes Instrument, aber perfekt für einen Überfall aus dem Hinterhalt in einer Schneenacht, falls die Gelegenheit sich bieten sollte...
Bei Sturm, vor allem nachts, schien Claudia LaCourts Haus an den Rand der Welt zu rutschen. Während der Schnee immer dichter fiel, wurden die Lichter, die über den zugefrorenen See schienen, schwächer und verschwanden dann eins nach dem anderen.
Gleichzeitig rückte der Wald heran, Fichten und Tannen drängten näher und neigten sich mit einem unerträglichen Gewicht über das Haus. Der Lebensbaum raschelte gegen die Fenster, und die nackten Birkenäste kratzten am Dachgesims. Zusammen hörten sie sich an, als nähere sich etwas Böses, ein Tier mit Klauen und spitzen Zähnen, das an den Schindelwänden klapperte und festen Halt suchte. Ein Tier, das imstande wäre, das Haus zu zertrümmern.
Wenn sie allein oder mit Lisa zu Hause war, spielte Claudia ihre alten Langspielplatten von Tammy Wynette oder sah sich Spielshows im Fernsehen an. Doch der Sturm drang immer durch, dröhnend und kreischend. Oder irgendwo riß eine Leitung: Die Lampen flackerten und gingen aus, die Musik verstummte, jeder hielt den Atem an... und da war der Sturm mit seinen Pranken. Kerzenlicht machte alles nur schlimmer, und Sturmlaternen halfen auch nicht viel. Das Böse, das sich die Phantasie bei einem nächtlichen Blizzard ausmalte, war nur mit den Segnungen der modernen Wissenschaft zu bekämpfen: Satellitenfernsehen, Radio, CDs, Telefone, Computerspiele, Bohrmaschinen. Dinge, die Maschinenlärm machten. Dinge, die die düsteren Klauen vertrieben, die an dem Haus zerrten.
Claudia stand am Spülbecken, wusch Kaffeetassen ab und stellte sie auf das Ablaufbrett. Ihr Gesicht wurde vom Fenster wie von einem Spiegel reflektiert, aber mit dunkleren Augen, dunkleren Umrissen, wie bei einer alten Daguerreotypie.
Von außen hätte sie ausgesehen wie eine Madonna auf einem Gemälde, das einzige Anzeichen von Licht und Leben in dem Schneesturm; doch sie selbst sah sich nie als Heilige. Sie war eine Mutter mit noch immer guter Figur, rötlich getöntem Haar, Sinn für Humor und einer Vorliebe für Bier. Sie konnte ein Fischerboot fahren und Softball spielen, und ein- oder zweimal im Winter, wenn Lisa bei Freunden übernachtete, fuhren sie und Frank nach Grant und nahmen ein Zimmer im Holiday Inn, wo die Schränke neben dem Bett von oben bis unten verspiegelt waren und sie sich nächtelang liebten.
Claudia schabte den letzten Rest verbrannter Kruste aus der Kuchenform, spülte sie ab und stellte sie auf das Abtropfbrett.
Ein Zweig kratzte an der Fensterscheibe; sie schaute hinaus, doch ohne Furcht. Sie/summte vor sich hin, ein altes Lied aus Schulzeiten. Wenigstens waren sie und Lisa heute nacht nicht allein. Frank war da. Eben kam er die Treppe herauf, ebenfalls leise summend. Das geschah oft, daß sie gleichzeitig dasselbe taten.
»Hm«, sagte er, und sie drehte sich um. Das schütter werdende schwarze Haar fiel über seine dunklen Augen. Er sieht wie ein Cowboy aus, dachte sie, mit seinen hohen Wangenknochen und den in abgetragenen Stiefeln steckenden Jeans. Er trug eine fleckige Arbeitsschürze über dem T-Shirt und hielt einen Pinsel mit blutrotem Lack in der Hand.
»Hm was?« fragte Claudia. Sie waren beide zum zweiten Mal verheiratet, beide ein wenig angeschlagen, und sie mochten sich sehr.
»Ich hab’ gerade mit dem Bücherschrank angefangen, und da fiel mir ein, daß ich den Holzofen fast habe ausgehen lassen«, sagte er reumütig. »Ich brauche noch eine Stunde, bis ich mit dem Bücherschrank fertig bin. Bei dem Lack kann ich wirklich nicht aufhören.«
»Verdammt, Frank...« Sie verdrehte die Augen.
»Tut mir leid...« Das klang auf jungenhaft charmante Weise bedauernd.
»Was ist mit dem Sheriff?« fragte sie. Themawechsel. »Wirst du’s wirklich machen?«
»Ich seh’ ihn morgen«, sagte er. Er wandte den Kopf ab und wich ihrem Blick aus.
»Das bringt nichts als Schwierigkeiten«, sagte sie. Sie hatten schon über das Thema gestritten. Sie trat vom Spülbecken zurück und beugte sich nach hinten, um durch den Flur zu Lisas Zimmer hinüberschauen zu können. Ihre Tür war geschlossen, und gedämpft klang die Musik von Guns N’Roses herüber. Claudias Stimme wurde schärfer und klang besorgt. »Wenn du bloß den Mund halten würdest... Es ist nicht deine Verantwortung, Frank. Du hast Harper davon erzählt. Jim war sein Junge. Falls es Jim ist.«
»Es ist Jim, das ist eindeutig. Und ich hab’ dir gesagt, was Harper getan hat.« Frank schloß den Mund zu einem schmalen, strengen Spalt. Claudia kannte diesen Ausdruck, sie wußte, daß er es sich nicht anders überlegen würde. Wie dieser Soundso in High Noon. Gary Cooper.
»Ich wollte, ich hätte das Bild nie gesehen«, sagte sie und senkte den Kopf. Mit der rechten Hand rieb sie sich die Schläfe. Lisa hatte sie zu sich in ihr Zimmer geholt, um es ihr zu geben. Sie wollte nicht, daß Frank es sah.
»Wir können es nicht einfach auf sich beruhen lassen«, beharrte Frank. »Das hab’ ich Harper gesagt.«
»Es wird Ärger geben, Frank«, sagte Claudia.
»Damit kann die Justiz fertigwerden. Es hat nichts mit uns zu tun«, sagte er. Nach einem Moment fragte er: »Kümmerst du dich um den Ofen?«
»Ja, ja. Das mach’ ich schon.«
Claudia sah aus dem Fenster zu der Quecksilberdampflampe unten bei der Garage. Der Schnee schien von einem Punkt direkt unter der Lampe zu kommen, als werde er durch einen Tunnel auf das Fenster auf ihre Augen zugeblasen. Kleine Kugeln, wie Vogelmist. »Sieht aus, als würde es nachlassen.«
»Es hätte überhaupt nicht schneien sollen«, sagte Frank. »Arschlöcher.«
Er meinte die Wetterleute im Fernsehen. Sie hatten gesagt, in Ojibway County würde es klar und kalt sein, und nun schneite es wie verrückt.
»Überleg dir, ob du es nicht doch bleiben läßt.« Jetzt klang ihre Stimme flehend. »Denk noch einmal darüber nach.«
»Ich werd’s mir überlegen«, sagte er. Dann drehte er sich um und ging zurück in den Keller.
Er würde es sich überlegen, aber er würde seine Meinung nicht ändern. Claudia, die an das Bild dachte, zog ein Sweatshirt an und ging hinaus in den Vorraum. Frank hatte seine Autohandschuhe naß werden lassen und über das Ofenrohr gelegt; der Raum roch nach trockener Wolle. Sie zog ihren Parka und eine Mütze an, nahm ihre Handschuhe, schaltete vom Vorraum aus das Garagenlicht an und trat hinaus in den Sturm.
Das Bild. Die Personen hätten alle möglichen Leute sein können, aus Los Angeles oder Miami, wo sie solche Sachen machten. Aber das waren sie nicht.
Sie waren aus Lincoln County. Der Druck war schlecht, und das Papier war so billig, daß es einem fast in den Fingern zerfiel. Aber es war der Harper-Junge, das stimmte. Wenn man genau hinsah, erkannte man den Fingerstummel an der linken Hand, mit der er in eine Holzsäge geraten war; und man erkannte den Ohrring. Er saß nackt auf einer Couch, einen dumpfen Ausdruck im Gesicht. Es war das Gesicht eines Heranwachsenden, aber sie konnte noch immer den Schatten des kleinen Jungen sehen, den sie gekannt hatte und der in der Tankstelle seines Vaters arbeitete...
Im Vordergrund des Bildes sah man den Torso eines erwachsenen Mannes, dick, mit behaarter Brust. Claudia erinnerte sich nur allzugut daran. Sie war vertraut genug mit Männern und deren Körpern, aber dieses Bild hatte etwas an sich, etwas so Übles... die Augen des Jungen waren wie schwarze Punkte. Als sie genau hingesehen hatte, war es ihr vorgekommen, als habe bei der Zeitschrift jemand mit einem Filzstift die Pupillen geschwärzt.
Sie erschauerte bei dem Gedanken und eilte den schneeverwehten Pfad entlang, den sie zur Garage und zum Holzschuppen hinüber zwischen den Schneewänden geschaufelt hatten. Zehn Zentimeter Neuschnee lagen bereits von neuem auf dem Weg; sie würde ihn morgen früh wieder freischaufeln müssen.
Der Pfad endete an der Garagentür. Sie drückte die Tür auf, trat ein, schaltete das Licht ein und stampfte mit den Füßen auf, um den Schnee abzutreten. Die Garage war gut isoliert und wurde mit einem Holzofen beheizt. Vier dicke Scheite Eiche brannten langsam und gaben genug Wärme, um die Innentemperatur auch in den kältesten Nächten über dem Gefrierpunkt zu halten. Warm genug jedenfalls, um die Autos anzulassen. Hier draußen in Chequamegon konnte es lebenswichtig sein, daß die Autos ansprangen.
Der Ofen war noch heiß. Das Holz war zu Kohle verbrannt, aber Frank hatte den Ofen am Vorabend geleert – wenigstens das brauchte sie nicht zu tun. Sie drehte sich um, zu dem Holzstoß neben der Tür. Genug für die Nacht, aber nicht mehr. Sie warf ein paar dünne Scheite harziges Fichtenholz auf die Glut, um Flammen zu erzeugen, und legte dann vier dicke Stücke Eichenholz darauf. Das sollte reichen.
Sie warf einen Blick zu der Stelle, wo noch mehr Holz hätte sein sollen, seufzte und beschloß, daß sie ebensogut jetzt gleich ein paar neue Scheite holen könnte – damit sie bis zum Morgen auftauten. Sie ging wieder nach draußen, zog die Tür hinter sich zu und stapfte zur Seite der Garage, wo in einem Anbau das Holz lagerte. Sie nahm vier dicke Eichenscheite, trottete zurück zur Garagentür, stieß sie mit dem Fuß auf und ließ die Scheite neben dem Ofen zu Boden fallen. Noch ein Gang, dachte sie; den Rest konnte Frank morgen machen.
Sie ging wieder hinaus, trat in die Dunkelheit des Holzschuppens und nahm zwei weitere Eichenscheite.
Und spürte, wie sich die Härchen in ihrem Nacken sträubten.
Sie war nicht allein...
Claudia ließ das Eichenholz fallen und fuhr sich mit einer behandschuhten Hand an die Kehle. Im Schuppen war es dunkel. Sie konnte es spüren, aber nicht sehen, sie hörte, wie ihr Herz pochte und wie draußen der Schnee leise rieselte. Sonst nichts, aber dennoch...
Sie wich zurück. Nichts, nur Schnee und der blaue Lichtschein der Hoflampe. Als sie den Pfad mit dem verwehten Schnee erreicht hatte, hielt sie inne, lauschte in die Dunkelheit... und dann rannte sie.
Zurück zum Haus. Noch immer hatte sie das Gefühl, jemand sei hinter ihr, strecke aus nächster Nähe die Hand nach ihr aus. Sie krallte sich an den Türgriff, drückte ihn nieder, stieß mit dem Handballen die Tür auf und trat in die Wärme und Helligkeit des Vorraums.
»Claudia?«
Sie schrie.
Frank stand da, den Pinsel in der Hand, und starrte sie mit aufgerissenen Augen verwundert an. »Was ist denn?«
»Mein Gott«, sagte sie. Sie zog den Reißverschluß des Schneeanzugs auf, mühte sich mit dem Mützenverschluß ab und stammelte: »Mein Gott, Frank, da draußen bei der Garage ist jemand.«
»Was?« Er runzelte die Stirn, ging zum Küchenfenster und schaute hinaus. »Hast du ihn gesehen?«
»Nein, aber ich schwöre bei Gott, Frank, da draußen ist jemand, ich habe ihn gespürt«, sagte sie, faßte nach seinem Arm und schaute neben ihm aus dem Fenster. »Ruf die Polizei an.«
»Ich sehe nichts«, meinte Frank. Er ging durch die Küche, beugte sich über die Spüle und schaute hinaus in Richtung Hoflicht.
»Man kann nichts sehen«, sagte Claudia. Sie schob den Türriegel vor und trat dann in die Küche. »Frank, ich schwöre dir, da draußen ist jemand...«
»Also gut«, sagte er. Er nahm sie ernst. »Ich gehe nachsehen...«
»Warum rufen wir nicht an...?«
»Ich gehe nachsehen«, sagte er wieder. »Sie würden bei diesem Sturm keinen Polizisten hier rausschicken. Nicht, wenn du nicht mal jemanden gesehen hast.«
Er hatte recht. Claudia folgte ihm in den Vorraum und hörte sich stammeln: »Ich hab im Ofen Holz nachgelegt, und dann bin ich nach draußen gegangen, um ein paar Scheite für morgen früh hereinzuholen...« Das bin doch nicht ich, dachte sie.
Frank setzte sich auf die Bank im Vorraum, zog die Stiefel aus, stieg in den Schneeanzug und dann in die Stiefel; er verschnürte sie, zog den Reißverschluß des Anzugs zu und nahm seine Handschuhe. »Bin gleich wieder da«, sagte er. Es klang entnervt, aber er kannte sie. Sie war nicht der Typ, der leicht in Panik geriet.
»Ich komme mit«, stieß sie hervor.
»Nein, du wartest hier«, sagte er.
»Frank, nimm die Pistole mit.« Sie rannte zur Kommode und zog die Schublade auf. Ganz hinten, hinter einer falschen Rückwand, lag eine geladene 357er Smith and Wesson. »Vielleicht ist es Harper. Vielleicht...«
»Himmel«, sagte er und schüttelte den Kopf. Er grinste sie reumütig an, zog die Handschuhe an und ging aus der Tür.
Draußen auf der Vortreppe stach ihm der Schnee wie mit Nadeln ins Gesicht. Er wandte sich halb um. Solange er nicht direkt in den Wind schaute, hielt ihn der Schneeanzug warm. Aber er konnte nicht viel sehen und hörte nichts als das Pfeifen des Windes an seiner Nylonkapuze. Mit abgewandtem Kopf ging er die Stufen hinunter und trat auf den schneeverwehten Weg zur Garage.
Der Eismann war da, neben dem Holzstoß, die Schulter an die Ecke des Schuppens gedrückt, den Rücken dem Wind zugewandt. Er war auf dem Grundstück gewesen, als Claudia herauskam. Er hatte versucht, sie zu erreichen, aber nicht gewagt, seine Taschenlampe zu benutzen. Im Dunkeln hatte er sich im Gebüsch verfangen, und er hatte stehenbleiben müssen. Als sie wieder ins Haus rannte, hätte er fast kehrtgemacht, um zu seinem Schneemobil zurückzukehren. Die Gelegenheit war verpaßt, hatte er gedacht. Irgendetwas hatte sie gewarnt. Und die Zeit drängte. Er sah auf seine Uhr. Er hatte eine halbe Stunde, nicht mehr.
Doch nach einem Augenblick des Nachdenkens hatte er methodisch seine Schneeteller aus dem Gebüsch befreit und war weiter auf den dunklen Schatten der Garage zugegangen. Er mußte die LaCourts zusammen erwischen, in der Küche, wo er sich um beide gleichzeitig kümmern konnte. Sie würden bewaffnet sein, also mußte er schnell handeln.
Der Eismann trug einen Colt Anaconda unter dem Arm. Er hatte ihn einem Mann abgenommen, der gar nicht gemerkt hatte, daß er ihm gestohlen wurde... Das hatte er oft getan, in den alten Zeiten. Hatte sich eine Menge gutes Zeug besorgt. Der Colt Anaconda war ein Schatz, jede Rundung und jede Einbuchtung war genau durchkonstruiert und bis ins letzte ausgeklügelt...
Das Messer dagegen war in seiner Einfachheit fast elegant. Es war selbstgemacht, mit rohem Holzgriff und sah ein bißchen wie eine Machete aus, aber mit dünnerer Klinge und eckiger Spitze. Früher war es zum Hacken von Maisstengeln benutzt worden. Die Klinge hatte eine Patina von Rost, aber er hatte die Kanten geschliffen, und die neue Schneide war silbrig und glatt und scharf genug, um sich damit zu rasieren.
Das Messer konnte töten, aber dazu hatte er es nicht mitgebracht. Es erzeugte einfach Angst. Wenn er sie bedrohen mußte, um das Bild zu bekommen, wenn er dem Mädchen etwas antun mußte, ohne es gleich zu töten, dann war das Messer genau richtig.
Der Eismann stand hoch auf dem Schnee und fühlte sich wie ein Riese, weil sein Kopf fast den Dachgiebel der Garage erreichte, während er an ihr entlangging. Er sah Frank ans Fenster treten und hinausschauen und blieb stehen. Hatte Claudia ihn vielleicht doch gesehen? Unmöglich. Sie hatte sich umgedreht und war weggelaufen, und er hatte sie kaum sehen können, obwohl in der Garage und im Hof Licht gewesen war. Er selbst hatte in der Dunkelheit gestanden, ganz in Schwarz gekleidet. Unmöglich.
Der Eismann schwitzte von dem kurzen Anstieg den Hügel hinauf und dem Kampf mit dem Gebüsch. Er löste die Bindungen seiner Schneeteller, blieb aber darin stehen. Er mußte vorsichtig sein, wenn er den Pfad hinabstieg. Er blickte auf seine Uhr. Zeit. Zeit. Zeit...
Er zog den Reißverschluß seines Parka auf, streifte den Handschuh ab und langte unter die Jacke nach dem Colt. Gerade als er auf den Pfad hinabsteigen wollte, öffnete sich die Tür, und ein Streifen Licht fiel über die Vortreppe. Der Eismann wich zurück, schleifte die Schneeteller mit seinen Stiefeln nach und suchte, an die Wellblechwand der Garage gedrückt, im Dunkel hinter dem Schuppen Schutz.
Franks Silhouette zeichnete sich im Licht der geöffneten Tür ab, und gleich darauf kam er den Hohlweg zur Garage entlang. Er hatte eine Taschenlampe in der Hand und ließ ihren Lichtkegel über die Seitenwand der Garage wandern. Der Eismann zog sich ganz zurück, als das Licht über die Wand strich, wartete noch ein paar Sekunden, bis Frank außer Sicht sein mußte, und spähte dann um den Schuppen herum. Frank hatte die Garagentür erreicht, öffnete sie. Der Eismann schlich zur Ecke der Garage, den Colt in der linken Hand, das Messer in der rechten, und die eisige Kälte stach seine nackten Hände wie glühende Nadeln.
Frank schaltete das Garagenlicht an und trat ein. Wenig später ging das Licht wieder aus. Frank kam heraus, zog die Tür hinter sich zu und rüttelte am Türknauf, um sicherzugehen, daß sie fest geschlossen war. Dann folgte er dem Pfad weiter, ließ das Licht der Taschenlampe langsam über den Hof hinüber zum Gastank gleiten. Trat noch einen Schritt vor.
Der Eismann wartete schon. Das Messer blitzte auf, fuhr nieder. Frank sah es kommen, gerade noch rechtzeitig, um zurückzuzucken, aber zu spät, um ihm noch auszuweichen. Die Schneide durchschlug Franks Parkamütze und seine Schädeldecke; die Wucht des Aufpralls durchzuckte den Arm des Eismanns. Es war ein vertrautes Gefühl, als hätte er das Messer in einen Zaunpfahl gerammt.
Die Schneide kam wieder frei, als Frank zusammenbrach. Er war schon im Fallen tot, aber aus seinem Körper drang ein Geräusch wie das einer Schlange, auf die man getreten war, ein scharfes Zischen, und dann färbte das Blut den Schnee rot.
Für einen kurzen Augenblick war der Sturm verstummt, als hielte die Natur den Atem an. Gleichzeitig hatte es offenbar aufgehört zu schneien, und etwas bewegte sich am Saum des Waldes, am Rande des Gesichtsfelds des Eismanns. Etwas war da draußen... Der Eismann erschauerte. Er sah sich um, aber jetzt war alles wieder ruhig, und der Sturm und der Schneefall hatten ebenso schnell wieder eingesetzt wie sie aufgehört hatten.
Der Eismann ging den Pfad entlang, näherte sich dem Haus. Claudias Gesicht erschien am Fenster; er konnte sie durch den Sturm sehen. Er hielt inne, sicher, daß sie ihn ebenfalls gesehen hatte. Doch sie drückte ihr Gesicht nur dichter an die Scheibe und spähte hinaus, und da wurde ihm klar, daß sie ihn noch immer nicht bemerkt hatte. Nach einem Augenblick verschwand sie vom Fenster. Der Eismann schritt wieder auf das Haus zu, stieg die Vortreppe hinauf, so leise er konnte, drehte den Türknauf und stieß die Tür auf.
»Frank?« Claudia war da, sie stand in der Tür zur Küche. Ihre Hand fuhr hoch, und der Eismann sah das Glänzen von Chrom, erkannte es, reagierte, hob die große 44er Magnum.
»Frank?« Claudia schrie. Die 357er hing in ihrer Hand, an ihrer Seite, nicht entsichert, vergessen, ein wertloses Symbol der Selbstverteidigung. Der Eismann nahm Claudia ins Visier. Das hatte er stundenlang geübt, das Anvisieren von Zielen, und er wußte, er hatte sie, spürte die Treffsicherheit in den Knochen, eins mit seinem Ziel.
Der Schuß traf Claudia in die Stirn, und die Welt stand still. Keine Lisa mehr, kein Frank mehr, keine Nächte mit Spiegeln im Holiday Inn mehr, keine Erinnerungen, kein Bedauern. Nichts. Sie prallte nicht zurück wie im Film. Sie stürzte nicht nieder, sondern sank einfach um, mit aufgerissenen Augen und offenem Mund. Der Eismann, der den Colt senkte, war irgendwie enttäuscht. Die große Waffe sollte die Leute niederhämmern, sie umnieten, die große Waffe war eine universale Macht...
Da ertönte aus dem Hinterzimmer in die Stille nach dem Schuß hinein die Stimme eines jungen Mädchens: »Mom? Mom? Was war das?«
Der Eismann packte Claudia, schleifte sie in die Küche und ließ sie fallen. Sie lag auf dem Boden wie eine Marionette mit durchgeschnittenen Fäden. Ihre Augen waren offen und blicklos. Er ignorierte sie. Er konzentrierte sich jetzt auf das hintere Zimmer. Er brauchte das Bild. Er hob das Messer und machte sich auf den Weg.
Wieder die Stimme des Mädchens. Diesmal ein wenig furchtsam: »Mom?«
Kapitel 2
Lucas Davenport stieg aus seinem Wagen. Das Licht auf dem Haus der LaCourts war gleißend. In der absolut klaren Luft sah man jeden Riß, jedes Loch, jeden Glassplitter so deutlich wie ein Haar unter einem Mikroskop. Der Geruch von Tod wehte ihn an, und er wandte ihm das Gesicht zu, nahm Witterung auf wie ein steinzeitlicher Jäger.
Das Haus sah mit den scheibenlosen Fensteröffnungen, die in die Schneelandschaft starrten, einem Schädel merkwürdig ähnlich. Die Haustür war von Feueräxten zertrümmert, die Seitentür, die nur noch an einer Angel hing, vom Feuer verzogen und geschwärzt. Die Vinylverkleidung war geschmolzen, verkohlt, verbrannt. Das halbe Dach war weg, und die Mitte der Ruine lag unter freiem Himmel. Überall war rosa Glaswolle, sie hing aus dem Haus, wehte über den Schnee, verfing sich in den nackten Birkenästen wie obszönes, fleischiges Haar. Eis vom Löschwasser, vermischt mit Ruß und Asche, drang allenthalben aus allen Türen und Rissen wie Miniaturgletscher.
Auf einer Seite des Hauses standen drei Reihen tragbarer Scheinwerfer, gespeist von einem alten, benzingetriebenen Armeegenerator, und tauchten die Szene in grelles, blauweißes Licht. Der Generator übertönte das Schreien der Feuerwehrleute und das Dröhnen der Löschpumpen mit einem wilden Hämmern.
Alles stank.
Nach Benzin und brennendem Isoliermaterial, nach wasserdurchtränktem Gips, verbranntem Fleisch und Dieselabgasen. Das Feuer hatte schnell um sich gegriffen, wütend gebrannt und war dann rasch erloschen. Die Toten waren mehr verkohlt als verbrannt.
Zwanzig Männer durchsuchten das Haus. Einige waren Feuerwehrleute, andere Polizisten, drei oder vier Personen waren in Zivil. Der Schneefall hatte nachgelassen, wenigstens zeitweilig, aber der Wind schnitt scharf wie Rasierklingen in die nackte Haut.
Lucas war groß, hatte einen dunklen Teint und tiefliegende, verblüffend blaue Augen unter einer kräftigen Stirn. Sein Haar war dunkel, leicht angegraut und recht lang; eine Strähne fiel ihm in die Augen, und er strich sie beiseite, während er dastand und das Haus betrachtete.
Zitternd, einem Jagdhund nicht unähnlich...
Sein Gesicht hätte kantig sein sollen und war das normalerweise auch, wenn er zehn Pfund schwerer war. Ein kantiges Gesicht paßte zu seiner übrigen Erscheinung, seinen schweren Schultern und Händen. Doch jetzt war er mager, und die Haut spannte sich über seinen Backenknochen: das Gesicht eines Boxers, der in hartem Training steht. Seit einem Monat hatte er täglich Skier oder Schneeteller angelegt und war durch die Hügel rund um seine Hütte in North Woods gelaufen. Nachmittags arbeitete er auf dem Holzplatz und spaltete mit einem Keil und Holzhammer Eichenscheite.
Wie hypnotisiert ging Lucas auf das verbrannte Haus zu. Er erinnerte sich an ein anderes Haus, in Minneapolis, gleich südlich vom Loop, in einer eisigen Februarnacht. In der unteren Wohnung lebte der Führer einer Gang; eine rivalisierende Gruppe beschloß, ihn auszuräuchern. Im oberen Stock wohnte eine Frau – Shirleen Soundso –, die illegal einen Übernachtungsservice für Kinder aus der Nachbarschaft betrieb. Sechs Kinder schliefen in dieser Etage, als unten die Molotow-Cocktails durch die Fenster flogen. Shirleen warf alle sechs schreienden Kinder aus dem Fenster. Zwei brachen sich die Beine, zwei weitere die Rippen, und ein Nachbar, der sie aufzufangen versuchte, trug einen gebrochenen Arm davon. Die Frau selbst war zu dick, um zu springen, und verbrannte bei dem Versuch, über die einzige Treppe aus dem Haus zu gelangen. Das Haus hatte genauso ausgesehen: nackt wie ein Schädel, Eis vom Löschwasser, und dieser Geruch, dieser beißende Geruch...
Unwillkürlich schüttelte Lucas den Kopf und lächelte. Er hatte gute Beziehungen zur Crack-Gemeinde gehabt und dem Morddezernat die Namen der Bandenmitglieder genannt. Sie saßen noch immer in Stillwater, wo sie für weitere acht Jahre bleiben würden. Binnen zweier Tage hatte er sie so erwischt, daß sie es noch immer nicht glauben konnten...
Und nun dies. Er ging zurück zur offenen Tür seines Wagens, beugte sich hinein, nahm eine Kappe aus schwarzem Kaschmir vom Beifahrersitz und setzte sie auf. Er trug einen blauen Parka über Jeans und einem Strickpullover, Schneestiefel und lange Unterwäsche, wie sie für Arktis-Expeditionen hergestellt wurde. Ein Deputy kam um den Geländewagen herum, der vor Davenports Ford in den Hof eingebogen war. Henry Lacey trug den üblichen braunen Sheriffsparka und Thermohosen.
»Shelly ist da drüben«, sagte Lacey und wies mit dem Daumen auf das Haus. »Kommen Sie, ich mache Sie bekannt... Was sehen Sie sich an, das Haus? Was ist daran komisch?«
»Nichts.«
»Ich dachte, ich hätte Sie lächeln sehen«, sagte Lacey ein wenig verstört.
»Ach was, mir ist bloß kalt«, sagte Lucas ausweichend. Verdammt, auch das noch.
»Ja, also, Shelly...«
»Ja.« Lucas folgte ihm, während er seine dicken Skihandschuhe anzog, noch immer das Haus betrachtend. Es hätte ein eisiger Vorort der Hölle sein können. Er fühlte sich wie zu Hause.
Sheldon Carr stand auf einer Eisplatte in der Einfahrt hinter den Tank- und Pumpwagen der Freiwilligen Feuerwehr. Er trug die gleiche Sheriffs-Winterausstattung wie Lacey, aber in Schwarz anstelle von Khaki und mit dem goldenen Sheriffstern statt der silbernen Marke des Deputys. Ein vereister schwarzer Schlauch schlängelte sich an seinen Füßen vorbei zum See hinunter, wo die Feuerwehrleute sich durch drei Fuß dickes Eis gehackt hatten, um an das Seewasser heranzukommen. Jetzt benutzten sie eine Fackel, um den Schlauch aufzutauen, und die blaue Flamme flackerte am Rand von Carrs Gesichtsfeld.
Carr war benommen. Er hatte getan, was er konnte, und dann hatte er zu funktionieren aufgehört: Er stand einfach in der Einfahrt und sah den Feuerwehrleuten bei der Arbeit zu. Und er fror erbärmlich. Seine Winterkleidung war für dieses Wetter nicht ausreichend. Seine Beine fühlten sich steif an und seine Füße taub, aber er konnte nicht in die Garage gehen, konnte sich nicht losreißen. Er stand da wie ein dunkler Schneemann, leicht übergewichtig, reglos, die Arme ein wenig abgespreizt, und starrte zum Haus empor.
»So ein...« Ein Feuerwehrmann rutschte aus und fiel fluchend hin. Carr mußte sich ungelenk umdrehen, um ihn anzuschauen. Der Feuerwehrmann war mit Asche verschmiert und halb von Eis bedeckt. Als sie versucht hatten, das Feuer zu löschen, hatte der Wind das Wasser in Form von Schneeregen auf sie zurückgetrieben. Ein paar von den Feuerwehrleuten sahen aus wie kleine, bewegliche Eisberge; sie glitzerten im starken Licht der Scheinwerfer, während sie sich über den Hof arbeiteten. Dieser hier lag auf dem Rücken und schaute zu Carr auf; sein Schnurrbart war weiß von Eis, das Gesicht rot vom Wind und der Anstrengung. Carr bewegte sich, um ihm zu helfen, und streckte die Hand aus, aber der Feuerwehrmann winkte ab. »Ich würde Sie nur umwerfen«, sagte er. Ungeschickt rappelte er sich auf und kämpfte mit einem gefrorenen Löschschlauch. Er versuchte, ihn in einen Lastwagen zu packen, doch der Schlauch wehrte sich wie eine flinke Anaconda. »So eine Scheiße...«
Carr wandte sich wieder dem Haus zu. Ein in Gummi gehüllter Feuerwehrmann half der Ärztin, durch die zertrümmerte Haustür zu klettern. Carr sah zu, wie sie sich allmählich einen Weg zum Kinderzimmer bahnten. Das kleine Mädchen war dort, die Leiche so verkohlt, daß nur Gott wissen konnte, was mit ihr passiert war. Was ihren Eltern zugestoßen war, war ziemlich klar. Claudias Gesicht war teilweise von einem feuerfesten Vorhang geschützt worden, der über sie gefallen war. Ein großes Einschußloch gähnte in ihrer Stirn wie ein ausdrucksloses drittes Auge. Und Frank...
»Irgendwas aus Madison gehört?« rief Carr einem Deputy in einem Jeep zu. Der Deputy ließ den Motor laufen, hatte die Heizung voll aufgedreht und das Fenster gerade so weit geöffnet, um sich verständigen zu können.
»Nichts. Schneit noch immer da unten. Vermutlich warten sie’s ab.«
»Abwarten? Abwarten?« Sheldon Carr schrie plötzlich, und seine Augen blitzten. »Rufen Sie die Dreckskerle noch mal an und sagen Sie ihnen, sie sollen gefälligst ihre Ärsche hierher bewegen. Sie haben sicher schon mal von Autos mit Vierradantrieb gehört, nicht? Rufen Sie sie noch mal an...«
»Sofort«, sagte der Deputy schockiert. Er hatte Sheldon Carr nie etwas Stärkeres sagen hören als verflixt.
Carr wandte sich ab. Er knirschte mit den Zähnen. Die Kälte hatte er vergessen. Abwarten? Henry Lacey kam auf ihn zu, sich vorsichtig über das trügerische Eis tastend, das sich bis in den Hof erstreckte. Ein Mann in einem Parka folgte ihm. Dann standen sie vor ihm. Der Mann nickte und sagte: »Ich bin Davenport.«
Carr nickte. »D-d-danke f-f-fürs Kommen.« Plötzlich brachte er die Worte kaum mehr heraus.
Lacey faßte ihn am Ellbogen. »Waren Sie die ganze Zeit hier draußen?«
Carr nickte benommen, und Lacey schob ihn auf die Garage zu und sagte: »Mein Gott, Shelly, Sie bringen sich um...«
»Ich bin okay«, stieß Carr hervor. Er machte seinen Arm frei und wandte sich an Lucas. »Als ich hörte, daß Sie aus Minneapolis hier sind, dachte ich, Sie wüßten mehr über diese Art Sachen als ich. Dachte, es wäre einen Versuch wert. Ich hoffe, Sie können uns helfen.«
»Henry sagte mir, daß es übel aussieht«, sagte Lucas.
Er grinste bei diesen Worten, ein leicht gemeines Grinsen, wie Carr dachte. Davenport hatte einen abgebrochenen und nie überkronten Zahn, wie man ihn sich vielleicht bei einem Kampf holt. Eine Narbe durchschnitt eine Augenbraue. »Es ist eine...« Carr schüttelte den Kopf und suchte nach Worten. »Es ist eine verflixte Tragödie«, sagte er schließlich.
Lucas schaute ihn an. Er hatte noch nie gehört, daß ein Polizist ein Verbrechen als Tragödie bezeichnete. Er hatte auch noch nie einen Polizisten verflixt sagen hören. Von Carrs Gesicht konnte er nicht viel sehen, aber der Sheriff war ein großer Mann mit ausladendem Bauch. In seinem schwarzen Schneeanzug sah er aus wie der Reifenmann von Michelin in Trauer.
»Wo ist die Spurensicherung?« fragte Lucas.
»Sie haben Schwierigkeiten, aus Madison rauszukommen«, sagte Carr grimmig. Er zeigte zum Himmel. »Der Sturm...«
»Haben sie keine Wagen mit Vierradantrieb? Die ganze Strecke ist Highway...«
»Das stellen wir gerade fest«, versetzte Carr barsch. Dann entschuldigte er sich: »Tut mir leid, das ist ein heikles Thema. Inzwischen müßten sie schon auf halbem Weg sein.« Er schaute zum Haus zurück, als könne er dessen Anziehungskraft nicht widerstehen. »Gott helfe uns.«
»Drei Tote?« fragte Lucas.
»Drei Tote«, sagte Carr. »Erschossen, mit einer Art Axt oder so was erschlagen, und die andere... erschossen oder sonst was, man weiß es nicht. Ein Kind.«
»Sind sie noch im Haus?«
»Kommen Sie«, sagte Carr grimmig. Plötzlich begann er, unkontrollierbar zu zittern; dann nahm er sich mühsam wieder zusammen und entspannte sich. »Wir haben sie zugedeckt. Und da ist noch was... Teufel, schauen wir uns erst die Leichen an, und dann kümmern wir uns darum.«
»Shelly, sind Sie okay?« fragte Lacey wieder.
»Ja, ja... ich führe Davenport – Lucas? – ich führe Lucas herum, dann gehe ich rein. Herrgott, diese Kälte ist unglaublich.«
Frank LaCourt lag mit dem Gesicht nach oben auf einem Gehweg, der vom Haus zur Garage führte. Carr ließ einen der Deputies die Plastikplane anheben, die die Leiche bedeckte; Lucas kauerte sich daneben.
»Himmel«, sagte er. Er schaute zu Carr auf, der sich abgewandt hatte. »Was ist mit seinem Gesicht passiert?«
»Ein Hund vielleicht«, sagte Carr und sah von der Seite auf das verstümmelte Gesicht nieder. »Kojoten... ich weiß nicht.«
»Könnte ein Wolf gewesen sein«, sagte Lacey von hinten.
»Wir hatten ein paar Berichte, ich glaube, es gibt einige, die hier runterkommen.«
»Haben ihn ganz schön zugerichtet«, sagte Lucas.
Carr schaute hinaus auf den Wald, der das Haus umgab. »Das ist der Winter«, sagte er. »Da draußen verhungert alles. Wir füttern einiges Wild, aber die meisten Tiere werden sterben. Tja, die meisten sind schon tot. Es gibt Kojoten, die sich bei den Mülltonnen in der Stadt herumtreiben, bei dem Pizzalokal...«
Lucas zog einen Handschuh aus, nahm eine Taschenlampe aus der Tasche seines Parka und leuchtete das an, was vom Gesicht des Mannes übrig war. LaCourt war ein Indianer, vielleicht fünfundvierzig Jahre alt. Sein Haar war steif von gefrorenem Blut. Ein Tier hatte den größten Teil seiner linken Gesichtshälfte zerfleischt.
»Der Angriff kam von der Seite, spaltete fast seinen Kopf, durch die Kapuze hindurch«, sagte Carr. Lucas nickte, berührte mit einem behandschuhten Finger die Kapuze und betrachtete den durchtrennten Stoff. »Der Arzt sagt, es wäre eine Art Messer oder Hackbeil gewesen«, sagte Carr.
Lucas stand auf. »Henry sprach von Schneetellern...«
»Da drüben«, sagte Lacey und deutete hin.
Lucas richtete die Taschenlampe in den Schatten neben dem Schuppen. Breite Abdrücke waren noch immer im Schnee sichtbar. Sie waren halb zugeweht.
»Wohin führen sie?« fragte Lucas und starrte zu den dunklen Bäumen hinunter.
»Sie kommen vom See herauf durch den Wald und führen dann wieder nach unten«, sagte Carr und zeigte auf einen Abschnitt des dichten Waldes. »Da unten ist eine Schneemobilspur, auf der dauernd Maschinen fahren. Frank hatte selbst ein paar Schlitten, also könnte er die Spur auch selbst hinterlassen haben, das wissen wir nicht.«
»Die Spuren führen genau zu der Stelle, an der er erschlagen wurde«, sagte Lucas.
»Ja – aber wir wissen nicht, ob er auf Schneetellern zum See runtergegangen ist, um nach etwas zu sehen, und dann zurückkam und getötet wurde, oder ob der Mörder kam und ging...«
»Wenn es seine Schneeteller waren, wo sind sie jetzt?«
»Im Vorraum gibt es welche, aber sie wurden von den Löscharbeiten so in Mitleidenschaft gezogen, daß wir nicht wissen, ob sie kurz zuvor benutzt worden sind oder was... keine Möglichkeit, das festzustellen«, sagte Lacey. »Aber sie haben die richtige Form. Bärentatzen. Keine Verlängerungen.«
»Okay.«
»Aber wir haben noch ein Problem«, sagte Carr und schaute widerstrebend auf die Leiche hinunter. »Sehen Sie sich den Schnee an, der auf ihm liegt. Die Feuerwehrleute haben ihn mit der Plane zugedeckt, sobald sie herkamen, aber für mich sieht es so aus, als läge eine dünne Schneeschicht auf ihm...«
»Ja, und?«
Carr starrte die Leiche einen Moment an und senkte dann die Stimme. »Hören Sie, ich erfriere, und es gibt ein paar seltsame Sachen, über die wir reden müssen. Ein Problem. Wollen Sie die anderen Leichen jetzt sehen? Die Frau wurde in die Stirn geschossen, das Mädchen ist verbrannt... Wir könnten auch gleich gehen und alles bereden.«
»Ein kurzer Blick«, bat Lucas.
»Dann kommen Sie«, sagte Carr.
Lacey entfernte sich. »Ich kümmere mich um Verstärkung, Shelly.«
Lucas und Carr tappten über eine Schicht aus farblosem Eis zum Haus und quetschten sich durch die Haustür. Innen hatten sich Wandverkleidungen und Deckenpaneele verzogen und verbogen und waren auf verbrannte Möbel und Teppiche gefallen. Geschirr, Töpfe und Pfannen und Glasscherben bedeckten den Boden; darunter lag eine Gruppe von Sammelfiguren aus Keramik. Bilderrahmen waren überall. Einige waren verbrannt, doch alle paar Schritte schaute ein klares, glückliches Gesicht den Besucher an, strahlend und mit großen Augen. Bessere Zeiten.
Zwei Deputies arbeiteten sich mit Kameras durch das Haus, der eine mit einer Videokamera, deren Kabel durch seinen Kragen in seinen Parka führte, der andere mit einer 35mm-Nikon.
»Mir frieren die Hände ab«, stammelte der Mann mit der Videokamera.
»Gehen Sie runter zur Garage«, sagte Carr. »Sonst holen Sie sich noch was.«
»In meinem Wagen sind ein paar Kannen mit heißem Kaffee und Pappbecher. Der weiße Explorer, der auf dem Parkplatz steht«, sagte Lucas. »Die Türen sind offen.«
»D-danke.«
»Heben Sie was für mich auf«, sagte Carr. Und zu Lucas: »Woher haben Sie den Kaffee?«
»Ich hab’ auf dem Weg hierher bei Dow’s Corners angehalten und deren Kaffeemaschine geleert. Ich bin sechs Jahre Streife gefahren und muß mir bei Hunderten von solchen Aktionen den Arsch abgefroren haben...«
»Aha. Dow’s.« Carr kniff die Augen zusammen und ging im Stillen eine Liste durch. »Sind das noch immer Phil und Vickie?«
»Ja. Kennen Sie sie?«
»Ich kenne jeden am Highway 77, von Hayward in Sawyer County bis zum Highway 13 in Ashland County«, sagte Carr sachlich. »Hier entlang.«
Er ging voran in einen verkohlten Korridor, vorbei an einer Badezimmertür, bis zu einem kleinen Schlafzimmer. Die Wand auf der Seeseite war fort, und Schnee rieselte durch die Trümmer. Die Leiche lag unter einem verbrannten Bettgestell; die Sprungfedern drückten auf die Brust des Mädchens. Einer der tragbaren Scheinwerfer stand direkt draußen vor dem Fenster und warf kaltes, indirektes Licht auf die verkohlten Trümmer, ließ aber das Gesicht des Mädchens in fast, doch nur fast völliger Dunkelheit. Lucas konnte ihre unglaublich weißen Zähne aus den verkohlten Resten lächeln sehen.
Lucas hockte sich nieder, schaltete die Taschenlampe ein, knurrte, schaltete sie wieder aus und stand auf.
»Mir ist schlecht geworden«, sagte Carr. »Ich war bei der Highway-Patrol, bevor ich zum Sheriff gewählt wurde. Ich habe ein paar unglaubliche Autounfälle gesehen. Davon wurde mir nicht schlecht, aber von dem hier schon.«
»Unfälle sind was anderes«, stimmte Lucas zu. Er sah sich im Zimmer um. »Wo ist die andere?«
»Küche«, sagte Carr. Wieder gingen sie durch den Korridor. »Warum hat er das Haus angesteckt?« fragte Carr, diesmal lauter. »Um die Morde zu vertuschen kann’s nicht gewesen sein. Er hat Franks Leichnam draußen auf dem Hof liegen gelassen. Wenn er einfach gegangen wäre, hätte es ein oder zwei Tage dauern können, bis jemand gekommen wäre. Wollte er damit prahlen?«
»Vielleicht hat er an Fingerabdrücke gedacht... Was hat LaCourt gemacht?«
»Er arbeitete unten in der Feriensiedlung, im Eagle Casino. War Sicherheitsmann.«
»In Casinos gibt’s viel Geld«, sagte Lucas. »Hatte er da unten Schwierigkeiten?«
»Weiß ich nicht«, sagte Carr schlicht.
»Was ist mit seiner Frau?«
»Sie war Aushilfslehrerin.«
»Irgendwelche Eheprobleme oder Exgatten, die herumlaufen?« fragte Lucas.
»Tja, sie waren beide schon mal verheiratet. Ich werde Franks Exfrau überprüfen, aber ich kenne sie, Jean Hansen. Die könnte keiner Fliege was zuleide tun. Und Claudias Exmann ist Jimmy Wilson; der ist vor drei oder vier Wintern nach Phoenix gezogen, aber er würde so etwas auch nicht tun. Ich werd’ ihn überprüfen, aber bei keiner der beiden Scheidungen hat es wirklich böses Blut gegeben. Sie mochten sich bloß nicht mehr. Kennen Sie das?«
»Ja, das kenne ich... Was ist mit dem Mädchen? Hatte sie einen Freund?«
»Das werd’ ich auch überprüfen«, sagte Carr. »Tja, aber, ich weiß nicht. Sie ist noch ziemlich jung.«
»Es gibt immer mehr Teenager, die ihre Familien und Freunde töten...«
»Ja. Eine Generation von Ratten.«
»Und heranwachsende Burschen bringen manchmal Feuer und Sex durcheinander. Es gibt eine Menge junger Brandstifter. Wenn jemand auf das Mädchen scharf war, müßte man da genauer nachhaken.«
»Sie könnten mit Bob Jones von der Junior High School reden. Er ist der Direktor und auch Schulpsychologe, also weiß er vielleicht was.«
»Hm«, sagte Lucas. Mit dem Ärmel streifte er eine verbrannte Wand; er bürstete ihn mit der Hand ab.
»Ich hoffe, Sie bleiben ein Weilchen hier«, platzte Carr heraus. Ehe Lucas antworten konnte, sagte er: »Kommen Sie, hier entlang.«
Sie bahnten sich einen Weg auf die andere Seite des Hauses, durch das Wohnzimmer und die Hintertür in die Küche. Zwei dick vermummte Gestalten beugten sich über eine dritte Leiche.
Die größere der beiden Gestalten richtete sich auf und nickte Carr zu. Der Mann trug eine russische Mütze mit heruntergeklappten Ohrenschützern und der Marke eines Deputies auf der Vorderseite. Die andere Gestalt, die eine Tasche bei sich hatte, benutzte ein metallenes Werkzeug, um den Kopf des Opfers zu drehen.
»Unglaublich, dieses Wetter«, sagte der Deputy. »Mir ist so sch... eh, so kalt, es ist unglaublich.«
»Scheißkalt, wollten Sie sagen«, sagte die Gestalt, die sich noch immer über die Leiche beugte. Ihre Stimme war leise und kaum moduliert und klang fast gelehrt. »Ich habe wirklich nichts gegen das Wort, vor allem, wenn es so scheißkalt ist.«
»Er hat sich’s nicht Ihretwegen verkniffen, sondern meinetwegen«, sagte Carr unverblümt. »Sehen Sie da unten irgendwas, Weather, oder spielen Sie bloß rum?«
Die Frau blickte auf und sagte: »Wir müssen sie nach Milwaukee schaffen, damit die Profis sie sich ansehen. Keine nächtlichen Stümpereien in der Leichenhalle.«
»Können Sie überhaupt etwas sehen?« fragte Lucas.
Die Ärztin schaute auf die Frau unter ihren Händen nieder. »Claudia wurde offensichtlich erschossen, mit einer ziemlich großkalibrigen Waffe. Könnte ein Gewehr gewesen sein. Der Schuß ging glatt durch. Hoffentlich können die Leute von der Spurensicherung die Patrone finden. In ihr ist sie nicht.«
»Was ist mit dem Mädchen?« fragte Lucas.
»Ich brauche eine Autopsie, ehe ich Ihnen etwas Definitives sagen kann. Es gibt Spuren von verkohltem Stoff um ihre Taille und zwischen ihren Beinen, also würde ich sagen, daß sie eine Unterhose und vielleicht sogar, hm, wie nennt man diese Trikothosen, äh...«
»Trainingshosen«, sagte Carr.
»Ja, so etwas. Und Claudia war mit Sicherheit angezogen, Jeans und lange Unterhosen.«
»Sie wollen damit sagen, daß sie nicht vergewaltigt wurden«, sagte Lucas.
Die Frau nickte und stand auf. Die Kapuze ihres Parka war eng um ihr Gesicht gezogen und ließ nur ein Oval um Augen und Nase frei. »Ich kann es nicht mit Sicherheit feststellen, aber auf den ersten Blick sieht es so aus. Allerdings ist das, was mit dem Mädchen passiert ist, möglicherweise schlimmer gewesen.«
»Schlimmer?« Carr zuckte zurück.
»Ja.« Sie beugte sich vor, öffnete ihre Tasche, und der Deputy sagte: »Das will ich nicht sehen.« Sie richtete sich wieder auf und reichte Carr eine Plastiktüte. Carr starrte den Inhalt an und reichte die Tüte dann Lucas.
»Was ist das?« fragte Carr die Frau.
»Ein Ohr«, sagten sie und Lucas gleichzeitig. Lucas gab ihr den Beutel zurück.
»Ein Ohr? Das kann nicht Ihr Ernst sein«, sagte Carr.
»Vor oder nach ihrem Tod abgeschnitten?« fragte Lucas in sanftem, interessiertem Ton. Carr sah ihn entsetzt an.
»Um das zu beantworten, bräuchte man ein Labor«, erklärte Weather in ebenso professionellem Ton wie Lucas. »Da gibt es ein paar Krusten, die wie Blut aussehen. Ich bin nicht sicher, aber ich würde sagen, daß sie noch lebte, als es abgeschnitten wurde.«
Der Sheriff betrachtete den Beutel in der Hand der Ärztin, drehte sich um, trat zwei Schritte zur Seite, beugte sich vor und würgte; ein Strom von Speichel floß aus seinem Mund. Nach einem Augenblick richtete er sich wieder auf, wischte sich mit dem Rücken des Handschuhs den Mund ab und sagte: »Ich muß hier raus.«
»Und Frank wurde mit einer Axt erledigt«, sagte Lucas.
»Nein, das glaube ich nicht. Nicht mit einer Axt«, sagte die Frau und schüttelte den Kopf. Lucas schaute sie an, konnte aber fast nichts von ihrem Gesicht erkennen. »Eine Machete, eine sehr scharfe Machete. Oder vielleicht etwas noch Dünneres. Vielleicht eine Art, äh, Krummsäbel...«
»Ein was?« Der Sheriff starrte sie ungläubig an.
»Ich weiß nicht«, sagte sie abwehrend. »Was immer es war, die Klinge war sehr dünn und scharf. Wie bei einem fünf Pfund schweren Rasiermesser. Es hat den Knochen durchschnitten und nicht zertrümmert, wie es bei einer keilförmigen Waffe der Fall gewesen wäre. Aber es hatte auch einiges Gewicht.«
»Sagen Sie das bloß keinem von der Zeitung«, sagte Carr.
»Die würden verrückt.«
»Die werden sowieso verrückt«, sagte sie.
»Tja, dann machen Sie sie nicht noch verrückter.«
»Was ist mit dem Gesicht des Mannes?« fragte Lucas. »Mit den Bißwunden?«
»Ein Hund«, sagte sie. »Ein Kojote. Ich habe hier in der Gegend weiß Gott genug Hundebisse gesehen, und danach sieht es aus.«
»Man kann sie nachts jaulen hören, ganze Rudel davon«, sagte der Deputy. »Kojoten.«
»Ja, oben bei mir gibt es auch welche«, sagte Lucas. »Sind Sie von der Bundespolizei?« fragte die Frau.
»Nein. Früher war ich Polizist in Minneapolis. Ich habe drüben in Sawyer County eine Hütte, und der Sheriff bat mich, herzukommen und mir das anzusehen.«
»Lucas Davenport«, sagte der Sheriff und nickte in seine Richtung. »Lucas, das ist Weather Karkinnen.«
»Ich habe von Ihnen gehört«, sagte die Frau und nickte.
»Weather war Chirurgin unten in Minneapolis, bevor sie wieder hierher zurückkam«, sagte der Sheriff zu Lucas. Dann blickte er die Ärztin an. »Ich hoffe, was Sie über Davenport gehört haben, war gut«, sagte er zu ihr.
Weather schaute zu Lucas auf und legte den Kopf schräg. Jetzt erst konnte er erkennen, daß sie blaue Augen hatte. Ihre Nase schien leicht gebogen zu sein. »Ich erinnere mich, daß er schrecklich viele Leute umgebracht hat«, sagte sie.
Die Ärztin erklärte, ihr sei kalt, und ging voraus zur Haustür. Der Deputy folgte ihr, und Carr stolperte hinterher. Lucas blieb noch und blickte auf die tote Frau nieder. Als er sich umdrehen wollte, um zu gehen, sah er ein Stück vernickeltes Metall unter der Ecke eines verzogenen, geschwärzten Wandbretts. An der Wölbung erkannte er, was es war: der vordere Teil einer Abzugssicherung.
»He«, rief er den anderen nach. »Ist dieser Kameramann noch im Haus?«
Carr rief zurück: »Der mit der Videokamera ist in der Garage, aber der andere ist noch hier.«
»Schicken Sie ihn zurück, wir haben eine Waffe...«
Carr, Weather und der Photograph kamen zurück. Lucas zeigte auf das Metallstück, und der Photograph machte zwei Aufnahmen von dem Bereich. Dann hob Lucas vorsichtig das Wandbrett an. Ein Revolver. Eine vernickelte Smith and Wessen, groß, mit Walnußgriff. Er schob das Brett aus dem Weg und blieb dann stehen, während der Photograph die Waffe im Verhältnis zu der Leiche aufnahm.
»Haben Sie Kreide oder einen Fettstift?« fragte Lucas.
»Ja, und ein Maßband.« Der Photograph griff in die Tasche und zog einen Fettstift heraus.
»Sollte man das nicht für die Spurensicherung aufheben?« fragte er nervös.
»Großes Ding, könnte die Mordwaffe sein«, sagte Lucas. Rasch zeichnete er den Umriß der Waffe auf den Boden und maß dann die Entfernung der Waffe von der Wand, vom Kopf und von einer Hand der toten Frau, während der Fotograf die Zahlen notierte. Als er fertig war, gab Lucas dem Fotografen den Fettstift zurück, sah sich um, nahm einen Holzsplitter auf, schob ihn hinter dem Abzug durch den Griff des Revolvers und hob ihn vom Boden auf. Er schaute die Ärztin an. »Haben Sie noch einen von diesen Plastikbeuteln?«
»Ja.« Sie öffnete ihre Tasche, stützte sie auf ihr Bein, wühlte darin herum und hielt ihm dann einen geöffneten Gefrierbeutel hin. Er ließ die Waffe hineingleiten, den Lauf auf den Boden gerichtet, und durch die Plastikschicht hindurch öffnete er die Kammer und drehte den Zylinder.
»Sechs Patronen, nicht abgefeuert«, sagte er. »Scheiße.«
»Nicht abgefeuert?« fragte Carr.
»Ja. Glaube nicht, daß das die Mordwaffe ist. Der Mörder würde sie nicht nachladen und dann auf den Boden werfen... zumindest kann ich mir nicht vorstellen, warum er das tun sollte.«
»Also?« Weather sah ihn fragend an.
»Vielleicht hat die Frau sie herausgeholt. Sie lag etwa einen Fuß von ihrer Hand entfernt. Vielleicht hat sie den Kerl kommen sehen. Vielleicht gab es irgendeinen Streit, und sie wußte, daß sie in Schwierigkeiten war«, sagte Lucas. Er las dem Fotografen die Seriennummer vor, und dieser schrieb sie auf. »Sie könnten versuchen, das heute Abend zu klären. Fragen Sie jedenfalls in den örtlichen Waffengeschäften nach.«
»Ich kümmere mich darum«, sagte Carr. Dann: »Ich b-b- brauche einen Kaffee.«
»Ich denke, Sie sind ganz schön unterkühlt, Shelly«, sagte Weather. »Was Sie brauchen, ist eine Badewanne mit heißem Wasser.«
»Ja, ja...«
Als sie die Vordertreppe hinuntergingen – Lucas mit dem Revolver –, kam ein anderer Deputy die Einfahrt hinauf. »Ich hab’ die Planen, Sheriff. Sie sind hinter mir in dem Lastwagen von der Nationalgarde.«
»Gut. Besorgen Sie sich Hilfe, und decken Sie alles ab«, sagte Carr, auf das Haus zeigend. »In der Garage sind Leute.« Zu Lucas gewandt, sagte er. »Ich habe Planen von der Nationalgarde besorgen lassen; wir decken das ganze Haus ab, bis die Leute aus Madison kommen.«
»Gut.« Lucas nickte. »Dazu brauchen Sie wirklich die Spurensicherung. Lassen Sie keinen etwas anfassen. Nicht mal die Leichen.«
In der Garage war es warm. Deputies und Feuerwehrleute standen um den altmodischen Eisenofen herum, der mit Eichenscheiten beheizt wurde. Die Ärztin nahm eine Tasse Kaffee. Der Beamte, der die Videoaufnahmen gemacht hatte, erblickte Carr und Davenport und kam mit einer von Lucas’ Thermoskannen herbei.
»Ich hab’ welchen aufgehoben«, sagte er.
»Danke, Tommy.« Der Sheriff nickte, nahm mit zitternder Hand einen Becher, reichte ihn Lucas und nahm sich dann selbst einen. »Gehen wir rüber in die Ecke, wo wir reden können«, sagte er. Carr ging um den Kühler von LaCourts altem Chevy-Kombi herum, fort von den Deputies und Feuerwehrleuten, drehte sich um und trank einen Schluck Kaffee. Er sagte: »Wir haben ein Problem...« Dann hielt er inne und fragte: »Sie sind kein Katholik, oder?«
»Dominus vobiscum«, sagte Lucas. »Und?«
»Doch? Ich bin noch nicht lange genug in der Kirche, um mich an das lateinische Zeug erinnern zu können«, sagte Carr. Er schien einen Augenblick darüber nachzudenken, trank von seinem Kaffee und sagte dann: »Ich bin vor ein paar Jahren konvertiert. Ich war Lutheraner, bis ich Pater Phil kennenlernte. Er ist Pfarrer in Grant.«
»Ach ja? Ich interessiere mich nicht mehr sonderlich für die Kirche.«
»Hm. Sie sollten bedenken...«
»Erzählen Sie mir von dem Problem«, sagte Lucas ungeduldig.
»Ich versuch’s ja, aber es ist kompliziert«, sagte Carr. »Okay. Wir nehmen an, wer immer diese Leute umgebracht hat, hat auch das Feuer gelegt. Es hat den ganzen Nachmittag geschneit – wir hatten ungefähr zehn Zentimeter Neuschnee. Als die Feuerwehrleute hier ankamen, hörte es gerade auf. Aber auf Franks Leiche lagen vielleicht anderthalb Zentimeter Schnee. Deswegen ließ ich ihn mit der Plane zudecken, damit wir einen genauen Zeitpunkt bestimmen können. Es verging nicht viel Zeit zwischen seinem Tod und dem Feuer, aber doch etwas. Das ist wichtig. Einige Zeit. Und jetzt sagen Sie mir, daß das Mädchen vielleicht gefoltert worden ist... Also vielleicht sogar mehr Zeit.«
»Okay.« Lucas nickte zustimmend.
»Wer immer das Feuer gelegt hat, hat es mit Benzin gemacht«, sagte Carr. »Man kann es noch immer riechen, und das Haus brannte wie eine Fackel. Vielleicht hat der Mörder das Benzin mitgebracht, vielleicht hat er das von Frank benutzt. Im hinteren Schuppen gibt es ein paar Boote und ein Schneemobil, aber es sind keine Benzinkanister dabei, und hier sind auch keine... Höchstwahrscheinlich ist immer etwas Benzin in den Kanistern.«
»Jedenfalls ging das Haus schnell in Flammen auf«, sagte Lucas.
»Ja. Die Leute auf der anderen Seite des Sees saßen vor dem Fernseher. Sie sagen, die ganze Zeit war draußen nichts als der Schnee. Und dann gab es von einem Augenblick auf den anderen einen Feuerball. Sie haben die Feuerwehr angerufen...«
»Bei der Feuerwache, an der ich vorbeigekommen bin? Unten an der Ecke?«
»Ja. Sie waren dort zu zweit. Sie aßen gerade etwas, und einer von ihnen sah einen schwarzen Jeep vorbeifahren. Ein paar Sekunden später kam der Notruf. Sie dachten, der Jeep gehöre Phil... dem Priester. Pater Philip Bergen, dem Pfarrer von All Souls.«
»Und? War es so?« fragte Lucas.
»Ja. Sie sagten, es habe so ausgesehen, als komme Phil aus der Seestraße. Also rief ich ihn an und fragte ihn, ob er etwas Ungewöhnliches gesehen hätte. Ein Feuer oder jemanden auf der Straße. Er hat nein gesagt. Dann, ehe ich weiter fragen konnte, sagte er, er sei hier gewesen, bei den LaCourts.«
»Hier?« Lucas zog die Augenbrauen hoch.
»Ja. Hier. Er sagte, als er ging, sei alles in Ordnung gewesen.«
»Aha.« Lucas dachte darüber nach. »Wissen wir sicher, daß die Zeit stimmt?«
»Sie stimmt. Einer der Feuerwehrleute stand mit einem dieser fertigen Schinkensandwiches an der Mikrowelle. Es dauerte etwa zwei Minuten, das heiß zu machen, und es war fast fertig. Der andere Mann sagte: ›Da fährt Pater Phil; scheußliche Nacht, um draußen zu sein‹ Dann klingelte die Mikrowelle, der Mann nahm sein Sandwich heraus, und bevor er es auspacken konnte, kam die Meldung.«
»Das ist knapp.«
»Ja. Es war nicht genug Zeit, daß so viel Schnee auf Frank fallen konnte. Nicht, wenn Phil die Wahrheit sagt.«
»Die Zeit ist etwas Eigenartiges«, sagte Lucas. »Vor allem bei Notfällen. Wenn es nicht nur eine Minute war, sondern vielleicht fünf, dann könnte dieser Pater Phil...«
»Das hab ich auch gemeint... aber es sieht nicht so aus.« Carr schüttelte den Kopf, ließ den Kaffee in seinem Styroporbecher kreisen, stellte den Becher dann auf die Motorhaube des Chevy und bog seine Finger, um sie etwas zu wärmen. »Ich hab mit den Feuerwehrleuten geredet und bin das Ganze ein paarmal durchgegangen. Die Zeit reicht einfach nicht.«
»Also hat der Priester...«
»Er sagte, er hat das Haus verlassen, ist direkt auf den Highway und dann in die Stadt gefahren. Ich hab ihn gefragt, wie lange er brauchte, von dem Haus hier zum Highway zu kommen, und er sagte, drei oder vier Minuten. Die Entfernung beträgt ungefähr eine Meile, also dürfte das hinkommen, bei dem Schnee und allem.«
»Hm.«
»Aber wenn er etwas damit zu tun hätte, warum sollte er zugeben, hier gewesen zu sein? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn«, sagte der Sheriff.
»Haben Sie ihn damit konfrontiert? Sich mit ihm hingesetzt und alles gründlich durchgesprochen?«
»Nein. Ich hab keine richtige Erfahrung mit Verhören. Ich kann mir einen Jugendlichen schnappen, der ein Auto geklaut oder eine Bierreklame abgerissen hat, ihn in eine der Arrestzellen setzen und ihm richtig Angst einjagen, aber das da wäre... anders. Mit diesen Sachen kenne ich mich nicht aus. Mit Mord.«
»Haben Sie ihm von dem zeitlichen Zusammenhang erzählt?« fragte Lucas.
»Noch nicht.«
»Gut.«
»Ich war aufgeschmissen«, sagte Carr, wandte sich um und starrte die Garagenwand an. »Als er sagte, er wäre hier gewesen, fiel mir nicht ein, was ich sagen könnte. Also hab ich gesagt: ›Okay, wir kommen auf Sie zurück‹ Er wollte herkommen, als wir ihm erzählten, daß die Familie tot ist, um ihnen einen letzten Segen zu geben, aber wir sagten, er solle in der Stadt bleiben. Wir wollten nicht, daß er...«
»In seiner Erinnerung beeinflußt wird.«
»Ja.« Carr nickte, nahm den Kaffee, den er auf die Motorhaube gestellt hatte, und trank ihn aus.
»Was ist mit den Feuerwehrleuten? Könnten die irgendwelche Gründe haben, in der Sache zu lügen?«
Carr schüttelte den Kopf. »Ich kenne sie beide, und sie sind nicht sonderlich befreundet. Es dürfte also kaum eine Verschwörung sein.«
»Okay.«
Zwei Feuerwehrmänner kamen durch die Tür. Der erste war in Gummi und Segeltuch gekleidet und von einer dicken Eisschicht bedeckt.
»Sie sehen aus, als ob Sie in den See gefallen wären«, sagte Carr. »Ihnen muß ja eiskalt sein.«
»Es war das Spritzen. Mir ist nicht kalt, aber ich kann mich nicht bewegen«, sagte der Feuerwehrmann. »Steh still«, sagte der zweite Feuerwehrmann. Der erste blieb stehen wie eine dicke Gummivogelscheuche, und der andere begann, mit einem Holzhammer und einem Eismeißel das Eis abzuschlagen.