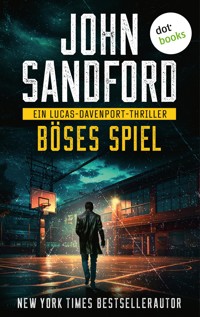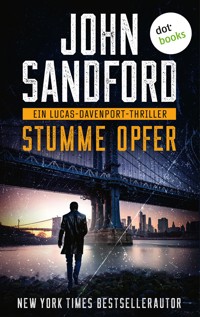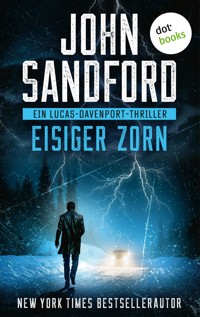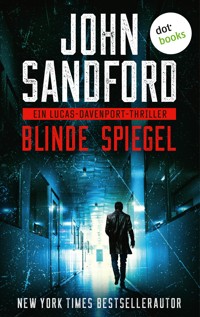9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lucas-Davenport-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Er jagt ohne Gnade – seine Beute sind junge Frauen: Der rasante Thriller »Messer im Schatten« von Bestseller-Autor John Sandford jetzt als eBook bei dotbooks. Er lauert seinen Opfern auf – bis er in ihren intimsten Momenten zuschlägt … Ein psychopathischer Killer, der es ausschließlich auf Frauen abgesehen zu haben scheint, hinterlässt eine blutige Spur aus Toten in den Häuserschluchten von Minneapolis. Der örtlichen Polizei sind die Hände gebunden – und so ist Ex-Cop Lucas Davenport, der sich noch immer von den lebensbedrohlichen Wunden seiner letzten Verbrecherjagd erholt, gezwungen, nach einer zweijährigen Pause in den Dienst zurückzukehren. Gemeinsam mit der Staatspolizistin Meagan Connell setzt er alles daran, den Morden ein Ende zu bereiten. Doch schon bald muss Davenport einsehen, dass sein geschickter Gegenspieler ihm stets ein paar Schritte voraus ist … »Sandford schreibt mit wildem Geschick!« Glasgow Herald Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Thriller »Messer im Schatten« von John Sandford – der spektakuläre sechste Band in seiner Reihe um den Polizisten Lucas Davenport – ist hochkarätige Spannung für die Fans von Michael Connelly und David Baldacci. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Ähnliche
Über dieses Buch:
Er lauert seinen Opfern auf – bis er in ihren intimsten Momenten zuschlägt… Ein psychopathischer Killer, der es ausschließlich auf Frauen abgesehen zu haben scheint, hinterlässt eine blutige Spur aus Toten in den Häuserschluchten von Minneapolis. Der örtlichen Polizei sind die Hände gebunden – und so ist Ex-Cop Lucas Davenport, der sich noch immer von den lebensbedrohlichen Wunden seiner letzten Verbrecherjagd erholt, gezwungen, nach einer zweijährigen Pause in den Dienst zurückzukehren. Gemeinsam mit der Staatspolizistin Meagan Connell setzt er alles daran, den Morden ein Ende zu bereiten. Doch schon bald muss Davenport einsehen, dass sein geschickter Gegenspieler ihm stets ein paar Schritte voraus ist…
»Sandford schreibt mit wildem Geschick!« Glasgow Herald
Über den Autor:
John Sandford ist das Pseudonym des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten John Camp. Seine Romane um den Polizisten Lucas Davenport stürmten allesamt die amerikanischen Bestsellerlisten und machten ihn international bekannt. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er mit dem »International Thriller Award« ausgezeichnet. John Sandford lebt in Minneapolis.
Die Website des Autors: https://www.johnsandford.org/
Der Autor bei Facebook: https://www.facebook.com/JohnSandfordOfficial/
Der Autor auf Instagram: https://www.instagram.com/johnsandfordauthor/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine internationale Bestseller-Reihe um den Polizisten Lucas Davenport mit den Titeln:
»Schule des Todes«
»Das Ritualmesser«
»Blinde Spiegel«
»Stumme Opfer«
»Eisiger Zorn«
»Messer im Schatten«
»Böses Spiel«
»Kalte Rache«
»Jagdpartie«
»Spur der Angst«
***
eBook-Neuausgabe Mai 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1994 unter dem Originaltitel »Night Prey« bei G. P. Putnam’s Sons, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Das Messer im Schatten« bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1994 by John Sandford
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Ray Mines und AdobeStock/Ana
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98952-186-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Messer im Schatten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
John Sandford
Messer im Schatten
Ein Lucas-Davenport-Thriller 6
Aus dem Amerikanischen von Manes Grünwald
dotbooks.
Für
Esther Newberg
Kapitel 1
Der Abend war warm, die Dämmerung einladend. Paare mittleren Alters in pastellfarbenen Hemden schlenderten händchenhaltend über die alten, ungepflegten Spazierwege entlang des Mississippi. Eine Gruppe von College-Studentinnen in Sweatshirts und Jogginghosen trabte über den Fahrradweg, schnatterte ununterbrochen während des Laufens, und die einheitlich blonden Pferdeschwänze der Mädchen wippten im Rhythmus auf und ab. Um acht Uhr gingen mit einem hörbaren Knacken, Block für Block, die Straßenlaternen an. Am Himmel, über dem frischen Grün der Ulmen, stießen Ziegenmelker ihr Skizzizk aus, und ihre Flügelschläge zeichneten Silberstreifen in die Dämmerung wie die Dienstgradbalken auf den Schultern frisch beförderter First Lieutenants.
Der Frühling ging in den Sommer über. Die Narzissen und Tulpen waren verblüht, Petunien breiteten sich jetzt wie Mennoniten-Quilts auf ihren Beeten aus.
Koop war auf der Jagd.
Er fuhr in seinem Chevy-S-10-Truck langsam durch die Wohnstraßen, das Autoradio auf Country-Lite eingestellt, den Ellbogen aus dem Fenster gestreckt, eine Flasche Pig’s-Eye-Bier zwischen die Oberschenkel geklemmt. Der sanfte Abendwind strich durch seinen Bart, fühlte sich an wie die Finger einer Frau.
An der Kreuzung Lexington und Grand Street überquerte eine Frau in einer scharlachroten Jacke die Straße vor seinem Wagen. Sie hatte einen langen, anmutigen Hals, trug das dunkle Haar in einem Knoten, und ihre hohen Absätze klackerten über den Asphalt. Sie wirkte zu selbstbewußt, zu lebhaft, bewegte sich zu forsch; sie war eine Frau, die wußte, welches Ziel sie ansteuerte. Nicht Koops Typ. Er fuhr weiter.
Koop war einunddreißig Jahre alt, sah aber, aus welcher Entfernung man ihn auch betrachtete, zehn bis fünfzehn Jahre älter aus. Er war ein recht kleiner, stämmiger Mann mit dem verbitterten Gesicht eines verarmten Farmpächters und engen, argwöhnischen grauen Augen; er hatte eine besondere Art, die Leute von der Seite anzusehen. Sein rotblondes Haar war auf Millimeterlänge gestutzt. Die Nase war spitz, ledrig und lang, und er trug einen kurzgeschorenen, pelzigen Bart, deutlich röter als sein Haar. Seine schweren Schultern und der breite Brustkorb gingen in schmale Hüften über. Die Arme waren dick und kräftig, endeten in backsteingroßen Fäusten. Er war früher ein gefürchteter Raufbold gewesen, ein Mann, der sich mit drei Bieren im Bauch über einen unpassenden Blick in maßlose Wut hineinsteigern konnte. Dieser Jähzorn steckte immer noch in ihm, aber er hatte ihn jetzt unter Kontrolle - bis auf besondere Gelegenheiten, wenn er wie ein Schweißbrenner in seinem Bauch aufloderte...
Koop war ein Athlet ganz besonderer Art. Er konnte Klimmzüge machen, bis es ihm langweilig wurde, er konnte vierzig Meter so schnell laufen wie ein professioneller Linebacker im Football. Er konnte elf Stockwerke eine Feuerleiter hochsteigen, ohne daß sein Atem auch nur eine Spur schneller ging.
Koop war ein Fassadenkletterer. Ein Dieb und ein Killer.
Koop kannte alle Straßen und fast alle Gassen in Minneapolis und St. Paul. Und war dabei, sie auch in den Vorstädten zu erkunden. Er verbrachte seine Tage damit, herumzufahren, herumzulaufen, neue Örtlichkeiten auszukundschaften, sich immer besser mit dem Spinnennetz der Avenues, Boulevards, Straßen, Wege, Gassen und Gäßchen in seinem Einsatzterritorium vertraut zu machen.
Jetzt zockelte er im Wagen gemächlich die Grand Avenue hinunter, dann hinauf zum Summit, zur St.-Paul-Kathedrale, kam an einem Crack-Dealer vorbei, der seine Geschäfte vor dem Verwaltungszentrum der Erzdiözese St. Paul und Minneapolis erledigte, dann ging es wieder den Berg hinunter. Er drehte zwei Runden um die United Hospitals, schaute zu den Krankenschwestern hinüber, die zu ihren speziell ausgewiesenen Parkplätzen für Frauen eilten - ein Witz, diese Parkplätze... Er betrachtete im Vorbeifahren die Schaufenster der Antikläden auf der West Seventh, fuhr an der Stadtverwaltung vorbei, ließ sich dann den Kellogg Boulevard hinuntertreiben, bog links in die Robert Street ein, schaute auf die Uhr am Armaturenbrett. Er war früh dran. Es gab mehrere Buchläden im Zentrum, aber nur einer davon interessierte ihn. Saint hieß der Laden, und dort fand eine Lesung statt. Es ging um irgendeinen Scheiß über »Frauen der Prairie« oder so was.
Der Laden wurde von einem ergrauenden Absolventen der St.- John-Universität betrieben. Bücher neu und gebraucht, tauschen Sie zwei alte Taschenbücher gegen ein neues ein. Die Tasse Kaffee kostet zwanzig Cents, bedienen Sie sich selbst, wir verlassen uns darauf, daß Sie das Geld in das Körbchen legen. Eine vornehme Sitzecke, in der schüchterne Leute sich entspannen konnten ... Koop war erst einmal dort gewesen, bei einer Gedichtlesung. Der Laden war voller langhaariger Frauen mit enttäuschten Gesichtern - Koops bevorzugtem Frauentyp - und Männern mit kahlen Stellen auf den Schädeln, Schmerbäuchen und unordentlich von Gummibändern zusammengehaltenen grauen Pferdeschwänzen gewesen.
Eine Frau hatte ihn angequatscht: »Haben Sie das Rubaiyat gelesen?«
»Hää...?« Wovon redete die?
»Das Rubaiyat von Omar Khayyam? Ich habe es gerade wieder mal gelesen«, schwätzte sie weiter. Sie hielt ein dünnes Buch mit einem schwarzen Einband in der Hand. »In der Übersetzung von Fitzgerald. Ich hatte es seit dem College nicht mehr gelesen. Es hat so manche Saite in mir zum Klingen gebracht. In einer bestimmten Weise gibt es Analogien zu den Gedichten, die James heute Abend vorgetragen hat.«
Koop interessierte sich einen Scheiß für James oder seine Gedichte. Aber die Frage selbst - Haben Sie das Rubaiyat gelesen? - klang irgendwie gut. Intellektuell. Einen Mann, der die Frage stellte Haben Sie das Rubaiyat gelesen? würde man als... als ungefährlich betrachten. Nachdenklich. Rücksichtsvoll.
Koop hatte an diesem Abend nicht das Bedürfnis nach einer Frau verspürt, aber er hatte sich das Buch gekauft und versucht, es zu lesen. Es war totaler Scheißdreck. So große, echte Scheiße, daß Koop es schließlich aus dem Fenster seines Trucks geworfen hatte, denn es gab ihm ein dämliches Gefühl, es auch nur auf dem Sitz neben sich liegen zu haben.
Er hatte das Buch weggeworfen, aber den Spruch hatte er sich eingeprägt: Haben Sie das Rubaiyat gelesen?
Koop fuhr im Kreis, überquerte dabei mehrmals die Interstate 94. Er wollte nicht vor Beginn der Lesung bei dem Buchladen ankommen; er wollte, daß die Leute den Künstler anschauten, nicht ihn. Was er heute Abend machte, entsprach nicht seiner sonst äußerst vorsichtigen Vorgehensweise. Aber er konnte nicht anders - der Drang war unwiderstehlich; er würde eben so vorsichtig wie möglich sein.
Er kam wieder über die Interstate, hielt vor einer roten Ampel und schaute zur Polizeistation von St. Paul hinüber. Die Sommersonnenwende lag erst zwei Wochen zurück, und um halb neun war es noch hell genug, Gesichter auch aus einiger Entfernung zu erkennen. Eine Gruppe uniformierter Cops, drei Männer und zwei Frauen, saßen auf der Treppe, unterhielten sich, lachten über irgend etwas. Er sah sie sich an, dachte an nichts, sah nur hin...
Der Fahrer des Wagens hinter ihm hupte.
Koop schaute in den linken Rückspiegel, dann in den rechten, dann zur Ampel hoch; sie hatte auf Grün geschaltet. Er sah wieder in den Rückspiegel, fuhr an, wollte nach links abbiegen. Vor ihm ging eine Gruppe von Leuten gerade los, wollte die Straße überqueren, sah ihn kommen, blieb abrupt stehen.
Koop bemerkte die Leute erst jetzt, stieg auf die Bremse, und der Wagen kam mit quietschenden Reifen zum Stehen. Als er aber sah, daß die Leute stehengeblieben waren, fuhr er wieder an; als sie wiederum sahen, daß er angehalten hatte, setzten sie sich wieder in Bewegung, kamen dem Wagen in die Quere. Sie stoben auseinander, und Koop mußte mit wilden Lenkbewegungen um einen fetten Mann im Overall herumkurven, der nicht beweglich genug war, ihm aus dem Weg zu springen. Ein Mann schrie ihn wütend an, seltsam krächzend, und Koop zeigte ihm den Stinkefinger.
Koop bereute es sofort. Er war doch der unsichtbare Mann... Und der zeigte den Leuten nicht den Stinkefinger, wenn er bei der Arbeit oder auf der Jagd war... Er war immer noch erst einen halben Block von den Cops entfernt, schaute schnell zu ihnen hinüber. Eines der Gesichter war ihm zugewandt, drehte sich dann weg. Die Leute auf der Straße lachten jetzt, gestikulierten miteinander, zeigten auf ihn.
Wut stieg heiß in seinem Magen auf. »Schwule Säue«, murmelte er vor sich hin. »Verdammte Arschficker...«
Er beruhigte sich, fuhr weiter zum Ende des Blocks, bog rechts ab. Auf der Straßenseite gegenüber dem Buchladen machte gerade ein Wagen einen Parkplatz frei. Sehr gut. Koop wendete, wartete kurz, bis der Wagen endgültig weggefahren war, stieß rückwärts in die Lücke, stieg aus und schloß den Truck ab.
Als er über die Straße ging, hörte er wieder das krächzende Schimpfen. Die Gruppe, die er eben beinahe angefahren hatte, ging am Ende des Blocks ebenfalls über die Straße, schaute zu ihm herüber. Einer der Männer drohte ihm mit der Faust, wieder war das krächzende Geschimpfe zu hören, dann lautes Lachen. Schließlich verschwanden die Leute hinter einem Gebäude.
»Verdammte Arschlöcher.« Leute wie die da, die so dämlich auf der Straße rumliefen, gingen ihm schwer auf den Keks. Saublöde Scheißer, man sollte... Er schüttelte eine Camel aus der Schachtel, steckte sie an, machte ein paar schnelle, wütende Züge, ging dann mit hängenden Schultern über den Bürgersteig auf den Buchladen zu. Durch das Schaufenster sah er eine Menge Leute vor einer dicken Frau sitzen, die so was wie eine Zigarre zwischen den Fingern hielt. Er machte noch einen letzten Zug an der Camel, schnipste sie dann auf die Straße und ging in den Laden.
Der Raum war voller Leute. Die dicke Frau saß auf einem Holzstuhl auf einem Podium, nuckelte, wie sich jetzt herausstellte, an einer Lakritzstange, und rund zwei Dutzend Leute saßen auf Klappstühlen im Halbkreis vor ihr. Etwa fünfzehn bis zwanzig andere standen hinter den Stuhlreihen. Einige Leute schauten kurz auf Koop, dann wieder auf die dicke Frau. Sie sagte gerade: »Da ist ein schockierender Moment der Erkenntnis, wenn man anfängt, es mit Scheiße zu tun zu kriegen - und nennen wir es doch beim Namen, mit guten alten angelsächsischen Ausdrücken -, mit Pferdescheiße und Schweinescheiße und Kuhscheiße; ich sage Ihnen, an den Tagen, an denen Sie in der Gülle rumrühren, reiben Sie sich als erstes ein bißchen davon in die Haare und unter die Achseln, reiben Sie sie so richtig fest ein. Auf diese Weise brauchen Sie nicht zu befürchten, daß sie etwas davon an ihr eigentliches Ich bekommen, und Sie können einfach weitermachen und Ihrer Arbeit nachgehen...
Im hinteren Teil des Ladens hing ein Schild »Fotobände«, und Koop schob sich in diese Richtung. Er besaß ein altes Buch mit dem Titel Dschungelfieber mit Bildern und Zeichnungen von nackten schwarzen Frauen. Das Buch turnte ihn immer noch ganz schön an. Vielleicht würde er so was Ähnliches da drüben finden...
Direkt unter dem Schild »Fotobände« zog er ein Buch aus dem Regal und blätterte es durch. Schuppen auf Feldern. Er schaute sich unauffällig um, machte Bestandsaufnahme. Einige der Frauen hatten diesen »unruhigen« Blick, den Blick von Menschen, die Kontakte suchten, die ihre Aufmerksamkeit nicht wirklich auf die Autorin richteten, welche gerade vortrug: »... gewisse menschliche Fähigkeit, anderen einen aufs Dach zu geben; oh, dann wird man wütend, manchmal so wütend, daß man nicht mal mehr kotzen kann...«
Koop war beunruhigt. Er sollte nicht hier sein. Er sollte nicht auf der Jagd sein. Er hatte im vergangenen Winter erst eine Frau gehabt, und das sollte für eine Weile genug sein. Sollte genug sein - wenn da nicht diese Sara Jensen wäre.
Wenn er die Augen schloß, sah er sie vor sich...
Siebzehn Stunden vorher, als er Sara Jensen noch nie gesehen hatte, war er in das Mietshochhaus gegangen, in dem sie ein Appartement bewohnte. Er hatte den Schlüssel benutzt und wegen der neugierigen Augen der Videokameras in der Lobby einen leichten Mantel und einen Hut getragen. Als er die Kameras hinter sich hatte, stieg er zügig und dennoch lautlos auf den Gummisohlen seiner Mokassins die Feuertreppe zum obersten Stockwerk des Gebäudes hoch.
Um drei Uhr morgens waren die Flure still und leer, es roch nach Teppichreiniger, Messingpolitur und Zigarettenrauch. Im elften Stock blieb er einen Moment hinter der Feuertür stehen, horchte, ging dann nach links in den Flur. Vor der Tür zu Appartement 1135 blieb er stehen und preßte sein Auge an den Spion. Dunkel. Er hatte den Türschlüssel dick mit Bienenwachs eingefettet; dadurch wurde der Schließmechanismus der Tür beim Aufschließen eingefettet und das Klicken gedämpft. Er hielt den Schlüssel in der rechten Hand, umschloß das Handgelenk mit der linken und schob den Schlüssel langsam ins Schloß. Er ließ sich reibungslos einführen.
Koop hatte das schon rund zweihundertmal gemacht, aber es war so eine Routinehandlung, die immer noch an seinen Nerven zerrte, als sei es das erste Mal. Was war hinter dieser Tür? Ein Bewegungsmelder, ein Dobermann - oder hunderttausend Dollar in bar? Koop würde es bald wissen... Er drehte den Schlüssel um und drückte die Tür auf: nicht schnell, aber fließend, in einem Zug, und das Herz schlug ihm dabei bis zum Hals. Es machte leise klick\ er wartete, horchte wieder, trat dann in das Appartement, drückte die Tür hinter sich ins Schloß, blieb stehen.
Und roch sie.
Das war seine erste Wahrnehmung.
Koop rauchte filterlose Camel, vierzig bis fünfzig am Tag. Und er schniefte fast jeden Tag Kokain. Seine Nasengänge waren vollgepfropft mit dem Teer der Zigaretten und zerfressen vom Koks, aber er war ein Geschöpf der Nacht, sehr sensibel gegenüber Geräuschen, Gerüchen und allem, was er anfaßte - und der Duft des Parfums war geheimnisvoll, sinnlich, verlockend, hing in der sterilen Luft des Appartements wie die Vision von einer nackten Frau auf einem Pferd. Der Duft fesselte ihn, lenkte ihn ab. Er hob den Kopf wie eine witternde Ratte und sog den Duft ein. Er war sich nicht bewußt, daß er seinen eigenen Geruch hinterließ, den beißenden Gestank kalten Zigarettenrauches.
Die Vorhänge im Wohnzimmer waren aufgezogen, und von der Straße herauf drang ein schwacher Lichtschimmer in den Raum. Als seine Augen sich langsam den Lichtverhältnissen anpaßten, erkannte er die wichtigsten Möbelstücke, die Rechtecke der Gemälde und Drucke an den Wänden. Er wartete immer noch, stand reglos da, roch die Frau, horchte auf Bewegungen, auf Worte, auf alles Mögliche, schaute sich angestrengt um - vor allem nach einem kleinen roten Licht an der Konsole einer Alarmanlage. Nichts. Das Appartement war in tiefen Schlaf versunken.
Koop schlüpfte aus den Mokassins und schlich lautlos durch den dunklen Flur tiefer in die Wohnung hinein. Links lag das Badezimmer, rechts das Arbeitszimmer. Am Ende des Flurs führten zwei Türen zu Schlafzimmern, links zum Schlafzimmer der Frau, rechts zum Gästezimmer. Er wußte, welche Räume hinter den Türen lagen, weil ein ehemaliger Sträfling, der für die Spedition Logan Van Lines arbeitete, es ihm gesagt hatte. Der Mann hatte geholfen, Jensens Möbel in dieses Appartement hochzuschleppen, er hatte den Abdruck von dem Schlüssel genommen, hatte den Plan der Wohnung gezeichnet. Und er hatte Koop gesagt, die Frau heiße Sara Jensen, sei eine reiche Fotze, hätte »was mit der Aktienbörse zu tun«, und sie hätte eine Vorliebe für Goldschmuck.
Koop streckte die Hand zur Schlafzimmertür aus. Sie stand ein paar Zentimeter weit auf. Gut. Paranoide und unruhige Schläfer machten meistens die Tür zu. Er wartete wieder eine Weile, horchte. Dann stieß er mit den Fingerspitzen die Tür langsam ein Stück weiter auf, streckte das Gesicht durch den Spalt, schaute nach innen. Links war ein Fenster, und wie im Wohnzimmer waren auch hier die Vorhänge zurückgezogen. Über dem Dach des Nachbargebäudes hing ein bleicher Halbmond, dahinter waren der Park und der See zu sehen - ein Bild wie in einer Bierreklame.
Und er konnte im fahlen Mondlicht die Frau ganz deutlich sehen.
Sara Jensen hatte die leichte Sommerdecke von sich gestrampelt. Sie lag auf dem Rücken auf einem dunklen Leintuch. Sie trug ein weißes Baumwollnachthemd, das sie vom Hals bis zu den Fesseln einhüllte. Ihr tiefschwarzes Haar umrahmte den Kopf wie ein dunkler Heiligenschein, das Gesicht war leicht zur Seite geneigt. Eine Hand lag entspannt neben ihrem Ohr, und es sah aus, als ob sie ihm zuwinken würde. Die andere Hand ruhte leicht gekrümmt in Höhe der Beckenknochen auf dem Bauch.
Ein kleines Stück unterhalb der Hand meinte Koop ein dunkles Dreieck zu erkennen, an ihren Brüsten den Schatten der braunen Brustwarzen. Dieses Bild von ihr hätte man nicht auf einem Film festhalten können. Das Halbdunkel, die Schatten - all das trug sicher auch zu einer phantasievollen Ausmalung bei. Das Nachthemd dichter, weniger durchsichtig, als Koop sich das einbildete... Aber Koop war in Liebe entbrannt.
Eine Liebe wie das Aufflammen eines Streichholzes in dunkler Nacht.
Koop blätterte ein paar Bildbände durch, lauerte, lauerte... Er sah sich gerade das Foto eines verstorbenen Filmstars an, als »seine« Frau um die Ecke kam, zum Regalbrett »Hobby- und Sammlerstücke« hochschaute.
Er erkannte den Typ sofort. Sie trug eine lose fallende braune Jacke, ein wenig zu lang, schon ein wenig aus der Mode, aber hübsch und gut zu ihr passend. Ihr Haar war kurz, gepflegt, sorgsam gekämmt. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt, schaute zu den oberen Regalbrettern hoch, ließ den Blick über eine Reihe antiquarischer Bücher gleiten. Sie war unscheinbar, trug kein Make-up, war weder dünn noch dick, weder groß noch klein, und sie trug eine Brille mit übergroßen Gläsern und Schildpattgestell. Eine Frau, die in einem Fahrstuhl von anderen Mitfahrern nicht wahrgenommen werden würde... Sie schaute weiter zu den oberen Regalbrettern hoch, und Koop fragte: »Kann ich Ihnen was von da oben runterholen?«
»Oh... Ich weiß nicht...« Sie versuchte sich an einem charmanten kleinen Lächeln, aber es wirkte eher nervös. Sie hatte Mühe, diesen Eindruck zu korrigieren.
»Nun, wenn ich helfen kann... « sagte er höflich.
»Vielen Dank. Sie wandte sich nicht ab. Sie wartete auf etwas. Und wußte nicht, wie sie es von sich aus in Gang setzen konnte.
»Ich habe die Lesung verpaßt«, sagte Koop. »Ich habe gerade das Rubaiyat zu Ende gelesen. Ich dachte, ich würde auf irgendwelche, verstehen Sie, analogen Dinge stoßen...«
Und kurz darauf sagte die Frau: »...Harriet. Mein Name ist Harriet Wannemaker.«
Sara Jensen, ausgestreckt auf dem Bett liegend, bewegte sich zuckend.
Koop, der gerade zur Kommode schlich, erstarrte. Sara war während der Collegezeit eine starke Raucherin gewesen, und ihr immer noch auf Tabak reagierendes Unterbewußtsein sprang auf Koops nikotingeschwängerte Atemluft an, aber sie schlief so fest, daß sie nicht aufwachte. Wieder durchlief ein leichtes Zucken ihren Körper, aber dann entspannten sich ihre Muskeln. Koops Herz hämmerte, und er schlich auf sie zu, streckte die Hand aus, hätte beinahe ihren Fuß gestreichelt.
Und dachte: Was zum Teufel mache ich da?
Er trat einen Schritt zurück, blieb wie versteinert stehen, und das Mondlicht spielte über ihren Körper ...
Gold.
Er atmete tief durch, ging zur Kommode. Frauen verstauten jeden gottverdammten persönlichen Gegenstand im Schlafzimmer - manchmal auch in der Küche -, und Jensen machte da keine Ausnahme. Das Appartement hatte eine Tür mit Sicherheitsschloß, Videokameras überwachten die Eingangshalle, ein privater Sicherheitsdienst fuhr nachts mindestens ein halbes dutzendmal am Gebäude vorbei, hielt zur Beobachtung gelegentlich auch an. Sie war hier sicher, dachte sie. Ihre Schmuckschatulle, poliertes dunkelbraunes Nußbaumholz, stand auf der Kommode...
Koop hob sie vorsichtig mit beiden Händen hoch, preßte sie an seinen Bauch wie ein Fullback den Football. Er schlich auf Zehenspitzen aus dem Zimmer, durch den Flur zurück ins Wohnzimmer, und dort stellte er die Schatulle auf den Teppich und kniete sich daneben. Er nahm seine kleine Taschenlampe aus der Brusttasche. Das Glas hatte er mit schwarzem Klebeband so abgedeckt, daß nur ein winziges Loch in der Mitte offenblieb. Er knipste sie an und hielt sie zwischen den Zähnen. Er hatte jetzt einen dünnen Lichtstrahl, gerade hell genug, einen Edelstein aufglitzern zu lassen oder seine Farbe zu zeigen, ohne daß seine an die Dunkelheit angepaßten Augen dadurch irritiert wurden.
Sara Jensens Schmuckschatulle enthielt ein halbes Dutzend mit Samt ausgelegter Einsätze. Er nahm einen Einsatz nach dem anderen heraus und fand einige gute Stücke. Ohrringe, davon einige aus Gold, vier mit Edelsteinen: zwei mit Brillanten, eines mit Smaragden, eins mit Rubinen. Die Steine waren schön - bis auf ein Paar, bei dem die Brillanten eher nach Splittern und nicht nach geschliffenen Steinen aussahen. Gesamtwert etwa fünftausend. Er würde zweitausend dafür bekommen. Nicht schlecht...
Darüber hinaus fand er zwei Broschen - eine mit einem Kreis aus Perlen besetzt, die andere mit Brillanten -, ein goldenes Hochzeitsarmband, einen Verlobungsring. Die Brillantbrosche war ein exzellentes Stück, das Beste, was sie besaß. Er wäre allein deswegen gekommen. Der Brillant auf dem Verlobungsring war gut, aber nicht großartig. Dann waren da noch zwei goldene Armbänder und eine Armbanduhr, eine Damen-Rolex, Gold mit rostfreiem Stahl.
Kein Schmuckgürtel.
Er steckte alles in einen kleinen schwarzen Beutel, stand auf, stieg vorsichtig über die leeren Einsätze, ging zurück ins Schlafzimmer. Langsam, ganz langsam zog er nacheinander die Schubladen der Kommode auf. Der wahrscheinlichste Platz war die oberste linke Schublade, der zweitwahrscheinlichste die unterste, abhängig davon, ob sie etwas verstecken wollte oder nicht. Er wußte das aus langer Erfahrung.
Er nahm sich zuerst die obere Schublade vor, zog sie auf, fuhr mit den Händen durch die nicht deutlich zu erkennenden Wäschestücke. Nichts Hartes...
Der Gürtel war in der untersten linken Schublade, ganz hinten unter Wollsachen für den Winter versteckt. Sie war also doch ein bißchen argwöhnisch. Er nahm ihn heraus, wog ihn in der Hand, wandte sich wieder Sara Jensen zu. Sie hatte ein festes Kinn, der Mund war jedoch weich und entspannt. Ihre Brüste waren rund und voll, ihre Hüften kräftig. Sie war wahrscheinlich eine recht große Frau. Nicht mollig oder dick, einfach nur groß.
Mit dem Gürtel in der Hand trat Koop den Rückzug an, blieb dann aber plötzlich stehen. Er hatte das Fläschchen auf der Frisierkommode stehen sehen, es aber ignoriert, wie er so was immer ignorierte. Aber diesmal... Er nahm es an sich. Ihr Parfum. Er schob sich rückwärts wieder zur Tür hin, stolperte beinahe: Er schaute nicht auf seinen Weg, er schaute auf die Frau, die da ausgestreckt auf dem Bett lag, nur eine Armlänge entfernt, und sein Atem ging schneller.
Koop blieb stehen. Fummelte einen Moment an dem Gürtel herum, faltete ihn zusammen, steckte ihn in die Tasche. Machte einen Schritt zurück, schaute wieder auf sie hinunter. Weißes Gesicht, runde Wangen, dunkle Augenbrauen. Das Haar um den Kopf ausgebreitet.
Ohne zu denken, ja ohne zu wissen, was er tat - er wäre sonst über sich selbst geschockt gewesen, wäre zurückgeschreckt -, trat Koop neben das Bett, beugte sich über sie und ließ leicht, ganz sanft, seine Zunge über ihre Stirn gleiten.
Harriet Wannemaker war ohne Umschweife einverstanden, einen Drink mit ihm bei McClelland zu nehmen: Sie hatte jetzt Farbe im Gesicht, Farbe von der Hitze der Aufregung. Sie würde ihn dort treffen, diesen ein wenig gefährlich wirkenden Mann mit dem moosigen roten Bart.
Er verließ vor ihr den Buchladen. Seine Nerven waren jetzt angespannt. Noch hatte er sich unter Kontrolle, noch war er okay, noch gab es nichts, über das er besorgt sein müßte. Hatte irgend jemand gesehen, daß sie sich unterhalten hatten? Er glaubte es nicht. Sie war so farblos, wer nahm sie überhaupt wahr? In ein paar Minuten...
Der Druck machte sich körperlich bemerkbar. Eine Schwere in den Eingeweiden, ein Brennen in der Brust, ein Schmerz im Nacken. Er dachte daran, schleunigst nach Hause zu fahren und die Frau zu vergessen. Aber er würde es nicht tun... Denn da war noch ein anderer Druck, ein Drang, der sich viel fordernder bemerkbar machte. Seine Hände am Lenkrad zitterten. Er stellte den Truck in der Sechsten Straße ab, oben auf der Hügelkuppe, öffnete die Wagentür. Atmete erregt durch. Noch war Zeit, davonzufahren ...
Er griff unter den Sitz, zog die Dose mit dem Äther und den Plastikbeutel mit dem Wattebausch hervor. Er öffnete den Verschluß der Dose, entleerte sie schnell in den Plastikbeutel, verschloß beides wieder. Der Äthergestank war ekelerregend, aber er verflüchtigte sich innerhalb einer Sekunde. In dem luftdicht verschlossenen Plastikbeutel würde sich der Wattebausch schnell mit Äther vollsaugen... Wo blieb sie?
Sie kam ein paar Sekunden später, parkte ihren Wagen hügelabwärts hinter seinem Truck, blieb noch einen Moment im Wagen sitzen, richtete ihre Frisur. Eine Bierreklame in einem Seitenfenster von McClellans mit einer defekt flackernden Glühbirne war hier oben auf dem Kamm des Hügels das hellste Licht weit und breit. Noch konnte er einen Rückzieher machen...
Nein. Tu es...
Sara Jensen roch nach Parfum und ein wenig auch nach Schweiß. Roch angenehm...
Sie bewegte sich, als er mit der Zunge über ihre Stirn fuhr, und er zuckte zurück, machte einen Schritt auf die Tür zu... und blieb stehen. Sie murmelte etwas, eine unverständliche Silbe, und er schlüpfte schnell, aber lautlos, durch die Tür, hin zu seinen Mokassins. Er lief nicht, aber sein Herz hämmerte wie wild in der Brust. Er schlüpfte in die Schuhe, nahm den Beutel mit der Beute an sich.
Und blieb wieder stehen. Die wichtigste Verhaltensregel für einen Einschleichdieb war einfach: mach alles langsam. Wenn es so aussieht, als ob es Schwierigkeiten geben könnte, mach alles noch langsamer. Und nur wenn sich alles wirklich ganz schlecht entwickelt, dann lauf weg wie der Teufel. Koop riß sich zusammen. Warum sollte er losrennen, wenn sie gar nicht wach wurde? Kein Grund zur Panik. Aber es zuckte immer wieder durch seinen Kopf: du Arschloch, du Arschloch, du Arschloch...
Aber sie kam nicht. Sie war wohl wieder fest eingeschlafen; und obwohl Koop es nicht sehen konnte - er schlüpfte aus der Wohnungstür, drückte sie leise hinter sich ins Schloß -, die Spur seines Speichels auf ihrer Stirn glitzerte im Mondlicht, lag kühl auf ihrer Haut, bis sie langsam verdunstete...
Koop schob den Plastikbeutel in die Jackentasche, trat ans Heck des Trucks, schloß die Tür des Camper-Aufsatzes auf der Ladefläche auf.
Sein Herz schlug jetzt sehr schnell...
»Hi«, rief sie. Aus fünfzehn Metern Entfernung. Errötend? »Ich war nicht sicher, ob Sie’s rechtzeitig schaffen würden.«
Sie hatte Angst gehabt, er würde sie sitzenlassen... Er hätte es ja auch fast getan. Sie lächelte, scheu, vielleicht ein wenig verängstigt, aber sie hatte noch mehr Angst vor der Einsamkeit...
Niemand in der Gegend zu sehen...
Und jetzt hatte es ihn gepackt. Dunkelheit legte sich über ihn - eine Dunkelheit im wahrsten Sinne des Wortes, eine Art Nebel, eine schwarze Wut, die aus dem Nichts zu kommen schien wie eine plötzliche Windbö. Er rollte den Plastikbeutel in der Tasche auf, griff mit der Hand hinein; der mit Äther vollgesogene Wattebausch brannte kalt auf der Haut seiner Finger.
Er preßte ein Lächeln auf sein Gesicht, ging zu ihr, sagte: »Hey, wie wär’s mit ’nem Drink? Kommen Sie... Heh, schaun Sie mal da drüben...«
Er drehte sich um, als wolle er ihr etwas zeigen, kam dadurch schräg rechts hinter sie, legte den Arm um sie, drückte mit der rechten Hand den Wattebausch gegen ihren Mund und die Nase, hob sie hoch; sie strampelte wie ein Eichhörnchen in der Schlingenfalle, aber für einen Beobachter konnte es so aussehen, als seien sie ein Liebespaar in einer leidenschaftlichen Umarmung. Wie auch immer, sie strampelte nur für einen kurzen Moment...
Sara Jensen drückte auf den Aus-Knopf des Weckers, drehte sich auf den Bauch, schlang die Arme um das Kopfkissen. Als der Wecker geläutet hatte, hatte ein Lächeln auf ihrem Gesicht gelegen. Es verebbte langsam. Ein seltsamer Alptraum lauerte irgendwo in ihrem Unterbewußtsein. Sie konnte sich nicht genau erinnern, aber er war da, wie die Fußspur auf dem Dachboden, bedrohlich...
Sie atmete tief durch, war im Grunde willens aufzustehen, wollte es dann aber doch noch nicht so richtig. Kurz vor dem Aufwachen hatte sie von Evan Hart geträumt. Hart war Anwalt in der Wertpapierabteilung. Er entsprach nicht ganz dem Bild des romantischen Helden, aber er war attraktiv, ausgeglichen, und er konnte witzig sein - obwohl er das, wie sie meinte, ihr gegenüber unterdrückte, um sie nicht zu verprellen. Er kannte sie nicht gut genug. Noch nicht.
Er hatte schöne Hände. Kräftige, lange Finger, die aussahen, als könnten sie fest zupackend und doch zugleich sensibel sein. Er hatte sie einmal berührt, an der Nase, und sie spürte jetzt noch, hier in ihrem Bett, wie warm die Finger gewesen waren. Hart war Witwer, hatte eine kleine Tochter. Seine Frau war vor vier Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Seitdem hatte er sich ausschließlich seinem Kummer und der Erziehung seiner Tochter gewidmet. Der Büroklatsch unterschob ihm zwei kurze, häßliche Affären mit falschen Frauen. Er war reif für die richtige Frau.
Und er lungerte herum, man brauchte nur zuzupacken...
Sara Jensen war geschieden; ihre Ehe war ein einjähriger Irrtum direkt nach dem College gewesen. Keine Kinder. Aber die Trennung war ein Schock gewesen. Sie hatte sich in die Arbeit gestürzt, war die Erfolgsleiter hochgeklettert. Aber jetzt...
Sie lächelte über sich selbst. Ich bin bereit, dachte sie. Etwas Beständiges; etwas fürs ganze Leben... Sie döste wieder ein, nur ein paar Minuten, träumte von Evan Hart und seinen Händen, ein wenig warm, ein wenig zärtlich...
Und dann drängte sich der Alptraum in den Vordergrund. Ein Mann mit einer Zigarette im Mundwinkel starrte sie aus dem Dunkel an... Sie zuckte zusammen. Und der Wecker schrillte wieder los. Sara fuhr sich über die Stirn, hob die Augenbrauen, setzte sich auf, schaute sich im Zimmer um, schob die Decke von sich, hatte das Gefühl, daß irgend etwas nicht in Ordnung war.
»Hallo?« rief sie, aber sie wußte natürlich, daß sie allein in der Wohnung war. Sie ging zum Badezimmer, zur Toilette, blieb jedoch unter der Tür kurz stehen. Irgendwas... Was aber?
Der Traum? Sie hatte in diesem Traum geschwitzt; sie erinnerte sich, daß sie sich die Stirn mit dem Handrücken abgewischt hatte. Aber das schien nicht der eigentliche Grund zu sein...
Sie drückte auf die Spülung, ging zum Wohnzimmer, immer noch das Bild im Kopf: schwitzend, die Stirn reibend...
Ihre Schmuckschatulle stand mitten im Zimmer auf dem Boden, die Einsätze leer daneben. Laut sagte sie: »Wie kommt das denn hierher?«
Für einen kurzen Moment war sie verwirrt. Hatte sie das gemacht, war sie zur Schlafwandlerin geworden? Sie machte einen Schritt weiter ins Zimmer, sah einen kleinen Haufen von Schmuck neben der Schatulle liegen, alles billiges Zeug.
Und dann erkannte sie die Wahrheit.
Sie trat zurück, eine Schockwelle zuckte durch ihre Brust, ein Adrenalinstrom ergoß sich in ihre Adern. Ohne zu wissen, warum sie es tat, hob sie den Handrücken zum Gesicht, zur Nase, roch das Nikotin - und das andere...
Das andere - was?
Speichel.
»Nein!« Sie schrie das Wort heraus, riß den Mund auf, die Augen.
Sie wischte den Handrücken krampfhaft am Nachthemd ab, wieder und wieder, wischte mit dem Ärmel über die Stirn, auf der Hunderte von Ameisen herumzukrabbeln schienen. Dann hörte sie plötzlich auf, schaute sich um, erwartete, ihn zu sehen - zu sehen, wie er sich materialisierte, aus der Küche kam, aus dem Wandschrank, oder daß er wie ein Golem aus dem Teppich auf dem Parkettfußboden aufstieg. Sie wandte sich in diese Richtung, dann in jene, rannte schließlich wie besessen in die Küche, riß den Telefonhörer vom Haken an der Wand.
Schrie auf dem Weg dorthin.
Schrie und schrie.
Kapitel 2
Lucas Davenport hielt seine Dienstmarke aus dem Fenster. Der pickelgesichtige Vorstadt-Cop hob das gelbe Tatort-Absperrband hoch und winkte ihn durch. Lucas steuerte den Porsche an den Einsatzwagen der Feuerwehr vorbei, fuhr über einen flachen Segeltuchschlauch, stoppte schließlich auf einer zerfurchten, mit Asche bedeckten Fläche, die ein paar Stunden vorher noch ein Rasen gewesen war. Einige Feuerwehrmänner, die gerade Kaffee tranken, drehten sich um und begutachteten den Wagen.
Das Telefon piepste, als er ausstieg. Er beugte sich in den Wagen und zog es aus der Halterung. Als er sich aufrichtete, traf ihn der Gestank des Feuers mit voller Breitseite: verbrannter Gips, verbrannte Isolierungen, verkohltes Holz.
»Ja? Davenport hier.«
Lucas war ein großer Mann mit breiten Schultern, einem eckigen Gesicht, dunklem Teint und beginnenden Krähenfüßen in den Augenwinkeln. Sein dunkles Haar hatte einen ersten Anflug von Grau; die Augen waren verblüffend blau. Eine dünne weiße Narbe zog sich über die Stirn und die rechte Augenhöhle, verlief dann nach unten bis zu seinem Mundwinkel. Er sah aus wie ein kampferprobter Athlet, ein Catcher oder Hockey-Verteidiger, vor kurzem aus der aktiven Laufbahn ausgeschieden.
Eine frischere, rosafarbene Narbe verlief direkt über dem Knoten seiner Krawatte quer über den Hals.
»Sloan hier. Die Zentrale hat mir gesagt, du wärst bei dem Feuer.« Sloan klang heiser, als ob er eine Erkältung hätte.
»Bin gerade angekommen«, sagte Lucas und schaute hinüber zu der ausgebrannten Nissenhütte.
»Wart auf mich. Ich komme rüber.«
»Was ist los?«
»Wir haben ein neues Problem«, sagte Sloan. »Ich sag’s dir, wenn ich bei dir bin.«
Lucas drückte das Telefon wieder in die Halterung, schlug die Wagentür zu und ging auf das ausgebrannte Lagerhaus zu. Es war eine große, hellgrüne Nissenhütte aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen, hatte vornehmlich aus galvanisiertem Stahl bestanden. Das Feuer war so heiß gewesen, daß sich die Stahlplatten verbogen, gekrümmt und aufeinandergefaltet hatten wie riesige metallene Tacos.
Mit Schweinefleisch...
Lucas berührte seinen Hals, die rosafarbene Narbe, die von dem Schuß des Mädchens stammte, kurz bevor die Geschosse aus dem M-16-Gewehr es in Stücke zerfetzt hatten. Dieser Fall hatte auch mit einem Feuer angefangen, mit demselben Geruch, demselben Gestank nach verkohltem Schweinefleisch, der jetzt aus dem ausgebrannten Trümmerhaufen herüberwehte. Schweinefleisch und doch nicht Schweinefleisch...
Er berührte wieder die Narbe, ging dann zu dem geschwärzten Gewirr aus umgekippten Stützpfeilern. Ein toter Cop läge in den Trümmern, hatte man ihm beim ersten Anruf gesagt, seine Hände seien hinter dem Rücken gefesselt. Dann hatte Del vom Tatort aus angerufen und gesagt, der Cop sei einer seiner verdeckten Ermittler. Lucas solle besser mal herkommen, obwohl der Tatort außerhalb der Zuständigkeit der Polizei von Minneapolis läge... Die Vorstadt-Cops liefen mit grimmigen Einer-von- uns-Gesichtern herum. In Lucas’ Umgebung hatten schon so viele Cops ins Gras gebissen, daß er keinen großen Unterschied mehr zwischen ihnen und Zivilisten machte, solange es sich nicht um Freunde von ihm handelte.
Del stapfte geschäftig durch die verkohlten Trümmer. Er war wie immer unrasiert und trug ein aschgraues Sweatshirt, dazu Jeans und Cowboystiefel. Er sah Lucas und winkte ihn zu sich. »Er war schon tot«, sagte Del. »Ehe das Feuer ihn erreicht hat.«
Lucas nickte. »Wie?«
»Sie haben ihm die Hände gefesselt und ihm dann in die Zähne geschossen, anscheinend drei- oder viermal in die verdammten Zähne, nach allem, was wir bisher von diesem verdammten Alptraum wissen«, sagte Del und rieb unbewußt seine Hände, als ob er sie waschen wollte. »Er hat es kommen sehen.«
»O Gott, ja, Mann, es tut mir leid«, sagte Lucas. Der tote Cop war ein Deputy aus dem Hennepin County. Zu Beginn des Jahres hatte er einen Monat lang eine Ausbildung bei Del gemacht, um auf die Aufgabe als verdeckter Ermittler unter der Tarnung eines Stadtstreichers vorbereitet zu werden. Er und Del waren fast Freunde geworden.
»Ich habe ihn wegen seiner Zähne noch gewarnt; kein Mensch im verdammten Straßenmilieu hat diese großen weißen Jacketkronen-Zähne«, sagte Del und schob eine Zigarette zwischen seine Lippen. Seine eigenen Zähne waren gelbe Pfähle. »Ich habe ihm vorgeschlagen, unter einer anderen Tarnung zu arbeiten. Alles andere wäre besser gewesen. Er hätte als Verkäufer von Autoersatzteilen oder Barkeeper oder irgendwas arbeiten können. Aber nein, er mußte ja unbedingt als Stadtstreicher auftreten...«
»Ja... Warum hast du mich hergerufen?«
»Hast du Feuer?« fragte Del.
»Aha - du wolltest Feuer für deine Zigarette, deshalb...«
Del grinste mit der unangezündeten Zigarette im Mund und sagte: »Komm mit nach hinten. Dort mußt du dir was anschauen.«
Lucas folgte ihm durch die Trümmer des Lagerhauses, entlang einem schmalen Pfad durch Öffnungen in halb verbrannten Zwischenwänden, an Stapeln verkohlter Holzpaletten vorbei. Im hinteren Teil sah Lucas die schwarze Plastikplane, mit der die Leiche abgedeckt war, und der Gestank nach verbranntem Schweinefleisch wurde intensiver. Del führte ihn zu einer umgestürzten Zwischenwand, hinter der in einer flachen Holzkiste drei dünne Rohre lagen, alle etwa hundertfünfzig Zentimeter lang.
»Sind das tatsächlich die Dinger, für die ich sie halte?« fragte Del.
Lucas ging neben der Kiste in die Knie, nahm eines der Rohre in die Hand, schaute sich die innere Gewindebohrung an einem Ende an, dann am anderen, erkannte die Züge im Lauf einer Schußwaffe. »Ja, sie sind es - wenn du an Ersatzläufe für Maschinengewehre Kaliber 50 gedacht hast.« Er legte den Lauf zurück zu den anderen, watschelte im Entengang zu einer anderen flachen Kiste einen halben Meter daneben, nahm ein Metallstück heraus. »Das ist das Schloß für ein MG 50«, sagte er. »Schloß MG Kal. 50 für Explosivgeschosse. Kaputt. Sieht aus wie ein Haarriß. Schlechter Stahl... Was war hier in diesem Teil des Gebäudes?«
»Ein Maschinenladen, glaube ich.«
»Ja, ein Maschinenladen«, sagte Lucas. »Ich wette, die haben hier diese MG-Schlösser hergestellt und gegen kaputte ausgewechselt. Holten sich die Läufe von einer anderen Quelle - die Dinger da sind Spezialanfertigungen, man findet sie nicht an normalen MGs, sind zu schwer. Wir sollten unsere Waffenspezialisten ranholen, sie sollen sich das mal ansehen, und wir sollten versuchen rauszufinden, wo die Läufe herkommen und für wen sie bestimmt sind.« Er ließ das kaputte Schloß auf den Boden fallen, stand auf und nickte mit dem Kopf in Richtung auf die Leiche. »Hinter wem war er her?«
»Hinter den Seeds, wie seine Freunde sagen. Ich hatte lange keinen Kontakt mehr mit ihm.«
Lucas schüttelte den Kopf. »Das hat uns gerade noch gefehlt, daß wir es mit diesen Arschlöchern zu tun kriegen.«
»Sie haben neuerdings politische Ziele«, sagte Del. »Wollen ein paar Schwarze umlegen.«
»Ja... Du willst in die Sache einsteigen?«
Del nickte. »Deshalb habe ich dich hergeholt«, sagte er. »Du siehst diese Waffen, du riechst das verbrannte Schweinefleisch, wie kannst du da nein sagen?«
»Okay... Aber du hältst mich alle verdammten fünfzehn Minuten auf dem laufenden«, sagte Lucas und tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Brust. »Ich will über alles informiert werden, was du rausfindest, klar? Über jeden Namen, auf den du stößt, über jedes Gesicht, das dir begegnet. Beim geringsten Anzeichen von Ärger setzt du dich ab und sagst mir Bescheid. Sie sind dumme Arschlöcher, aber sie werden dich umlegen, wenn du nicht aufpaßt.«
Del nickte, sagte: »Bist du sicher, daß du kein Feuer für mich hast?«
»Del, ich meine es ernst«, sagte Lucas. »Wenn du mich bescheißt, stecke ich deinen Arsch wieder in eine Uniform. Dann wirst du den Verkehr auf der Zufahrt zu ’nem Parkplatz dirigieren dürfen. Deine Frau ist schwanger, und ich will nicht in die Lage kommen, dein Kind großziehen zu müssen.«
»Ich brauche verdammt noch mal Feuer«, sagte Del nur.
Die Seeds: die »Heusaat-Mafia«, der Motorradclub »Böse Saat«. Fünfzig bis sechzig Kriminelle - Autodiebe, Schmuggler, Lastwagen-Entführer, Harley-Davidson-Freaks, die meisten im Nordwesten Wisconsins beheimatet, durch Familienbande oder Heirat oder auch gemeinsame Knastaufenthalte miteinander verbunden. Strohhaarige Arschlöcher vom Land mit Babygesichtern. Sind bewaffnet, machen die Gegend unsicher. Und sie waren vor kurzem von einem bösartigen Bazillus befallen worden, der einen apokalyptischen, irren Haß auf Schwarze bei ihnen erzeugte, und man hatte sie im Verdacht, einen schwarzen kleinen Ganoven vor einer Billardhalle in Minneapolis umgebracht zu haben.
»Wozu brauchen Sie die MGs?« fragte Del.
»Vielleicht bauen sie irgendwo in den Wäldern ein Waco auf - wie diese Sekte.«
»Der Gedanke ist mir auch gerade gekommen«, sagte Del.
Als sie wieder draußen waren, schob sich gerade ein Streifenwagen der Stadtpolizei von Minneapolis durch die Ansammlung von Feuerwehrwagen, Fahrzeugen der örtlichen Polizei und des Sheriffs. Der Wagen hielt direkt vor ihnen, und Sloan stieg aus, beugte sich zu dem Fahrer hinunter, einem uniformierten Sergeant, und sagte: »Der Rest ist für Sie.«
»Leck mich«, sagte der Fahrer freundlich und fuhr weiter.
Sloan war ein kleiner Mann mit einem runden Arschbackengesicht. Er trug einen braunen Hunderfünfzigdollar-Sommeranzug, braune Schuhe mit einem nicht zum Anzug passenden Stich ins Gelbe sowie einen Filzhut in der Farbe von Bratensaft.
»Hallo Lucas«, sagte er. Dann sah er Del an. »Del, Mann, du siehst beschissen aus.«
»Wo hast du diesen Hut her?« fragte Lucas. »Ist es zu spät, ihn umzutauschen?«
»Meine Frau hat ihn mir gekauft«, sagte Sloan und ließ die Fingerspitzen um den Rand gleiten. »Sie sagt, er paßt zu meiner temperamentvollen Persönlichkeit.«
»Sie hat wohl Scheiß im Kopf, wie?« meinte Del.
»Vorsicht«, sagte Sloan beleidigt. »Du redest... von meinem Hut.« Er sah Lucas an. »Wir müssen los.«
»Wohin?«
»Wisconsin.« Er wiegte sich auf den Spitzen der zu gelben Schuhe. »Hudson. Uns eine Leiche anschauen.«
»Jemand, den ich kenne?« fragte Lucas.
Sloan hob die Schultern. »Kennst du eine Puppe namens Harriet Wannemaker?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Aber so heißt sie wahrscheinlich.«
»Und warum soll ich sie mir ansehen?«
»Weil ich es sage und du meinem Urteil vertraust?« Sloan ließ es wie eine Frage klingen.
Lucas grinste. »Okay.«
Sloan schaute zu Lucas’ Porsche hinüber. »Darf ich fahren?«
»Sah wohl schlimm da drin aus, wie?« fragte Sloan. Er warf seinen Hut auf den Rücksitz und schaltete runter, als sie auf das Stoppschild vor dem Highway 280 zufuhren.
»Sie haben ihn hingerichtet. Ihm in die Zähne geschossen.
Könnten die Seeds gewesen sein.«
»Verdammte Arschlöcher«, sagte Sloan ohne besondere Schärfe. Er fuhr auf den Highway 280 auf.
»Was ist mit dieser Wie-heißt-sie-noch-mal passiert?« fragte Lucas. »Wannebe oder so ähnlich.«
»Wannemaker. Sie verschwand vor drei Tagen von der Bildfläche. Ihre Freunde sagen, sie hätte am Freitagabend zu einem Buchladen gehen wollen, wissen aber nicht, in welchen, und sie ist am Samstagmorgen nicht wie verabredet bei ihrem Frisör erschienen. Wir haben eine Vermißtensuchmeldung losgelassen, und das war auch schon alles, bis heute Morgen Hudson anrief. Wir haben ihnen ein Polaroidfoto rübergefaxt; es war nicht besonders gut, aber sie glauben, es ist diese Wannemaker.«
»Erschossen?«
»Nein, erstochen. Die angewendete Technik besteht im Prinzip aus einem Aufschlitzen - ein Stich in den Unterbauch, dann ein Hochreißen des Messers bis zum Brustbein. Großer Kraftaufwand... Du verstehst jetzt, warum ich mir das anschauen will.«
»Hat es was mit dieser Wie-heißt-sie-noch zu tun, dieser Tante von der Staatspolizei?«
»Meagan Connell«, sagte Sloan. »Ja.«
»Wie ich höre, gibt’s Arger.«
»Das kann man wohl sagen. Eine komplette Persönlichkeitstransplantation wäre bei ihr sehr angebracht«, sagte Sloan. Er zischte an einem Lexus SC vorbei und lächelte überheblich. Der Typ in dem Lexus trug eine Sonnenbrille und Fahrerhandschuhe. »Aber wenn man ihre Unterlagen liest, die Fakten, die sie zusammengetragen hat - ich muß sagen, da ist was dran, Lucas. Aber Gott sei uns gnädig, daß es nicht wieder einer von den Morden dieses Kerls ist. Es klingt so, als könnte es sein, aber es ist noch zu früh für ein endgültiges Urteil. Wenn er es trotzdem sein sollte, dann legt er an Tempo zu.«
»Das machen die meisten«, sagte Lucas. »Sie werden dazu getrieben.«
Sloan hielt vor einer Ampel, raste bei Grün wieder los, die Auffahrt zum Highway 36 hinauf. Er beschleunigte auf fünfundsiebzig Meilen, hielt diese Geschwindigkeit und drängelte sich durch den Verkehr wie ein Hai auf Beutesuche. »Der Kerl hat ja bisher immer regelmäßige Zeitabstände eingehalten«, sagte er. »Ich meine, wenn es ihn gibt... Er hat einmal im Jahr oder so einen Mord begangen. Jetzt wären wir bei vier Monaten. Den letzten Mord hat er ungefähr um die Zeit begangen, als du diesen Schuß in den Hals abgekriegt hast. Griff sich die Frau in Dulutz, ließ die Leiche oben im Carlos-Avery-Wildpark liegen.«
»Irgendwelche Spuren von ihm?« Lucas strich über die rosafarbene Narbe am Hals.
»Verdammt wenige. Bis auf die in Meagans Aktensammlung über ihn.«
Sie brauchten zwanzig Minuten, bis sie das Netz der Highways östlich von St. Paul hinter sich hatten und Wisconsin ansteuerten. Die Landschaft war grün und üppig nach dem feuchten Frühjahr. »Hier draußen auf dem Land ist alles besser«, meinte Sloan. »Mein Gott, die Medien werden wegen dem ermordeten Cop durchdrehen.«
»Da kommt ’ne Menge Scheiß auf uns zu«, stimmte Lucas zu. »Na ja, der Cop war wenigstens keiner von uns.«
»Vier Morde in fünf Tagen«, sagte Sloan. »Wannemaker bringt uns auf fünf in einer Woche. Vielleicht sind es sogar sechs. Wir untersuchen den Fall einer alten Lady, die in ihrem Bett erstickt ist. Einige meinten, da wäre ein bißchen nachgeholfen worden. Aber bis jetzt geht man noch von einer natürlichen Todesursache aus.«
»Der Fall Dupont ist klar, oder?« fragte Lucas.
»Ja. Der Hammer-und-Meißel-Fall...«
»Tut irgendwie weh, wenn man sich das vorstellt.« Lucas grinste.
»Bekam es genau zwischen die Augen«, sagte Sloan, offensichtlich tief beeindruckt. Er hatte es noch nie mit einem Hammer-und-Meißel-Fall zu tun gehabt, und Neuerungen waren im Mordgeschäft nicht gerade häufig. Im Normalfall kratzte sich ein angetrunkener Typ am Hintern und sagte: »Herrgott, sie hat mich echt auf die Palme gebracht, verstehen Sie?« Sloan fuhr fort: »Sie wartete, bis er fest eingeschlafen war, und peng. In Wirklichkeit wohl eher peng, peng, peng. Der Meißel ging durch bis in die Matratze. Sie zog ihn raus, legte ihn in die Spülmaschine, stellte die Spülmaschine an, wählte dann die Notrufnummer... Macht mich irgendwie nachdenklich, wenn ich abends ins Bett gehe. Du erwischst deine Alte dabei, wie sie dich seltsam anstarrt...«
»Irgendwelche Milderungsgründe? Langzeitiger Mißbrauch oder so was?«
»Bis jetzt nicht. Bisher sagt sie nur, es wäre sehr heiß in der Wohnung gewesen, und sie hätte die Schnauze voll davon gehabt, daß er dauernd nur schnarchend und furzend rumlag... Kennst du Donovan vom Büro des Staatsanwalts?«
»Ja.«
»Er sagt, er hätte auf Mord zweiten Grades plädiert, wenn es nur einmal ›peng‹ gewesen wäre«, sagte Sloan. »Aber mit ›peng, peng, peng‹ müsse er auf ersten Grad plädieren.«
Ein Lastwagen schob sich plötzlich vor sie, und Sloan fluchte, ging auf die Bremse, gab wieder Gas und überholte ihn rechts.
»Und die Sache mit Louis Capp?« fragte Lucas.
»Wir haben ihn«, sagte Sloan befriedigt. »Zwei Zeugen, einer von ihnen kannte ihn... Capp schoß dreimal auf das Opfer, hat hundertfünfzig Dollar erbeutet.«
»Ich war zehn Jahre hinter Louis her, habe ihn aber nie erwischt«, sagte Lucas. Eine Spur von Bedauern lag in seiner Stimme, und Sloan sah ihn an, grinste. »Bringt er was zu seiner Entlastung vor?« fragte Lucas.
»Die übliche Masche«, sagte Sloan. »Das war 'n anderer Typ. Wird aber diesmal nicht funktionieren.«
»Er war schon immer ein dämlicher Mistkerl«, sagte Lucas. Er sah Louis Capp wieder vor sich. Großer Kerl, Arme wie Baumstämme, riesiger Bauch. Trug den Gürtel unterhalb des Bauches, so daß der Hosenstall fast zwischen den Knien hing. »Die Sache war ja die, daß er alles so einfach abspulte, daß man dabei sein mußte, wenn man ihn überführen wollte. Sich hinter ein Opfer schleichen, ihm eins über den Kopf ziehen, ihm die Brieftasche abnehmen. Der Kerl muß in seiner Karriere mindestens zweihundert Leute zusammengeschlagen haben.«
»Er ist so niederträchtig, wie er dumm ist«, sagte Sloan.
»Mindestens«, stimmte Lucas zu. »Was haben wir sonst noch?
Den Vergewaltiger Hmong und die hingefallene, hingestürzte, hingestoßene, tote Kellnerin... «
»Hmong wird uns diesmal nicht entkommen«, sagte Sloan. »Die Kellnerin hatte Hautpartikel unter den Fingernägeln.«
»Aha.« Lucas nickte. Das gefiel ihm. Haut - das war immer gut...
Lucas war vor zwei Jahren aus dem Polizeidienst ausgeschieden, nicht ganz freiwillig, nachdem er eine Schlägerei mit einem Zuhälter gehabt hatte. Er hatte eine Firma gegründet, die anfänglich Spiele verschiedener Art konzipierte. Die Computer-Kids, mit denen er zusammenarbeitete, hatten ihn dann in eine neue Richtung gedrängt - die Herstellung von Computerspielen, bei denen es um Simulation der Polizeiarbeit bei der Überführung und »Erledigung« von Verbrechern ging. Er fing gerade an, das große Geld zu machen, als die neue Polizeichefin von Minneapolis ihn bat, wieder in den Dienst zurückzukommen.
Er konnte nicht wieder als städtischer Angestellter übernommen werden; er hatte jedoch das politische Amt eines Deputy Chief akzeptiert. Er arbeitete im Bereich der Verbrechensaufklärung, wie er es vorher getan hatte, und zwar mit zwei hauptsächlichen Zielen: Überführung der aktivsten und gefährlichsten Verbrecher sowie Rückendeckung des Departments bei Schwerverbrechen, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zogen.
»Versuchen Sie uns davor zu bewahren, in irgendwelche Fallen der Spinnen da draußen zu geraten«, hatte der - weibliche - Chief gesagt. Lucas zögerte einige Zeit, aber die Tätigkeit des Geschäftsmannes langweilte ihn, also stellte er einen Geschäftsführer für seine Firma ein und nahm das Angebot des Chiefs an.
Er war ganz unten wieder eingestiegen, hatte sich einen Monat lang auf den Straßen herumgetrieben und versucht, seine alten Informationsquellen wieder zu erschließen, aber es war schwerer gewesen, als er gedacht hatte. In nur zwei Jahren hatte sich vieles geändert. Grundlegend verändert.
»Es überrascht mich, daß Louis den Revolver benutzt hat«, sagte Lucas. »Er hat damals meistens mit einem Totschläger oder einem Bleirohr gearbeitet.«
»Heutzutage haben sie alle Revolver«, sagte Sloan. »Alle. Und sie haben nicht die Spur von Bedenken, sie auch einzusetzen.«
Der St. Croix zog sich als stahlblaues Wasserband unter der Hudson-Brücke hindurch. Segel- und Motorboote trieben auf dem Fluß wie Konfettischnipsel.
»Du solltest eine Bootsstation kaufen«, sagte Sloan. »Ich könnte dann die Tankstelle für dich betreiben. Ich meine, sieht das nicht verdammt toll aus?«
»Biegst du hier ab oder fahren wir durch bis Chicago?«
Sloan gab es auf, die Schönheit der Landschaft zu bewundern, stieg auf die Bremse, schnitt einen Kombi, bog in die erste Abfahrt auf dem Gebiet von Wisconsin ein, fuhr dann nach Norden in Richtung Hudson. Direkt vor ihnen tauchte an einer Bootsrampe eine Ansammlung von Notfall-Einsatzwagen auf, etwa ein halbes Dutzend, und uniformierte Polizisten der Stadtpolizei von Hudson dirigierten den Verkehr an der Rampe vorbei. Zwei Cops, die Daumen in ihre Revolvergürtel gehakt, standen vor einem Müllcontainer. Seitlich davon redeten ein dritter Cop und eine blonde, breitschultrige Frau mit Sonnenbrille und schwarzem Hosenanzug aufeinander ein. Sie schienen sich zu streiten. Sloan sagte: »Oje, Scheiße.« Als sie den Schauplatz erreichten, kurbelte er das Fenster herunter und rief dem nächststehenden, mit der Verkehrsregelung beschäftigten Cop zu: »Polizei Minneapolis«. Der Cop winkte ihn durch zu den anderen Fahrzeugen.
»Was ist los?« fragte Lucas. Die Blonde wedelte mit den Armen in der Luft herum.
»Ärger«, sagte Sloan. Er stieß die Wagentür auf. »Das ist Connell.«
Ein knochiger Deputy Sheriff mit dunklem, wettergegerbtem Gesicht sprach gerade mit einem der Cops an dem Müllcontainer; als der Porsche vorfuhr, grinste er kurz, rief etwas in Richtung des Cops, der mit der blonden Frau herumdiskutierte, und kam dann auf den Porsche zu.
»Hellstrom«, sagte Lucas zu Sloan, nachdem er den Namen aus dem Gedächtnis hervorgekramt hatte. »D. T. Hellstrom. Erinnerst du dich an den Professor, den Carlo Druze ermodet hat?«
»Ja.«
»Hellstrom hat ihn gefunden«, sagte Lucas. »Er ist ein netter Kerl.«
Sie stiegen aus, und Hellstrom streckte Lucas die Hand entgegen. »Hey, Davenport. Hab gehört, daß Sie wieder im Dienst sind. Als Deputy Chief, nicht wahr? Gratuliere!«
»Hey, D. T., wie geht’s Ihnen?« begrüßte ihn Lucas. »Wir haben uns nicht mehr gesehen, seit Sie damals den Professor gefunden haben.«
»Ja, aber das ist schlimmer«, sagte Hellstrom und schaute hinüber zu dem Müllcontainer. Er rieb sich die Nase.
Die blonde Frau rief an dem Cop vorbei. »Hey, Sloan.«
Sloan murmelte etwas vor sich hin, sagte dann laut: »Hey, Meagan.«
»Arbeiten Sie mit dieser Lady zusammen?« fragte Hellstrom Sloan und deutete mit dem Daumen auf die blonde Frau.
Sloan nickte und sagte: »Mehr oder weniger.« Lucas deutete auf seinen Freund: »Das ist Sloan«, sagte er zu Hellstrom. »Mordkommission Minneapolis.«
»Sloan!« rief die Frau. »Hey, Sloan, kommen Sie her!«
»Ihre Freundin ist ein Brechmittel«, sagte Hellstrom zu Sloan.
»Sie haben hundertprozentig recht, bis auf die Tatsache, daß sie nicht meine Freundin ist«, sagte Sloan und setzte sich in Bewegung. »Ich komme gleich zurück.«
Sie standen auf der Bootsrampe, auf deren schwarzem Asphalt Parkplätze für Personenwagen und Wohnmobile eingezeichnet waren und auf der ein Parkscheinautomat und ein Abfallcontainer standen. »Auf was seid ihr denn nun gestoßen?« fragte Lucas Hellstrom, während sie auf den Container zugingen.
»Auf einen Irren... Er hat den Mord auf eurer Seite der Brücke begangen, nehme ich an. Es gibt kein Blut hier, außer dem an der Leiche. Sie hat aufgehört zu bluten, noch ehe sie in den Müllcontainer geworfen wurde, es sind keinerlei Blutspuren auf dem Boden. Und es muß verdammt viel Blut gegeben haben... Mein Gott, schauen Sie sich das an!«
Auf dem Westausläufer der Brücke stand ein Van mit flackerndem Gelblicht direkt am Geländer, und ein Mann richtete eine Fernsehkamera auf sie herunter.
»Darf der das denn?« fragte Lucas.
»Keine Ahnung«, antwortete Hellstrom.
Sloan und die Frau kamen auf sie zu. Die Frau war groß und jung, Ende Zwanzig bis Anfang Dreißig. Trotz des Zornes wegen der Auseinandersetzung mit dem Cop war ihr Gesicht nicht gerötet, sondern weiß wie ein Leintuch; ihr blondes Haar war so kurz geschnitten, daß die bleiche Kopfhaut durchschimmerte. »Es gefällt mir nicht, wie ich hier behandelt werde«, sagte die Frau.
»Sie sind hier nicht zuständig«, fauchte Hellstrom sie an. »Sie halten jetzt entweder den Mund oder verschwinden über die Brücke. Ich habe die Schnauze voll von Ihnen.«
Lucas sah die Frau neugierig an. »Sind Sie Meagan O’Connell?«
»Connell. Kein O’. Ich bin Untersuchungsbeamtin bei der Staatspolizei. Und wer sind Sie?«
»Lucas Davenport.«
»Oje«, stöhnte sie. »Ich habe von Ihnen gehört.«
»So?«
»Ja. Sie sind so was wie ein Macho-Arschloch.«
Lucas lachte verkrampft, wußte nicht, ob sie das ernst gemeint hatte, sah Sloan an, aber der hob nur die Schultern. Sie hatte es tatsächlich ernst gemeint... Connell schaute Hellstrom an, der sich ein leichtes Grinsen erlaubt hatte, als Connell so heftig auf Lucas losgegangen war. »Darf ich die Leiche jetzt sehen oder nicht?«
»Wenn Sie mit der Mordkommission Minneapolis zusammenarbeiten...« Hellstrom sah Sloan an, und Sloan nickte. »Seien Sie mein Gast. Aber fassen Sie nichts an.«
»Mein Gott...«, murmelte sie und stolzierte zu dem Müllcontainer hinüber. Der Rand des Containers reichte ihr bis zum Hals, und sie mußte sich auf Zehenspitzen stellen, um reinschauen zu können. Sie warf einen kurzen Blick ins Innere des Containers, ging dann schnell zur Seite, auf den Fluß zu und übergab sich würgend.
»Seien Sie mein verdammter Gast«, murmelte Hellstrom.
»Was hat sie denn bisher gemacht?« fragte Lucas.
»Kam her, als ob sie Feuer unterm Arsch hätte, und fing an, jeden einzelnen von uns anzuschreien«, antwortete Hellstrom. »Als ob wir vergessen hätten, uns die Pferdescheiße von den Stiefeln abzukratzen.«
Sloan war besorgt, wollte zu Connell gehen, blieb dann aber stehen, kratzte sich am Kopf, ging zum Container, warf einen Blick hinein. »Wow.« Er drehte sich weg. »Gottverdammte Scheiße!« Dann, zu Lucas: »Du hältst besser den Atem an.«
Lucas atmete durch den Mund, als er in den Container schaute. Die Leiche war nackt und steckte in einem grünen Plastik-Müllsack, der oben zugebunden war. Der Sack war beim Aufprall auf den Boden des Containers aufgeplatzt, vielleicht hatte ihn auch jemand aufgeschnitten.
Der Bauch der Frau war aufgeschlitzt worden, und die Eingeweide quollen heraus wie verfaulter Maisbrei. Sloans frühere Beschreibung traf zu: Sie war nicht erstochen, sie war aufgeschlitzt worden wie eine Sardinenbüchse, mit einem langen Schnitt von der Beckengegend bis zum Brustbein. Im ersten Moment dachte Lucas, Maden hätten bereits mit ihrer Arbeit begonnen, sah dann aber, daß es sich bei den weißen Flecken auf der Leiche um Reiskörner handelte, offensichtlich Abfall von irgendeinem Benutzer des Containers.
Der Kopf der Frau lag im Profil auf dem grünen Plastiksack. Dieser war mit einer roten Schnur zugebunden, und die Schleife lag auf dem Ohr der Frau wie auf einem Weihnachtspäckchen. Fliegen krabbelten überall auf dem Körper herum wie winzige russische MiG-Jagdbomber. - Über ihren Brüsten, etwa eine Handbreit oberhalb des Endes des Schnittes, waren zwei kleinere Einschnitte in die Haut, die wie Buchstaben aussahen. Lucas sah sie sich eine Weile an, trat dann zurück, atmete erst wieder durch die Nase, als er mehrere Schritte von dem Container entfernt war.
»Der Mann, der sie hier reingeworfen hat, muß ziemlich kräftig sein«, sagte Lucas zu Hellstrom. »Er hat sie sehr hoch anheben und dabei aufpassen müssen, daß keine Innereien in der Gegend verstreut wurden.«
Mit kreidebleichem Gesicht kam Connell über die Rampe wieder auf sie zugewankt.
»Was haben Sie gerade gesagt?«
Lucas wiederholte es, und Hellstrom nickte dazu. »Richtig. Und nach der Personenbeschreibung, die man uns gegeben hat, war sie keinesfalls ein Leichtgewicht. Sie hat rund hundertfünfunddreißig Pfund auf die Waage gebracht. Wenn es Wannemaker ist.«
»Sie ist es«, sagte Sloan. Er war um den Container herumgegangen und sah von der anderen Seite nach innen. Mit Augen, Nase und Ohren über dem Rand des Containers sah er aus Lucas’ Perspektive aus wie Kilroy. »Und ich will euch was sagen: Ich habe die Videoaufnahme von der Leiche gesehen, die man oben im Carlos-Avery-Wildpark gefunden hat. Wenn das nicht derselbe Killer war wie der hier, dann haben die beiden Aufschlitz-Unterricht beim selben Lehrer genommen.«
»Genau dasselbe?« fragte Lucas.
»Völlig identisch«, sagte Connell.
»Na ja, nicht ganz«, korrigierte Sloan und trat vom Container zurück. »Die Carlos-Avery-Leiche hatte nicht diese komischen Schnörkelschnitte über ihren Tit..., ehm, Brüsten.«
»Schnörkelschnitte?« fragte Connell.
»Ja. Sehen Sie sich das mal an.«
Sie schaute wieder in den Container, sagte nach einigen Sekunden: »Die Schnitte sehen aus wie ein großes S und ein großes J«
»Dachte ich auch«, sagte Lucas.
»Und was soll das heißen?« fragte Connell.
»Ich bin kein Hellseher«, antwortete Lucas. »Schon gar nicht, wenn es um Leichen geht.« Er wandte sich an Hellstrom. »Kann es sein, daß jemand da drin rumgewühlt hat? Was rausgenommen hat? Aus dem Container?«
»Das bezweifle ich. Es hat seit Freitag ein paarmal geregnet, und die Leute haben übers Wochenende alles Mögliche reingeschmissen, aber... Warum fragen Sie?«