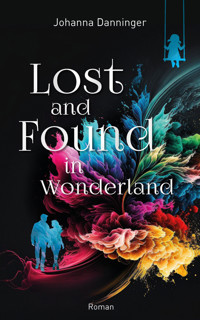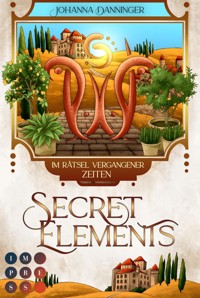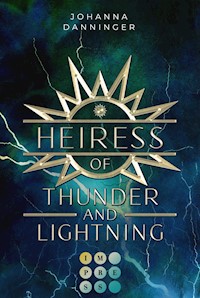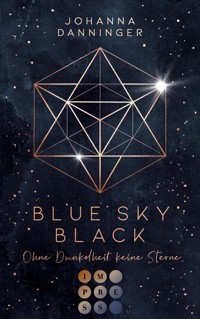
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Wenn die Hoffnung stirbt, dann kämpfe, um zu lieben.** In Milas Leben ist nichts mehr so, wie es früher war. Durch eine Reihe von Naturkatastrophen ist die Welt zu einem feindlichen Ort geworden und Mila muss in ihrer neuen Heimat Kanada allein für sich sorgen. Wo sie hinschaut, gibt es keine Hoffnung mehr. Bis eines Tages ein junger Mann in ihr Leben tritt. Er ist ihr Nordstern in der Dunkelheit. Doch die Finsternis macht auch vor dem Licht der Liebe nicht halt. Es stellt sich heraus, dass er nicht der ist, der er zu sein vorgibt. Und dass nur sie beide die Welt – und einander – retten können … Leserstimmen: »Bewegend und authentisch.« »Ich liebe es! Es wird eines meiner Jahreshighlights.« »Man kann das Buch nicht aus den Händen legen, wenn man erst einmal angefangen hat.« »Eine Besonderheit in diesem Buch waren für mich die unterschiedlichen Frauenrollen. Jede auf ihre Weise stark.« »Mein Mann wird es jetzt auch lesen und das sagt schon alles!« »Spannung, Liebe, Verschwörung - das Buch muss man einfach lesen.« //Hol dir auch die wunderschön veredelte Print-Ausgabe als Schmuckstück für dein Bücherregal! //»Blue Sky Black. Ohne Dunkelheit keine Sterne« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Johanna Danninger
Blue Sky Black. Ohne Dunkelheit keine Sterne
**Wenn die Hoffnung stirbt, dann kämpfe, um zu lieben.**In Milas Leben ist nichts mehr so, wie es früher war. Durch eine Reihe von Naturkatastrophen ist die Welt zu einem feindlichen Ort geworden und Mila muss in ihrer neuen Heimat Kanada allein für sich sorgen. Wo sie hinschaut, gibt es keine Hoffnung mehr. Bis eines Tages ein junger Mann in ihr Leben tritt. Er ist ihr Nordstern in der Dunkelheit. Doch die Finsternis macht auch vor dem Licht der Liebe nicht halt. Es stellt sich heraus, dass er nicht der ist, der er zu sein vorgibt. Und dass nur sie beide die Welt – und einander – retten können …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Johanna Danninger, geboren 1985, lebt als Krankenschwester mit ihrem Mann, einem Hund und zwei Katzen umringt von Wiesen und Feldern im schönen Niederbayern. Schon als Kind dachte sie sich in ihre eigenen Geschichten hinein. Seit sie 2013 den Schritt in das Autorenleben wagte, kann sie sich ein Dasein ohne Tastatur und Textprogramm gar nicht mehr vorstellen. Und in ihrem Kopf schwirren noch zahlreiche weitere Ideen, die nur darauf warten, endlich aufgeschrieben zu werden!
Prolog
Dienstag
Die Fahrzeugkolonne schob sich träge über die Interstate 15. Mila zwirbelte angespannt eine Strähne ihres hellbraunen Haars zwischen den Fingern ihrer linken Hand. Mit der anderen hielt sie das Lenkrad so fest umklammert, dass ihre Fingerknöchel weiß hervortraten. Ihr Dad saß auf dem Beifahrersitz und starrte schweigend geradeaus. Dunkle Schatten lagen unter seinen geröteten Augen. Er hatte seit gestern nicht mehr geschlafen, weshalb Mila sich kurzerhand hinters Steuer gesetzt hatte. Ihre Mum und ihr jüngerer Bruder Sam saßen auf der Rückbank des Vans. Auch sie sprachen kein Wort. Nur leise Popmusik erklang aus dem CD-Spieler des Wagens.
Noch fünf Meilen bis zur kanadischen Grenze.
Mila kannte die Strecke vom amerikanischen Great Falls zum kanadischen Redwood Meadows wie ihre Westentasche. Seit sie denken konnte, hatte sie einmal im Jahr die knapp 400 Meilen Fahrt mit ihrer Familie auf sich genommen, um ihren Großvater zu besuchen.
Doch diesmal war alles anders.
Der Ansturm auf die Grenze war enorm. Ganz Montana schien sich nach Kanada in Sicherheit zu bringen. Unzählige Fahrzeuge, beladen bis unters Dach und darüber hinaus, schoben sich in Richtung Grenze. Immer wieder kam der ohnehin stockende Verkehr für mehrere Minuten komplett zum Erliegen. So wie in diesem Moment auch.
Ein Militärhubschrauber donnerte über den Highway hinweg. Bei dem Geräusch zuckte Mila zusammen. Der Anblick der schweren Kampfmaschinen war beängstigend und irreal zugleich. Dabei war das US-Militär bereits seit zwei Tagen allgegenwärtig, um der Bevölkerung zu helfen und die Situation unter Kontrolle zu halten. Die ersten Soldaten hatten schon bereitgestanden, bevor die Menschen überhaupt begriffen, was die Meldungen aus den Nachrichten eigentlich zu bedeuten hatten.
Vor ungefähr sechs Monaten ging eine Meldung durch die Medien, dass unerklärliche seismische Aktivitäten auf dem gesamten Globus im Gange seien. Als würde die Erdkruste plötzlich verrücktspielen. Alle paar Wochen erschütterten Beben vereinzelte Gebiete zahlreicher Kontinente. Mal in Japan, dann in Russland. In der Türkei, in Südafrika und Frankreich.
Geologen und Geophysiker stritten sich öffentlich über die Tragweite dieser Vorkommnisse. Die einen waren überzeugt davon, dass die Anomalien von temporärer Natur und nicht weiter bedenklich seien, während andere davor warnten, das Ganze könne von tiefergehenden Veränderungen im Erdkern ausgehen, deren Auswirkungen weder messbar noch vorauszusehen seien.
Im Endeffekt war nur klar, dass niemand wusste, was mit dem Planeten gerade geschah. Vielleicht waren die unzähligen widersprüchlichen Theorien auch der Grund dafür, dass die breite Masse der Bevölkerung ihr Leben trotz der massiven Naturkatastrophen einfach weiterlebte. Für die meisten Menschen waren sie zu abstrakt, als dass sie ihren Alltag beeinflusst hätten. Vielleicht ignorierte man das Bevorstehende aber auch, weil der Großteil mit dem Begriff »globale Katastrophe« nichts anfangen konnte. Weil die meisten Leute solche Szenarien einzig aus dem Fernsehen kannten und sich diese in der Regel fernab der eigenen Heimat ereigneten.
Mila hatte ähnlich reagiert und die Nachrichten einfach ignoriert. So wie all ihre Freunde am College auch. Der Unterricht dort war anspruchsvoll wie immer gewesen, die Partys fröhlich und ausgelassen wie eh und je. Sie hatte sogar noch mit den Augen gerollt, als ihr Vater vor drei Wochen beschlossen hatte, dass die ganze Familie zu Großvater Joe nach Kanada ziehen sollte, denn der lebte auf dem Land, wo bessere Überlebenschancen bestanden. Sie hatte nicht nur mit den Augen gerollt, sondern sich mit ihren achtzehn Jahren aufgeführt wie ein störrischer Teenager. Hatte ihren Dad als Weltuntergangsfanatiker bezeichnet und überhaupt nicht eingesehen, das Schuljahr vorzeitig zu beenden. Und was wäre dann überhaupt mit ihrem Freund David? Nach langem Hin und Her hatten sie endlich zusammengefunden, und nun sollte sie Hals über Kopf nach Kanada umziehen, nur weil ein paar Wissenschaftler seltsame Thesen von sich gaben?
Gequält biss Mila sich auf die Unterlippe. Es war allein ihre Schuld, dass der geplante Umzug zu einer überstürzten Flucht geworden war und sie jetzt inmitten einer wahren Flüchtlingswelle im Stau standen. Nur Mila zuliebe hatten ihre Eltern den Umzug verschoben. Trotz aller Achtsamkeit hatte sogar ihr Dad geglaubt, dass ihnen die Zeit dazu bleibe.
Doch das war nicht so.
Nun befanden sie sich inmitten der wohl größten Evakuierung aller Zeiten. Der Grund dafür war die rasant angestiegene vulkanische Aktivität im Yellowstone-Nationalpark. Genau genommen war der gesamte Nationalpark ein einziger Supervulkan, dessen drohender Ausbruch ähnlich verheerende Folgen wie die eines Kometeneinschlags haben könnte. Hierüber waren sich die Wissenschaftler ausnahmsweise einig.
Milas Heimatstadt Great Falls befand sich gut zweihundert Meilen nördlich von Yellowstone. Die befürchtete Reichweite einer Eruption überstieg Milas Vorstellungskraft. So wie fast die gesamte Situation ihre Vorstellungskraft überstieg.
Über dem Highway erstreckte sich ein strahlend blauer Himmel. Die Sonne lachte. Nichts wies auf die geologischen Vorgänge hin, die angeblich tief unten in der Erde stattfanden. Vielleicht irrten sich die Wissenschaftler ja? Vielleicht interpretierten sie ihre Messungen falsch?
Mila strich die Haarsträhne hinter ihr Ohr und lehnte den Kopf nach hinten. Dabei fiel ihr Blick auf den braunen Caravan, der sich auf der Überholspur an ihnen vorbeischob. Ein kleiner Junge saß auf dem Rücksitz und sah durch das heruntergelassene Fenster zu ihr. Seine blonden Locken tanzten in einer sanften Brise. Die gegenwärtige Sorge schien ihn kaum zu kümmern. Er wirkte eher aufgeregt. Als wäre er mit seinen Eltern auf dem Weg in einen spannenden Urlaub.
Sein Anblick beruhigte Mila auf seltsame Weise. Sie grinste ihn an und streckte ihm frech die Zunge heraus. Der Junge lachte. Dabei sah er aus wie ein kleiner Engel.
Plötzlich rollte ein Dröhnen über die Autodächer. Erst glaubte Mila, ein weiterer Hubschrauber würde seine Runden drehen, doch das dunkle Grollen wurde immer lauter. Mila spürte, wie es den ganzen Wagen zum Vibrieren brachte. Jemand schrie. Ihr Vater fuhr herum und blickte durch die Heckscheibe.
In seinem Gesichtsausdruck spiegelte sich blankes Entsetzen. Auf dem Rücksitz stieß ihre Mutter ein verängstigtes Keuchen aus.
Mila wagte es nicht, nach hinten zu sehen. Sie war wie versteinert und starrte nur ihren Dad an. Einige aus den umstehenden Fahrzeugen stiegen aus. Der Wehlaut einer Frau drang durch die geschlossenen Fenster herein und ließ Milas Nackenhaare zu Berge stehen.
Ihr Dad wandte sich wieder nach vorn und stellte das Autoradio auf einen Nachrichtensender um.
»… noch ist unklar, ob es sich um eine Eruption der gefürchteten Hauptcaldera handelt. Die Aschewolke ist gewaltig. Experten schätzen, dass sie sich in einem Umkreis von zweihundert Meilen ausbreiten könnte. Vielleicht sogar noch weiter …«
»Dad?«, fragte Sam heiser. »Wie weit sind wir von Yellowstone entfernt?«
Milas Vater schloss kurz die Augen, bevor er mit ruhiger Stimme antwortete: »Fast vierhundert Meilen. Also weit genug.«
»Alles klar.« Sam räusperte sich und versuchte wohl, ebenso beherrscht zu klingen wie sein Vater. »Schaut euch das an! Wie hoch muss die Wolke sein, dass man sie bis hierher sehen kann?«
»Gott, steh uns bei«, hörte Mila ihre Mutter flüstern.
Immer mehr Menschen tauchten neben den Fahrzeugen auf dem Highway auf und blickten schockiert nach hinten. Manche weinten, anderen stand nur der Mund offen vor Erschütterung.
Sam öffnete die Tür und stieg aus. Milas Dad wirkte einen Moment so, als wollte er seinen Sohn zurückhalten, doch dann langte er ebenfalls nach dem Türgriff. Er sah Mila fragend an, die stumm den Kopf schüttelte und ihren Blick zur Windschutzscheibe wandte. Ihr Vater zögerte. Schließlich drückte er in einem Versuch, sie zu trösten, ihre rechte Schulter, bevor er aus dem Van kletterte.
Erst als die Beifahrertür ins Schloss fiel, bemerkte Mila, dass ihre Mum ebenfalls ausgestiegen war. Sie war allein im Wagen. Nur die Stimme des aufgelösten Nachrichtensprechers erfüllte den Innenraum. Mit zittrigen Fingern stellte sie das Radio auf CD-Wiedergabe und blickte dann weiter stur geradeaus.
Sie wollte nicht sehen, was sich hinter ihrem Rücken gerade abspielte. Sie wollte nicht Zeuge davon werden, wie ihr Zuhause zerstört wurde.
Was machte David wohl im Moment? Wie erging es ihm bei seiner Verwandtschaft in Ohio? War er überhaupt schon angekommen?
Er und seine Familie hatten sich ein paar Stunden vor Mila auf den Weg gemacht. Bevor ihr Gespräch unterbrochen worden war, vermutlich weil das Mobilfunknetz überlastet war, befanden sie sich irgendwo in North Dakota. Das bedeutete, dass er sich in jedem Fall außerhalb der Reichweite des Yellowstone-Vulkans befand.
Automatisch nahm Mila ihr Handy aus der Ablage und überprüfte den Funkstatus, obwohl ihr klar war, dass sich an der Situation nicht viel geändert haben dürfte. Was auch
der Fall war. Sie legte das Smartphone zurück und kratzte sich fahrig an der Stirn. Dabei traf ihr Blick auf den Rückspiegel.
Ihr Atem stockte. Absolutes Entsetzen kroch durch ihre Glieder.
Die Aschewolke war in aller Deutlichkeit am Horizont zu sehen. Wie ein dunkelgrauer Turm ragte sie in den Himmel. Das Ende verschwand hinter einer Schicht aus leuchtend weißen Kuschelwolken.
Erschreckend und faszinierend zugleich war es, dieses Naturschauspiel, dessen Ausmaße unbeschreiblich waren. Mila war gänzlich gefangen von diesem Anblick. Unfähig, sich abzuwenden.
Eine fremde Frau ging am Heck des Vans vorbei und holte sie schließlich zurück in die Gegenwart. Mila schöpfte einige Male tief Luft, um den Schock zu überwinden. Dabei suchte sie über den Rückspiegel nach ihrer Familie. Sie entdeckte ihre Mutter und Sam ein gutes Stück hinter ihrem Wagen neben einem Wohnmobil. Ihr kleiner Bruder stand aufrecht und tapfer da. Er schirmte mit einer Hand seine Augen gegen die Sonne ab, einen Arm hatte er schützend um seine Mutter gelegt, die sich stumm über ihre tränennassen Wangen wischte. Ihr Vater unterhielt sich ein wenig abseits mit einem älteren Mann. Beide deuteten immer wieder auf die gigantische Rauchwolke, als würden sie sich gegenseitig erklären, was dort gerade geschah.
Mila tastete nach der Gurtschnalle, um sich doch noch zu ihrer Familie zu gesellen. Kaum streifte ihr Zeigefinger den Plastikknopf, da erfasste plötzlich eine Erschütterung den Wagen. Ein ähnliches Grollen wie vorhin erklang. Diesmal weitete sich das anfängliche Vibrieren jedoch innerhalb eines Wimpernschlags zu einem gewaltigen Beben aus.
Der gesamte Highway geriet ins Wanken. Schreie von Menschen vermischten sich mit knirschenden Geräuschen und ohrenbetäubendem Krachen.
Bevor Mila wusste, wie ihr geschah, wurde sie nach vorn in den Gurt geschleudert. Ihr Kopf prallte hart auf die Seitenscheibe.
Dann wurde es dunkel.
***
Donnerstag
Caithlyn watete durch das knietiefe Wasser. Bei jedem Schritt tastete sie zuerst mit der Fußsohle über den Boden, um nicht versehentlich auf eine scharfe Kante oder sogar in einen offen stehenden Gully zu treten. So bahnte sie sich unermüdlich einen Weg durch das Treibgut, das in der trüben Brühe schwamm. Ihre Stiefel waren schwer wie Blei, die durchnässten Füße eiskalt. Der Stoff ihrer Feuerwehruniform war bis zur Hüfte vollgesogen, doch immerhin schützte er sie vor Schnitten und Kratzern.
Sie hatte längst aufgehört, die Dinge genauer zu betrachten, die sie mit ihren Oberschenkeln von sich wegschob. Genauso wie sie auch aufgehört hatte, über den Albtraum nachzudenken, in dem sie sich gerade befand.
Cait funktionierte einfach. Kämpfte sich seit mehreren Stunden durch das vollkommen zerstörte Los Angeles auf der Suche nach Überlebenden.
Weite Teile der Stadt waren immer noch nicht zugänglich. Nur in wenigen Gebieten hatte sich der Pazifik so weit zurückgezogen, dass die Rettungskräfte vordringen konn-
ten.
Gespenstische Stille lag über dem überschwemmten Wohngebiet, das Caithlyn mit ihrem Team zugeteilt worden war. Zwei ihrer Kollegen führten ein Schlauchboot neben sich her, dessen Motor aufgrund der herumschwimmenden Trümmerteile nicht benutzt werden konnte. Obwohl es früh am Nachmittag war, zeigte sich der Himmel in einem seltsamen Dämmerlicht. Ein grauer Dunst verschleierte das Licht der Sonne. Was auf den ersten Blick wie eine dichte Wolkenwand anmutete, war in Wirklichkeit Vulkanasche, die sich den weiten Weg vom Yellowstone-Park bis hierher gebahnt hatte. Als vor zwei Tagen die Meldung des Vulkanausbruchs kam, waren alle Augen auf Montana gerichtet. Niemand hatte geahnt, was noch bevorstand.
Der Planet spielte verrückt.
Die Eruption des Yellowstone war nur der Startschuss für eine ganze Reihe von unvorstellbaren Naturkatastrophen gewesen. Mehrere Erdbeben erschütterten den gesamten Kontinent. Ein gewaltiges Seebeben im Pazifik rief einen Tsunami hervor, der die amerikanische Westküste überrollte. Vor knapp einer Stunde meldeten die Nachrichtendienste, dass sich ein Hurrikan der Kategorie vier auf die Ostküste zu bewegte.
Und das waren nur die Ereignisse in den USA …
»Cait? Alles klar bei dir?«
Caithlyn zog ihren blonden Zopf fester und setzte ein Lächeln auf, bevor sie sich zu ihrem Kollegen Mike umwandte. »Klar.«
Er musterte sie eingehend. »Du solltest vielleicht mal eine Pause einlegen.«
»Nein«, antwortete sie bestimmt.
Sie sah kurz zu den anderen beiden Mitgliedern ihres Teams, dann wieder zu Mike. Alle waren aschfahl im Gesicht. Übermüdet, erschöpft und fassungslos. Trotzdem standen sie aufrecht in der dreckigen Brühe, den Blick wachsam auf die Umgebung gerichtet. Keiner von ihnen würde jetzt nach einer Pause verlangen.
Dabei war wohl jedem ihrer Kollegen klar, dass die Überlebenschancen in diesem Gebiet verschwindend gering waren. Die Siedlung hatte vorwiegend aus schlichten Einfamilienhäusern bestanden, die von der Flutwelle einfach fortgespült worden waren. Die meisten Bewohner hatten vermutlich gebannt vor dem Fernseher gesessen und sich die erschreckenden Bilder aus dem Rest der Welt angesehen, als der Tsunami ohne jegliche Vorwarnung über die Stadt hereingebrochen war.
Caithlyn war seit fünf Jahren bei der Berufsfeuerwehr von Los Angeles und seit einem Jahr in der Fire Station 76 stationiert, nahe den Hollywood Hills. Ihre Schicht hatte ihr das Leben gerettet, denn in ihrer eigenen Wohnsiedlung sah es sicher ähnlich aus wie hier. Ein Kloß bildete sich in ihrem Hals, als sie an ihre Nachbarn dachte.
Sie blinzelte die Trauer hartnäckig weg und straffte ihre Schultern. Mike nickte ihr zu und watete an ihr vorbei. Die Gruppe setzte sich wieder in Bewegung.
Caithlyn betrachtete nachdenklich Mikes Gestalt vor sich. Seine Frau war bei der Arbeit gewesen, als die Flut über sie hereingebrochen war. Ihre Firma befand sich in einem der am schwersten betroffenen Gebiete, das für die Rettungsteams im Augenblick noch unerreichbar war. Erste Luftaufnahmen hatten gezeigt, dass das Gebäude zwar noch intakt war, aber immer noch bis zum zweiten Obergeschoss unter Wasser stand. Niemand konnte sagen, wie es in seinem Inneren aussah, geschweige denn, ob sich die Leute rechtzeitig in die höheren Etagen hatten retten können. Die Luftrettungen mittels Hubschraubern waren im vollen Gange, doch aufgrund des ungeheuren Ausmaßes der Zerstörung musste nach einem strengen Plan vorgegangen werden. Straße für Straße, Gebiet für Gebiet. Das dauerte. Und Mike konnte nur hoffen, dass seine Frau zu den Überlebenden gehörte.
Doch anstatt sich in seiner Sorge zu verlieren, kämpfte er sich verbissen mit Caits Team durch das Katastrophengebiet. Er würde vermutlich durchdrehen, könnte er nicht wenigstens irgendwem helfen.
Eine Bewegung zu ihrer Rechten lenkte Caithlyns Aufmerksamkeit in diese Richtung. Dort steckte ein verbeultes Auto in einem Trümmerhaufen, der wohl einmal ein Haus gewesen war. Zwischen den Brettern und Balken lugte ein menschlicher Arm hervor. Und – er bewegte sich!
Caithlyn verengte die Augen und sah genauer hin. Ihre Aufregung legte sich, kaum dass sie aufgekommen war. Das Gesicht des Opfers befand sich vollständig unter Wasser. Die Bewegung des Arms rührte nur von der leichten Wellenbewegung des Wassers her. Hastig wandte Caithlyn sich von dem Anblick des Toten ab.
Im Laufe der Jahre hatte sie einige Leichen gesehen. Das brachte ihr Beruf unweigerlich mit sich. Normalerweise konnte sie auch einigermaßen gut damit umgehen. Doch das hier? Es waren so viele.
So unvorstellbar viele.
***
Samstag
Logan fuhr mit der Hand über sein dunkles Haar und starrte die schlichte Betonwand vor sich an. Nur das leise Surren der Umluftventilatoren erfüllte die bedrückende Stille im Flur des Bunkers. Auf der Metalltür neben ihm prangte das Emblem der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Raum dahinter war völlig abgeschottet. Nichts ließ erahnen, dass sich darin gerade die wichtigsten Männer der USA befanden und über das weitere Vorgehen beratschlagten.
Dem Secret Service war der Zutritt nicht erlaubt. Deshalb stand Logan nun mit seinen Kollegen vom Personenschutz im Flur herum und wartete. Diese Tatenlosigkeit war nicht gut, denn dabei bot sich unweigerlich Zeit zum Nachdenken und man versuchte, das alles zu begreifen.
Es musste ungefähr drei Monate her sein, dass der Leiter des Katastrophenschutzes plötzlich täglicher Gast im Weißen Haus geworden war. Unzählige Konferenzen fanden statt. Der Präsident wurde mitsamt seiner Familie zu einem geheimen Ort gebracht. Fernab der Öffentlichkeit trafen auch die anderen Regierungen sämtlicher Staaten der Welt ihre letzten Vorbereitungen.
Natürlich bekam Logan all diese Vorgänge mit. Und natürlich schwante ihm, dass etwas Außerordentliches bevorstand. Die Wahrheit wurde allerdings bis zuletzt sogar den Mitarbeitern des Secret Service verschwiegen. Ein paar Tage vor den Aktivitäten im Yellowstone-Park wurden nur wenige ausgewählte Personenschützer informiert und in einen speziellen Evakuierungsplan eingewiesen.
Dass Logan zu diesen Auserwählten gehörte, hatte ihn selbst verwundert. Er hatte seine Ausbildung zwar mit Bravour abgeschlossen, war jedoch einer der jüngsten Agenten im Haus. Da er nur ein Jahr aktiven Dienst vorweisen konnte, hatte er wenig Berufserfahrung im Vergleich zu den alten Hasen seines Teams. Aber inzwischen ahnte er, dass genau dieser Umstand der Grund für seine Beförderung gewesen war, denn sein Job hatte sich in den letzten Tagen vollkommen verändert.
Früher hatte seine Hauptaufgabe darin bestanden, Vizepräsident Straton gemeinsam mit sechs anderen Agenten vor einem Attentat zu bewahren. Nun war er allein für das Wohl seines Schützlings verantwortlich – was durchaus machbar war, denn während die Welt aus den Fugen geriet, hatten selbst Terroristen andere Probleme, als ein Attentat durchzuführen. Im Grunde war Logan nur dafür zuständig gewesen, den Vizepräsidenten zu dieser geheimen Bunkeranlage in Massachusetts zu begleiten und dafür zu sorgen, dass er heil hier ankam.
Sie waren vor fünf Tagen hier angekommen, und inzwischen hatte sich Logans Aufgabengebiet erweitert. Er war zu einer Art persönlichem Assistenten von Straton geworden, denn seine vorige Assistentin hatte ihn verlassen, um ihre eigene Familie in Sicherheit zu bringen. Ihr Verhalten war kein Einzelfall. Eher im Gegenteil.
Logan vermutete inzwischen, dass dies ein weiterer Grund gewesen war, der für seine Person gesprochen hatte. Seit dem Attentat am elften September war er Vollwaise. Der Terroranschlag war ein prägendes Ereignis für ihn gewesen – wie für viele andere Amerikaner –, das ihn bereits als Jugendlicher den Entschluss fassen ließ, für den Heimatschutz tätig zu werden. Fleiß, Durchhaltevermögen und seine unangefochtene Loyalität gegenüber dem amerikanischen Staat hatten ihn letztlich ins Weiße Haus gebracht. Ebenjene Loyalität, die er nach wie vor für sein Land hegte.
Aber gab es dieses Land überhaupt noch?
Das Weiße Haus lag in Schutt und Asche. Ganz Amerika war zerstört und im Rest der Welt sah es genauso aus, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ein paar Inselstaaten waren gar von der Landkarte verschwunden.
Logan hatte keine Ahnung, wie es nun weitergehen sollte. Mit den Menschen, die noch übrig waren. Es gab keinen Notfallplan dieser Größenordnung.
Nur wenige Städte innerhalb der USA waren so weit intakt, dass sie kurzerhand als Flüchtlingslager umfunktioniert werden konnten. Doch auch dort waren die Lebensbedingungen katastrophal. Es gab keinen Strom, kaum Nahrung, von medizinischer Betreuung ganz zu schweigen.
Das System war innerhalb weniger Tage vollständig zusammengebrochen, ohne eine reelle Chance, dass man es in naher Zukunft wiederaufbauen könnte. Nachdem die Erde sich wieder beruhigt hatte, bahnte sich nämlich schon die nächste Katastrophe an – ein vulkanischer Winter.
Die Eruptionen rund um den Erdball hatten so viel Asche in die Luft geschleudert, dass sie wie ein Nebelschleier in der Stratosphäre hing. Das würde fatale Folgen für das Klima haben. Man ging jetzt schon davon aus, dass sich eine weltweite Erdabkühlung ereignen würde, die sich regional zu einer Eiszeit entwickeln könnte.
Soweit Logan wusste, hatte die Regierung zwar geheime Nahrungsmittelspeicher angelegt, doch zum einen war es fraglich, ob diese Vorräte überhaupt noch verwendbar waren, und zum anderen, wie lange sie reichen würden. Die Überlebenden würden also während des vulkanischen Winters verhungern, sofern sie vorher nicht schon erfroren waren.
Logan war so tief in seine düsteren Zukunftsgedanken versunken, dass er unwillkürlich zusammenschrak, als sich die Tür neben ihm aufschob. Der Leiter des Bundeskatastrophenschutzes und Vizepräsident Straton traten auf den Flur. Sie verabschiedeten sich per Handschlag voneinander. Dann wandte Straton sich nach links und Logan heftete sich schweigend an seine Fersen.
»Geben Sie dem Piloten Bescheid, dass er sich in zwei Stunden bereithalten soll«, wies Straton ihn an.
»Mit welchem Ziel, Sir?«, fragte Logan.
»Das wird er rechtzeitig erfahren.«
»Verstanden.«
Trotz der ruppigen Antwort wirkte Straton entspannt. Zumindest äußerlich. Logan hatte inzwischen gelernt, dass der schlanke Mann mit dem grau melierten Haar schwer zu durchschauen war. Es gab nur wenige Momente, in denen der Vizepräsident seine Sorge durchscheinen ließ. Die meiste Zeit strahlte er abgeklärte Besonnenheit aus, als hätte er alles im Griff.
Straton war überhaupt ein bewundernswerter Mann. Er war wortgewandt, charismatisch und über alle Maßen intelligent. Logan hatte sich oft gefragt, ob er nicht der bessere Kandidat für die Präsidentschaft gewesen wäre als der amtierende Präsident. Bis er verstanden hatte, dass Stratons Einfluss auch so weitreichender war, als der Normalbürger ahnte. Im Grunde funktionierte die gesamte Demokratie der USA anders, als der Normalbürger dachte.
Wenig später erreichten die beiden Männer einen der Büroräume der Bunkeranlage. Straton betätigte den Türöffner und gab Logan einen dezenten Wink, ihm weiter zu folgen. »Wir müssen etwas besprechen, Logan.«
Das war an sich nichts Ungewöhnliches, doch etwas in Stratons Stimme ließ Logan nervös werden. Angespannt betrat er hinter dem Vizepräsidenten das enge, aber voll ausgestattete Büro und setzte sich ihm gegenüber an den Schreibtisch. Straton lehnte sich ungezwungen zurück, doch seine grauen Augen ruhten mit Rasiermesserschärfe auf Logan.
»Wussten Sie, dass ich Sie persönlich ausgewählt habe?«, fragte der Vizepräsident plötzlich. »Für Ihren aktuellen Posten, meine ich.«
»Nein«, antwortete Logan und versuchte zu ergründen, worauf dieses Gespräch hinauslaufen sollte.
»Ich habe Sie beobachtet, Logan Moore, und ich erkenne Ihr Potenzial. Sie sind klug. Um einiges klüger, als so ziemlich jeder Ihrer kanonengeilen Kollegen.« Stratons Mundwinkel zuckte amüsiert. »Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber anders kann man es kaum beschreiben.«
Logan schmunzelte.
»Sie haben Ihre Ausbildung überdurchschnittlich gut abgeschlossen«, fuhr der Vizepräsident fort. »Zwei Fremdsprachen, herausragender Schütze, Kenntnisse in vier verschiedenen Kampfsportarten. Eine Anfrage der CIA, die Sie jedoch abgelehnt haben. Ja, ich kenne Ihre Akte. Was jedoch nicht darin steht, Sie aber in meinen Augen zu einem der vielversprechendsten Kandidaten macht, ist Ihre Treue. Ihre außerordentliche Überzeugung, dieses Land beschützen zu wollen. Damit haben Sie sich vor allem in den letzten Tagen meinen Respekt und mein uneingeschränktes Vertrauen verdient.«
Diese überschwängliche Lobeshymne weckte automatisch Misstrauen in Logan. Solche Reden waren untypisch für Straton.
Logan hob eine Braue. »Einen Kandidaten wofür?«
Straton lachte leise, wurde aber sofort wieder ernst. »Ich will es Ihnen erklären«, sagte er und sah Logan wieder mit einem durchdringenden Blick an. »Sie wissen vermutlich längst, dass die Welt nie wieder so sein wird wie zuvor.«
»Ja«, bestätigte Logan knapp. Er legte den Kopf schräg. »Die eigentliche Frage lautet, wie die neue Welt sein wird.«
Der Vizepräsident beugte sich vor und stützte sich mit den Ellbogen auf den Schreibtisch. Er musterte sein Gegenüber jetzt mit einem zufriedenen Lächeln.
»Und genau darüber will ich mit Ihnen sprechen.«
Kapitel 1
Zwei Jahre später
Schnee.
Überall nur Schnee, so weit das Auge reichte. Er glitzerte im Schein der Nachmittagssonne, schimmerte wie ein weißer Seidenschal unter dem Horizont und lag wie Zuckerwatte auf den buschigen Fichtenästen.
Mila hatte für den hübschen Anblick nichts übrig, während sie angestrengt durch eine Schneewehe stapfte und den alten Holzschlitten hinter sich herzog. Bei jedem Schritt sank sie bis zu den Knien in das glitzernde Weiß ein und musste sich wieder emporkämpfen, nur um dann abermals zu versinken.
Dieser Abschnitt ihres Weges war der mühseligste. Sobald sie die Senke überwunden hatte, würde es leichter vorangehen.
Der Schlitten wurde mit einem Mal merklich schwerer. Genervt drehte Mila sich um und scheuchte den blinden Passagier von Bord.
»Ricco! Immer dasselbe mit dir! Du bist nicht so leicht, wie du glaubst.«
Der Waschbär keckerte beleidigt. Er sprang von dem Holzschlitten und verschwand sofort bis zur Nasenspitze im Schnee. Anklagend reckte er sein pelziges Gesicht zu Mila, die seufzte.
»Ich weiß. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir sind fast oben.«
Mila zog mit einem Ruck an dem Schlitten, den der Waschbär mit seinem Gewicht tief in den Schnee gedrückt hatte. Immerhin wog er sicher doppelt so viel wie die eigentliche Ladung.
Die heutige Ausbeute war spärlich gewesen. In der alten Obstkiste befanden sich nur drei kleine Dosen eingelegtes Gemüse, eine Packung Zwieback und ein halbes Kilo Mehl. Hootch, der inoffizielle Bürgermeister von Redwood, hatte Mila aber versichert, dass er bei der nächsten Lieferung eine großzügige Ration für sie zur Seite legen würde. Sie zweifelte nicht an diesem Versprechen, denn der gutmütige Mann mit dem buschigen Bart hatte sie noch nie enttäuscht.
Auf der Anhöhe angekommen, gönnte Mila sich eine kleine Verschnaufpause. Sie schob das Jagdgewehr auf ihrem Rücken zurecht und blickte hinunter in das Tal. Ricco kletterte wieder auf den Schlitten. Während ihrer Pause ließ sie ihn gewähren, damit er seine ausgekühlten Pfoten ein wenig aufwärmen konnte.
Zwischen vereinzelten Bäumen konnte man die eingeschneiten kleinen Häuser von Redwood Meadows erkennen. Es war eine idyllische Kulisse, die man damals wohl auf eine Postkarte gedruckt hätte.
Damals.
Damals schien eine Ewigkeit her zu sein. Damals, als Milas größte Sorge darin bestand, die passenden Schuhe zu einem neuen Outfit zu finden. Oder den neuesten Kinofilm ja nicht zu verpassen. Oder wie sie an eine Einladung zur angesagten College-Party der Stadt herankommen sollte.
Wirklich bescheuert, mit welch lächerlichen Problemen sie sich früher herumgeschlagen hatte. Wie selbstverständlich ihr ein behütetes und komfortables Leben vorgekommen war. Wie oft sie wegen irgendwelcher dummen Lappalien mit ihren Eltern und ihrem Bruder gestritten hatte.
Der Gedanke an ihre Familie versetzte Mila einen Stich in die Magengrube. Sie zog ruppig an dem Schlittenseil und stapfte weiter, als könnte sie so vor den schmerzhaften Erinnerungen fliehen.
Die Schuldgefühle lasteten schwer auf ihr. Sie allein trug die Verantwortung dafür, dass sie auf dem Highway in den Stau geraten waren. Hätte sie den Plan ihres Vaters nicht durchkreuzt, wären sie längst bei Opa Joe gewesen, als das Erdbeben die Straße vor der kanadischen Grenze im wahrsten Sinne zerbersten ließ.
Und ihre Familie wäre jetzt noch am Leben …
Mila erinnerte sich nur lückenhaft an die Tage nach dem verheerenden Erdbeben. Es war, als hätte sie der Schock in eine Art Trance versetzt. Sie war in einem provisorischen Camp aus ihrer Ohnmacht erwacht. Dort hatte man sie medizinisch versorgt und irgendwann nach Calgary gebracht, wo nach den gröbsten Aufräumarbeiten ein Evakuierungslager eingerichtet worden war. Wie durch ein Wunder hatte ein paar Tage später plötzlich Opa Joe vor ihrer Pritsche gestanden.
»Da bist du ja«, hatte er geflüstert.
Sie konnte seine Worte hören, als wäre es erst gestern gewesen. Seine Stimme hatte sie aus dem dumpfen Schleier des Traumas geweckt und in die Realität zurückgeholt. Er hatte sie bei sich aufgenommen, mit ihr gemeinsam getrauert und gleichzeitig neuen Lebenswillen in ihr geweckt.
Ohne Opa Joe hätte Mila längst aufgegeben.
Das letzte Wegstück führte sie durch einen dichteren Wald. Einzelne Sonnenstrahlen drängten sich durch das verschneite Geäst und warfen goldene Muster auf den Boden. Es kam Mila vor wie ein Hoffnungsschimmer.
Die grauen Schlieren der Vulkanasche hatten sich in den letzten Monaten vom Himmel verzogen. Die Sonne gewann immer mehr Kraft und die Menschen sahen dem Ende des vulkanischen Winters entgegen. Doris, die rechte Hand des Bürgermeisters, meinte sogar, es könne zu einem vagen Frühling kommen, eine baldige Schneeschmelze halte sie für wahrscheinlich.
Mila betrachtete im Vorbeigehen die Bäume und versuchte sich vorzustellen, wie sie den Schnee abschüttelten und junge Triebe gen Himmel streckten. Sie hoffte inständig, dass die Natur sich von den Ascheregen erholt und dass die Erde sich unter der dichten Schneedecke regeneriert hatte.
Früher hatte sich Mila nie für Flora und Fauna interessiert. Bäume waren einfach da gewesen, wie eine Art Dekoration. Inzwischen war das anders. Nicht zuletzt, weil ein ausgeprägtes Wissen über die Natur heutzutage unabdingbar geworden war, um zu überleben. Opa Joe hatte Mila beigebracht, den Wald und all seine Bewohner als ihre Verbündeten zu betrachten. Es ging darum, mit der Natur zu leben, und nicht nur in ihr.
Manchmal fragte sich Mila, ob die Erde vielleicht nur deshalb verrücktgespielt hatte, weil der Mensch sich derart rücksichtslos über das gesamte Ökosystem gestellt hatte. Vielleicht sollte der allgemeine Kollaps ihn daran erinnern, dass er nicht so mächtig war, wie er gern glaubte.
Mit diesen Gedanken war Mila nicht allein. Niemand hatte bisher erklären können, was wirklich der Auslöser all der Katastrophen gewesen war. Die Theorien reichten von Erdachsenverschiebung über Polumkehr bis hin zum Jüngsten Gericht. Vor allem letztere These hatte eine ganze Welle von Selbstmorden ausgelöst. Da sich die Welt allerdings immer noch weiterdrehte, hatten sich die religiösen Fanatiker inzwischen wieder beruhigt.
Das alles wusste Mila nur aus Erzählungen. Das Telekommunikationssystem war nämlich noch nicht wiederaufgebaut worden, und auch die allgemeine Stromversorgung nicht. Es gab ein paar wenige Radiosender, die einzelne Informationen zum Weltgeschehen verbreiteten, doch die gehörten allesamt zur Union.
Union. So nannte sich die Obrigkeit inzwischen. Ein komplett neuartiges System war damit entstanden. Etwas, das noch nie da gewesen war.
Eine Weltregierung.
Anfänglich klangen die Ziele der Union noch vielversprechend. Die Völker der Erde sollten vereint werden, damit man gemeinsam eine neue Welt aufbauen könne. Die Umsetzung war jedoch fragwürdig. Zumindest, was den Kontinent Amerika betraf. Wie es andernorts funktionierte, wusste niemand.
Die erste Maßnahme der Union bestand darin, jegliche Landesgrenzen aufzuheben. Übergeordnete Militäreinheiten wurden geschaffen und die Polizei aufgelöst. Dann gab es neue internationale Gesetze und eine Weltwährung wurde eingeführt. Sogar ein einheitliches Schulsystem hatte man inzwischen eingerichtet.
Gleichzeitig wurden sogenannte Safetowns angelegt. In diesen Städten, die völlig abgeschirmt von der Umgebung waren, wurde den Bewohnern unter der strengen Führung der Union ein bequemes Leben ermöglicht. Es handelte sich dabei um autarke Systeme mit eigener Elektrizität und Wasserversorgung, und angeblich sogar mit einem internen Fernsehsender.
Dem Normalbürger war der Zutritt zu einer Safetown strikt untersagt. Darin lebten nur Menschen, die einen speziellen Eignungstest bestanden hatten, den inzwischen nur noch Leute bis zum Alter von einundzwanzig Jahren überhaupt absolvieren durften.
Der Rest der Bevölkerung war weitgehend auf sich selbst gestellt. Die Union betrieb zwar einige Versorgungszentren außerhalb der Safetowns, aber das wirkte eher wie der klägliche Versuch, den Menschen ein Interesse an ihrem Wohlergehen zu suggerieren. Die Nahrungsmittel, die die Union den noch existierenden Siedlungen dort zur Verfügung stellte, waren so knapp bemessen, dass sie niemanden satt machten. Vor ein paar Monaten waren die Rationen sogar noch gekürzt worden, weil die Lagerbestände angeblich zu schnell schrumpften. Dabei hatte die Union im letzten Jahr gewaltige Gewächshäuser aus dem Boden gestampft, die inzwischen sicher reichliche Erträge lieferten.
Das Versprechen, die Energie- und Wasserversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen, wurde nicht eingehalten. Obwohl die Ressourcen durchaus vorhanden waren. Sie wurden jedoch ausschließlich für die Erweiterung der Safetowns genutzt.
Mila käme mit ihren zwanzig Jahren für den Eignungstest durchaus infrage. Aber etwas in ihr sträubte sich dagegen, Teil des Unionssystems zu werden. Sie hatte grundsätzlich kein großes Vertrauen in diese neuartige Regierungsform, und das Leben in einer Safetown kam ihr viel mehr wie die Mitgliedschaft in einer ausgeklügelten Sekte vor. Doris pflegte in diesem Zusammenhang gern den Begriff »Gehirnwäsche« zu verwenden – wobei Doris dieses Wort grundsätzlich gern benutzte.
Die verschrobene Frau war Mila sehr ans Herz gewachsen. Sie mochte die unverfälschte Art, mit der die Mittfünfzigerin ihren Mitmenschen gegenübertrat. Doris musste man einfach vertrauen, auch wenn sie oftmals wie eine verrückte Wissenschaftlerin mit einer Tendenz zur Verschwörungstheoretikerin anmutete. Der alte Hootch mit seinem grauen Bart bildete mit seiner diplomatischen Besonnenheit einen guten Gegenpart zu ihr. Die Bewohner von Redwood Meadows hatten die beiden außergewöhnlichen Menschen stillschweigend zu ihren heimlichen Oberhäuptern gemacht. Doris und Hootch war es zu verdanken, dass die Gemeinde auch heute noch als Einheit funktionierte und ein echtes Miteinander lebte.
Mila war so tief in Gedanken versunken, dass sie das zusätzliche Gewicht des Schlittens gar nicht bemerkte. Dabei hatte Ricco sich die ganze Zeit still und heimlich von ihr ziehen lassen. Erst als der Weg in eine Senke führte und der Schlitten sie überholte, sah Mila den Waschbären zufrieden darauf herumlümmeln.
»Du Faulpelz!«, schimpfte sie ihn, musste aber gleichzeitig kichern, weil er ertappt die Augen aufriss. »Na warte! Du willst fahren? Dann fahr!«
Sie lachte schadenfroh und ließ das Seil los. Sofort nahm der Schlitten Geschwindigkeit auf und sauste schnurstracks aus dem Waldstück hinaus. Dahinter breitete sich eine Wiese vor Grandpas Haus aus, wodurch dem Waschbären keine Gefahr durch eine ungewollte Kollision drohte. Ricco sah das allerdings anders und gab erschrockene Quieklaute von sich, während er die letzten Meter hinunterglitt. Fehlte gerade noch, dass er sich die Augen zuhielt.
Wenige Meter vor der Veranda des gemütlichen zweistöckigen Holzhauses kam der Schlitten schließlich unversehrt zum Stehen, und der Waschbär hüpfte mit anklagenden Lauten von dem Gefährt. Mila folgte ihm grinsend.
Das Anwesen ihres Großvaters lag an einem großen See, den man wegen der dichten Schneedecke kaum vom Festland unterscheiden konnte. Aus dem Kamin des Blockhauses stieg eine dünne Rauchsäule empor und versprach gemütliche Wärme im Inneren.
Bevor Mila zur Veranda schritt, machte sie noch einen kurzen Abstecher zum See und betrat seine zugefrorene Oberfläche. Ein kleines Stück vom Ufer entfernt ragte einsam und verlassen eine Angel aus der schneebedeckten Ebene. Mila hob den Stock auf, der danebenlag, und durchstach damit die hauchdünne gefrorene Schicht, die sich über einem kreisrunden Loch in der Eisplatte gebildet hatte. Dann zupfte sie an der Angelschnur und prüfte, ob ein Fisch angebissen hatte. Leider nicht, aber sie würde später noch einmal nachsehen.
Mila ging zurück zum Haus und hob die Kiste mit den Nahrungsmitteln von ihrem Schlitten. Sie betrachtete kopfschüttelnd den Inhalt. Wäre Redwood ausschließlich auf die Rationen der Union angewiesen, wären sie vermutlich längst verhungert. Welch ein Glück sie doch hatten, sich zusätzlich selbst versorgen zu können. Jeder Dorfbewohner trug seinen Teil dazu bei. Mila und Joes Job war die Fischerei. Andere betrieben selbst gezimmerte Gewächshäuser oder gingen auf die Jagd.
Ja, den Einwohnern von Redwood Meadows ging es wirklich gut. Zu gut, um es an die große Glocke zu hängen. Auf Doris’ Rat hin erwähnten sie ihre Selbstversorgung keinem Fremden gegenüber. Zum einen, weil sonst vermutlich die Unterstützung der Union ganz ausgefallen wäre, und zum anderen, um sich vor Plünderern zu schützen. Durch die nahe Versorgungsstation der Union in Calgary war diese Gefahr zwar relativ gering, doch man durfte sie nicht unterschätzen. Immer wieder hörte man von anarchistischen Clans, die durch die Lande zogen und alles raubten, was sie brauchen konnten. Die Union verhinderte dies mit härtester Waffengewalt, aber nur in ihrem direkten Umkreis. Was sich fernab der offiziellen Einrichtungen abspielte, schien ihr egal zu sein. Darum bestand Milas Großvater auch darauf, dass sie stets eine Waffe bei sich trug, sobald sie das Haus verließ.
Wohltuende Wärme schlug Mila entgegen, als sie mit ihren vollgepackten Armen umständlich die Haustür aufstieß. Sofort flitzte Ricco an ihr vorbei und hinterließ mit seinen nassen Pfoten kleine Pfützen auf dem Dielenboden.
Die Ausstattung des Hauses hatte man früher wohl als rustikal bezeichnet. Jetzt ermöglichte sie einen unwahrscheinlichen Luxus. Nicht nur wegen des Holzofens im Wohnzimmer. Es gab auch noch einen Küchenherd, der mit Holz zu befeuern war und gleichzeitig als eine Art Warmwasserboiler fungierte. Außerdem war der alte Brunnen vor dem Haus intakt, an dem man mit einer manuellen Pumpe Wasser fördern konnte. Selbst das uralte Plumpsklo hinter dem Schuppen hatte sich inzwischen bewährt. Wieder etwas, worüber Mila sich vorher nie Gedanken gemacht hatte. Denn auch eine Toilette funktionierte ohne Strom einfach nicht.
Mila stampfte sich vor der Schwelle den Schnee von den Füßen, bevor sie eintrat. Sie stellte die Kiste ab und zupfte sich die Handschuhe von den Fingern.
»Hat die Union schon wieder gekürzt?«, hörte sie Joe fragen.
Ihr Großvater saß in eine Decke gehüllt auf dem Ohrensessel vor dem offenen Kamin und betrachtete stirnrunzelnd die halb leere Kiste.
»Offiziell nicht«, antwortete Mila. Sie tauschte ihre schweren Stiefel gegen Filzpantoffeln und schälte sich aus ihrem Parka.
»Und inoffiziell?«
Sie deutete vielsagend auf die Kiste. Joe seufzte schwer. Sein Seufzen ging in ein rasselndes Husten über. Er bemerkte Milas besorgten Blick und winkte ab.
»Nur eine kleine Erkältung«, sagte er heiser und räusperte sich mehrmals. »Das vergeht bald wieder.«
»Das hast du letzte Woche schon gesagt.«
»Eine Erkältung dauert nun mal ein paar Tage.«
Mila verzog missmutig das Gesicht. »Ich weiß nicht, Grandpa. Dein Husten klingt nicht gerade nach einer harmlosen Erkältung. Hast du noch Fieber?«
»Nein.«
Sie kniff die Augen zusammen und ging zu ihm hinüber, um seine Stirn zu fühlen. Joe ließ es erschöpft geschehen.
»Du glühst ja förmlich!«, rief Mila.
»Kein Wunder«, brummte er und schloss die Augen. »Deine Finger sind eiskalt, Schätzchen. Dagegen glühen ja sogar die Fensterscheiben.«
Allein dass er ihre kühlende Hand offenbar als angenehm empfand, strafte ihn Lügen. Mila ließ sie eine Weile auf seiner verschwitzten Stirn liegen und musterte ihn nachdenklich. Die »harmlose« Erkältung hatte Joe erheblich zugesetzt. Er schien in wenigen Tagen um Jahre gealtert zu sein. Seine Hautfarbe war trotz des Fiebers fast so weiß wie sein Haar und die dezenten Fältchen in seinem Gesicht waren zu ausgeprägten Furchen geworden. Joe hatte abgenommen und wirkte insgesamt kraftlos und ausgemergelt. Sein Atem ging schwer und jeder seiner Atemzüge war von einem kaum hörbaren Rasseln begleitet. Auch ohne Medizinstudium wusste Mila, dass es sich um eine Lungenentzündung handeln musste. Für einen Mann von über siebzig Jahren war das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
»Du brauchst Medizin«, sagte sie leise und tauschte ihre Hand gegen die andere. »Penicillin, oder wie das Zeug heißt.«
»Die Union würde mir nichts geben, das weißt du genau. Ich bin zu alt.«
»Dann sage ich ihnen eben, dass ich die Medikamente für mich brauche.«
Joe lächelte sanft und blickte zu ihr auf. »Mila, du weißt doch, wie das läuft. Zum einen erkennen die sofort, dass du kerngesund bist, und zum anderen würden sie dir die Medikamente vor Ort verabreichen.«
»Ich könnte die Tabletten gleich wieder ausspucken«, überlegte sie. »Die wirken dann trotzdem noch, oder?«
»Und wenn sie dir eine Spritze verpassen?«
Darauf wusste sie keine Antwort. Schweigend nahm sie die Hände von seinem Gesicht und erwiderte sein Lächeln. »Dann muss der Zwiebelsud wohl ausreichen.«
Sie wandte sich von ihrem Großvater ab, um die Tränen zu verbergen, die in ihren Augen brannten. Ihn so zu sehen war unerträglich. Sie hatte große Angst um ihn und musste hilflos mit ansehen, wie seine Erkrankung immer schlimmer wurde. Inzwischen wusste sie viel über Naturheilkunde, aber Kräuter reichten bei seinem Zustand einfach nicht mehr aus.
Nur die Union konnte ihm jetzt noch helfen.
Wut und Unverständnis schnürten ihr beinahe die Kehle zu, während sie die Kiste mit den Lebensmitteln in die Küche trug. Die Union machte kein Geheimnis daraus, dass sie über einen großen Vorrat an Medikamenten verfügte. Sie hatte allerdings beschlossen, dass diese Medikamente nur unter strenger Kontrolle und maximal bis zu einem Alter von siebzig Jahren ausgegeben wurden. Was darüberlag, wurde als lebensverlängernde Maßnahme bezeichnet, und dafür gab es keine Ressourcen.
Das hatte die Union entschieden. Einfach so.
Und niemand konnte etwas dagegen tun.
Kapitel 2
Zwei Tage später wachte Joe nicht mehr auf.
Am Vorabend war Hootch bei ihnen gewesen und hatte Mila noch zur Seite genommen, bevor er sich verabschiedete. Es sei unvermeidlich, hatte er gesagt.
Nun saß Mila auf dem Boden neben Joes Bett und streichelte seine Hand. Sie war eiskalt. Es war eine andere Art von Kälte als jene, die man sich draußen im Schnee holte. Eine endgültige Kälte.
Mila wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, seit sie versucht hatte, ihren Großvater heute Morgen wach zu rütteln. Es konnten Stunden sein, vielleicht auch nur Minuten. Nachdem sie verstanden hatte, dass Joe die Augen nicht mehr aufschlagen würde, hatte sie seine Bettdecke zurechtgezupft, sich hingesetzt und nicht mehr von der Stelle gerührt.
Wie versteinert kauerte sie da, gefangen von Trauer und Schmerz. Sie bewegte sich nicht einmal, als sie gedämpfte Stimmen aus dem Erdgeschoss vernahm. Irgendjemand rief ihren Namen. Mila hatte nicht die Kraft zu antworten. Aber Ricco flitzte aus dem Zimmer in den Flur und begrüßte die Besucher mit einem aufgeregten Keckern. Der Waschbär schien nicht zu begreifen, was mit seiner menschlichen Familie heute los war, und klang fast so, als würde er um Hilfe rufen.
Schritte knarzten über die Holztreppe herauf. Kurz darauf betrat Doris das Schlafzimmer. Mila sah mit dumpfem Blick zu ihr auf.
Doris erfasste die Situation sofort. Sie nahm ihr Basecap ab und steckte es in die Brusttasche ihrer verschlissenen Latzhose. Seufzend strich sie ihr ergrautes Haar zurück.
»Es tut mir so leid«, flüsterte sie und kniete neben Mila nieder, um sie in den Arm zu nehmen.
Erst da brachen die Tränen aus Mila heraus. Als hätte die sanfte Umarmung plötzlich sämtliche Schleusen geöffnet. Sie schluchzte ungehemmt an Doris’ Schulter und ließ sich von ihr wiegen, bis der Schmerz einigermaßen verklungen war.
Doris wartete geduldig ab, bis Mila sich aus der Umarmung löste. Sie streichelte ihr übers Haar, auch ihre eigenen Wangen waren mit Tränen bedeckt.
»Komm«, sagte sie und zog Mila behutsam hoch. »Lass uns hinuntergehen.«
Mila hakte sich dankbar bei Doris unter und ließ sich von ihr ins Wohnzimmer führen. Dort drückte Doris sie auf die Couch und breitete eine Decke über sie aus. Dann entfachte sie ein Feuer im Kamin und verschwand in der Küche.
Mit trübem Blick sah Mila dabei zu, wie die Holzscheite sich gegen die züngelnden Flammen wehrten. Sie krachten und zischten, als hätten sie Schmerzen.
Übelkeit stieg in Mila auf. Sie musste sich von dem Feuer abwenden, weil es sie daran erinnerte, was nun unweigerlich bevorstand. Die Erde war gefroren, man konnte Joe nicht darin bestatten.
Ricco sprang neben Mila auf die Couch. Er hielt ein Stück Brot in seinen Pfoten und knabberte daran. Doris stellte eine dampfende Tasse Tee auf den Couchtisch und reichte Mila ebenfalls eine Scheibe Brot. Mila nahm es entgegen und starrte es an, ohne davon abzubeißen.
Doris setzte sich in den Ohrensessel und schaute schweigend in das knisternde Feuer.
»Danke«, murmelte Mila belegt.
»Gern geschehen«, antwortete Doris.
Mila brach ein Stück von ihrem Brot ab und hielt es dem Waschbären hin. Erst dann biss sie selbst hinein, doch ihr kam es vor, als würde sie auf einer modrigen Baumrinde herumkauen. Sie würgte den Bissen hinunter und gab Ricco auch noch den Rest davon.
»Du könntest mit zu mir kommen«, schlug Doris unvermittelt vor. »Und Ricco auch.«
Mila hob verständnislos den Kopf.
»Natürlich nur, wenn du willst«, sprach Doris weiter. »Überleg es dir einfach mal. Meine Tür steht dir immer offen.«
»Okay.«
Mit zitternden Händen zog Mila die Decke enger um sich, als auf einmal schwere Schritte auf der Veranda draußen zu hören waren. Wenig später kam Hootch herein. Er hatte einige Dorfbewohner mitgebracht, deren betretene Mienen genügten, um Milas Tränen erneut fließen zu lassen. Ricco kuschelte sich eng an ihre Seite, während sie die Beileidsbekundungen über sich ergehen ließ. Die Worte kamen nicht wirklich bei ihr an, weshalb sie nur stumm nickte und die Geschehnisse um sie herum wie aus weiter Ferne verfolgte.
Hootch kümmerte sich um alles Notwendige. Er und ein paar andere Dorfbewohner errichteten eine Feuerstätte inmitten des zugefrorenen Sees. Zwei Frauen wuschen den Leichnam und kleideten ihn an. Verschiedenste Menschen gingen im Haus ein und aus.
Mila blieb unterdessen reglos sitzen. Sie wagte nicht aufzublicken, als man ihren Großvater die Treppe hinuntertrug. Erst als Hootch leise verkündete, es sei nun an der Zeit, stand sie auf und straffte ihre Gestalt.
Doris begleitete sie nach draußen. Ein strahlend blauer Himmel leuchtete über dem verschneiten See, auf dem sich zahlreiche Leute versammelt hatten. Ganz Redwood schien gekommen zu sein, um Joe die letzte Ehre zu erweisen.
Ergriffen schritt Mila neben Doris auf die Trauergemeinde zu. Die Menschen machten ihr Platz und gaben den Blick auf den aufgebahrten Leichnam frei.
Joe so zu sehen war kaum zu ertragen. Trotzdem zwang Mila sich, in der ersten Reihe stehen zu bleiben und den herzergreifenden Worten zu lauschen, mit denen Hootch sich im Namen der Gemeinde von Redwood Meadows von Joe verabschiedete. Er erzählte eine kleine Anekdote aus ihrer gemeinsamen Zeit im Fischereiverband und betonte, welch großartiger Mann der gute alte Joe gewesen sei. Und er schloss seine Rede mit den wundervollen Worten: »Du hast diesen See geliebt, alter Freund, darum sollst du genau hier zur Ruhe kommen.«
Als die beiden brennenden Fackeln auf Joes Lagerstätte niedergesenkt wurden, wandte Mila sich ab. Sie wollte nicht dabei zusehen, wie der Körper ihres Großvaters von den Flammen erfasst wurde. Wie das Feuer ihr auch noch das letzte Familienmitglied nahm.
Jetzt war nur noch sie übrig.
***
Doris blieb drei Tage an ihrer Seite, bis Mila sie davon überzeugen konnte, dass sie nun allein zurechtkam. Dabei brauchte sie ein großes Maß an Schauspielkunst, denn Doris schien genau zu wissen, wie es im Inneren der jungen Frau aus-
sah.
Die Wahrheit war nämlich, dass Mila sich die Frage stellte, ob sie überhaupt allein zurechtkommen wollte. Sie fragte sich, warum zum Teufel ausgerechnet sie immer noch lebte und der Rest ihrer Familie tot war. Jeder Einzelne von ihnen hatte das Leben mehr verdient als sie. Grandpa mit seinem großen Herzen. Dad, der stets alles gegeben hatte, um seinen Kindern ein wundervolles Zuhause zu bieten. Mum, die beste Mutter der Welt, die mit ihrem Lachen die Sonne zum Strahlen brachte. Und Sam. Der fleißige, kluge Sam, der Medizin studieren wollte. Nicht um ein gut verdienender Herzchirurg zu werden, nein – er hatte davon geträumt, Arzt zu werden, um armen Menschen in Entwicklungsländern zu helfen. Welcher Teenager hegte schon solche Träume?
Mila hingegen hatte nur von einem Tag auf den anderen gelebt. Sie hatte ihren Alltag mit Oberflächlichkeiten gefüllt und ausschließlich an sich selbst gedacht.
Inzwischen wusste sie das, doch was nutzte es ihr? Es war zu spät. Die Erkenntnis, was wirklich im Leben zählte, war ihr zu spät gekommen.
Und Mila hasste sich dafür.
Sie fühlte sich schuldig, unwürdig und schwach.
Ihre Schultern bebten, als sie nun vor dem rußschwarzen Fleck im Schnee inmitten des zugefrorenen Sees auf die Knie sank. Die Klinge des großen Jagdmessers reflektierte blitzend das Sonnenlicht. Mila betrachtete das Lichtspiel, während sie den Griff leicht hin und her drehte.
Was hatte es für einen Sinn, weiterzuleben?
Wofür?
Schon vor zwei Jahren, nach dem verheerenden Erdbeben, hatte sie keine Antwort darauf gefunden. Erst als Joe vor ihrer Pritsche aufgetaucht war. Er war es gewesen, der sie aufgefordert hatte, nicht aufzugeben. Er hatte ihr immer wieder gesagt, dass sie nicht das Recht hatte, das Geschenk des Lebens abzulehnen.
Bei diesem Gedanken schnaubte Mila verbittert. Das Leben heutzutage war kein Geschenk. Es war eine Last. Ein qualvoller Weg ohne Ziel, den sie fortan vollkommen allein bestreiten sollte.
Also – wo lag der Sinn?
Mila schob ihren Ärmel zurück und legte die Klinge auf ihr linkes Handgelenk. Das Metall fühlte sich eiskalt auf ihrer Haut an. So kalt, dass es brannte. Der Schmerz tat gut. Er lenkte sie von der Pein ihres Herzens ab. Mit nur einem einzigen Schnitt könnte sie allem ein Ende setzen. Sie könnte der hoffnungslosen Einsamkeit entfliehen, in der sie ihr Leben führen musste.
Mila drehte das Messer und verstärkte den Druck auf ihre Haut. Ihr Herz pochte wie wild. Ihre Hand zitterte.
Mit einem tiefen Schluchzen ließ sie das Jagdmesser schließlich fallen und legte den Kopf in den Nacken.
»Es tut mir leid, Grandpa«, flüsterte sie in den Himmel. »Ich bin sogar zu feige, dir zu folgen.«
Ja, sie hatte Angst vor dem Leben. Doch noch mehr Angst hatte sie vor dem Tod.
Sie lehnte sich nach vorn und ihre Finger gruben sich tief in den rußverfärbten Schnee. Der bittersüße Schmerz der Kälte begleitete die wenigen Tränen, die sie noch hatte.