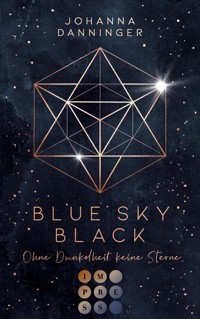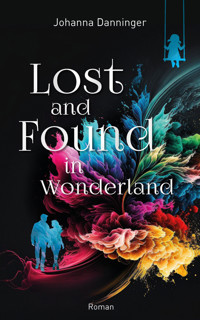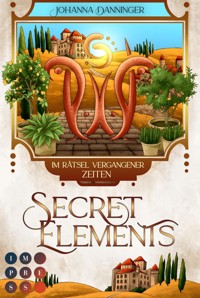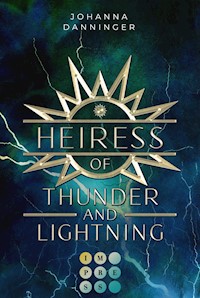5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das grandiose Finale der neuen Fantasy-Buchreihe von Bestseller-Autorin Johanna Danninger! **Finde deine Bestimmung als Lichtbringerin!* Lucia arbeitet weiter an ihren Fähigkeiten als Lichtbringerin. Sie will alles geben, was sie nur kann, um der Bedrohung durch den schwarzmagischen Zirkel zu begegnen. Zugleich wird sie in einen Strudel der Gefühle gerissen. Noah, der Lucia doch schon mehrfach das Leben gerettet hat, verhält sich ihr gegenüber abweisend und sogar verletzend. Andererseits spürt sie, wenn sie mit Rakesh zusammen ist, tief in ihrem Innern eine Unsicherheit, die sie sich nicht erklären kann. Um das Gefühlschaos in den Griff zu kriegen, muss Lucia lernen nicht mit dem Verstand zu denken, sondern mit dem Herzen ... Magisch-romantische Urban Fantasy zum Niederknien! Nach dem großen Erfolg der »Secret Elements«-Reihe entführt die Bestseller-Autorin Johanna Danninger ihre Leser nun in die grandiose Welt der Lichtbringer. Eine Fantasy-Liebesgeschichte in drei Bänden voll einzigartiger Charaktere und magischer Wesen, die dich sofort in ihren Bann ziehen. Textauszug: »Das Licht besiegt die Dunkelheit, wenn vereint, was einst entzweit.« //Dies ist der dritte Band der magisch-romantischen Fantasy-Reihe »Die Lichtbringerin«. Alle Bände der Buchserie: -- Die Lichtbringerin 1 -- Die Lichtbringerin 2 -- Die Lichtbringerin 3// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Johanna Danninger
Die Lichtbringerin 3
**Finde deine Bestimmung als Lichtbringerin!* Lucia arbeitet weiter an ihren Fähigkeiten als Lichtbringerin. Sie will alles geben, was sie nur kann, um der Bedrohung durch den schwarzmagischen Zirkel zu begegnen. Zugleich wird sie in einen Strudel der Gefühle gerissen. Noah, der Lucia doch schon mehrfach das Leben gerettet hat, verhält sich ihr gegenüber abweisend und sogar verletzend. Andererseits spürt sie, wenn sie mit Rakesh zusammen ist, tief in ihrem Innern eine Unsicherheit, die sie sich nicht erklären kann. Um das Gefühlschaos in den Griff zu kriegen, muss Lucia lernen nicht mit dem Verstand zu denken, sondern mit dem Herzen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Johanna Danninger, geboren 1985, lebt als Krankenschwester mit ihrem Mann, einem Hund und zwei Katzen umringt von Wiesen und Feldern im schönen Niederbayern. Schon als Kind dachte sie sich in ihre eigenen Geschichten hinein. Seit sie 2013 den Schritt in das Autorenleben wagte, kann sie sich ein Dasein ohne Tastatur und Textprogramm gar nicht mehr vorstellen. Und in ihrem Kopf schwirren noch zahlreiche weitere Ideen, die nur darauf warten, endlich aufgeschrieben zu werden!
Eine der größten Herausforderungen ist es,
die Stimme des Herzens nicht nur zu erkennen,
sondern ihr auch zu folgen.
Kapitel 1
Ich saß im Schneidersitz auf meinem Bett in Haus Elderstett, schloss die Augen und blendete nach und nach meine Umgebung aus. Geistig fixierte ich meine Gedanken auf einen goldenen Punkt und bändigte damit meinen Verstand. Ich ignorierte das Toben der Kinder auf dem Fußballplatz unter meinem offenen Fenster, genau wie die Wärme eines hereinfallenden Sonnenstrahls auf meinem linken Knie. Auch die Hummel, die sich in mein Zimmer verirrt hatte, ignorierte ich.
Mein Atem ging ruhig und gleichmäßig. Ich achtete darauf, weiterhin meinen Körper wahrzunehmen, um nicht versehentlich zu tief in meine Seelenreise einzutauchen. Dann rief ich mir die Landschaft in den Sinn, von der ich schon so oft geträumt hatte.
Sofort war ich dort. Eine hügelige Graslandschaft umgab mich. Ich konnte die Wiese unter meinen nackten Füßen spüren, genau wie den Wind, der mir immer wieder leicht über das Haar strich. Vor mir erhob sich eine Kuppe, die ich langsam erklomm, bis ich den Rand der Klippe erreichte und hinaus aufs Meer schaute.
Ich wartete einen Moment. Schließlich lächelte ich, denn ich spürte sofort, dass er hier war.
Noah …
Ohne Eile wandte ich mich zu ihm um. Er schritt langsam auf mich zu. Der Wind wirbelte durch sein dunkelblondes Haar. Seine Augen waren blau wie der Ozean und ließen den wolkenlosen Himmel wie einen farblosen Hintergrund erscheinen. Neben ihm wirkte einfach alles farblos und unscheinbar.
Er blieb vor mir stehen und sah mich an.
»Wann wirst du aufwachen?«, fragte ich ihn.
Er antwortete nicht. Das hatte er noch nie getan, so oft ich es auch versuchte.
»Es sind jetzt schon drei Wochen«, sagte ich. »Rina meint, der Heilprozess sollte bald abgeschlossen sein.«
Noah schwieg beharrlich. Natürlich, denn ich sprach ja nur mit einem Traumbild. Mit einer Erinnerung, die allerdings so klar war, dass man sich leicht darin verlieren konnte. Anders als in meinen eigenen Träumen hatte ich hier aber die Kontrolle, darum wich ich sofort zurück, als Noah einen Schritt auf mich zu tat.
Noah schmunzelte. Er streckte eine Hand nach meinem Gesicht aus, doch ich fing sie ab und hielt sie zwischen uns fest.
»So schön es sich auch anfühlt«, flüsterte ich. »Das hier ist nicht echt. In Wahrheit weiß ich überhaupt nicht, wer du bist.«
Zweifelnd legte er den Kopf schief. Zum allerersten Mal sah ich eine Reaktion auf meine Worte in seinen Augen. Überrascht hielt ich den Atem an und ließ es geschehen, dass er ganz nah an mich herantrat.
»Du weißt genau, wer ich bin«, sagte er leise.
Ein Rauschen fuhr durch mich hindurch. Ich war völlig gefangen, nicht nur von seinem Blick, sondern auch von der tiefen Zuneigung, die ich in meinen Träumen für Noah empfand. Bereitwillig gab ich mich den Gefühlen hin, reckte mich ihm entgegen, als er sich zu mir herabneigte, um mich zu …
RRRR! RRRR!
Ich schnappte vor Schreck nach Luft. Einen Augenblick lang war ich völlig orientierungslos. Dann kam ich schlagartig zu mir und hangelte kopfschüttelnd nach meinem Handy, das polternd über meinen Nachttisch vibrierte.
Ich deaktivierte den Alarm, den ich vorsorglich angestellt hatte, und legte das Telefon neben mich. Mein Herzschlag beruhigte sich wieder. Ich streckte meine Arme durch und ließ mir Zeit, vollständig im Jetzt anzukommen.
Nachdenklich strich ich mir mit dem Zeigefinger über die Lippen. Trotz der ruppigen Unterbrechung war mir, als könnte ich Noahs Kuss darauf spüren. Ich wusste, dass die tiefe Liebe zwischen uns im Grunde nur eine Erinnerung aus einem vergangenen Leben war. In unserem jetzigen Leben kannten wir uns kaum. Außerdem hatten wir uns bei unseren wenigen Begegnungen nicht besonders gut verstanden. Umso verwirrender war die Intensität meiner Gefühle, die sich offensichtlich nicht darum scherten, was heute und was gestern war.
Jeden Tag bangte ich, dass Noah endlich aus dem Heilschlaf erwachte, in den er nach seiner schweren Verletzung durch den Dämonenfürsten Andras gefallen war. Trotz zahlreicher Versuche war es mir nicht gelungen, während meiner Traumreisen etwas über unsere Verbindung zu erfahren.
»Wenn es so weit ist, wirst du es verstehen«, sagte Azariel.
Ich schaute mürrisch zur Decke hinauf. Das war nämlich die Standardaussage meines Schutzengels zu diesem Thema und die gefiel mir überhaupt nicht.
»Meine Aufgabe ist es, dir zu helfen, und nicht, dir zu gefallen.«
Ertappt kräuselte ich die Nase.
»Entschuldige, Azariel, so war das nicht gemeint«, sagte ich in Gedanken zu ihm. »Nimm meine Ungeduld bitte nicht persönlich.«
»Ich bin ein Engel. Würde ich so etwas persönlich nehmen, hätte ich meinen Job längst hingeworfen.«
Ich lachte leise. Der trockene Humor meines geistigen Begleiters war echt eine Marke für sich. Wir standen noch nicht sehr lange in solch offenem Kontakt miteinander, doch diese kleinen Dialoge gehörten inzwischen fest zu meinem Alltag. Ich wollte Azariels Stimme, die wie meine eigenen Gedanken klang und sich doch deutlich davon unterschied, nie wieder missen. Mein Schutzengel war zu einem wundervollen Teil meines Lebens geworden, den ich über alle Maßen zu schätzen wusste.
Schließlich stand ich auf, hängte mir meine Tasche um und machte mich auf den Weg ins Erdgeschoss. Ich hatte mir nämlich nicht ohne Grund den Wecker gestellt, denn gleich würde meine Fahrstunde beginnen, und zu der wollte ich nicht zu spät kommen.
In den Fluren des riesigen Internatsgebäudes war es mucksmäuschenstill. Kein Wunder, denn das Wetter war an diesem frühen Mittwochnachmittag einfach bombastisch. Die Schüler spielten bestimmt alle draußen in der Julisonne. Der Gemeinschaftsraum war leer, also hatten sich vermutlich auch die Lichtkrieger zu ihnen gesellt. Oder sie führten einen Auftrag aus, von dem ich nichts mitbekommen hatte. Ich war nämlich nach wie vor nicht wirklich in die Aktivitäten der Lichtkrieger eingebunden. Vor allem seit sich herausgestellt hatte, dass die Bruderschaft der Abenddämmerung es auf mich abgesehen hatte.
Nun, der schwarzmagische Zirkel hatte es nicht unbedingt auf mich persönlich abgesehen. Sie hatten mich nur als schwächstes Glied unseres Lichtbringerordens identifiziert und hatten versucht, über mich an Informationen über Haus Elderstett zu gelangen. Zum Glück war ihnen das misslungen. Sie wussten zwar inzwischen, dass Rina die Leiterin des Internats war, aber mehr wussten sie nicht darüber. Das gesamte Internatsgelände war von einem magischen Schutz umgeben, der nicht nur den Standort des Gebäudes verschleierte, sondern auch jedem den Zutritt verwehrte, sofern er nicht dazu eingeladen wurde. Da Rina es war, die diesen mächtigen Zauber aufrechterhielt, durfte sie das Internat nicht verlassen. Zumindest nicht physisch, sondern nur in ihrer Astralgestalt.
Als ich das Erdgeschoss über das östliche Treppenhaus erreichte, stieg Rakesh gerade von unten herauf.
»Hey«, grüßte ich meinen Mentor salopp. »Warst du unterwegs?«
Er blieb neben mir stehen und wischte sich eine dunkle Locke aus der Stirn. »Ja, ich war mit Kommissarin Becker bei ein paar Lichtbringern. Schon interessant, welch überzeugende Wirkung eine Polizeimarke auf andere ausübt.«
Kommissarin Sandra Becker arbeitete bei der Polizei unserer Stadt und zog Rakesh schon seit Längerem bei schwierigen Ermittlungen als spirituellen Berater hinzu, obwohl sie mit Magie und Spiritualität nichts am Hut hatte. Seit die Bruderschaft der Abenddämmerung in der Stadt wütete, war die Kommissarin eng in den Kampf der Lichtkrieger gegen den schwarzmagischen Zirkel verstrickt. Vor knapp einer Woche war ein weiterer Lichtbringer überfallen worden und man hatte ihm die Seele geraubt. Die Lichtkrieger hatten ihn vorgewarnt, doch er wollte ihnen nicht glauben. Der Anführer der Bruderschaft, William Craw, war nun im Besitz von fünf Lichtbringerseelen, die seiner unheilvollen Magie stetig mehr Kraft verliehen. Die Lichtkrieger gingen davon aus, dass Craw noch mehr Seelen in seinen Besitz bringen wollte, und suchten daher jeden gefährdeten Lichtbringer der Stadt auf, um deutliche Warnungen auszusprechen. Inzwischen mit tatkräftiger Unterstützung von Kommissarin Becker.
Rakesh ließ einen Blick über mich gleiten. »Hast du Fahrstunde?«
»Doppelstunde Überlandfahrt.« Ich stöhnte übertrieben. »Ich langweile mich jetzt schon. Ich bin echt froh, dass ich bald meine Prüfung machen kann.«
Ich ging langsam weiter und Rakesh begleitete mich noch ein Stück, bevor sich unsere Wege in der großen Eingangshalle trennten.
»Frag doch mal deinen Schatten, ob er ein bisschen für dich singt«, meinte Rakesh scherzhaft zum Abschied und wandte sich in Richtung Orangerie.
»Gott bewahre!«, rief ich ihm hinterher.
Schmunzelnd durchquerte ich die hübsche Eingangshalle mit der schicken Haupttreppe. Die wilde Mischung an unterschiedlichen Einrichtungsstilen faszinierte mich, immer wenn ich hier vorbeikam, und mir war, als würde ich jedes Mal etwas Neues entdecken. Auf einem Beistelltisch stand eine pfirsichfarbene Vase, mit der ich nicht gut Freund war. Eigentlich hatte ich gedacht, sie wäre bei unserem letzten Aufeinandertreffen zu Bruch gegangen, doch allem Anschein nach hatte sie ihren Sturzflug wie durch ein Wunder heil überstanden.
Um das in den dunklen Fliesenboden eingelassene Mosaik machte ich vorsorglich einen großen Bogen. Das kreisrunde Muster stellte die sogenannte Blume des Lebens dar, eines der stärksten Energiesymbole überhaupt. In der Mitte war ein spezielles Symbol eingelassen, das beim Teleportieren als Orientierungspunkt genutzt werden konnte. Die hohe Kunst des Teleportierens beherrschten im Hause Elderstett allerdings nur Rina und seit Kurzem auch Rakesh. Und Noah natürlich, der insgesamt über herausragende magische Fähigkeiten zu verfügen schien.
Als ich die große Eingangstür öffnete, kam mir sofort die Juliwärme entgegen. Der Wetterbericht hatte für Ende der Woche eine richtige Hitzewelle angekündigt und man konnte wahrlich spüren, wie die Sommersonne an Fahrt aufnahm.
Ich kramte meine Sonnenbrille aus der Handtasche, setzte sie mir auf die Nase und folgte dem Kiesweg durch den schmucken Innenhof. Ein schmiedeeisernes Tor trennte das Grundstück von der verkehrsarmen Straße. Trotz der dunklen Brillengläser konnte ich dort das Flimmern der magischen Barriere erkennen, das viel mehr Schutz bot als der stabilste Eisenzaun der Welt. Und ich sah noch etwas anderes, nämlich meinen sogenannten Schatten, der mit brüskiert verschränkten Armen und schillernden Flügelchen über dem Tor in der Luft schwebte.
»Bist ganz schön spät dran!«, schimpfte die Fee Annegret und tippte anklagend auf eine imaginäre Uhr an ihrem Handgelenk. »Muss ich jetzt auch noch aufpassen, dass du pünktlich bist, oder was?«
Gut, dass ich die Sonnenbrille aufhatte, denn so konnte ich hingebungsvoll mit den Augen rollen, ohne die Fee zusätzlich zu verärgern. Ich wollte sie wirklich nicht beleidigen, denn wir waren gut befreundet, und außerdem hatte sie sich dazu bereiterklärt, sich als meine persönliche Personenschützerin um mich zu kümmern, solange ich den Führerschein machte. Sie begleitete mich nicht nur zu jeder Fahrstunde, sondern wich auch während der Theoriestunden nicht von meiner Seite. Darum nannte ich sie inzwischen auch meinen persönlichen Schatten.
»Entschuldige«, beeilte ich mich zu sagen. »Aber der Müller ist ja noch gar nicht da.«
Mit übertriebener Geste deutete Annegret die Straße hinauf, wo just in diesem Augenblick das silberne Fahrschulauto heranrollte.
»Perfektes Timing, oder?«, sagte ich unbekümmert und trat durch das eiserne Tor, dessen Scharniere unheilvoll quietschten.
Annegret hob streng einen Zeigefinger. »Werd ja nicht frech! Immerhin habe ich Besseres zu tun, als deine Kindsmagd zu spielen!«
Ich grinste in mich hinein, denn ich wusste ganz genau, dass sie es gewesen war, die Rakesh den Vorschlag unterbreitet hatte, mein Schatten zu werden. Und dieser Vorschlag war aus mehreren Gründen grandios gewesen, denn Annegret war nicht nur für Menschenaugen unsichtbar, sie verfügte auch über große magische Kräfte, mit denen sie mich notfalls sogar teleportieren konnte. Sie war also der perfekte Bodyguard für mich und noch dazu eine gute Unterhaltung im Gegensatz zu meinem verschwiegenen Fahrlehrer Herr Müller. Es war oft nicht leicht, sich bei ihren Kommentaren ein Lachen zu verkneifen, und Herr Müller fragte sich sicher, was mit mir eigentlich nicht stimmte und warum sich manchmal ein dümmliches Grinsen auf meine Lippen legte.
***
Die Überlandfahrt gestaltete sich genauso öde wie befürchtet. Da es meine vorletzten Pflichtstunden waren, war auch das Fahren selbst längst nicht mehr so aufregend wie am Anfang. Meiner Meinung nach hatte ich den Dreh schon ziemlich gut raus. Für den Nürburgring würde es wahrscheinlich nicht reichen, aber dem normalen Straßenverkehr fühlte ich mich durchaus gewachsen. Der graubärtige Herr Müller sah das wohl ähnlich, denn die einzigen Kommentare, die er bisher von sich gegeben hatte, lauteten »Da vorne rechts« und »Da vorne links abbiegen«. Im Grunde mimte er also ein menschliches Navi, das mich kreuz und quer durch das Bamberger Umland scheuchte.
Fahrsicher lenkte ich das Fahrzeug über eine einsame Landstraße, die in sanften Kurven durch ein Waldstück führte. Über den Rückspiegel konnte ich sehen, dass Annegret gelangweilt auf der Hutablage herumturnte. Ich war schon lange nicht mehr aus der Stadt herausgekommen und genoss den Anblick des dichten Waldes. Die hohen Bäume dämmten den Sonnenschein, darum nahm ich meine Brille ab. Ich legte sie in die Ablage hinter der Gangschaltung. Als ich meinen Blick nach dieser winzigen Ablenkung wieder nach vorn richtete, stand plötzlich eine Frau direkt vor uns auf der Straße.
Meine Beine reagierten bereits, als mein Gehirn noch im Schockzustand verharrte. Reflexartig trat ich mit aller Kraft auf die Bremse und umklammerte das Lenkrad. Die Reifen pfiffen schrill. Herr Müller wurde nach vorne in den Gurt gedrückt. Gleichzeitig wurde Annegret an mir vorbei in Richtung Windschutzscheibe geschleudert. Doch bevor sie auf das Glas traf, löste sie sich einfach in Luft auf und verschwand.
Die Frau auf der Straße schaute mich an und streckte ihre Arme aus, als wollte sie das Auto abfangen. Und dann …
schlidderte das Fahrzeug direkt durch sie hindurch.
Zumindest musste es so gewesen sein, denn der erwartete Aufprall blieb aus. Der Wagen rutschte immer noch mit blockierenden Reifen über den Asphalt. Ich sah in den Rückspiegel und tatsächlich stand die Frau noch an der gleichen Stelle und schaute uns hinterher. Mit einem letzten Ruck kam das Auto endlich zum Stehen.
Herr Müller ächzte und schnappte nach Luft. Annegret tauchte wieder auf und stellte sich anklagend vor mich auf das Lenkrad.
»Was soll denn das?«, schimpfte sie und stemmte die Arme in die Hüften.
»Hast du das gesehen?«, fragte ich aufgeregt.
»Da war nichts!«, rief Herr Müller schrill. »Da war überhaupt nichts! Großer Gott!«
Ich ignorierte den schockierten Fahrlehrer und drehte mich nach hinten um. Die Frau war verschwunden.
»Wo ist sie hin?«, murmelte ich und schaute wieder nach vorn zu Annegret.
»Wer?«, fragte die Fee ratlos.
Gerade als ich antworten wollte, bemerkte ich eine Bewegung zu meiner Linken. Die mysteriöse Frau stand plötzlich vor der Seitenscheibe und schaute mich mit großen Augen an. Ich keuchte erschrocken. Auch Annegret zuckte zusammen, fing sich aber schnell wieder.
»Ah ja«, sagte die Fee, während ich tief Luft holte. »Oje, sie hatte einen Unfall.«
Erst jetzt registrierte ich, dass der Körper der Frau nicht ganz so materiell war, wie er auf den ersten Blick erschienen war. Bei genauer Betrachtung waren ihre Umrisse leicht verschwommen und die Farben ihrer Kleidung wirkten merkwürdig trüb. Neben mir stand also keine richtige Frau, sondern eindeutig nur ihre Astralgestalt. Es stellte sich also die Frage, wo der physische Teil von ihr abgeblieben war.
»Lucia, um Himmels willen, was haben Sie sich dabei gedacht?«, schnaufte mein Fahrlehrer.
Ich ignorierte ihn weiterhin, denn die Frau sah mich flehend an und winkte mich mit sich. Sie brauchte offenbar meine Hilfe.
»Rufen Sie den Notruf«, wies ich Herrn Müller an und löste meinen Gurt. »Hier ist ein Unfall passiert.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, stieg ich aus. Mein Fahrlehrer rief mir noch irgendwas von wegen eines Warndreiecks hinterher, aber da lief ich bereits die Straße entlang und kümmerte mich nicht weiter um ihn.
Die Astralgestalt der Frau hatte sich an der Stelle materialisiert, wo ich durch sie hindurchgefahren war, und deutete eindringlich auf die zugewucherte Böschung neben sich. Annegret schwirrte mit sirrenden Flügelchen neben mir her. Nach wenigen Schritten gab sie ein entsetztes »Oh Nein!« von sich und verschwand. Beinahe zeitgleich konnte ich ebenfalls hören, was die Fee zur Eile angetrieben hatte. Es war das erschütternde Weinen eines Kindes.
Ich beschleunigte meine Schritte und erkannte Fahrzeugspuren auf dem schmalen Grünstreifen am Straßenrand und abgeknickte Äste im Gebüsch. Ich folgte hastig den Spuren. Gleich hinter dem dichten Gestrüpp fiel der Wald steil bergab. Ein dunkler Wagen stand an der vorderen Baumreihe. Das Heck wirkte unversehrt, doch vom Motorraum stieg heller Dampf auf. Noch bevor ich den steilen Hang ganz hinuntergestolpert war, war das Weinen des Kindes verklungen. Erst deutete ich das als alarmierendes Zeichen, aber als ich die hintere Tür auf der Beifahrerseite erreichte, atmete ich erleichtert auf.
Ein Mädchen, ungefähr ein Jahr alt, saß auf der Rückbank im Kindersitz und betrachtete mit großen Augen Annegret, die lächelnd vor ihm schwebte. Die Wangen des Kindes waren tränennass und gerötet, aber ich konnte auf den ersten Blick keine Verletzungen erkennen.
Ich schluckte schwer, als ich die Person auf dem Fahrersitz bemerkte. Es war die Frau von vorhin, und ich brauchte sie nicht von vorn anzusehen, um zu wissen, dass sie tot war.
Diesmal erschrak ich nicht, als die Astralgestalt der Frau sich aus dem Nichts neben mir manifestierte. Ihre Erscheinung war um einiges durchsichtiger als zuvor, denn sie war im Begriff zu gehen. Das wusste ich. Und sie wusste es auch.
Die Frau legte eine flache Hand an die Seitenscheibe und blickte zu ihrer Tochter hinab. Tränen rollten über ihre Wangen und der Schmerz in ihrem Gesicht zerriss mir fast das Herz.
»Es tut mir so leid«, flüsterte ich heiser. »Es tut mir so unendlich leid.«
Die Frau sah mich an und lächelte traurig. Sie sprach mit mir. Nicht mit Worten, sondern auf einer anderen Ebene. Ich fühlte, dass es für sie in Ordnung war zu gehen, da sie ihre Tochter nun in Sicherheit wusste. Sie würde von nun an auf andere Weise über sie wachen, denn das Band der Liebe ging weit über die Grenzen eines Lebens hinaus.
Gerührt wischte ich mir eine Träne von der Wange. Ihre Botschaft berührte mich tief in meinem Herzen. Ich lächelte und streckte einen Arm aus, um eine Lichtsäule zu errichten. Es war die Verbindung zur höchsten Dimension, der wir alle entsprangen, zur reinsten Seelenebene.
Die Frau nickte mir dankbar zu. Nach einem letzten Blick auf ihre Tochter wandte sie sich der wirbelnden Lichtsäule zu, trat ohne Scheu hinein und löste sich darin auf. Einen Moment lang betrachtete ich die wunderschöne Helligkeit zwischen den Bäumen. Ich fragte mich, ob ich jemals ganz verstehen würde, was genau dieses Licht war. Bisher fühlte es sich so an, als hätte ich gerade mal den Hauch einer Ahnung. Trotzdem wusste ich mit absoluter Gewissheit, dass ich diesem Licht bedingungslos vertrauen konnte.
»Um Gottes willen!«, hörte ich Herr Müller von der Straße her rufen.
Sein Entsetzen galt nicht der Lichtsäule, denn die konnte er gar nicht sehen, sondern natürlich dem Unfallwagen. Er stand oben am Abhang und hatte sein Telefon am Ohr.
»Eine Frau und ein Kleinkind!«, rief ich zu ihm hinauf.
Dann schloss ich mit einer Handbewegung die Lichtsäule und öffnete die hintere Fahrzeugtür. Das kleine Mädchen lachte mich an, bevor es wieder über Annegret gluckste, die in der Luft kleine Purzelbäume schlug.
»Wieso kann sie dich sehen?«, fragte ich die Fee.
»Alle Kleinkinder können mich sehen«, antwortete Annegret zwischen zwei Saltos. »Kinder können generell sehr viel sehen, bevor die Erwachsenen ihnen einreden, dass sie es nicht können.«
Während wir auf die Einsatzkräfte warteten, dachte ich über ihre Worte nach. Ich wünschte dem kleinen Mädchen von Herzen, dass sie das Vertrauen in ihre Wahrnehmung niemals verlieren würde. Denn so würde sie auch niemals vergessen, dass ihre Mutter aus dem Himmel über sie wachte.
Kapitel 2
Annegret brachte mich bis zur Eingangstür von Haus Elderstett. Sie knuffte mich zum Abschied aufmunternd in die Wange und verschwand dann im Nichts.
Gedankenverloren machte ich mich auf den Weg in mein Zimmer. Der Unfall hatte keinen wirklichen Schock in mir ausgelöst, aber eine tiefe Traurigkeit hinterlassen. Ich fragte mich immer wieder, warum solche schrecklichen Dinge passieren mussten. Eines der höchsten Universalgesetzte lautete, dass alles seinen Sinn und seinen Platz habe, nichts geschehe ohne Grund. Aber welchen Grund sollte es haben, einem kleinen Mädchen seine Mutter zu entreißen?
Ich schloss die Zimmertür hinter mir, verharrte einen Moment und merkte plötzlich, dass ich wie paralysiert meine Schreibtischschublade anstarrte. Mit abgehackten Bewegungen ließ ich meine Handtasche zu Boden sinken, durchquerte den Raum und zog die Schublade auf. Darin lag nur ein einzelner verschlossener Brief, doch der wog für mich schwerer als ein ganzer Aktenberg.
Sorgfältig unterdrückte Gefühle wallten in mir auf. In meinem Brustkorb brodelte tiefe Enttäuschung, so heftig, dass mir schwindelig wurde. Auch ich hatte vor einiger Zeit meine Mutter verloren. Der Unterschied war nur, dass sie nicht durch einen Unfall aus meinem Leben gerissen worden war, sondern mich freiwillig verlassen hatte.
Mit zitternder Hand nahm ich den Brief aus der Schublade und setzte mich auf die gepolsterte Fensterbank. Eine Weile starrte ich den Umschlag an, während längst verdrängte Erinnerungen auf mich einprasselten.
Ich sah mich als Kind im Wohnzimmer stehen, meinen Vater vor mir auf der Couch, eine Zigarette in der einen Hand, die Nachricht meiner Mutter in der anderen. Nie würde ich vergessen, wie er damals sagte: »Deine Mama ist abgehauen. Sie will uns nicht mehr.«
Ich erinnerte mich noch genau daran, dass ich ihm nicht glauben wollte. Ich war hinausgerannt, setzte mich vor die Eingangstür unseres Wohnblocks und wartete darauf, dass meine Mutter wieder zurückkam. Wie viele Stunden ich auf dem kalten Beton verbracht hatte, wusste ich nicht mehr, aber als es bereits dunkel wurde, bemerkte mich unsere Nachbarin und brachte mich nach oben, wo mein Vater auf der Couch pennte. Ich wusste noch genau, wie ich die Tränenspuren auf seinem Gesicht betrachtet hatte und er mir ganz schrecklich leidtat. Erst einige Jahre später verstand ich, dass er mein Mitleid nicht verdient hatte.
An jenem Tag hatte ich aufgehört, Kind zu sein. Das wurde mir jetzt erst klar. Meine Eltern hatten mich behandelt wie eine Belastung, wie jemand, der es nicht wert war, dass man sich um ihn kümmerte und sich für ihn Zeit nahm. Dabei hatte ich immer nur eins gewollt – ich wollte, dass meine Eltern glücklich waren. Aus dem Verstand heraus wusste ich inzwischen ganz genau, dass ich an ihrem verbitterten Leben nicht schuld war, und trotzdem fühlte es sich so an. Die Schuld, die ich als Kind auf mich geladen hatte, war zu tief in mir verankert, um sie einfach loszuwerden.
Ich drehte den Brief mehrmals herum. Seit Wochen drückte ich mich nun schon davor, ihn zu lesen, weil ich Angst hatte, mit dem Inhalt nicht umgehen zu können. Wollte ich denn wirklich wissen, was meine Mutter mir nach so vielen Jahren zu sagen hatte? Vielleicht bat sie mich um Vergebung. Aber ich spürte deutlich, dass ich ihr gar nicht vergeben wollte.
»Und das ist auch völlig in Ordnung«, meldete Azariel sich sanft zu Wort. »Vergebung ist ein Prozess. Aber du könntest dir selbst ein großes Geschenk machen, indem du damit beginnst, Frieden zu schließen. Nicht im Kopf, sondern im Herzen.«
Mir selbst ein Geschenk machen … Das klang schön, wühlte mich aber gleichzeitig total auf. Als würde sich etwas in mir dagegen sträuben.
»Bist du es denn wert, ein Geschenk zu empfangen?«, fragte Azariel.
Ich lachte bitter, weil ich plötzlich verstand, was er meinte. Es ging nicht darum, dass ich meiner Mutter nicht vergeben wollte. Nicht nur. Schuld und das Gefühl meiner Wertlosigkeit wogen so schwer, dass ich mir den Frieden selbst nicht erlaubte. Weil ich es mir nicht wert war.
Eine Weile dachte ich über diese Erkenntnis nach. Dann straffte ich die Schultern und sagte zu Azariel: »Ich bin es wert!«
Entschlossen riss ich den Umschlag auf, nahm den Brief heraus, faltete ihn auseinander und rutschte ein wenig tiefer in die Polster. Während ich die handgeschriebenen Zeilen überflog, dröhnte mein eigener Herzschlag in meinen Ohren.
Liebe Lucia,in letzter Zeit habe ich viel nachgedacht, und es gibt so vieles, was ich dir sagen möchte. Zu viel, als dass ich es in wenige Zeilen packen könnte. Darum würde ich mich freuen, wenn du mich unter der unten stehenden Telefonnummer anrufen würdest.Schöne Grüße,Deine Mutter
PS: Es tut mir leid.
Mit bebenden Schultern ließ ich den Brief sinken und starrte an die Wand gegenüber.
PS: Es tut mir leid?
Das war alles?
Schon klar, dass es mehrere Zeilen gebraucht hätte, um eine anständige Erklärung zu verfassen. Das war meiner werten Mutter aber offensichtlich zu viel Arbeit. Selbst bei ihrer angeblichen Entschuldigung wälzte sie die Verantwortung also lieber auf mich ab, anstatt sich gefälligst mal zusammenzureißen und sich Mühe zu geben!
Mir entwich ein wütendes Grollen und ich zerfetzte den Brief in mehrere Schnipsel, die langsam auf den Boden segelten. Ich war so außer mir, dass ich aufsprang und auf den Papierfetzen herumtrampelte, bis tiefe Schluchzer meinen Brustkorb erschütterten. Jahrelang vor sich hin gärender Schmerz schoss aus meinem Herzen und machte mir das Atmen schwer. Ich sank vor den Papierschnipseln auf die Knie und ergab mich den erbitterten Tränen.
Es war beileibe nicht mein erster emotionaler Ausbruch dieser Art, darum wusste ich auch, dass – so schrecklich er sich im Moment auch anfühlte – bald eine Linderung eintreten würde. Als würde man einen Holzsplitter aus einer entzündeten Wunde ziehen. Das Entfernen tat weh, aber nur dadurch konnte die Verletzung am Ende heilen.
Nach einer Weile verebbten meine Schluchzer und ich blickte mit dumpfer Leere im Herzen auf die Brieffetzen hinab. Mechanisch sammelte ich das Papier ein, legte es zurück in den Umschlag und stand auf, um ihn in den Papierkorb zu werfen. Doch nach kurzer Überlegung holte ich den Umschlag wieder heraus und verstaute ihn stattdessen in der Schreibtischschublade.
Ich atmete tief durch. Da wartete noch einiges an innerer Arbeit auf mich, aber er erste Schritt war nun getan.
***
Nach einer kurzen Dusche machte ich mich auf den Weg zum Abendessen. Ich fühlte mich ein wenig erschöpft, aber trotzdem gefasst. Die Probleme mit meiner Mutter hatte ich erfolgreich mit dem Brief in der Schublade zurückgelassen. Stattdessen beschäftigte ich mich in Gedanken wieder mit dem Unfall, während ich über den Flur wanderte, bis ich meinen Namen aus dem Gemeinschaftsraum vernahm. Ich tat einen Schritt zurück und sah Rakesh am Computer sitzen.
»Was ist passiert?«, fragte er sofort.
Da ich inzwischen selbst dazu fähig war, die Emotionen anderer wahrzunehmen, wunderte ich mich nicht mehr über solche direkten Fragen. Ich konnte meine Gefühlswelt zwar bei Bedarf nach außen hin abschirmen, sah aber in Haus Elderstett keinen Sinn darin, mich zu verstecken – und vor Rakesh schon gleich zweimal nicht.
Ich ging zu ihm an den Schreibtisch und lehnte mich daneben an die Wand. Rakesh hörte mir aufmerksam zu, während ich ihm in knappen Worten von dem Unfall berichtete und danach noch kurz von dem Brief erzählte.
»Ganz schön viel für nur einen Nachmittag«, meinte er schließlich und lächelte mich mitfühlend an.
Ich stimmte ihm mit einem leisen Schnaufen zu. »Allerdings.«
»Du bist sehr stark geworden.« Rakesh stand auf und trat vor mich hin. »Aber selbst der Stärkste kann ein wenig Trost vertragen.«
Er breitete die Arme aus und ich nahm ohne Scheu seine Einladung an und lehnte mich dankbar gegen ihn. Ich bettete meinen Kopf an seine Schulter und ließ mich einfach von seiner Nähe umhüllen. Rakesh brauchte keine Worte, um mich zu trösten. Seine Umarmung reichte vollkommen aus, um mir zu sagen, dass er für mich da war. Er war mein Beschützer, der Lichtkrieger, der immer auf mich aufpasste.
Ganz von selbst wanderten meine Finger zu den weichen Locken in seinem Nacken. Rakesh streichelte mir sanft über den Rücken und ich genoss das wohlige Prickeln, das seine Berührung bei mir auslöste. Ich bemerkte nur am Rande, dass sich unsere Umarmung langsam in etwas wandelte, das über eine freundschaftliche Geste hinausging. Die vertrauten Funken zwischen uns erwachten. Ich konnte spüren, wie sie in meinem Bauch kribbelten.
Ein Räuspern von der Tür her durchbrach den prickelnden Moment. Ich öffnete die Augen und konnte kaum glauben, was sie mir da präsentierten.
»Noah!«, stieß ich verblüfft aus und löste mich hastig von Rakesh.
Im ersten Moment wollte ich zu Noah stürmen, um ihn freudig zu umarmen. Doch dann hielt ich mitten in der Bewegung inne. Ich hatte ganz vergessen, welch unnahbare Arroganz er stets ausstrahlte. Nun stand sie dermaßen deutlich in seinen blauen Augen geschrieben, dass sie mich über vier Meter Entfernung hinweg versteinern ließ.
»Ich wollte euch nicht stören«, sagte Noah gedehnt und ließ seinen Blick durch das Zimmer schweifen. »Aber kann mir vielleicht jemand erklären, was passiert ist?«
Der Noah aus meinem Traum und der aus der Gegenwart prallten in einem gewaltigen Konflikt in meinem Herzen zusammen. Ich starrte in das Gesicht, das mich in meinen Träumen stets so liebevoll anlächelte, und konnte einfach nicht fassen, wie hart es nun auf mich wirkte. Da ich mich in einer Art Schockzustand befand, übernahm Rakesh kurzerhand das Reden.
»Andras hat dich schwer erwischt«, erklärte er. »Wir haben dich hierhergebracht. Du warst knapp drei Wochen im Heilschlaf.«
»Drei Wochen«, wiederholte Noah, ohne großartig darüber schockiert zu sein. »Und wo genau ist hier?«
»Haus Elderstett«, antwortete Rakesh. »In Bamberg.«
Noah trat näher an den Schreibtisch heran und betrachtete die Pinnwand, die vor gesammelten Hinweisen bezüglich der Bruderschaft der Abenddämmerung beinahe überquoll. Er ließ sich nicht anmerken, was er von den vielen Zetteln und Steckbriefen hielt, sondern schaute mit unveränderter Miene wieder zu uns. »Ich bin also in eurer Einsatzzentrale.«
»Du bist in unserem Zuhause«, korrigierte ihn Rakesh reserviert.
Ich verfolgte schweigend den angespannten Dialog zwischen den beiden. Rakesh hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Noah nicht leiden konnte, und das beruhte zweifellos auf Gegenseitigkeit. Das war schon so gewesen, seit sie sich das erste Mal begegnet waren, und ich hatte das Gefühl, dass sich diese Abneigung sogar noch verschlimmert hatte. Jedenfalls gab sich keiner der beiden auch nur ansatzweise Mühe, einigermaßen freundlich zu sein.
Im nächsten Moment kam Parla zur Tür herein. Die Lichtkriegerin trug ein kunterbuntes Sommerkleid, das hervorragend zu ihrem knallroten Bob passte. Sie strahlte wie immer wie der Sonnenschein höchstpersönlich und als sie Noah erblickte, strahlte sie sogar noch mehr.
»Na, da sieh an!«, rief sie gutgelaunt. »Endlich ausgeschlafen, ja?«
Sie schlug Noah kumpelhaft auf die Schulter und schob ihn ein wenig zur Seite, um an eine Schreibtischschublade zu kommen. Noah schien sich einen Augenblick lang über ihre scheulose Art zu wundern, doch sein Stirnrunzeln verschwand schnell wieder.
»Ich bringe dich zur Internatsleitung«, sagte Rakesh zu ihm, in einem Tonfall, der beinahe wie ein Befehl klang.
Noahs Mundwinkel zuckte leicht, doch er nickte nur und bat Rakesh mit einer Geste, voranzugehen.
Die beiden Männer verließen den Gemeinschaftsraum. Parla kramte in der Schreibtischschublade herum und ich stierte schweigend auf die Stelle, wo Noah gerade noch gestanden hatte.
Wow …
Drei Wochen lang hatte ich darauf gewartet, dass er endlich aufwachte, und dann verschlug mir sein Anblick glatt die Sprache. Nicht mal ein »Hallo« hatte ich zustande gebracht. Wobei er sich jetzt auch nicht unbedingt mit Begrüßungsfloskeln aufgehalten hatte. Ganz im Gegenteil, er schien meine Anwesenheit kaum wahrgenommen zu haben. Er hatte mich mit dem gleichen kühlen Blick angesehen wie Rakesh.
»Nicht leicht zu durchschauen, der Gute«, sagte Parla plötzlich. Sie hielt einen Briefumschlag in der Hand und kickte die Schublade mit der Hüfte zu. »Ich muss zugeben, diese mysteriöse Art hat schon was.«
Sie grinste kess, doch ich verschränkte nur die Arme. Mir waren eindeutig Menschen lieber, bei denen ich wusste, woran ich war.
***
Wenig später saß ich mit den Lichtkriegern im großen Speisesaal beim Abendessen. Das fröhliche Stimmengewirr der Internatsschüler vermischte sich mit dem Klirren von Tellern und Gläsern. An unserem Tisch wurde rege über Homöopathie diskutiert, doch meine Aufmerksamkeit galt ausschließlich der Tür und der Frage, wann Rakesh und Noah von ihrem Gespräch mit Rina zurückkehren würden.
»Luuuciaaa!«, drang schließlich Jans Stimme zu mir durch.
Ich sah verwirrt zu ihm hinüber. »Hm?«
»Ich hab dich gefragt, ob du mir mal die Kartoffeln reichen kannst«, sagte er und zog mit einer Schnute seinen Haarknoten fest. »Schon drei Mal!«
In puncto Essen verstand der Technopath Jan keinen Spaß, darum reichte ich ihm hastig die gewünschte Schüssel. Die Lichtkriegerin Lien saß neben ihm und schüttelte grinsend den Kopf, während er sich eine Kartoffel nach der anderen auf den Teller schaufelte.
»Iss doch einfach direkt aus der Schüssel«, schlug Elani ihm schnippisch vor.
Ich brauchte gar nicht erst an Parla vorbei zu Elani zu sehen, denn ich konnte mir schon vorstellen, welch arroganten Gesichtsausdruck sie gerade zur Schau stellte. Die afrikanische Lichtkriegerin war nämlich so unsympathisch, wie sie schön war. Und sie war wirklich sehr schön.
»Beim nächsten Mal mach ich das vielleicht«, erwiderte Jan gelassen, während er die nun fast leere Schüssel auf den Tisch stellte.
Mir gegenüber saß Martin, der sich lachend die Brille ein Stück höher schob. Wir waren miteinander zur Schule gegangen und ein tragischer Umstand hatte ihn nach Elderstett geführt. Martins Vater war einer der Lichtbringer, dem William Craw die Seele geraubt hatte.
Es war schön, Martin wieder herzlich lachen zu sehen. Die Trauer über den Verlust seines Vaters war ihm noch anzumerken, aber ihm schien das Herz mit jedem Tag leichter zu werden, was wohl größtenteils seiner Mentorin Lien zu verdanken war.
Rina hatte Martin angeboten, dass er im Internat bleiben und neben seiner regulären Ausbildung zum Heilpraktiker die Lehren des energetischen Heilens studieren dürfe. Martin hatte schon immer gewusst, dass ein Heiler in ihm steckte, und er hatte die großartige Chance, die sich ihm hier bot, mit Freuden wahrgenommen. Wir waren also beide so etwas wie Lehrlinge hier im Haus Elderstett. Der Unterschied bestand nur darin, dass ich immer noch keinen Schimmer hatte, was ich mit meinen erlernten Fähigkeiten eigentlich anfangen sollte.
Dummerweise war mir längst klar, dass alles darauf hindeutete, eine Lichtkriegerin zu werden. Aber genau das wollte ich nicht sein. Ich wollte nicht gegen Schwarzmagier und Dämonen kämpfen, auch wenn ich trotzdem immer wieder mitten im Geschehen landete. Rakesh meinte, ich müsste mich jetzt noch nicht entscheiden. Allerdings schwante mir, dass diese Entscheidung längst gefällt worden war und meine Seele nur vergessen hatte, mich darüber zu informieren.
Ja, es war kompliziert …
»Lucia!« Jan schaute mich mürrisch an. »Das Saaahaaalz!«
Leicht entnervt reichte ich ihm den Salzstreuer. »Noch was?«
»Momentan nicht.« Er würzte seinen Kartoffelberg und schob sich etwas davon auf seine Gabel. »Was spukt dir denn heute alles im Kopf herum?«
»Nicht ›was‹«, gackerte Parla sofort, »sondern ›wer‹ …«
Ich spürte förmlich, wie sich daraufhin alle Blicke auf mich richteten. Jan hielt sogar mit dem Essen inne, und das mochte schon etwas heißen.
»Wer denn?«, fragte Lien und beugte sich ein Stück vor, um mich anschauen zu können. Ihre Augen weiteten sich. »Oh! Es geht um Noah, nicht wahr?«
»Pffffffff«, machte ich und winkte ab. »Quatsch, ich …«
Ich stockte, weil mir bewusst wurde, dass es keinen Sinn hatte, diesen Leuten etwas vorzulügen. Sie würden es ja doch erspüren.
»Na, gut«, lenkte ich schließlich ein und verschränkte die Arme. »Er hat immerhin sein Leben für mich riskiert. Da darf ich mir ja wohl noch Gedanken über ihn machen.«
Parla sah mich regelrecht entsetzt an. »Ja, aber natürlich darfst du dir über Noah Gedanken machen! Wie sollte eure Romanze denn sonst anfangen?«
Nun war ich es, die Parla entsetzt ansah. Wusste sie etwa von der Verbindung zwischen mir und Noah? Eigentlich dürfte nur Rina darüber Bescheid wissen. Selbst Rakesh hatte ich bisher nichts von meinen Träumen erzählt, weil ich mich davor scheute, mit ihm über die tiefen Gefühle zu sprechen, die ich darin für Noah empfand.
»Ach, komm schon«, kicherte Parla und stieß mich mit dem Ellbogen an. »Lass mich doch ein bisschen fantasieren.«
Augenblicklich entspannte ich mich.
Lien seufzte verträumt. »Hach, das wäre schon ein wenig wie in einem klassischen Liebesroman. Der heldenhafte Ritter rettet die Prinzessin und verliebt sich in sie …«
Elani gab ein ausgiebiges Würgegeräusch von sich. Damit waren wir wohl zum ersten Mal der gleichen Meinung. Ich konnte Schmonzetten nämlich nicht ausstehen.
»Ich finde es ganz furchtbar, dass Prinzessinnen immer gerettet werden müssen«, sagte ich überzeugt. »Eine echte Prinzessin sollte sich gefälligst selbst retten können.«
Dummerweise hatte das Gespräch mich derart abgelenkt, dass ich Noah und Rakesh erst neben unserem Tisch entdeckte, nachdem ich meine inbrünstige Rede beendet hatte. Mein Herz stolperte, als ich den spöttischen Zug um Noahs Lippen sah. Allerdings blieb sein Blick nur eine Sekunde lang an mir haften, bevor er seine Aufmerksamkeit auf die anderen Lichtbringer richtete.
»So wie es aussieht, werde ich wohl eine Zeitlang bei euch bleiben«, sagte er in die Runde. »Also, mal ganz offiziell – Hi, ich bin Noah.«
Meine Augen schnellten zu Rakesh, der mit versteinerter Miene um den Tisch herum ging und sich auf den freien Platz neben Elani setzte. Es war ihm deutlich anzusehen, dass er mit Noahs Bleiben nicht einverstanden war.
Ganz im Gegensatz zu Parla, die hocherfreut in die Hände klatschte. »Prima! Im Kampf gegen die Bruderschaft ist uns jede Unterstützung willkommen.«
»Der Meinung war Rina auch«, erwiderte Noah und lächelte dabei sogar recht entgegenkommend.
»Komm, setz dich«, forderte Jan ihn auf und klopfte einladend auf den freien Stuhl neben sich.
Noah folgte der Einladung und saß damit ziemlich weit von mir entfernt. Irgendwie war ich froh darüber, denn so fiel es wenigstens nicht auf, dass ich seinem Blick aufs Sorgfältigste auswich. Wobei das gar nicht nötig war. Er sah nämlich sowieso nicht zu mir herüber.
Verkrampft stocherte ich in dem Essen auf meinem Teller herum. Noahs bloße Anwesenheit wühlte mich derart auf, dass ich am ganzen Körper leicht zitterte. Ich bekam nur am Rande mit, wie sich Martin, Lien und Jan bei Noah vorstellten. Erst als Elani an der Reihe war, horchte ich auf.
»Ich bin Elani«, sagte sie freundlich. »Schön, dass wir uns endlich kennenlernen.«
Was zum …?
»Wenn du magst«, sprach sie weiter, »kann ich dich nach dem Essen gern herumführen und dir das Anwesen zeigen.«
Was ging denn bitte mit Elani ab? Frau Ich-hasse-generell-jeden-den-ich-nicht-kenne machte ausgerechnet bei dem undurchsichtigsten Kerl aller Zeiten eine Ausnahme und gab sich so herzlich, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte?
»Sehr gern«, antwortete Noah ihr. »Das Internat scheint ziemlich groß zu sein.«
»Oh ja«, schnurrte Elani. »Es gibt hier viele Winkel und Ecken, in denen man sich gut verstecken kann.«
Meine Gabel landete mit lautem Klirren auf meinem Teller. Ich konnte nicht sagen, ob es jemand mitbekam, denn ich hielt meinen Blick stur auf den Tisch gerichtet, hob die Gabel hastig auf und schob mir ein Stück Karotte in den Mund, obwohl mir gehörig der Appetit vergangen war. Keine Ahnung, ob Noah Elanis offensichtlichen Flirt erwiderte. Ich war nicht fähig weiter zu lauschen, da mein ganzer Körper merkwürdig vibrierte und ich aus meiner eigenen Reaktion nicht recht schlau wurde.
War es Eifersucht, die da gerade durch meine Adern rauschte? Die war aber hier definitiv fehl am Platz. Sie gehörte nämlich der Vergangenheit an, zu einer Inkarnation, in der Noah und ich ein Liebespaar gewesen waren. Im Jetzt gab es für mich überhaupt keinen Anlass, eifersüchtig zu sein.
Ich würgte meinen letzten Bissen hinunter und war heilfroh, als meine Rettung in Form eines Servierwagens in mein Sichtfeld rollte.
»Kann ich bei euch schon was mitnehmen?«, fragte der Junge, der heute Küchendienst hatte.
»Nein!«, rief Jan panisch und schirmte schützend seinen Teller ab.
Beinahe gleichzeitig sprang ich auf und stellte mein Geschirr auf den Wagen.
»Ich helfe dir ein bisschen«, teilte ich dem Jungen mit und kaperte kurzerhand den Servierwagen.
Hauptsache, weg von diesem Tisch.
***
Seit zwei Stunden hockte ich nun schon im Finstern auf meiner Fensterbank und lauschte auf die Geräusche draußen im Flur. Ich konnte ganz genau sagen, wann welcher Lichtbringer in sein Zimmer gegangen war. Nur Elani und Noah waren noch nicht dabei gewesen.
Der Mondschein leuchtete matt über die Konturen meines Bettes. Es war sinnlos, sich jetzt hinzulegen. Ich hätte mich sowieso nur unruhig herumgewälzt und nicht einschlafen können. Da konnte ich genauso gut die glitzernden Lichter der Altstadt durch mein Fenster betrachten und der grauen Katze Mimi den Bauch kraulen. Sie hatte sich in der Kuhle meines angewinkelten Knies eingerollt und schnurrte genüsslich vor sich hin.
Was treiben Elani und Noah nur so lange?
Herrgott! Ich rieb mir hart über die Stirn. Das Gefühlschaos in meinem Inneren brachte erneut meinen ganzen Körper zum Vibrieren. Es fühlte sich fast so an wie Mimis Gebrumm unter meiner linken Hand. Ich konnte immer noch nicht sagen, was sich da alles in mir regte. Es war einfach ein riesen Batzen aus allen möglichen Gefühlen, der mich wie eine zähe Masse umwaberte.
»Azariel, hilf mir bitte!«, flehte ich inständig.
»Wobei?«, fragte er.
»Was soll ich mit all diesen Gefühlen tun, die in mir feststecken?«
»Gefühle wollen gefühlt werden, nicht wahr?«, erwiderte er.
»Aber das versuche ich doch schon die ganze Zeit!«, rief ich genervt.
»Tust du das wirklich?«
Ich verzog das Gesicht, denn Azariel hatte natürlich recht. Die ganze Zeit über hatte ich mich auf meine körperliche Wahrnehmung fixiert, statt die Emotionen wirklich zu durchfühlen.
Während ich darüber nachdachte, drangen endlich Geräusche vom Flur zu mir herein. Sofort hob ich Mimi von meinem Bein, ignorierte ihr protestierendes Miauen, sprang auf und huschte zur Tür. Dort verharrte ich in leicht gebückter Stellung und lauschte.
Schritte. Zwei Personen. Sie hielten ungefähr auf Höhe des Gemeinschaftsraums inne. Dann waren Stimmen zu hören. Elani lachte.
Mir entwich ein Schnauben. Erschrocken presste ich mir eine Hand auf den Mund. Gleichzeitig kam ich mir unheimlich bescheuert vor, aber das hielt nur so lange an, bis ich plötzlich Noahs Stimme vernahm. Ich verstand seine Worte nicht, drückte daher mein Ohr gegen die Tür und hielt sogar den Atem an. Der Inhalt des Gesprächs blieb mir trotzdem verborgen. Kurz darauf hörte ich das leise Klicken einer Zimmertür.
Dann war es für einen Moment still.
Noah war doch nicht etwa mit zu …?