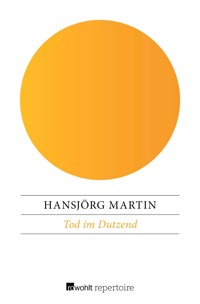9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Kurzgeschichten sind über einen Zeitraum von mehreren Jahren entstanden. Sie stehen Martins Romanen in nichts nach – die Handschrift des Autors bleibt unverkennbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Blut an der Manschette
Kriminalstories
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Diese Kurzgeschichten sind über einen Zeitraum von mehreren Jahren entstanden. Sie stehen Martins Romanen in nichts nach – die Handschrift des Autors bleibt unverkennbar.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Blut an der Manschette
Die Sache ist mehr als zwei Monate her, aber sie steckt mir noch in den Knochen wie eine schlecht auskurierte Grippe. Die irre’Angst der ersten Tage ist allerdings vorbei. Es ist unwahrscheinlich, daß ich jetzt noch mit Dorettes Tod in Verbindung gebracht werde.
Zum Glück war es ja auch die ganze Zeit über sehr einsam dort. Nahezu ausgeschlossen, daß mich irgend jemand jemals hat kommen oder weggehen sehen, zumal es meist Abend war, wenn sie mich mit ihrem unauffälligen Wagen vom sechs Kilometer entfernten Bahnhof abholte, und fast immer noch – oder schon wieder – dunkel, wenn sie mich wegbrachte oder wenn ich zum Bus ging.
Das Schlimmste an der Geschichte war ja auch nicht die Angst vor Entdeckung – obschon vieles, wenn nicht sogar alles kaputtgegangen wäre, falls sie es rausgekriegt hätten, daß ich in jener Nacht bei Dorette war. Meine Ehe wäre bestimmt in die Brüche gegangen – und damit ganz zwangsläufig auch das Geschäft, denn es gehört zu sechzig Prozent Erikas Vater. Erika ist meine Frau.
Das Schlimmste war auch nicht der Schreck und nicht die rabiate Prügelei – ich wußte ja nicht, daß es um Leben und Tod ging.
Auch der spitze Schrei, den Dorette ausstieß in ihrer Angst, war nicht das Schlimmste, und auch das Blut nicht, das ihr aus dem weißblonden Haar über die Stirn lief und auf die Schulter und auf ihre schönen Brüste tropfte, ehe sie zusammenbrach.
Das alles war nicht so schlimm wie die Stille hinterher!
Diese entsetzliche Stille ist mir – so komisch das klingt – in den zwei Monaten seither nicht aus den Ohren gegangen … Nichts im nächtlichen Haus gab ein Geräusch von sich. Nicht einmal eine Uhr tickte. Meine Armbanduhr war zerbrochen bei der blöden Rangelei. Die große Standuhr im Wohnraum nebenan hatte Dorette angehalten, wie immer, wenn ich bei ihr war:
«Die Zeit soll stehenbleiben, solange du hier bist, mein Geliebter!» hatte sie jedesmal gesagt.
Sie hatte öfter solche Marlitt-Anwandlungen. Es zog mir zwar immer in die Zähne wie ein Biß in eine Zitrone, wenn sie so was sagte: «Wir sind ein Leib, Liebster!» oder: «Mein Blut pulsiert nur für dich!» – aber ich nahm es in Kauf, denn ihre sonstigen Qualitäten wogen diese Sprüche und Sentimentalitätsanfälle reichlich auf.
Erstens war sie hübsch … Nun ja, nicht mehr allererste Jugend. Sie hat mir ihr Alter nie gesagt; ich habe auch nicht danach gefragt. Ich weiß nur, daß sie Widder war. Aber ich schätze, sie muß so Mitte Dreißig gewesen sein … Na, vielleicht auch Ende Dreißig. Aber wirklich richtig hübsch anzuschauen, gut zu riechen und fein anzufassen.
Zweitens war sie vermögend und – nach einer neunjährigen Ehe mit einem offenbar unheimlich tyrannischen Mittsechziger – so voller Selbständigkeitsdrang und Emanzipationsideen, daß keinerlei Gefahr bestand, sie am Hals zu haben wie einen zu engen Frackhemdkragen.
Drittens bis neunundsechzigstens war sie, ebenfalls infolge der Ehe mit dem superkorrekten Korinthenkacker, hungrig nach Zärtlichkeit in allen Schattierungen, wie ein Waisenkind nach Bonbons. Und es machte Spaß, ihr Bonbons zu liefern; ich lieferte ihr alle Sorten, die ich kannte und mochte, und ein paar neue Mischungen erfanden wir dann noch gemeinsam.
Das Haus, das der Verblichene (den ‹Gatte› zu nennen bei den Assoziationen, die dieses Wort hervorruft, eine Übertreibung wäre) – das Haus also, das er ihr hinterlassen hatte, lag am Rand einer Mittelstadt zwischen meinem Heimatort und Frankfurt. Direkt am Wege, sozusagen, denn ich habe beruflich zwei-, dreimal im Monat in Frankfurt zu tun.
Es war somit die Gelegenheit, die Diebe macht. Eine reizende, einsam gelegene Gelegenheit, hübsch eingerichtet, mit einem guten Bett und immer gefüllten Kühlschrank und Barschrank. Ich hätte ein Mönch oder ein Eunuch sein müssen, wenn ich sie nicht genutzt hätte, als sie mir – inklusive Bewohnerin – geboten wurde.
Sie wurde mir geboten, als ich nach einem der periodischen Ehekräche mit meiner sonst reizenden Frau Gemahlin (wegen irgendeiner Nichtigkeit, ich weiß nicht mehr …) wütend in den Speisewagen des Intercity ging, der mich nach Frankfurt bringen sollte. Ich hatte die Absicht, mich ein wenig zu betrinken und zu vergessen, was zu Hause für böse Worte und Töne gefallen und ertönt waren. Ja, und da saß die Dame allein an einem der Zweiertische und sagte nicht nein, als ich fragte, ob der Gegenüberplatz frei sei.
Sie sagte auch nicht nein, als ich sie fragte, ob ich sie zu einem Cognac einladen dürfe, und sie sagte anderthalb Stunden und fünf Cognacs später immer noch nicht nein, als ich ihr anbot, in F. mitauszusteigen und ihr beim Koffertragen zu helfen. Ich durfte ihr den Koffer vom Bahnsteig zum Taxi tragen, vom Taxi bis zur Tür des hübschen, einsam gelegenen Hauses und von der Haustür über die rustikal möblierte Diele bis ins Schlafzimmer mit dem breiten, schönen Bett. Dort mußte ich erst mal Luft schnappen, ja … Und sie half mir beim Luftschnappen, bis wir beide völlig außer Atem waren.
Ja, so hat das angefangen, vor gut einem Jahr. Es war wirklich ein gutes Jahr. Ich genoß das Doppelleben, kam mir ungeheuer verrucht vor und freute mich immer, wenn ich in F. ausstieg, sie wiederzusehen und bei ihr außer Atem zu kommen. Ich freute mich allerdings auch, wenn ich’s heute bedenke, nach zwölf oder sechzehn oder im Höchstfall mal vierundzwanzig Stunden, wieder in den Zug steigen und nach Hause fahren zu können, wo es nicht so atemlos zuging und wo niemand sagte: «Wir sind ein Leib, Geliebter!» oder ähnlich schreckliche Sachen … Nein, der jeweilige Abschied von Dorette ist mir, wenn ich ehrlich sein soll, nie schwergefallen, wenn ich auch ihr zuliebe immer so getan habe, als könne ich mich gar nicht trennen. Was tut man nicht alles aus Nächstenliebe.
Es wäre falsch und irgendwie unfair ihr gegenüber, wenn ich heute sagen wollte, daß mir der Abschied in der Nacht vor zwei Monaten besonders leicht gefallen ist … Aber das war ja kein Abschied – das war eine Flucht. Eine Flucht vor dem Schrecklichen, vor der Toten, vor der entsetzlichen Stille, in der nicht einmal eine Uhr tickte …
Ich hatte den Mann zuerst gesehen. Das heißt, ich hatte den Schatten gesehen, den er warf.
Wir lagen in dem schönen, breiten Bett und erholten uns von der ersten Atemlosigkeit. Dorette duselte halbschlummernd an meiner Seite. Ihr nackter Arm lag quer über meiner Brust. Ich zog sachte die Daunendecke darüber, damit sie sich nicht erkälte, denn es war eine kühle Mainacht, und wir hatten die Terrassentür offengelassen, weil es von draußen so gut nach Flieder duftete.
Ich sah zuerst die Hand, die sich an der Tüllgardine zu schaffen machte, und dann den Schatten auf dem Vorhang. Einen, wie mir schien, sehr großen Schatten … Langsam schob sich der Kopf des Mannes zwischen Vorhang und Gardine ins Zimmer.
Ich konnte nicht viel erkennen, denn draußen schien der Mond ziemlich hell. Der Mann hatte lockiges Haar, das unter einer Schiffermütze hervorquoll, und er trug eine Art Overall. Das Gesicht blieb unter dem Mützenschirm verborgen, nur einmal, als sich der Mann kurz nach links wandte, sah ich seine Nase. Es war eine große, gerade Nase, fast klassisch geformt, wie bei Michelangelos David in Florenz … Ich weiß nicht, wieso mir der gebildete Vergleich einfiel, denn sonst fiel mir in diesem Moment überhaupt nichts ein.
Ich hätte aufspringen oder wenigstens schreien sollen, als er noch nicht im Zimmer war. Dann wäre er vermutlich schleunigst abgehauen, und ich könnte heute noch bei Dorette übernachten, weil sie dann sicher noch am Leben wäre … Hätte und wäre und könnte – der Konjunktiv macht keinen wieder lebendig; er macht Geschehenes nicht ungeschehen und Fehler nicht rückgängig.
Ich schrie nicht. Ich sprang nicht auf, um den Eindringling zu verjagen. Ich blieb still neben der schlummernden Dorette liegen, die ihm den Rücken zuwandte, und beobachtete ihn.
Er konnte uns nicht sehen, da das Bett im Dunkeln stand, in einer Art Alkoven, in den vom Fenster und von der Terrassentür her kein Licht fiel. Er schlich quer durch das Schlafzimmer zur Dielentür, die nur angelehnt war … Ich frage mich heute noch, woher er die Räumlichkeiten so gut kannte. Vielleicht war er als Handwerker mal im Haus gewesen und hatte sich alles gründlich angesehen und gemerkt. In der Diele, neben der Tür zum Wohnraum, stand eine Vitrine, in der Dorette wertvolles Porzellan aufgestellt hatte. In den Schubladen darunter, nur mit einem einfachen Schlüssel versperrt, der meistens auch noch steckte, bewahrte sie ihren Schmuck auf und meistens auch Bargeld. Auch darüber schien der Mann Bescheid zu wissen. Ich hörte, wie sich leise ein Schlüssel in einem Schloß drehte. Eine Schublade knarrte. Porzellan klirrte zart.
Mich überkam die Wut. Na warte! Na warte! dachte ich; so einfach denn nun auch wieder nicht … Ich stand leise auf. Ich stand nackt neben dem Bett und überlegte. Dann ging ich auf Zehenspitzen zur Dielentür, die der Mann hinter sich wieder angelehnt hatte, und schob sie auf.
Da kniete er vor der Vitrine und sortierte im Schein einer kleinen Taschenlampe in aller Seelenruhe aus, was er mitnehmen wollte. Auf einem Tuch, das er neben sich ausgebreitet hatte, lag schon die kleine Schmuckkassette Dorettes, ein Bündel Banknoten und verschiedenes Silberzeug.
Ich habe das Dämlichste getan, was in der Situation möglich war. Splitternackt, ohne wenigstens einen Bademantel anzuhaben, in dessen Tasche eine Waffe hätte stecken können – splitternackt stand ich da und sagte: «Hände hoch!»
Der Mann erschrak, blickte hoch, knipste die Taschenlampe aus und sprang mich an, ehe ich bis drei hätte zählen können, wenn ich zu zählen versucht hätte.
Ich knallte gegen einen Stuhl. Der Stuhl fiel polternd um. Ich krallte die Hände in den Overall des über mir Liegenden und wehrte so gut es ging seine Schläge ab, indem ich mich duckte.
«Da kam Dorette. «Hilfe!» sagte sie. Sie schrie nicht; sie sagte halblaut «Hilfe!». Dann schaltete sie das Deckenlicht in der Diele ein und begann wortlos den Mann von mir wegzuzerren. Sie war ebenfalls nackt.
Ich stieß dem Mann mein Knie in den Unterleib. Er stöhnte. Von zwei Seiten attackiert, verlor er die Nerven. Er bekam einen Bronzelöwen zu fassen, der auf einem Sims stand, und schlug damit um sich. Mich verfehlte er, aber Dorette traf er, ehe ich sie beiseite stoßen konnte, voll auf den Scheitel.
Sekundenlang stand sie wie gelähmt. Das Blut lief ihr über die Stirn und tropfte auf die Brust. Und dann, ohne einen Laut von sich zu geben, brach sie zusammen.
Der Mann grunzte erschrocken.
Ich rief: «Dorette!» und lief zu ihr und beugte mich über sie und ließ den Burschen einfach laufen – husch, durch die Diele, ins Schlafzimmer … Weg war er.
Der doppelthandgroße Bronzelöwe lag auf dem schönen roten Teppich aus Belutschistan und wackelte noch ein Weilchen. Dann lag er still. Dorette lag auch still. Ich sah, wie ihre Augen brachen. Ich kauerte neben ihr in der kühlen Diele und versuchte, meine Gedanken zu ordnen, die wie Ameisen durcheinanderliefen, in deren Bau jemand einen Stock gesteckt hat.
Polizei! dachte ich. Mordkommission … Dann dachte ich Skandal! Und schon krabbelten auch die anderen Ameisen dazwischen: Ruin …, Ehebruch … Bloßnichtsdamitzutunhaben … Die Angst- und Fluchtgedanken-Ameisen wurden immer zahlreicher und schlugen die Bürgerpflicht-Ameisen aus dem Felde.
Und es bemächtigte sich meiner im Handumdrehen eine Geschäftigkeit, die nahe an Panik kam.
Ich zog mich an, wobei mein linker Manschettenknopf quer durch die Diele bis unter den Kopf der toten Dorette rollte, was mir einen Schauer über den Rücken jagte; dann suchte ich meine Siebensachen zusammen. Den Plan, überall meine Fingerabdrücke abzuwischen, gab ich als zwecklos auf – ich hatte keine Ahnung, was ich in diesem Haus alles angefaßt hatte im Laufe der Zeit. Ich räumte nur mein Cognacglas weg, wusch es aus und stellte es in den Gläserschrank; ich leerte den Aschenbecher ins Klo und löschte die Lichter. Dann verließ ich, die Tür hinter mir zuziehend, den nun plötzlich so grauenvollen Ort, an dem die eine Hälfte meines Doppellebens … Nun, das war vorbei. Nur weg!
Ich lief mit meiner Reisetasche durch leere nächtliche Straßen eine gute Stunde lang zum Bahnhof, traf dort kurz nach drei Uhr früh ein und hatte Glück, zehn Minuten später einen D-Zug zu kriegen, der hauptsächlich aus Schlaf- und Liegewagen bestand und von Paris nach Kopenhagen unterwegs war. Nach fünf schlaflosen Stunden Bahnfahrt traf ich am Vormittag mit wundgelaufenen Gehirnwindungen zu Hause ein. Ich schützte Kopfschmerzen vor und schickte mich an, ins Bett zu gehen. Erika, meine Frau, brachte mir heiße Milch mit Honig ins Badezimmer. Das ist ihr Allheilmittel gegen Unbill aller Art, vom Bowlenkater bis zum Seelenschmerz, Halsweh und Magenverstimmung eingeschlossen. Sie blieb stehen, bis ich das Glas ausgetrunken hatte. Für Widerstand war ich zu schwach, also trank ich es schnell, obschon ich die klebrige Süße nicht ausstehen kann.
Als sie zufrieden hinausging, nahm sie meine Wäsche mit. «Was hast du denn mit deinem Hemd gemacht?» fragte sie noch beiläufig.
«Mit meinem … Wieso?»
«So komische Flecke», sagte sie, «sieht aus wie Blut an der Manschette.»
«Blut? An der Manschette?» Ich war plötzlich heiser. «Vielleicht hab ich mich beim Rasieren geschnitten im Zug. Die Holperei …»
«Seit wann rasierst du dich, wenn du dein Oberhemd schon anhast?» fragte sie noch, aber dann erlosch ihr Interesse; sie ging hinaus und überließ mich dem Badewasser mit Fichtennadelschaum.
Das ist jetzt acht Wochen her. Oder, ganz genau, 57 Tage.
Seither ist nichts mehr geschehen. Es ist wirklich unwahrscheinlich, daß ich mit Dorettes Tod jetzt noch in Verbindung gebracht werde.
Ich kann, glaube ich, wieder frei atmen und will mir darauf eben einen Cognac genehmigen. So quasi als Memorial für die arme Dorette … War schon ein reizendes Persönchen! Verdammt schade, daß es so enden mußte. Wir hätten noch viele Bonbons miteinander … Prost, Dorette!
Erika kommt und bringt die Post. «Seit wann säufst du am hellichten Vormittag?» fragt sie mit einer Mischung aus Spott und Indignation.
«Ich fange gerade damit an!» gebe ich zurück und gieße mir trotzig noch einen zweiten ein, obwohl mir gar nicht der Sinn danach steht. «Willst du auch einen?» frage ich provozierend.
«Ja», sagt sie zu meiner Überraschung.
Sonst trinkt sie nie Cognac. Schon gar nicht am Vormittag. Ich stehe auf, hole ein Glas und gieße ihr auch einen ein. «Prosit!» sage ich. «Es möge nützen!»
«Skål!» sagt sie, kippt die edle Flüssigkeit hinter, schüttelt sich, lächelt und geht zur Tür. «Ich muß nach dem Essen sehen», sagt sie noch. «Wenn in der Post was Wichtiges ist, sag mir Bescheid, ja?»
«Ja, natürlich!» murmle ich und greife nach dem Bündel Drucksachen und Briefe, das sie mir auf den Schreibtisch gelegt hat.
Das Wichtige ist ein Brief aus F. Er stammt von einem Rechtsanwalt Dr. Schubert. Rechtsanwalt und Notar.
Sehr geehrter Herr Jansen, schreibt der Rechtsanwalt und Notar, durch eine Reihe unglücklicher Umstände hat unser Büro erst vor fünf Tagen vom tragischen Ableben unserer Mandantin, Frau Dora Bärwinkel, bis zu ihrem Tod am26. 5. wohnhaft gewesen … usw. … Nachricht bekommen. Das istvor allem daraus zu erklären, daß Frau B. ihre Vermögens- und Liegenschaftsangelegenheiten bei einem anderen Kollegen bearbeiten ließ, während sie bei uns lediglich ihr Testament hinterlegt hatte.
Bei der Eröffnung dieses Testaments am … folgt Datum … ist nun festgestellt worden, daß Frau B. Sie als Haupterbe eingesetzt hat. Da das Vermögen, das an Sie fällt, nicht unbeträchtlich ist, bitte ich Sie hiermit höflichst, sich umgehend mit mir in Verbindung setzen zu wollen, damit wir uns über die Modalitäten Ihres Erbantritts auseinandersetzen können.
Mit vorzüglicher Hochachtung … Unterschrift.
Heiliger Sankt Florian – verschone unsre Häuser, zünd andern ihre … Was, zum Teufel, soll ich tun?
Das Erbe einfach ablehnen? Einen Cognac! Mein Herz klopft bis in die Lippen. Sie beben, als ich trinke.
Erika kommt. Ich kann den Brief gerade noch verschwinden lassen.
«Was Wichtiges?» fragt sie.
«Nichts Besonderes …»
«Ach ja», sagt sie, «ehe ich’s vergesse: Da hat vorhin, als du unter der Dusche warst, ein Mann angerufen. Komischer Kerl, von irgendeiner Behörde; ich hab’s nicht verstanden … Ob du am 26. Mai verreist warst, wollte er wissen. Ich habe gesagt, keine Ahnung; er sollte dich selber fragen. Er kommt mal vorbei im Laufe des Vormittags … Warst du denn am 26. Mai verreist?»
«Das weiß ich doch auch nicht aus dem Handgelenk», sage ich. «Ich bin ziemlich oft verreist, nicht wahr?»
«War das nicht, als du krank zurückkamst?» fragt sie. «Und als du dich so doll beim Rasieren geschnitten hattest, daß deine Manschette …?»
«Kann sein …» Ich zucke die Achseln. Mir ist sterbenselend.
«Wozu will denn der das wissen?» fragt sie. «Komisch … Kannst du dir denken, wozu er das wissen will?»
«Nein», sage ich. Dann hebe ich den Kopf: «War das …?»
«Ja», sagt sie, «es hat geschellt … Bleib nur – ich mach schon auf.»
Pistolen bringen manchmal Glück
Am Abend meines 31. Geburtstags, als ich feststellte, daß ich vierzehn Jahre, fast die Hälfte meines Lebens, gearbeitet hatte, ohne recht voranzukommen, entschloß ich mich, auf andere Weise reich und glücklich zu werden.
Ich hatte es satt, jeden Wochentagmorgen um halb sieben Uhr aufzustehen, sommers und winters in der vollen Straßenbahn stadtwärts zu fahren, müde zwischen ebenso müden, mißmutig zwischen ebenso mißmutigen Mitmenschen.
Ich mochte nicht mehr von acht bis fünf in dem entsetzlichen Großraumbüro sitzen, das nach den neuesten Erkenntnissen der Arbeitsplatzpsychologen gebaut worden ist – und vielleicht darum besonders schwer zu ertragen. Ich wollte nicht mehr täglich achteinhalb Stunden – mit einer Mittagspause von dreißig Minuten und lieblos gekochtem Fraß in der (ebenfalls psychologisch durchdachten) Kantine – Zahlenkolonnen kontrollieren, die vor mir bereits eine Rechenmaschine und zwei andere Buchhalter kontrolliert hatten.
Es hing mir ellenlang zum Hals heraus, die Wochenenden in meiner teilmöblierten Anderthalbzimmerwohnung zu verschlafen, aus Langeweile in dämliche Filme zu laufen, stundenlang fernzusehen, aus Einsamkeit mit fremden Frauen schlafen zu gehen, die ich in dem Vorstadttanzetablissement kennenlernte und die ebenso sauer auf ihr Leben waren wie ich.
Ich hatte es satt, auf irgendein Wunder zu warten, das doch nicht kommen würde, und jeden Zehn-Mark-Schein dreimal umzudrehen, ehe ich ihn auszugeben wagte. Ich hatte mein kleines, enges Büroangestelltendasein satt, mein ganzes kleines, enges Leben – satt, satt, satt! Und ich pfiff auf die idiotische Hoffnung, durch Fleiß aus der Misere zu kommen, im Lotto zu gewinnen, oder was es in dieser Scheißgesellschaft so an Trostpflästerchen für Leute wie mich gibt.
Eine Weile hatte ich mal mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen, weil ich bemerkt hatte, daß man da mit dem Mundwerk was werden kann, daß da schon viel Dümmere als ich was geworden waren; aber dann konnte ich mich für keine der bestehenden Parteien richtig erwärmen. Die einen waren mir zu heuchlerisch, zu verlogen; die anderen waren mir zu kleinkariert, um echte Aussicht für den Sieg ihrer an sich guten Idee zu gewährleisten – sie würden die Weltveränderung, die sie propagierten, schon über einer neuen Leseordnung in städtischen Büchereien aus den Augen verlieren. Und die dritte Partei … Also, ich weiß nicht mehr, was ich gegen die dritte Partei hatte, aber da war auch irgendwas.
Am Abend meines 31. Geburtstags gab ich alle diese absurden Gedanken auf, verwarf den Glauben an das Glück von oben oder durch Schweiß auf der Stirn und entschloß mich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Ich beschloß, eine Bank zu berauben. Und zwar möglichst bald.
Aber natürlich nicht übereilt und kopflos, denn ich hatte erkannt, daß zu einem solchen Unternehmen neben einigem Mut vor allem Intelligenz gehört und daß Geduld eine der weiteren Voraussetzungen für das Gelingen ist. Zunächst war ich darauf aus, mir einschlägige Lektüre zu beschaffen und diese zu studieren …
Es gibt erstaunlich viel Literatur über das Thema. Meist sind es zwar Schilderungen mißglückter Raube, Überfälle und Einbrüche, doch auch diese interessierten mich, weil man aus den Fehlern anderer am ehesten und leichtesten lernen kann. Das gilt für alle Bereiche. Ich habe mal ein paar Wochen was mit einer verheirateten Frau gehabt, die mir gleich am Anfang erzählt hatte, wie schrecklich ihr Mann als Liebhaber sei. Und ich hatte aus ihren Schilderungen entsetzt erkannt, daß ich die gleichen gedankenlosen Fehler bisher gemacht hatte. Von da an bin ich in dieser Hinsicht immer überaus erfolgreich gewesen … Doch zur Sache:
Die Lektüre war überaus zeitraubend und durchaus nicht immer interessant, zumal die meisten Beschreibungen sich mit den großen Banküberfällen befaßten, bei deren bloßer Erwähnung noch ganze Generationen von Ganoven vor Bewunderung feuchte Augen kriegen. Das waren alles Überfälle oder Einbrüche gewesen, die von mehr oder weniger gut organisierten, mehr oder weniger erfolgreichen Banden ausgeführt worden waren. Das heißt, bei genauem Hinsehen waren diese Banden eigentlich nicht so besonders erfolgreich gewesen. In 99 von 100 Fällen waren sie geschnappt worden – entweder weil einer gequatscht hatte oder weil ein anderer mit dem jähen Reichtum plötzlich durchdrehte und die Puppen hatte tanzen lassen.
So eine Banden-Sache war aber ohnehin nichts für mich; das kam nicht in Frage. Denn abgesehen davon, daß ich nicht gewußt hätte, wo ich Komplicen hätte suchen und finden können – ich bin von Natur aus ein Einzelgänger, und mein Instinkt sagte mir, daß ich bei einem solchen Vorhaben auch nur als Einzelgänger Erfolg haben könnte.