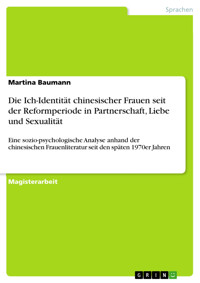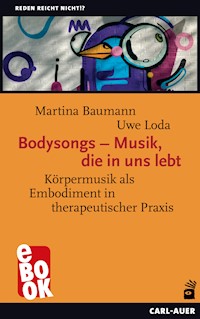
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reden reicht nicht!?
- Sprache: Deutsch
Körpermusik und Bodysongs sind relativ neue Werkzeuge in der Therapielandschaft. Sie machen Freude, aktivieren und beruhigen das Nervensystem und fördern die Gesundheit. In diesem Buch zeigen Martina Baumann und Uwe Loda, wie es gelingt, verkörperte Musik tiefgehend und nachhaltig ins Spiel zu bringen, sie mit einer hypnosystemisch-psychotherapeutischen Praxis zu verbinden und auch für musikaffine Kolleg:innen aus anderen Berufsfeldern anschlussfähig zu machen. Körpermusikalische Stimm- und Rhythmusspiele, ausgewählte Lieder sowie online bereitgestellte Videobeispiele runden das Buch ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die im vorliegenden Buch besprochenen Videos sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQF8Gc3PwITs6_7wtvtPPiZetaGgy3c5P
Martina Baumann, Uwe Loda
Bodysongs – Musik, die in uns lebt
Körpermusik als Embodiment in therapeutischer Praxis
Mit einem Geleitwort von Maja Storch und einem Vorwort von Andreas Gerber
2023
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe: »Reden reicht nicht!?«
hrsg. von Michael Bohne, Gunther Schmidt und Bernhard Trenkle
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Umschlagfoto: © Richard Fischer • www.richardfischer.org
Notengrafiken: Silke Wittenberg, Illustrationen: Johanna Graul
Redaktion: Veronika Licher
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2023
ISBN 978-3-8497-0477-3 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8432-4 (ePUB)
© 2023 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografìe; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Geleitwort von Maja Storch
Vorwort von Andreas Gerber
Einleitung
Teil 1: Rahmungen
1 Verortung
Was sind Bodysongs?
Musikalisches Embodiment
Was ist Körpermusik?
Körpermusik ist Menschheitssprache
Körpermusik ist Muttersprache
Körpermusik in der Musiktherapie
Körpermusik ist psychosomatischer Gesundheitserreger
Betriebsklima und Gesundheit
»Betriebsklima« als Metapher für psychosomatische Gesundheit
Weitere Perspektiven zum Verständnis von Gesundheit
Die Resonanzachsen nach Hartmut Rosa
2 Zutaten der Körpermusik – ein Feld ansteckender Gesundheit
Rhythmus – am Anfang war der Groove
Singen – »forever young«
Spielen – frei und verbunden
Ruhen – »sound of silence«
Teilen – alles ist willkommen
Der Kreis – die Mischung macht’s
Teil 2: Praxisfelder
Wie Körpermusik und Bodysongs sich in unseren Praxisfeldern ereignen – und gelingen können
3 Gesundheitserregende Körpermusikspiele
Spiele für einen guten Anfang
Mitmachen
»Call and Response« aus dem Atem
»Call and Response« aus dem Beat
Freunde finden
»Forget the Police«
»Betreutes Fluchen«
»Cogito ergo sum« – ich summe, also bin ich
Vertiefende Stimmspiele
Verlautbarung in drei Schritten
»Schattensingen«
Duo-Singspiel in fünf Stufen
Duo-Singspiel in fünf Stufen für eine Gruppe mit Solisten
Die »Rhythm Sound Machine«
»Circle Singing«
4 Die Universen der Bodypercussion und ihre Verknüpfung mit Liedern
Einführung in die Bodypercussion
Was ist Bodypercussion?
Bodypercussion – eine alte Sprache des Körpers
Bodypercussion und Lieder – unsere ersten Experimente
Wie Bodypercussion Wirkung zeigt
Spielformen der Bodypercussion
Die Bodypercussion-Sprache
Die Spielform »Kaskadien« – ein Hauch von Keith Terry
Das Bruniversum
Der QPA-Style
Rhythmische Schrittmuster als Basis für Bodysongs und Körperstimmspiele
5 Bodysongs
Lieder als Blumen im Garten der Musik
»Nur Mut« – Wie Bodysongs einladen, ermutigen und anstecken
»Ein kleines Lied«
»Spirit of the Wind« – Checkpoints und wie ein Bodysong seinen Weg in ein therapeutisches Setting findet
Wie wir Bedenken und Ängsten vor aktiver Musikbeteiligung begegnen
Der Vorhang geht auf für »Spirit of the Wind« – Wie wir einen Bodysong lernen können
»Ich nehme mir die Zeit« – Bodysongs und Ordnungszustände (States)
Bodysongs verwandeln auf die sanfte Tour
»Ich lass mich in Ruhe« – raus aus der Anstrengung
»Mach das Jetzt zum roten Faden«
»Du machst nichts falsch in deinem Leben«
»Be still my soul« – ein rhythmusbasierter und tranceinduzierender Bodysong
Bitte ein Lied – wir haben was zu verdauen!
Das Phänomen Trance in einem rhythmusbasierten Bodysong
»Ich bin schön, wenn ich singe« – neue Räume nach Traumaerleben
»Nach und nach kommen alle Dinge zur Ruhe« – Bodysongs und die energetische Wirkung des Klopfens
Was geschieht, wenn wir mit Klopf- und Stimulationstechniken arbeiten?
Bodysounds: Berühren – Bewegen – Begleiten
»In mir klopft es« – die Tragkraft von Bodysongs in Zeiten der Trauer
»Salaleo« – Körpermusik als Kulturträger
Spielen mit gezielter Verstörung – wofür ist es gut?
Einfach ist sexy
Wenn Leichtigkeit und Tiefe zusammenkommen
»Sei willkommen!« – Körpermusik und Bodysongs in Playshops und Seminaren
»Es darf sein, das was ist«
»Herzensweite«
6 Selbstgeschöpfte Bodysongs
Wie wir innere Anteile zum Klingen bringen
Frau F. – Wie ein therapeutischer Prozess in einen Circle Song mündet
Die »Problem-Lösungs-Gasse«
Musik, die in uns wohnt
Transfer, Nachhaltigkeit und Selbstmanagement mit musikalischem Embodiment
Bodysongs – hilfreiche Begleiter auf Schritt und Tritt
7 Grundannahmen und Haltungen der Körpermusik als Gesundheitserreger
8 Ausblick
Was hat sich bisher ereignet?
Wie Körpermusik anschlussfähig ist – Transfererfahrungen von Kolleg:innen
Wie könnte es weitergehen? – Resümee und Blick in die Zukunft
Danksagung
Literatur
Zitierte oder abgebildete Liedtexte und Noten
Empfohlene weiterführende Noten- und Liederbücher
Webseiten der Komponist:innen
Über die Autorin und den Autor
Geleitwort
Potzblitz, was für ein Buch!
Noch nie in meiner ganzen Laufbahn als Psychologin ist mir jemals eine Übung für »betreutes Fluchen« (S. 58) begegnet. Diese Übung beinhaltet ganz viel von dem, was dieses Buch auszeichnet. Sie ist außergewöhnlich und überraschend. Sie zeigt, dass Martina Baumann und Uwe Loda keine Angst vor Tabubrüchen haben. Sie beweist auch, wie sorgfältig und liebevoll die beiden ihre Klientel an die Hand nehmen, um sie mit sich selbst und ihrem Körper in Kontakt zu bringen. Und: Die Übung ist mit Sicherheit lustig, befreiend und enthemmend.
Baumann und Loda erweitern die allgemeine Embodiment-Thematik, die glücklicherweise mittlerweile immer mehr Interesse erfährt, um den musikalischen Aspekt. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass die Möglichkeit, sich mit Musik auf den Heilungsweg zu machen, eine unerlässliche Ressource darstellt. Da in unserer Kultur der freie Körperausdruck, der natürliche Bewegungsdrang und der Gebrauch der Stimme den kreatürlich-spontanen Kindern abtrainiert wird (»Sitz endlich still, gib Ruhe, sei leise!«), steht man in der Psychotherapie vor der Aufgabe, diese verschütteten Ressourcen wieder freizulegen.
Baumann und Loda kriegen das hin und zwar mit äußerstem Feingefühl und ausgeprägter Sanftheit. Wenn ich mir vorstelle, als gehemmter Mensch bei ihnen in einer Bodysong-Gruppe mitzumachen, dann könnte ich mich ihrer Führung vorbehaltlos anvertrauen, denn die Beschreibungen ihrer Vorgehensweise sind von Rücksicht und Behutsamkeit geprägt. Natürlich dürfen viele Übungen in Lebenslust und Ausgelassenheit münden, aber auf dem Weg dahin muss man nie einen Schritt gehen, der ungute Gefühle hinterlassen würde.
Dieses Buch ist ein Fundus-Buch. Baumann und Loda teilen darin ein Lebenswerk mit uns. Wer sich professionell mit Musik, Tanz und Körperarbeit beschäftigt, wird Übungen in Hülle und Fülle finden. Die Anleitungen zu den Übungen sind so präzise, dass man sofort damit arbeiten kann. Darum wird dieses Buch vermutlich bei allen Profis mit vielen Klebe-Markierungen versehen und heftig benutzt werden.
Auch wissenschaftlich-theoretisch Interessierte kommen auf ihre Rechnung, denn Baumann und Loda haben die wesentliche Literatur zur ihrer Thematik aufbereitet. Wer mal ganz schnell zur Orientierung schmökern möchte, dem empfehle ich die Darstellung der Fallgeschichte von Frau F. auf Seite 177. Man sieht hier bestens, wie die Autorin und der Autor den individuellen Bodysong einer Patientin erarbeiten, ihn mit Hilfe der Gruppe ausformen und gestalten und wie sie den Übergang zum Selbstmanagement außerhalb des geschützten Raumes der Gruppe herstellen.
Die Embodiment-Ansätze genauso wie die Musik- und Tanztherapie sind durch dieses Buch um eine ganz entscheidende Etappe weitergekommen. Es ist überflüssig, diesem Buch viele Lesende zu wünschen (was ich natürlich trotzdem tue), denn ich bin überzeugt, es wird sich von alleine durchsetzen, einfach deswegen, weil es saugut ist.
Potzblitz, Martina Baumann und Uwe Loda, ich gratuliere! Musikalisch wäre das ein Trommelwirbel mit Tusch.
Maja Storch
Zürich, im Januar 2023
Vorwort
Wenn die Augen zu leuchten beginnen, der Körper warm wird und die Stimme sich mit den Rhythmen im Flow zu verweben beginnt: dann ist Körpermusikzeit!
Gibt es etwas Schöneres, als mit anderen Menschen sein Lied zu singen? Im Musizieren finden wir die Resonanzräume, in denen die Sehnsuche uns zu uns selbst, zueinander und in die klangzauberhafte Welt der Rhythmen führt. Man könnte auch sagen: Die Musik findet uns – in unserem Zuhause, dem Körper.
Martina Baumann und Uwe Loda haben das Kunststück gewagt, ihre Spiel-, Arbeits- und Übungswege der Körpermusik in Worte zu bringen, und dabei ihre eigene Domäne – die Bodysongs – ins Zentrum gestellt. Das ist ein Glücksfall für alle spiel- und lernfreudigen Praktiker:innen in therapeutischen Berufsfeldern. Und es ist ein inspirierender Fundus für Menschen, die am Zusammenspiel von Gesang und Bodypercussion – eingebettet in körperlichem Erleben und tiefem Zuhören – interessiert sind. In ihrem Buch entfaltet sich eine Fülle von Spielideen und Werkzeugen, sowohl für den niederschwelligen Neukontakt mit der eigenen verschütteten, eingeschüchterten oder eingeschlafenen Körpermusikalität als auch für einen aufbauenden therapeutisch begleiteten Entwicklungsprozess, bis hin zum eigenen Bodysong als Ausdruck von Selbstwirksamkeit, Eigenart und Schönheit.
Diese Arbeit braucht über die menschlich-therapeutische Kompetenz hinaus eine große Liebe zur Musik und eine Beheimatung in der Kunst der Improvisation. Immer wieder stelle ich mir beim Lesen die Autor:innen vor und freue mich – denn: Hier schreiben zwei hochkompetente und tiefsensible Musiker:innen, bei denen kein Ohr trocken bleibt. Ihr stilistisches Spektrum geht von Folk und Jazz bis zu Rhythmus- und Klangköstlichkeiten aus den Weltmusikküchen.
Ich wünsche diesem Buch viel Resonanz und vor allem neugierige offene Leser:innen, damit es dazu beitragen kann, dass viele Menschen sich in der Körpermusik neu wiederfinden können und die friedensstiftenden Kräfte, die darin spielen und walten, sich entfalten – außen wie innen.
Andreas Gerber
Januar 2023
Einleitung
»Jenseits von Richtig und Falsch gibt es einen Ort – treffen wir uns dort.«
Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī1
Wofür dieses Buch? Wir wollen Sie, liebe Lesende, neugierig machen auf ein Phänomen, das uns fasziniert und unsere Herzen höherschlagen lässt. Es ist das Phänomen, auf die Musik, die in unserem Körper wohnt, zu hören und mit ihr »jenseits von Richtig und Falsch« zu spielen. Körper und Stimme werden zu Musikinstrumenten. Eigensinn und Gemeinsinn, Lautstärke und Leisestärke, Zartheit und Wildheit können »unter einer Decke stecken«. Wir haben die Gewissheit, dass das, was sich da unter der Decke befindet, ein Inkubationsraum für neue, gesundheitserregende Erfahrungen ist und dass diese Erfahrungen für viele therapeutische Anwendungsfelder von Bedeutung sind.
Körpermusik kann zu einer Form der Gesundheit einladen, die weit darüber hinausgeht, sich selbst zu optimieren. Unser Musizieren in der Körpermusik ist eingebettet in ein Zusammenspiel mit anderen. Wenn wir uns im Kreis musikalisch begegnen, miteinander Schritte gehen oder ein Lied singen, dann stimmen wir uns aufeinander ein. Die Einstimmung und die Magie des Kreises können in ein Erleben von körperlich gegründeter Sicherheit und seelisch erfahrbarer Verbundenheit hineinführen. Von Teilnehmenden wird dies beschrieben als »ich fühle mich im Einklang mit mir und der Welt und so lebendig«. Im Einzel- und im Gruppensetting haben wir die Möglichkeit, unsere eigenen Bodysongs zu schöpfen und mit den jeweiligen Prozessschritten zu verbinden.
Die Gewissheit, dass die vielfältigen Spielformen der Körpermusik die eigenen Freude-Netzwerke befeuern, unser Nervensystem aktivieren – oder auch beruhigen – können und darüber hinaus soziale Gesundheit fördern, hat uns motiviert, dieses Buch zu schreiben.
Kursteilnehmende aus den unterschiedlichen therapeutischen und (heil)pädagogischen Feldern entdecken das Potenzial der Körpermusik und erkennen die Anschlussfähigkeit an ihre eigenen Methoden und Arbeitsfelder. Musikaffinität und Neugierde scheinen die Schlüssel zu sein, die körpermusikalischen Elemente zu integrieren.
Möge dieses Buch auch diejenigen anregen, die in Musik oder Musiktherapie bereits tätig sind. Vielleicht werden Sie neugierig auf weitere Perspektiven und Herangehensweisen, die Ihre bereits vorhandenen Musikschätze zu vertiefen vermögen und Ihren Handlungsspielraum erweitern. Viel Freude wünschen wir Ihnen beim Lesen und Ausprobieren der Spielformen und Lieder und beim Verknüpfen mit Ihren eigenen Landkarten.
Nun wollen wir Ihnen einen Überblick verschaffen, wohin die Reise geht. Worte und Gedankengänge können wir nur hintereinander formulieren. Das heißt aber nicht, dass Sie diese hintereinander lesen müssen.
In unserer praktischen Lehrtätigkeit können wir uns im gemeinsamen Raum den Wirkweisen der Körpermusik spiralförmig annähern und sie am eigenen Leibe erfahren. Wir können im Prozess des Lernens im Kreise Gleichgesinnter (Baldwin u. Linnea 2014) wechseln zwischen theoretischer Rahmung, praktischem Spiel, Feedbackschleifen, eigener Selbsterforschung und gemeinsamer Reflexion. Deshalb laden wir Sie ein, auch beim Lesen Ihren eigenen Rhythmen und Vorlieben zu folgen und damit zu spielen. Lassen Sie sich finden und fühlen Sie sich frei, dorthin zu blättern, wo es Sie hinzieht.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert, die wir Rahmungen und Praxisfelder nennen. Dies entspricht der Struktur unseres Curriculums »Körpermusik und Bodysongs in Musik-, Psychotherapie, (Heil-)Pädagogik und Palliative Care«, das wir seit 2018 in München und Heidelberg anbieten.
Teil 1: Rahmungen
In Kapitel 1 definieren wir, was wir unter Bodysongs und Körpermusik verstehen. Zudem wird der Begriff »musikalisches Embodiment« eingeführt. Die Begriffe mögen im ersten Moment exotisch und fremd wirken. Wir machen Sie mit ihnen vertraut und stellen sie in einen Zusammenhang, der uns aufzeigt, dass Körpermusik eine ganz ursprüngliche, menschliche Erfahrung ist.
Nun kommt die Psychosomatik ins Spiel. Was bedeutet Gesundheit im umfassenden Sinne und inwieweit ist verkörperte Musik gesundheitsförderlich? Bei diesen Fragestellungen verwenden wir die Metapher vom »Betriebsklima«, wie wir sie bei Gunther Schmidt kennengelernt haben. Wir nutzen weiter das Konzept der Resonanz von Hartmut Rosa, das uns sehr hilfreich erscheint bei der Beschreibung der Phänomene, die im Zusammenhang mit gesungenen, verkörperten Liedern entstehen.
In Kapitel 2 bekommen Sie schon ein wenig mehr Geschmack von den Elementen der Körpermusik. Es geht um die einzelnen Grundzutaten und wie diese – Rhythmus, Spielen, Singen, Teilen, Ruhen und der Kreis – zu einem gesundheitserregenden Zaubertrank werden, wenn die Mischung stimmt.
Teil 2: Praxisfelder
Der zweite Teil des Buches ist ein Praxisteil. Nun werden die Zutaten in Zusammenhang gesetzt mit konkreten Werkzeugen und Spielformen, wie wir sie in der Psychotherapie und Seminararbeit anwenden.
In Kapitel 3 widmen wir uns exemplarisch ausgesuchten Spielen, die wir als die Zellkerne der Körpermusik bezeichnen. In dieser Fundgrube finden Sie Spielanleitungen und bekommen Anregungen, in welche Räume diese Spiele (ent)führen können.
In Kapitel 4 stellen wir Ihnen Schritt für Schritt einzelne Bodypercussion-Styles vor. Wir zeigen auf, wie wir diese mit Liedern verknüpfen und daraus Bodysongs entstehen. Kleine Lehrvideos, die online bereitstehen,2 vermitteln Ihnen davon einen lebendigen Eindruck und ein Gefühl für die Machbarkeit.
In Kapitel 5 widmen wir uns den Bodysongs in unterschiedlichen Anwendungsfeldern. Anhand ausgewählter Lieder werden zahlreiche Fallbeispiele aus Einzelbegleitungen, Gruppen- und Seminararbeit dargestellt. In kleinen Schritten wird vermittelt, wie wir die Lieder moderieren und sie mit Bodypercussion in den Körper bringen. Hier wird ein Innenblick auf die intra- und interpersonellen Wirkungsräume transportiert, die sich im Zusammenspiel mit Bodysongs in der Musik- und Psychotherapie eröffnen.
Wenn wir mit Bodysongs im therapeutischen Setting arbeiten, kommen wir mit verschiedenen Fragen und Themen in Berührung. Wie fange ich an? Welche Hürden und Anfangsschwierigkeiten gibt es zu beachten und welche Werbeschleifen sind hilfreich, um Einzelne oder eine Gruppe auf den Geschmack zu bringen? Jedes von uns vorgestellte Lied wird in Zusammenhang mit einem Phänomen oder einer für uns relevanten Fragestellung gesetzt. Wir nehmen die Lieder zum Anlass, uns mit den Bodysongs und ihrer Relevanz für therapeutische Themen auseinanderzusetzen: vom »guten Anfang« und dem Beachten sogenannter »Checkpoints« zu kreativer Verstörung, dem Einbinden von Flow und Stateveränderungen hin zu Selbstregulation und der Tragkraft von Liedern. Natürlich stoßen wir dabei auf Lieder als mögliche Lösungsräume für bestimmte Problemphänomene.
In Kapitel 6 widmen wir uns den aus einem therapeutischen Prozess entstandenen Liedern, den selbstkreierten und selbstgeschöpften Bodysongs. Hier geht es um das Verklanglichen, Versinglichen und Verkörpern innerer Persönlichkeitsanteile, von Affirmationen oder inneren Wünschen und weiteren Anliegen in einer hypnosystemisch orientierten Psychotherapie. Hier finden Themen wie Selbstwirksamkeitserleben, Transfer und Nachhaltigkeit durch musikalisches Embodiment ihren Platz. Vom Problem-Lösungs-Rap bis hin zum Dirigieren eines Innere-Anteile-Orchesters können Sie sich dort von der Vielfalt der Herangehensweisen inspirieren lassen.
Wir schließen unseren Praxisteil in Kapitel 7 mit einer Zusammenfassung unserer Haltungen und Grundannahmen, die bereits implizit in den Beispielen transportiert wurden. Die Haltungen könnte man auch ganz an den Anfang stellen als Ergebnis langjähriger Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Sie sind der Praxis abgelauscht und von Theorien inspiriert. Insofern passen sie für uns an das Ende des Buches. Sie stehen in enger Korrespondenz mit dem Feld der Hypnosystemik,3 mit dem wir seit mehr als 30 Jahren verbunden sind.
Im Ausblick in Kapitel 8 beschäftigt uns die Frage, wie Kolleg:innen die Körpermusik bereits in ihre Arbeitsfelder hineintragen und wie diese sich insgesamt weiterentwickeln könnte. Außerdem sind wir gespannt, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, als sich selbst organisierende Wesen die Anregungen aufnehmen, weiterverarbeiten und zu Ihrem machen werden.
In der Wissenschaft und in der Sprache der Musik haben sich viele Anglizismen etabliert. So sprechen wir bspw. von Embodiment, Bodysongs, Loops, Groove, Beat oder Styles. Gerade in der Musik stehen Wörter wie Groove für ein dynamisches, energetisches Ereignis, das sich nur schwierig übersetzen ließe. Als gewordenes gemeinsames Kulturgut greifen wir insofern gerne auf diese Begriffe zurück.
1 Vgl. Rosenberg 2003, S. 31.
2 Verfügbar unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQF8Gc3PwITs6_7wtvtPPiZetaGgy3c5P.
3 Der Begriff »Hypnosystemik« stammt von Gunther Schmidt. Er hat den Begriff Anfang der Achtzigerjahre vorgeschlagen, um »ein Modell zu charakterisieren, das versucht, systemische Ansätze für Psychotherapie und Beratung […] mit den Modellen der kompetenzaktivierenden Erickson’schen Hypno- und Psychotherapie zu einem konsistenten Integrationskonzept auszubauen« (Schmidt 2018, S. 7). In der sysTelios Klinik werden die Konzepte mit den jeweiligen therapeutischen Fachrichtungen wie Musik-, Kunst-, Körper- und Gesprächspsychotherapie verknüpft, in die klinische Praxis umgesetzt und weiterentwickelt.
Teil 1: Rahmungen
1 Verortung
»Aus der Perspektive des Traumlandes sind Körpersymptome ungesungene Lieder […]. Krankheit ist einfach ein Koffer voller unausgepackter musikalischer Geschenke. Ihre Symptome sind nicht bloß Teil eines kranken Körpers, sondern eine Gruppe paralleler Welten, die darauf warten, ›gesungen‹ zu werden.«
Arnold Mindell (2006, S. 109)
Was sind Bodysongs?
Als Bodysongs bezeichnen wir Lieder, bei denen der Körper als rhythmisches Begleitorchester mit ins Spiel gebracht wird. In Form von Klatschen, Schnipsen, Stampfen, Klopfen und anderen »Bodysounds« macht der Körper die Beats. Ein Bodysong ist also Singen in Bewegung, bei der körperliche Selbststimulation das Singerlebnis erweitert. Jedes Lied kann so zu einem Bodysong werden.
Bodysongs können auch im Verlauf eines therapeutischen Prozesses entwickelt werden. Die im therapeutischen Beziehungsraum entstehende Musik wird in feiner Detailarbeit »festgeklopft«. Diese Neuschöpfung aus Text, Melodie und Verkörperung dient uns zur Verankerung eines bestimmten Erlebens oder therapeutischen Ziels. Diese persönlichen, verkörperten Lieder können zu nachhaltigen Begleitern auf Schritt und Tritt werden.
Nehmen wir jene Bodysongs noch dazu, die spontan aus den Momenten gemeinsamen Spielens entstehen, könnte man von drei Arten von Bodysongs sprechen:
bereits existierende Lieder, die wir mit dem Körper als Instrument begleiten und bereichern
selbstgeschöpfte Bodysongs, die manifest und »festgeklopft« werden und sich mit Wünschen und Zielen verbinden
»Pusteblumen«-Bodysongs, die beim körpermusikalischen Spielen oder im therapeutischen Prozess aus dem Raum des Unwillkürlichen spontan entstehen und auch wieder vergehen.
All diese Formen von Bodysongs stellen Facetten der Körpermusik dar, denn sie sind verkörperte Musik. Und weil verkörperte Liedereinfach nicht so schön klingt, nennen wir sie Bodysongs und bezeichnen den Prozess des In-den-Körper-Bringens als musikalisches Embodiment oder Musikembodiment. Schon wieder so ein Anglizismus – doch er lohnt sich.
Musikalisches Embodiment
Unter musikalischem Embodiment verstehen wir den Prozess des Verkörperns von Musik. Der Begriff lehnt sich an die multidisziplinäre Wissenschaft des Embodiment und seine Konzepte an. Embodiment heißt wortwörtlich übersetzt Verkörperung. Embodimentkonzepte in der klinischen Psychologie und in den Neurowissenschaften meinen damit, dass Gedanken, Geist und Psyche in einen Körper eingebettet sind und der Körper immer mit im Spiel ist (Storch u. Tschacher 2016, S. 32; Storch et al. 2017). Eine zentrale Annahme dieser Konzepte ist die Wechselwirkung bzw. das ineinander Verwobensein von körperlichem und psychischem Geschehen. »Jeder Gedanke und jedes Gefühl haben eine sogenannte sensomotorische Komponente« (Storch, Jäger u. Klöckner 2021, S. 11). Die Embodimentkonzepte sind nicht nur spannend für die Körpermusik, sondern auch für jegliche Art des Musizierens. So wie es kein Denken ohne Körper gibt, so wie es kein Gefühl ohne Körper gibt, so gibt es auch kein Musizieren ohne Körper. Das musikalische Tun ereignet sich in zirkulärer Wechselwirkung von Körper-Geist-Seele. Das eine gibt es nicht ohne das andere.
Das Bewusstsein über diese bidirektionale und multidimensionale Wechselwirkung zwischen Körper und Musik eröffnet uns neue Handlungsräume und Ausrichtungen für Therapie und soziales Zusammensein mit Musik. Die Embodimentkonzepte bieten einen theoretischen Rahmen und aus ihnen lassen sich therapeutische Interventionen ableiten. Sie zeigen uns, wie der Körper mit uns kommuniziert und wir mit ihm.4
Wenn wir ein Lied singen, es mit dem Körper als Rhythmusinstrument begleiten, hat dies eine Rückkoppelungswirkung auf unser eigenes Erleben und das Erleben unserer Mitwelt. Wenn wir Musik machen, versetzen wir unser inneres System und unsere Umgebung in Schwingung. Wir sorgen für eine bestimmte Schwingungsumgebung, in die wir selbst miteingebettet sind. Die Ziele und Absichten können hierbei sehr unterschiedlich ausfallen. Musikalisches Embodiment bestaunt und nutzt die offensichtlichen und gleichzeitig geheimnisvollen, zum Teil in Vergessenheit geratenen musikinduzierten Wechselwirkungsprozesse in der Therapie, im menschlichen Zusammensein oder zur eigenen Selbstfürsorge.
Was ist Körpermusik?
Körpermusik ist Musik, die wir mit unserem Körper machen. Der Körper wird zum eigentlichen Musikinstrument. Stimme, Hände, Füße, Mund – der ganze Körper erzeugt Melodien, Rhythmen, Klänge und Harmonien. Der Körper drückt sich dabei musikalisch aus. Die Wortschöpfung »Körpermusik« haben wir im Rahmen einer gleichnamigen Ausbildung kennengelernt. Deren Begründer, Andreas Gerber und Karin Enz-Gerber, lehren eine Kombination aus Stimm- und Körperarbeit, TaKeTiNa® Rhythmuspädagogik, Bodypercussion und Improvisation.
In Abgrenzung zur Körpermusik wird der Anglizismus Bodymusic für verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks verwendet. Gesang, Tanz und Bodypercussion werden miteinander verbunden, wie wir es in vielen Kulturen vorfinden. Schuhplattler, Gumboot Dance, Capoeira, Irish Dance und viele mehr – all das sind soziale, rituelle und künstlerische Formen aktueller Körpermusik, deren Wurzeln weit in die Vergangenheit reichen.
Diese Verortung setzt die Körpermusik, wie wir sie als Praxis zur Potenzialentfaltung in Therapie und Seminararbeit anwenden, in einen historischen Sinnzusammenhang. Sie verdeutlicht, wie heilsam und gesundheitserregend Körpermusik sein kann und warum es naheliegt, in Musik- und Psychotherapie sowie anderen therapeutischen oder pädagogischen Feldern von diesem »Zaubertrank« zu kosten. Wir erfinden also das Rad nicht neu, sondern nutzen uralte Wirkungsweisen und kombinieren diese mit unserer therapeutischen Haltung und Praxis in der Gegenwart.
Körpermusik ist Menschheitssprache
Musik mit dem Körper war und ist ein in allen Kulturen der Menschheit verankerter Bestandteil sozialen Zusammenseins. Sie dient dem Zeitvertreib, der Feier des Lebens, der Anbetung der Götter, dem Vollzug kollektiver und intimer Beziehungsrituale, der Bewältigung schwieriger Lebensereignisse und der Abwehr von Bedrohung und Mühsal. Übergänge des Lebens werden seit jeher mit Musik begleitet und vollzogen. Es gibt keine Kultur ohne Musik, Tanz und Gesang. Musik als Teil menschlicher Lebenskunst und Alltagskultur verändert unser Bewusstsein, induziert heilsames Tranceerleben, fördert Gemeinsinn, ordnet soziale Gruppen, bildet Gemeinschaft und fördert Resilienz. Der Arzt, Musiker und Musikmediziner Eckart Altenmüller beschreibt dies in seinem Buch Vom Neandertal in die Philharmonie (Altenmüller 2018): Musik, Klänge, Laute und Rhythmen können, noch bevor es spezielle Musikinstrumente gab, als erste Sprache des Menschen bezeichnet werden.
Körpermusik ist Muttersprache
Körpermusik wird uns in die Wiege gelegt, sogar schon, bevor wir geboren werden. Wir hören das Herz der Mutter als Embryo im Mutterleib ca. 26 Millionen Mal (Berendt 1983). Rhythmus ist für das ungeborene Kind »die Trägerwelle für die Signale, die von seiner Mutter kommen« (Flatischler 2012, S. 14). In der Musiktherapieforschung wird von »Körpermusik der Mutter« im intrauterinen Erleben des Kindes gesprochen. Hier taucht der Begriff Körpermusik als pränatale Beziehungserfahrung auf (Decker-Voigt, Oberegelsbacher u. Timmermann 2008, S. 115 ff.). Säuglinge werden mit Summen, Schaukeln, Wiegen von ihren Bezugspersonen großgezogen. Dieses Call-and-Response-Phänomen des »frühen Dialoges« und all seine vielfältigen Rhythmen und Melodien werden von uns als Urerfahrung tief in unser kollektives und persönliches Körperwissen aufgenommen. Der Säugling erlebt diese Körpermusik im Sinne einer frühen Resonanz als »einfühlende Wahrnehmung« und »stimmige Beantwortung« (vgl. Bauer 2019, S. 24 ff.). Instinktiv greifen wir in späteren Lebensphasen auf diese Formen der Selbstregulation und Selbstberuhigung zurück. Auch können wir Menschen am Ende ihres Lebens oder in schwerer Erkrankung mit basaler Körperberührung und basaler Musik erreichen, beruhigen und begleiten. Körperliche Musik dient der Gestaltung einer sicheren Beziehung, besonders da, wo wir noch oder wieder sprachfern sind.
Mit körperlicher Musik erfahren wir Angenommensein, Aufgehobensein, In-Beziehung-Sein, tiefste Sicherheit, Freude und Körperglück. Mütter, Väter, Großmütter, Großväter, Erzieher:innen, Pflegende singen, summen und praktizieren Körpermusik, ohne es so zu bezeichnen.
Körpermusik in der Musiktherapie
In den vielfältigen musiktherapeutischen Praxisfeldern wird körperliches Musizieren in das musiktherapeutische Behandlungskonzept integriert (Decker-Voigt, Oberegelsbacher u. Timmermann 2008, S. 20 ff.). In der Neonatologie, in der Neurorehabilitation, in der Arbeit mit schwerst- und mehrfachbehinderten Menschen sowie in der Geriatrie und der Arbeit mit schwerstkranken oder sterbenden Menschen wird auf einfachste Elemente der Körpermusik zurückgegriffen, ohne den Begriff explizit zu verwenden (Baumann u. Bünemann 2020; Decker-Voigt, Oberegelsbacher u. Timmermann 2008). Musik als basale Stimulation und elementare Beachtung im Sinne von somatischer Resonanz erreicht Menschen auf nicht sprachlicher, nicht intellektueller Ebene. Komapatienten bspw. nehmen wahr, was atmosphärisch, körperlich, stimmklanglich und musikalisch um sie herum passiert. In musiktherapeutischen Konzepten wird körpermusikalische Zuwendung als essenzielle therapeutische Intervention beschrieben.
Aber nicht nur dort, wo der Körper das »Hauptsorgenkind« ist, sondern auch in der psychotherapeutischen Musiktherapie, in der integrativen Gestaltmusiktherapie ereigneten sich schon immer Verknüpfungen, in denen Körper, Stimme, Bewegung und Tanz miteinbezogen wurden (z. B. Hegi 1986; Rittner u. Hess 1994; Petzold 1988). Auch hier erfinden wir das Rad nicht neu. Was ist nun das Neue?
Körpermusik ist psychosomatischer Gesundheitserreger
Was zieht uns an der Körpermusik so an? Wieso und womit macht sie einen Unterschied? Warum hat es nach 20 Jahren Musiktherapie bei uns klick gemacht, als wir begonnen haben, uns deren Elemente als Teilnehmende der zweijährigen Ausbildung »Körpermusik« bei Andreas Gerber und Karin Enz Gerber anzueignen? Wieso ist diese Körpermusik auch für andere Kolleg:innen so attraktiv?
Die Körpermusik, wie wir sie anwenden, ist eine auf Singen in Bewegung basierende gesundheitserregende Praxis, die über den Begriff Therapie weit hinausgeht. Sie kann ohne jeglichen therapeutischen Kontext existieren und einfach Bereicherung sein zur eigenen Potenzialentfaltung, in der Seminararbeit, in der Selbstfürsorge oder als Form eines gemeinschaftsbildenden sozialen Zusammenseins. In den letzten 25 Jahren konnten wir bemerken, dass strukturierte und moderierte Übungen als Form der Praxis zunehmend Eingang in therapeutische Settings gefunden haben. Dies gilt auch bspw. für therapeutisches Taiji oder das von Jon Kabat-Zinn entwickelte Stressbewältigungstraining durch Achtsamkeit (Kabat-Zinn 1990). Auch die Körpermusik kann als Praxis einerseits für sich stehen und andererseits als Element der Musikpsychotherapie fungieren.
Wie hat sich die Körpermusik nun in unsere Art der Musikpsychotherapie eingeschlichen? Wir vermuten, dass es an den Körperglückserfahrungen des Singens in Bewegung liegt. Die Wirkung ist ansteckend und springt auf uns Behandelnde über. Wir begeben uns gemeinsam in einen Fluss. Dieses Baden im Fluss ist für alle Beteiligten eine Erfrischung mit regenerativer Wirkung.
Auch hypnosystemische Konzepte, Trauma- und Resilienzforschung betonen die regenerative Funktion von gemeinsam erlebten Körperglückserfahrungen. Diese bilden einen Gegenpol zu den schmerzlichen oder traumatischen Körpererinnerungen und dienen uns als Ressource im Umgang mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen und Herausforderungen. Gesang, Tanz und rhythmische Bewegung aktivieren »traumaferne Aktionssysteme wie Neugierde, Spiel und positive Bindung« (Nottelmann 2019, S. 38), sie fördern Freude und Wohlbefinden (Schmidt 2018, S. 33 ff.; van der Kolk 2016). In diesem Sinne verstehen wir Körpermusik als musikalisches Embodiment mit gesundheitserregenden Wirkfaktoren.
Uns interessieren die synchronisierende, stabilisierende Wirkung von bereits vorhandenen Liedern und rhythmischen Räumen sowie das Spiel mit dem Unwillkürlichen. Bei Letzterem sind wir ganz im Sinne einer hypnosystemischen Haltung neugierig, wie wir Symptome (bspw. Ängste, Depressionen, Traumafolgestörungen, komplizierte Trauerprozesse, Schmerzen) in Bedürfnisse übersetzen können. Und weiter musikalisch dekliniert: wie wir Bedürfnisse in Klänge, Stimmklänge, Körperklänge und letztlich in eigene, aus dem Prozess heraus geschöpfte Lieder transferieren können.
Unsere Erfahrungsgrundlage sind die Anwendungsfelder in der sysTelios Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, in der wir auf der Grundlage hypnosystemischen Denkens und Handelns musiktherapeutisch arbeiten. Hier experimentieren wir täglich, die neuen Formen der Körpermusik in die Musikpsychotherapie zu integrieren oder sie als ein gruppenübergreifendes Angebot zu etablieren. Außerdem bieten wir Körpermusik als Selbstfürsorgeangebote, Seminare und Weiterbildungsformate sowie als Kraftquellentage für Menschen an, die in der Hospizarbeit tätig sind. Wenn wir also postulieren, Körpermusik sei ein psychosomatischer Gesundheitserreger, was verstehen wir dann unter Gesundheit?
Betriebsklima und Gesundheit
»Betriebsklima« als Metapher für psychosomatische Gesundheit
In unserer langjährigen Praxis haben wir die Erfahrung gemacht, dass Körpermusik das innere Klima eines Menschen sowie das einer Gruppe verändern kann. »Betriebsklima« ist in diesem Zusammenhang als Metapher für psychosomatische Gesundheit zu verstehen. Dr. Gunther Schmidt verwendet dieses Bild im Rahmen seiner Vorträge in der sysTelios Klinik. Er bezieht sich dabei u. a. auf Konzepte des Soziologen und Systemtheoretikers Niklas Luhmann (Luhmann 2020). Der Begriff möchte vermitteln, wie das komplexe, autopoietisch funktionierende System Mensch als biosozialpsychisches Wesen mit anderen eigenständigen und komplexen Umwelten interagiert. Ein komplexes System wie das der menschlichen Gesundheit funktioniert nicht nach Ursache-Wirkungs-Mechanismen. Es ist umgeben von verschiedenen Umwelten, die als weitere Systeme in Kommunikation mit dem eigenen menschlichen System stehen.
So können wir musikalische Impulse geben und Angebote machen, die als klimatische Umweltbedingung möglicherweise Wirkung entfalten können. Teilnehmende als eigenständige komplexe Systeme sind autonom und frei darin, ob und wie diese Impulse beantwortet werden. Was wie wirkt, können wir als Behandelnde nicht wissen.
Wir können beobachten und erfragen, welches Erleben sich zeigt, ob es in eine gewünschte Richtung geht und welche Auswirkungen das hätte. Dieser fragende Ansatz, verbunden mit dem Generieren von Feedbackschleifen, ist eines der wichtigen Paradigmen hypnosystemischer Praxis (Schmidt 2018). Wir fragen nach, würdigen unser Gegenüber und laden dann in mögliche Lösungsräume ein, die einen Unterschied machen könnten.
Aus hypnosystemischer Sicht sind wir nicht nur der oder die eine. Wir sind ein vielstimmiges Orchester innerer Persönlichkeitsanteile und wir sind auch mehr als nur die Summe aller Persönlichkeitsanteile. Wir sind das Zusammenspiel der Anteile, eingebettet in die weiteren Umwelten. Dieses wirkt auf das Betriebsklima. Musik kann dabei als Schwingungsträgerin und Königin der Synchronisation auf innere Dialoge und Anteile Einfluss nehmen. Musik kann das innere Zusammenspiel fördern, sodass das Wirksamwerden von Selbstheilungskräften auf selbstorganisierte Weise ermöglicht wird.
Weitere Perspektiven zum Verständnis von Gesundheit
Gesundheit wurde 1946 in der Präambel der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert als
»ein Zustand von vollständigem, physischen, geistigen und sozialen Wohlbefinden, der sich nicht nur durch die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung auszeichnet«5.
Muss Gesundheit wirklich vollständig sein? Das Konstrukt einer vollständigen Gesundheit wird in neueren Diskussionen kontrovers betrachtet. Mehr und mehr geht es, ähnlich wie beim Gesundheitsbegriff in Palliative Care und Hospizarbeit, um ein subjektives Wohlbefinden angesichts widriger Umstände bzw. angesichts dessen, was ist (Hammer 2019; Hornberg 2016).
Die aktuellen Konzepte der modernen Gesundheitswissenschaften lehnen sich an den Begriff der Salutogenese von Antonovsky (1997) an. Gesundheit gilt hier als die Fähigkeit eines Systems, sich selbst zu regulieren. Gesundheit stellt keinen statischen Zustand dar, sondern einen lebendigen Prozess. Gesundheit ist aktiv, in sich dynamisch und besitzt eine körperliche, eine psychische und eine soziale Dimension. In der Psychoneuroimmunologie spricht man von neurobiopsychosozialer Gesundheit und den vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Körper, Seele und Geist (Schubert 2015). Gesundheit kann auch nicht nur durch naturwissenschaftliche und medizinische, sondern muss zusätzlich durch psychologische, soziologische, ökonomische und ökologische Analysen erforscht werden (Petzold 2020). Theodor D. Petzold spricht vom Begriff der ansteckenden Gesundheit (ebd.), den wir auch gerne im Zusammenhang mit körpermusikalischen Erfahrungen verwenden. Wenn wir nun die exemplarisch ausgewählten Gesundheitsbegriffe betrachten, können wir zusammenfassen:
Die Resonanzachsen nach Hartmut Rosa
»Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung.«
Hartmut Rosa (2016, S. 13)
Hartmut Rosa beschreibt in seinem Buch (ebd.), auf welche Weise wir in Resonanz mit der Welt gehen und sie mit uns: Wir fühlen uns gesund, wenn wir im Einklang mit der Welt sind und sie mit uns. Die Bahnen, auf denen sich die bidirektionale Resonanz »Mensch–Welt« ereignet, bezeichnet Rosa als Resonanzachsen. Diese sind für ihn Metapher für das, was aktiv ist, wenn wir den Draht zur Welt aufspannen und sie den Draht zu uns. Dann erfahren wir ein In-der-Welt-Sein, in dem wir uns aufgehoben und getragen fühlen. Für Rosa ist Resonanz das, was der Mensch braucht, um sich gesund zu fühlen, im Sinne dessen, im Einklang zu sein mit dem, was ist. Krankheit hingegen wäre das Verstummen auf jeglichen Achsen.
Wir können auf vielfältige Weise Resonanz erfahren. Die ersten Achsen, auf denen der Mensch als Säugling Weltbeziehung erfährt, sind Körper und Stimme, »weil die menschliche Weltbeziehung zunächst eine leibliche ist …« (ebd., S. 71).
Rosa spannt den Begriff der Resonanz im Weiteren auf und spricht von drei Hauptachsen der Welt-Mensch-Beziehung – der horizontalen (Draht zu Familie und Gesellschaft, Freundschaften), der vertikalen (Kunst, Religion, Spiritualität, Natur, Geschichte) und der diagonalen Achse (Objektbeziehungen, Sprache, Bildung).
Rosa erwähnt hierbei die Musik als ein ganz besonderes, quasi übergreifendes Phänomen des In-der-Welt-Seins, welches in alle drei Resonanzdimensionen hineinreicht. Musik kann in die vertikale, die horizontale und die diagonale Beziehung zur Welt hineinspielen. So gehen wir mit ihr in spirituelle Tiefen oder Höhen, sie führt in den sozialen Raum und sie kann Sprache, Gedanken und Ideen transportieren. Gleichzeitig ermöglicht sie immer auch eine Resonanz mit unserer Innenwelt.
So schreibt er über das Chorsingen, Musik, insbesondere mit der Stimme, erzeuge
»in den gelingenden Momenten eine Tiefenresonanz zwischen seinem Körper und seiner mentalen Befindlichkeit zum Ersten, zwischen sich und den Mitsingenden zum Zweiten, sowie die Ausbildung eines kollektiv geteilten physischen Resonanzraumes […] zum Dritten. Dieser ganz wesentlich leiblich-physische Resonanzzusammenhang wird es ihm schwermachen, sich wenigstens vorübergehend nicht im Einklang mit sich und der Welt zu fühlen« (ebd., S. 112).
Rosas Resonanzkonzept entspricht unseren Erfahrungen mit der Körpermusik im Kreis. Seine Ausführungen haben uns inspiriert und uns ein tieferes Verständnis zur Verfügung gestellt, um das in Worte zu fassen, was aktiv wird, wenn wir im Kreis stehen, uns Blicke zu werfen, uns mit der Stimme begegnen und gemeinsame Schritte gehen. In der Körpermusik erfahren wir ein Feuerwerk der Resonanz, es laufen mehrere Drähte heiß, die uns mit uns selbst und mit der Welt verbinden. Wir erfahren ein In-Einklang-Sein mit uns und der Welt, das gesundheitserregend und gesundheitsförderlich ist.
Welche Drähte sind das im Besonderen?
4 Storch und Tschacher bezeichnen in ihrem Buch Embodied Communication jegliche Kommunikation zwischen Menschen in Präsenz als verkörperte Kommunikation. Sie sprechen von den Qualitäten »Aufmerksam sein […], Augen auf […], Ohren auf« (Storch u. Tschacher 2016, S. 122 ff.). »AAO« sei das Geschenk, das wir uns als Menschen geben, wenn wir aufmerksam kommunizieren – dann erleben wir Stimmigkeit, Verstandenwerden und Empathie insbesondere in therapeutischen Beziehungen. Kommunikation mit offenen Augen, offener Präsenz und offenen Ohren ermögliche es, »optimale Randbedingungen für ein Stimmigkeitsgefühl und gelingende Selbstorganisation zu schaffen« (ebd., S. 123). In der therapeutischen Musik können wir dieses Geschenk der Stimmigkeit hautnah erleben.
5 Deutschsprachige Übersetzung verfügbar auf der Webseite des Bundesrates der Schweiz unter: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/201405080000/0.810.1.pdf [26.7.2022].