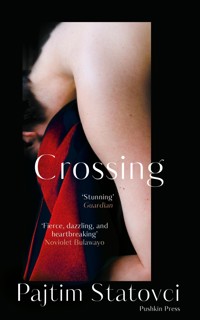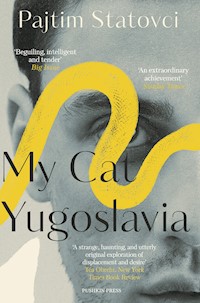17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie lebt man ein Leben, das sich nicht nach dem richtigen anfühlt? Eine unmögliche Liebe vor dem Hintergrund des Balkankriegs: Zwei Männer auf der Suche nach Heimat und einem selbstbestimmten Leben.
Pristina, 1995: Arsim ist zweiundzwanzig und frisch verheiratet mit einer Frau, die ihm die Welt zu Füßen legt. Eine Welt, die jedoch mit jedem Tag gefährlicher wird, denn der Kosovo steht an der Schwelle zu einem grausamen Krieg. Als Albaner versucht Arsim in einer Atmosphäre der schleichenden Bedrohung, nicht aufzufallen und irgendwie sein Studium zu beenden. Doch dann trifft er Miloš, einen Serben. Und die zwei beginnen ein Leben im Verborgenen. Bis der Krieg Arsim zwingt, seine Familie und sich in Sicherheit zu bringen und alles zurückzulassen. Die Heimat, das Studium und den Mann, den er liebt.
»Bolla« erzählt davon, was es bedeutet, wenn das Zeitgeschehen ins Privatleben drängt, wenn eine ohnehin schon verbotene Beziehung sich mit noch unermesslicheren Gefahren auflädt und schließlich durch Krieg und Migration entzweit wird. Pajtim Statovci schreibt mit einer verstörenden Lebendigkeit von den »Folgen von Trauma, Scham und Angst« (Observer).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Pristina, 1995: Arsim ist zweiundzwanzig und frisch verheiratet mit einer Frau, die ihm die Welt zu Füßen legt. Eine Welt, die jedoch mit jedem Tag gefährlicher wird, denn der Kosovo steht an der Schwelle zu einem grausamen Krieg. Als Albaner versucht Arsim in einer Atmosphäre der schleichenden Bedrohung, nicht aufzufallen und irgendwie sein Studium zu beenden. Doch dann trifft er Miloš, einen Serben. Und die zwei beginnen ein Leben im Verborgenen. Bis der Krieg Arsim zwingt, seine Familie und sich in Sicherheit zu bringen und alles zurückzulassen. Die Heimat, das Studium und den Mann, den er liebt.
»Bolla« erzählt davon, was es bedeutet, wenn das Zeitgeschehen ins Privatleben drängt, wenn eine ohnehin schon verbotene Beziehung sich mit noch unermesslicheren Gefahren auflädt und schließlich durch Krieg und Migration entzweit wird. Pajtim Statovci schreibt mit einer verstörenden Lebendigkeit von den »Folgen von Trauma, Scham und Angst« (Observer).
Autor
Pajtim Statovci, geboren 1990, ist ein finnisch-kosovarischer Schriftsteller. Mit zwei Jahren zog er mit den albanischen Eltern aus dem Kosovo nach Finnland. Statovci wird als Shootingstar und großer europäischer Autor von der internationalen Kritik euphorisch gefeiert, sein Werk ist vielfach ausgezeichnet. Für den Roman »Meine Katze Jugoslawien« erhielt er 2024 gemeinsam mit seinem Übersetzer Stefan Moster den Internationalen Literaturpreis des Haus der Kulturen der Welt. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität von Helsinki.
Übersetzer
Stefan Moster übersetzte u. a. die Werke von Petri Tamminen, Rosa Liksom, Selja Ahava und Hannu Raittila. 2023 wurde er mit dem finnischen Alfred-Kordelin-Preis ausgezeichnet.
Pajtim Statovci
Bolla
Roman
Aus dem Finnischen von Stefan Moster
Luchterhand
Die finnische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Bolla« bei Otava, Helsinki.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Verlag dankt FILI (Finnish Literature Exchange) für die Förderung der Übersetzung.
Copyright © der Originalausgabe 2019 Pajtim Statovci
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Covergestaltung: buxdesign | München nach einem Entwurf von Emily Mahon
Covermotiv: William De Morgan. Courtesy of the De Morgan Foundation/Bridgeman Images
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26594-6V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Bolla
1. Gespenst, Unsichtbarer, Bestie, Teufel
2. Unbekannte Tierart, schlangenähnliches Wesen
3. Außenseiter
I
Kaum hatte Gott die Welt erschaffen, bereute er auch schon sein Werk. Er traf sich mit dem Teufel, der ihn fragte: »Was ist daran auszusetzen?«
»Es gibt eine Schlange in meinem Paradies«, sagte Gott.
»Sieh an, sieh an«, entgegnete der Teufel, ohne sein maliziöses Lächeln zu verbergen, schmatzte mit den Lippen und wartete darauf, dass Gott das Haupt senkte und ihn um einen Gefallen bat – und das tat Gott denn auch.
»Gib mir ein Kind Gottes, dann tue ich, was du willst und hole meine Schlange aus deinem Paradies«, sagte der Teufel zu Gott, der vor ihm kniete.
»Ein Kind Gottes«, wiederholte Gott.
»Ja, ein Kind Gottes«, sprach der Teufel, und Gott dachte nach.
»Also gut«, sagte er schließlich verzweifelt. »Ich gebe dir ein Kind Gottes dafür.«
22. Januar 2000
Ich habe einen Mann umkommen gesehen, ich habe den abgetrennten Arm eines Soldaten auf einer Landstraße gesehen, er sah aus wie ein Hecht, den man aus der Erde gegraben hat, ich habe gesehen, wie Zwillinge bei der Geburt getrennt wurden, ich habe niedergebrannte Häuser und eingestürzte Gebäude gesehen, zersplitterte Fenster, zerbrochenes Geschirr, gestohlenes Zeug, so viel Zeug, du glaubst nicht, wie viel Zeug übrig bleibt, wenn das Leben drum herum zerstört wird, auch die Gegenstände sterben, wenn man ihnen den Besitzer raubt.
Ich habe schreckliche Dinge gesehen, eines schrecklicher als das andere, wie Treibholz an Land gespülte Leichen, entsetzliche, kranke Taten, unverzeihliche Sünden, bewaffnete Männer in Reihen, ihren Opfern gegenüber, Kinder eines Dorfes mit ihren Eltern auf der Erde kniend, und ich wusste, dass gleich keines von ihnen mehr am Leben sein würde, wie das Bild auf einem Plakat habe ich das heute in meinem Kopf, den Gesichtsausdruck eines jeden von ihnen, sie waren sich des bevorstehenden Endes bewusst, das ließ ihre Gesichter leer und starr aussehen wie bei Porzellanpuppen, und obwohl sie sich gegenseitig stützten und sich aneinander festhielten und sich einnässten und uns anflehten, nicht zu schießen, berührten sie sich fast so, als wären sie einander fremd, die Männer ihren Frauen und die Mütter ihren Kindern, indem sie sich aneinanderdrückten, schoben sie sich gegenseitig weg, dabei würde man glauben, das Umgekehrte wäre der Fall. Es überraschte mich, dass das Leben in einem solchen Moment ein derart großes Gegenteil zur Liebe war, eine so klare Vertrautheit mit dem Tod.
Ich habe das Herz eines Freundes auf dem Handteller gehalten, habe meine Hand in die von einem Geschoss aufgerissene Brust geschoben, nach der geplatzten Aorta gegriffen, so glatt wie ein Aal, habe die Rückenwirbel an meinen Fingerknöcheln gespürt wie Zähne, habe meine Finger auf dem Brustfell ruhen lassen wie auf einem feuchten Kissen.
Ich habe neben einem angeschossenen Mann im Wald gelegen, ich lag neben ihm, konnte ihn nicht verlassen, du glaubst mir doch, dass ich nicht anders konnte, als darüber zu wachen, dass er am Leben blieb, und ich schlang die Arme um ihn, drückte mit den Armen auf den Verband und spürte jeden Versuch seines Körpers, im vertrauten Rhythmus zu bleiben, ich spürte das Tosen der inneren Organe und den sich mit Blut füllenden, hart werdenden Bauch, die verwirrte Bewegung eines jeden Organs, wie die Stimme eines fremden Tiers.
So lag ich mit einem angeschossenen Mann da, und viele Stunden vergingen, bis man uns fand, mitten im finsteren Wald fand man uns, wie aus einer Laune der Natur heraus, und man brachte uns ins Feldlazarett, wo ich ihn operierte, ich flickte seinen geplatzten Darm, und sein entzündetes Bein amputierte ich vom Knie abwärts, und ich erzählte ihm, was im Wald passiert war, als er endlich aufwachte und einfach nicht glauben wollte, dass er noch lebte, und er ergriff meine Hand und weinte und küsste sie und sagte, er erinnere sich an mich aus dem Wald, danke, sagte er dann, ich werde dir ewig dankbar sein, hörst du, ewig dankbar für dieses Leben.
Einige Monate später erhielt ich einen Brief von ihm, ich war inzwischen als Sanitäter anderswohin verlegt worden und hatte ihn schon vergessen. In dem Brief stand: Du hast mich dort in dem Wald geküsst, nicht wahr, es ist doch so, dass du mich auf den Mund geküsst hast, meinen Hals und meine Wangen und meine Stirn hast du geküsst, und hast du mich nicht auch angefasst, weil du geglaubt hast, ich schlafe, weil du geglaubt hast, ich sterbe? Weil mir so kalt war, dass deine Lippen Feuer waren. Diese Erinnerungen sind kein Traum, nicht wahr?
Ich las seinen Brief zigmal und kam nur selten bis zum Ende, wo er mir zunächst dafür dankte, dass ich ihm das Leben gerettet hatte, und erneut sagte: Ich werde dir ewig dankbar sein, für jeden anbrechenden Morgen, für jede Nacht, die ich leben darf. Und dann schrieb er, vielleicht, vielleicht könnten wir uns noch einmal sehen, es vielleicht noch einmal tun oder so, ja, diesmal aber beide wach, es hat mir gefallen
nein
entschuldige dass
ich dir so schreibe
ich wohne in Belgrad
falls du einmal kommen willst
Ich warte in den nächsten Wochen am Denkmal für Prinz Mihailo auf dich, ich werde jeden Mittwoch und jeden Samstag um die Mittagszeit auf den hellen Stufen sitzen, mit einem weißen Hemd und schwarzen Hosen, du wirst mich bestimmt an dem im Wind flatternden, leeren Hosenbein erkennen, in dem das Bein stecken sollte, das du mir weggenommen hast.
Das schrieb er mir, und ich bin nie hingegangen, um ihn zu treffen, obwohl ich einmal nahe daran war, denn ich war eine Zeit lang in Belgrad, ich ging nicht hin, weil ich
ihn nicht noch einmal küssen wollte, natürlich nicht, einen Mann ohne Bein, wer würde denn so etwas tun, einen Versehrten berühren
Wenige Wochen nach dem Brief des Mannes schrieb mir sein Vater und teilte mir mit, sein Sohn habe sich mit einer Pistole in den Mund geschossen, und dem Brief war eine Einladung zur Beerdigung beigefügt. Viele Tage lang betrachtete ich den Brief, nahm ihn abends aus der Brusttasche und manchmal auch morgens. Er roch nach Rauch, und sein säuerlicher Geruch, eine Mischung aus feuchter Pappe und verbranntem Plastik, breitete sich überall aus, griff nach meinen Fingerspitzen und lief mir die Arme hinauf und von dort auch in den Mund, wenn ich mir die Zähne putzte, er drang in die Kleider, wo er nicht einmal mit Essigwasser rausging, und schließlich warf ich den Brief weg wie das Schreiben eines Ungeheuers, und dann sagte ich mir, dass ich Arzt bin, ich bin Arzt, ich bin Chirurg, ich helfe Menschen
Nach der Beerdigung schrieb mir der Vater des Mannes noch einmal, er schrieb: »Ich weiß alles, du weißt schon, was, nicht mal ein Albaner würde so etwas tun.«
Es war das gleiche Briefpapier, das mir, in vermodertem Zustand, überallhin folgte, es blieb an meiner Haut haften, auch nachdem ich gebadet und alle Textilien in meiner Wohnung gewechselt hatte, es schwebte mit mir in die Bäckerei, zu dem Tisch, auf dem im Feldlazarett operiert wurde, folgte mir auf der Reise von Belgrad über Gradnja nach Kamenica. Dort verwandelte es sich in einen Sturzregen, der tagelang anhielt: Das Wasser füllte die Rinnen und Abflüsse und schlängelte sich geädert die Straßenränder entlang, ertränkte Blumen, Gras und Moos, riss Verkehrsschilder und Wildzäune um, brach auch den Asphalt auf und schlich sich schließlich mit brennendem Zorn in die Häuser, stieg
bis zu den Knien
»Ich werde zu Ende bringen, was mein Sohn nicht getan hat: Auge um Auge, ich werde kommen, du verdammter Peder.«
mit diesen Worten endete der Brief, kannst du dir vorstellen, wie nah ich daran war zu gehen
1 Pristina 1995
Zum ersten Mal sehe ich ihn beim Überqueren einer Straße. Was mir auffällt, ist der gesenkte Kopf, der sich kaum dreht, auch nicht auf der verkehrsreichen Kreuzung, danach der fadendünne Körper, den lange Schnurbeine mit sich ziehen. Durch den Mittelscheitel sehen seine Haare wie Krähenflügel aus, und er drückt einen Stapel Bücher an die Brust; die andere Hand wird mal hinter dem Körper, mal an der Seite vergessen, dann wieder schiebt er sie in die Hosentasche und zieht sich die ziemlich engen dunkelroten Cordjeans hoch.
Ich sitze im Schatten vor einem Café, und er geht mit der Sonne im Nacken in meine Richtung, ein erwachsener Mann im Körper eines Teenagers, und kurz darauf sehe ich ihn für einen Moment aus unmittelbarer Nähe, ich nehme das Zittern der Augen wahr, als er an mir vorbeigeht, die Sachen in seinen Hosentaschen, die zarte Nackenbehaarung und die rasierten Arme, und dann betritt er die Terrasse des leeren Cafés, bleibt für einen Augenblick neben einem Tisch stehen, meine Zigarette ist abgebrannt, und er wirkt verwirrt, als wüsste er, dass ihn jemand beobachtet. Er formt ein Gähnen mit dem ganzen Körper, das gleich darauf als dünnes Hauchen hinter der schüchternsten Faust ertrinkt, die ich je gesehen habe, die vor den Mund gehaltene Hand öffnet sich zur Straße hin, langsam wie eine aufgehende Blüte, und erst dann legt er die Bücher auf den Tisch und setzt sich.
Es ist Anfang April, und ich kann die Augen nicht von ihm abwenden. Er sieht schreckhaft und verirrt aus, als durchlebe er einen unangenehmen Traum, als folge er einem anderen Takt und anderen Gesetzen als alle um ihn herum, und seine Haltungen und Gesten – die Art, wie er vorsichtig ein Buch aufschlägt, als befürchte er, den Umschlag zu beschädigen, wie er den aus der Tasche gezogenen Stift hält, als wäre es die Scherbe eines zerbrochenen Kristallglases, wie er immer wieder die Finger an die Schläfen drückt und die Augen schließt, wie um einen konzentrierten Eindruck zu vermitteln, auch wenn ich den Verdacht habe, dass er nur versucht, sich vom Umschauen abzuhalten – haben etwas Nacktes und Ungezähmtes; etwas Unerklärliches und zugleich Vielsagendes.
Ich stehe auf und gehe zu ihm, ich weiß nicht, woher ich den Mut nehme, warum ich es unumgänglich finde, nähere Bekanntschaft mit ihm zu schließen.
»Zdravo«, sage ich auf Serbisch.
»Hallo«, sagt auch er mit heller Stimme, die mich fast an meine Frau erinnert, den Blick auf das aufgeschlagene Buch gerichtet, dessen Text so dicht und klein gesetzt ist, dass ich die Sprache nicht erkennen kann.
»Darf ich mich setzen?«, frage ich und ziehe den Stuhl unter dem Tisch hervor.
»Sicher«, antwortet er, blickt sich um, nickt dann in Richtung des Stuhls und schaut mir in die Augen, und ich denke, was für ein wahnsinnig, erstaunlich schöner Mann er ist, seine Iriden sehen aus wie ein Himmel, der sich auf einen Sturm vorbereitet, und der sauber gestutzte Dreitagebart harmoniert mit den rötlich braunen, gut gepflegten Haaren, sein Rücken ist lang wie bei einem Pferd und das Gesicht wohlproportioniert und liebenswürdig, und ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit seit seiner Antwort vergangen ist, wie lange ich ihn nur angestarrt habe und er mich, wie einen Freund, von dem man Jahrzehnte getrennt war.
»Ich bin Arsim«, sage ich und reiche ihm die Hand.
»Miloš«, antwortet er und ergreift meine Hand mit kalten, knochigen Fingern. »Freut mich, dich kennenzulernen«, sagt er, und ich löse den Griff und fließe in seine alten, traurigen Augen, auf denen schwere, runzlige Lider lasten.
Die folgende Stunde ist so angenehm wie keine andere zuvor in meinem Leben. Wir bestellen noch einmal Kaffee, senken die Stimmen, und als ich seine englischsprachigen Bücher bemerke, wechseln wir die Sprache. Es kommt mir natürlich vor, denn wenn wir Englisch sprechen, sind wir nicht Albaner und Serbe, sondern losgelöst von der Umgebung, aus einem Roman herausgerissene Seiten.
Ich erfahre, dass er ein Jahr älter ist als ich, fünfundzwanzig, dass er an der Universität Pristina Medizin studiert und sich höchstwahrscheinlich auf Chirurgie spezialisieren will, dass er aus der kleinen Stadt Kuršumlija von jenseits der Grenze stammt, dreißig Kilometer nordöstlich von meiner Heimatstadt Podujevo, die wiederum dreißig Kilometer nordöstlich von Pristina liegt, dass er außer seiner Muttersprache und Englisch fließend Deutsch und sogar ein bisschen Albanisch spricht.
Auch ich erzähle ganz gewöhnliche Dinge von mir, wie man sie einem neuen Bekannten eben erzählt, nenne mein Alter und meine Heimatstadt, erzähle, dass mein Vater als Englischlehrer mein Interesse für Fremdsprachen geweckt habe und dass ich hoffe, eines Tages als Lehrer für Literatur oder Korrekturleser für eine Zeitung tätig sein zu dürfen, und während ich rede, spüre ich den Leim seines Blicks auf meinen Wangen, wie er jede kleinste meiner Regungen beobachtet, mit gekrümmtem Rücken und schief gelegtem Kopf konzentriert zuhört, als versuchte er, alles, was ich erzähle, auswendig zu lernen.
Ich sage, ich studiere ebenfalls an der Universität, Literatur, Geschichte und Englisch, oder habe zumindest einmal dort studiert, ich weiß nicht, es ist mir peinlich, davon zu erzählen, denn die Universität, an der ich mich vor Jahren eingeschrieben habe, ist nicht mehr dieselbe wie die, an der er studiert, diejenige, an der wir ungefähr zur gleichen Zeit das Studium aufnahmen.
Nachdem wir den Kaffee getrunken haben, schauen wir einander eine Weile an, und das kommt mir richtig und echt vor, im Gegensatz zu Pristina, den auf die Straßen drängenden Truppen mit ihren Sturmgewehren, den Schlangen von Panzern und Militärfahrzeugen, die aussehen, als wären sie aus dem Weltall hier gelandet.
Er lächelt, und auch ich lächle, es macht mir keine Angst, wie wir in diesem Augenblick von außen betrachtet wirken mögen, und ihm auch nicht, denn wir waren dazu bestimmt, uns zu begegnen, denke ich, und er denkt es vielleicht auch, wir sind aus gutem Grund zur gleichen Zeit in diesem Café gelandet.
Irgendwann bittet er die Bedienung um die Rechnung, zahlt auch meinen Kaffee und sagt, er müsse vor seiner nächsten Vorlesung noch in die Bibliothek.
»Möchtest du mitkommen?«, fragt er.
Ich habe keinen Grund, in die Bibliothek zu gehen, sage aber, ohne zu zögern, ich würde ihn begleiten, und so gehen wir ein kurzes Stück, überqueren die Straße und erreichen den Campus, betreten einen Rasen, der mit grauen, erodierenden Wegplatten gesprenkelt ist, von denen die Jahre ganze Brocken abgebissen haben, wir steigen ein paar Stufen zum Eingang eines Gebäudes hinauf, das aussieht, als wäre es in ein Fischernetz gewickelt, und treten in eine große, vom Licht geöffnete Halle wie in den entzündeten Rachen einer altertümlichen Bestie. Die Böden bestehen aus imposanten Marmormosaiken, und an den Wänden sind runde Metallrosetten angebracht, die überwachende Blicke zu werfen scheinen, wie Augen von Göttern.
Er geht ein kleines Stück vor mir her, und plötzlich greife ich nach seiner Schulter, wie ein Wahnsinniger, mitten in der Eingangshalle der Bibliothek, genauso, vollkommen entgegen meiner Natur, ohne zu überlegen, in der Menschenmenge, die dem Gebäude entströmt, im Herzen eines ins klebrig Warme gekippten Nachmittags fasse ich ihn allen Ernstes an, und er bleibt stehen, und erst einen Moment später dreht er den Kopf, schaut zuerst auf meine Hand auf seiner Schulter, auf meine Fingerspitzen, die auf dem Bogen seines Schlüsselbeins ruhen, und dann auf mich, und während dieses kurzen Zeitraums bin ich ganz und gar ein anderer Mann – so lebendig, denke ich, so lebendig bin ich noch nie gewesen.
Er ist Serbe, und ich bin Albaner, und darum sollten wir Feinde sein, aber jetzt, da wir einander berühren, steht nichts zwischen uns, was dem anderen ungewöhnlich oder fremd wäre, und ich habe das unerschütterliche Gefühl, wir beide, wir sind nicht wie die anderen, und dieses Gefühl trifft mich so stark, so undurchdringlich deutlich, dass es wie eine von oben gesandte, für mich geschriebene Botschaft ist; und wir achten nicht darauf, wie manche der Leute die Augen verdrehen oder uns bitten, nicht den Weg zu versperren, wie manche zu lachen scheinen, als sie an uns vorbeigehen, vielleicht darüber, dass wir keine Worte zu bilden vermögen, weder für sie noch füreinander.
Denn als er mich schließlich fragt, ob ich Zeit hätte, ihn nächste Woche wieder zur Mittagszeit im selben Café zu treffen, und er seinem Gesicht das Ausrutschen in ein Lächeln gestattet, das er unverzüglich zu bändigen versucht wie einen ungehörigen Lachanfall und auf das ich mit meinem Lächeln und den Worten, wir sehen uns nächste Woche im selben Café, antworte, spüre ich, wie mein Leben entzweibricht, in das Leben vor ihm und in das Leben nach ihm, wie mein bisheriges Leben auf einmal ein kaum noch bedeutsames Detail in meinem neuen Leben ist, wie es zurückbleibt wie eine auf die Schnelle erfundene Notlüge.
Es ist Anfang April, und ich will diesen Mann so unbestreitbar und deutlich, dass er für den ganzen Rest des Tages in den Gebeten ist, in denen ich Gott schamlos um ihn bitte.
Am selben Abend serviert mir meine Frau Bohnensuppe, gebratene Paprika in Sahnesoße, Feta, Tomaten, Gurken und Ajvar. Während ich esse, sitzt sie mir gegenüber und wirkt besorgt, als hielte sie den Atem an oder befände sich in unangenehmer Gesellschaft.
Ich habe sie jung geheiratet, im Frühsommer vor vier Jahren, mit gerade mal zwanzig, das einzige Kind meiner Eltern, auf Anweisung meines Vaters, der später einem Leberleiden erlag, denn sie ist eine außergewöhnliche Frau, folgsam und wortkarg, trotz ihrer fehlenden Schulbildung intelligent, geschickt mit den Händen, mit guten Manieren und aus einer angesehenen Familie, so wurde es mir versprochen, eine anständigere Frau als Ajshe, eine bessere Mutter als sie wird nicht zu bekommen sein.
So sagte ich, auf Wunsch meines Vaters, der Großes von mir erwartete, ich würde sie ohne Weiteres heiraten, sofern ihr Vater mir verspreche, dass Ajshe die über sie gesprochenen Worte wirklich lebe. Als auch ich meinerseits Ajshes Vater versicherte, anständig und zuverlässig zu sein, als ich erklärte, noch nie an die Faust geglaubt zu haben, niemals herumhuren zu können, nie auch nur einen Dinar beim Glücksspiel einsetzen würde und dass auch der Flaschenhals keine Bedrohung für mich darstelle, denn ich hielte – genau wie mein Vater – die Bildung in Ehren und sei im Begriff, mich an der Universität einzuschreiben, bekam ich sie zur Frau.
Wir heirateten schlicht und einfach deswegen, weil es für den Menschen besser ist, mit jemandem zusammen als allein zu leben, weil es sich für einen Mann gehört, eine Frau an seiner Seite zu haben, weil es sich auch für eine Frau gehört, einen Mann neben sich zu haben, weil ein Mann, insbesondere ein Mann wie ich, sich vermehren und für den Fortbestand der Familie sorgen muss, es ist wichtig, dass man wenigstens einen Sohn bekommt, dem man die Häuser, das Land und das Geld hinterlässt.
Unsere Hochzeit war traditionell, Ajshe bereitete sich wochenlang darauf vor, machte die Aussteuer fertig und verabschiedete sich von den Menschen ihres früheren Lebens, und ich stellte mich darauf ein, ihr Raum zu geben und hoffte, sie würde mit meinen Eltern auskommen. Das Schlimmste wäre gewesen, wenn sie sich als dickköpfig erwiesen hätte, als schlecht im Annehmen von Anweisungen, oder wenn meine Mutter auf unnachgiebig geschaltet und die Nase darüber gerümpft hätte, wie die Neuangekommene die Hausarbeit machte.
Dann wurde sie zu mir geholt. An unserem Hochzeitstag war sie ungeheuer schön und schweigsam wie ein Wandbehang, nahezu taubstumm, so wie es sich auch gehört, ihr Hochzeitskleid mit den Goldstickereien sah aus wie gefälteltes Seidenpapier, über das man Glitter gestreut hatte, und als ich am Hochzeitsabend zum ersten Mal mit ihr schlief, atmete sie nur wenige Male etwas schwerer, obwohl sie Blut vergoss, obwohl ich sehen konnte, was für starke Schmerzen sie hatte.
Nachdem wir in jener Nacht getrennt geduscht hatten, sagte ich zu Ajshe, sie habe bei unserer Hochzeit einfach umwerfend ausgesehen, ich hätte in meinem Leben noch keine schönere Frau gekannt und sei froh über unsere Heirat, und auch sie sagte, sie sei glücklich und stolz darüber, dass ausgerechnet ich ihr Mann und der künftige Vater unserer Kinder sei, und bald schliefen wir ein, ich verirrte mich in einen ruhelosen Schlaf, und ihr fielen, erschöpft von den Schmerzen, die Augen zu.
»Ich verspreche dir, mich um dich zu kümmern, deine rechte Hand zu sein, dein Stein«, sprach Ajshe am nächsten Morgen, als rezitiere sie ein Kirchenlied, legte die herzförmigen Ohrringe, die sie von mir bekommen hatte, an, und in ihren Worten lag nicht die geringste Sorge über die Zukunft und keine Spur vom Schmerz des Abends zuvor.
Mein Vater starb zwei Monate nach unserer Hochzeit. Er war lange krank gewesen und in seinen letzten Wochen sehr schwach, aber er hatte einen guten Tod, denn er konnte mich noch zusammen mit einer Frau wie Ajshe sehen.
Ajshe ist zu meiner Erleichterung exakt so, wie man es mir versprochen hat. Sie ist geduldig und verständnisvoll, die großherzigste Frau, die ich kenne. Sie hört zu und unterstützt mich und hat mir oder meinen Eltern nie widersprochen, und als ich ihr erzählte, eines Tages ein Buch schreiben zu wollen, das in der Vergangenheit spiele, eine Erzählung über den Krieg, über die schon Jahrhunderte währende Demütigung der Albaner vielleicht, die atemberaubendste Liebesgeschichte aller Zeiten, sagte sie:
»Welche Menschen sollten sonst Bücher schreiben, wenn nicht Männer wie du? Sag nur, wenn ich etwas tun, dir dabei helfen kann.«
Sie ist so stolz auf mich, als wäre ich bereits die Verkörperung meines Traums, ein Schriftsteller, dessen Worte auf den Seiten von Büchern und Zeitungen verewigt sind. Sie sagt diese Dinge, ohne zu wissen, wie viel Zeit und Engagement eine solche Arbeit erfordert.
Als meine Mutter zwei Jahre später an Krebs erkrankte, übernahm Ajshe die Verantwortung für sie: Sie wusch und wechselte ihre Kleider, gab ihr zu essen, leistete ihr Gesellschaft und hörte ihr zu, und es gelang Ajshe, eine wohlschmeckende Mahlzeit nach der anderen zuzubereiten, obschon das Geld knapp war, denn ich arbeitete neben meinem Studium nur gelegentlich als Kellner in einem Restaurant in Pristina.
Nachdem meine Mutter gestorben war, verkaufte ich das Haus an Verwandte von mir und kaufte eine Wohnung in der Nähe der Innenstadt von Pristina, damit ich es weniger weit zur Universität hatte, auf mein Auto verzichten und durch die kürzeren Wege Zeit sparen konnte. Außerdem wollte ich weg von meiner Verwandtschaft auf dem Land, denn der von misstrauischen Blicken und Gerede hinter dem Rücken pervertierte ländliche Alltag hatte noch nie zu meinem Charakter gepasst.
Wir tauschten unser großes und in ziemlich gutem Zustand befindliches dreistöckiges Haus gegen eine heruntergekommene Zweizimmerwohnung in Ulpiana. Dort muss Ajshe immer mucksmäuschenstill sein, wenn ich lerne oder schreibe oder schlafe. Obwohl es ihr Traum ist, in einem großen Haus zu wohnen, Kinder in einer ruhigen Umgebung großzuziehen, sich um den Garten und das Feld zu kümmern und Tiere zu halten, hat sie nie protestiert. Sie geht dorthin, wohin ich gehe.
Bisweilen denke ich, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass sie meine Frau ist und genau diesen Charakter hat, vor allem wenn ich die Geschichten meiner Bekannten über ihre Frauen höre, Geschichten davon, wie die ins Haus gekommene Frau den häuslichen Frieden bricht, indem sie sich mit ihren Schwiegereltern zerstreitet, wie sie ihren Ehemann beschämt, indem sie ihm ständig widerspricht oder indem sie den Haushalt und ihre Aufgaben als Erzieherin vernachlässigt.
Dann wieder denke ich, dass ich sie nicht verdiene – wenn wir miteinander schlafen, zum Beispiel, wenn sie mir ansieht, wie ich mich beeile, wie ich einen Samenerguss vorspiele, obwohl kein Tropfen aus mir herauskommt, und wie ich es vermeide, mich anfassen zu lassen und sie zu berühren –, und versinke in Kummer, denn ich verstehe, dass sie viel zu gut für mich ist, zu gut, um mit mir dieses Leben zu führen.
Am schlimmsten ist es zu wissen, dass Ajshe sich nie trauen würde, es mir zu sagen, wenn sie entgegen den von mir getroffenen Entscheidungen würde leben wollen. Oder nein, noch schlimmer ist es, dass aus der Achtung füreinander ein Wettkampf zwischen uns geworden ist, den ich wiederholt verliere.
Die Zuneigung, die mir durch sie zuteilwird, und die Liebe, die sie für mich hat – oft frage ich mich, ob ich sie jemals erwidern kann.
Als wir uns an diesem Abend am Küchentisch gegenübersitzen, spricht Ajshe meinen Namen so aus, wie sie ihn noch nie ausgesprochen hat. Ihre Stimme ist so leise und so zart, dass ich beinahe weiß, was sie sagen will, und dass sie weiß, wie sehr ich mich vor ihren nächsten Worten fürchte.
»Ich bin schwanger«, fährt sie fort, senkt den Blick, hebt ihn wieder, schaut mir in die Augen, dann wieder nach unten und faltet die Hände auf dem Tisch.
»Bist du sicher?«, frage ich und lege den Löffel aus der Hand.
Warum muss das Kind gerade jetzt kommen, frage ich mich, warum hat es nicht früher kommen können, als wir genug Platz für es hatten, in einer Zeit, die uns passend für die Geburt unseres ersten Kindes schien.
»Ja«, sagt sie langsam, »ich habe es dir nicht früher sagen können, erst seit Kurzem bin ich mir sicher. Ich war heute beim Arzt, entschuldige, dass ich heimlich gegangen bin, aber ich musste herausfinden, warum mein Bauch in letzter Zeit so unruhig gewesen ist, und man hat mir gesagt, dass die Schwangerschaft schon ziemlich weit fortgeschritten ist, obwohl ich normale Monatsblutungen hatte, dass das Kind schon im Juni zur Welt kommt.«
Wir schweigen lange und starren einander an; es scheint unpassend, auch nur einen Ton hervorzubringen, auch nur eine Regung zu zeigen.
Sie weicht meinen Augen als Erste aus und führt ihren Blick über das Serviergeschirr, über die Wände, zum Fenster hinaus, sie schaut alles an, nur nicht mich. Und dann passiert etwas, ich kann nicht erklären, was in mir geschieht, aber ich stehe auf, als würde ich hochgerissen, mache ein paar Schritte, um näher an Ajshe heranzukommen, die mir nun wie ein gefühlloser, wildfremder Mensch vorkommt.
Und dann schlage ich sie, zum allerersten Mal, mit der flachen Hand ins Gesicht, so fest, wie es mein Arm hergibt.
Durch die Kraft meines Schlags schwingt ihr Kopf nach hinten wie eine Boxbirne, und sie gibt ein erbärmliches Wimmern von sich, und als sie mich dann mit geschlossenen Augen um Verzeihung bittet, begreife ich, dass Gewalt weitere Gewalt nach sich zieht.
Wir schlafen in dieser Nacht in getrennten Zimmern. Ich lege mich mit der Überlegung hin, ob dieser Tag für uns beide der beste und schlimmste unseres Lebens gewesen sein könnte.
In der folgenden Woche sehe ich Miloš wieder. Es ist ein trüber Morgen, und was vom Winter übrig geblieben ist, richtet sich zäh zum Frühling hin auf, wie eine auf den Rücken gekippte Schildkröte. Die Stadt hat jeden Tag etwas Gereizteres und Bedrohlicheres an sich als am Tag zuvor, die Menschen werden immer unruhiger, sogar die Häuser sind wie auf dem Sprung.
Er sitzt am selben Tisch, in der gleichen unbequem aussehenden Haltung, vor sich hat er einen Kaffee, zwei kleine Äpfel und eine Tüte Saft. Ohne zu zögern, trete ich zu ihm, an die andere Seite des Tisches, und als er mich bemerkt, greift er nach einem Apfel und beißt ein Stück davon ab.
»Hallo«, sage ich und setze mich.
»Hallo«, antwortet er, lächelt und legt den Apfel auf den Tisch.
Ich bestelle mir einen Macchiato, zünde mir eine Zigarette an und bewege unter dem Tisch die Beine hin und her, während er seinen Apfel vertilgt.
»Wie geht’s?«, fragt er, nachdem die Bedienung meinen Kaffee gebracht hat.
»Gut. Und dir?«, sage ich nach einem Moment – und merke, dass ich auf seinen Mund starre.
»Gut«, antwortet er und leckt sich über die Unterlippe.
Wir schweigen eine Weile, aber die Stille hat nichts Peinliches. Ich präge mir alles ein, wie er sich auf dem Stuhl nach hinten lehnt, seine geäderten Arme, die Art, sich zu halten, wenn er die Beine übereinanderschlägt, seine hohen Wangenknochen und die Haut seines Halses, die an trockenes Brot erinnert, die kleine gerundete Hüfte wie bei einem Mädchen, wie sorgfältig und vorsichtig er spricht, als überlegte er sich jede Silbe genau, wie weiß seine Zähne sind und mit wie vielen Falten sich das Lächeln auf seinem eckigen Gesicht ausbreitet, wie der Bauch von jemandem, der sich hinsetzt.
Ich rede, was mir gerade einfällt, von meiner zu kurzen Nacht und von dem Buch, das ich gerade lese, darüber, wie unproduktiv und für alle Parteien schädlich es sei, dass die serbische Verwaltung die albanischen Lehrkräfte und Studierenden aus der Universität geekelt habe, über meinen Teilzeitjob in einem Restaurant mit serbischem Besitzer, nicht sonderlich weit weg von hier, über Gäste, die nur einen Kaffee bestellen und stundenlang die Tische blockieren, darüber, wie enttäuscht ich von Präsident Rugova sei, und davon, dass er Tag für Tag dieselben Dinge wiederhole, die Albaner bitte, durchzuhalten, einfach durchzuhalten, über die Kurse, die ich derzeit hier und da besuche, in Privatwohnungen von Albanern, in leeren Lagern und Geschäftsräumen und Kellern, und darüber, wie demütigend das sei, und er lächelt mich wohlwollend an, als würden wir uns seit jeher kennen, und während er mir genauer von seinem Studium an der medizinischen Fakultät erzählt und von seinem kleinen Apartment einen Block vom Campus entfernt, von seinen Sommerjobs, ebenfalls in Restaurants, lässt er die Augen hemmungslos über meinen Körper wandern – schaut auf meine Hände und Schultern, auf meinen Hals und meinen Brustkorb, auf meine Seiten, er schaut auf meine Lippen und auf meine Stirn, auf die gleiche Art, wie ich alles an ihm betrachte, sodass uns jeder Augenblick, in dem wir uns nicht berühren, vergeudet zu sein scheint.
»Willst du anderswo hingehen?«, unterbricht er irgendwann.
»Ja«, antworte ich unverzüglich, wie ein ausgehungertes Tier.
»Zu mir, meine ich«, flüstert er.
»Ja«, sage ich und stehe auf.
Wir treten von der Café-Terrasse auf die Straße, und plötzlich habe ich Angst, denn es kommt mir vor, als hörte die ganze Stadt meine Gedanken, als wüsste sie, wohin wir gehen und warum.
Wir kommen an einer Näherei vorbei, an einem kleinen Zeitungskiosk, in dem ein Teenagerjunge mit Basecap eine Zigarette raucht, an einem lauten Restaurant, wo an einem Tisch auf der Terrasse vier serbische Soldaten selbstgefällig in die Umgebung spähen, und dann schlängeln wir uns durch einen Billigwarenladen, der sich auf den Gehweg ergießt, und erreichen das Haus, in dem er wohnt, er schafft es, mit Müh und Not, die Haustür zu öffnen und hinter uns zu schließen, als ich auch schon an ihm hänge – im dunklen, von Müll und Zigarettenstummeln bevölkerten, nach Urin riechenden Treppenhaus, an der von hartnäckigem Schmutz bemoosten Wand küsse ich ihn.