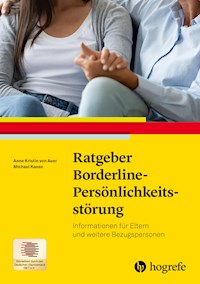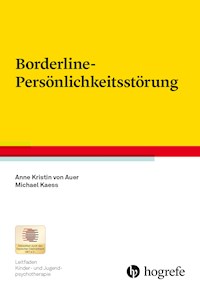
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Behandlung von Jugendlichen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und deren Familien stellt oft eine Herausforderung für Therapeutinnen und Therapeuten dar. Der Band liefert wichtige Informationen zur Symptomatik und Diagnostik und beschreibt das Vorgehen in der Einzel- und Familienarbeit. Der Band ist damit eine wichtige Ergänzung des interaktiven Skillstrainings für Jugendliche, welches vor allem die Vermittlung von Skills beschreibt. Als zentrales Behandlungsprogramm wird die Dialektisch-Behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A) vorgestellt. Die DBT-A ist ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Konzept, das speziell für die Arbeit mit emotional-instabilen Jugendlichen und deren Familien konzipiert wurde. Neben dem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatz spielt als Basis für alle anderen Therapiebausteine eine dialektische Haltung, die die Pole Akzeptanz und Veränderung integriert und eine achtsame Haltung, die annehmend und möglichst nicht bewertend ist, eine große Rolle. Der Band erläutert die Struktur der DBT-A, die Grundhaltung, die zentralen Behandlungsstrategien sowie die Einbettung des Skillstrainings. Durch die Integration von Strategien der Compassion Focused Therapy (CFT) sollen die Patientinnen und Patienten lernen, Mitgefühl für sich und andere zu entwickeln. Der Einsatz von DBT-Familienskills, die von Alan Fruzzetti und Perry Hoffman entwickelt wurden, soll Eltern von emotional-instabilen Jugendlichen dabei helfen, sich selbst besser zu regulieren und die Interaktion innerhalb der Familie zu verbessern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Anne Kristin von Auer
Michael Kaess
Borderline-Persönlichkeitsstörung
Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie
Band 31
Borderline-Persönlichkeitsstörung
Dr. Anne Kristin von Auer, Prof. Dr. Michael Kaess
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Manfred Döpfner, Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann, Prof. Dr. Paul Plener
Die Reihe wurde begründet von:
Manfred Döpfner, Gerd Lehmkuhl, Franz Petermann
Dr. Anne Kristin von Auer, geb. 1971. 1990–1996 Studium der Psychologie in Düsseldorf und Trier. Ab 1996 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum für Psychobiologie und Psychosomatik der Universität Trier. 1999 Promotion. 1996–2003 Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. 1999–2003 Psychologin in der kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilung des Mutterhauses der Borromäerinnen in Trier. 2003–2012 Psychologin in der Vorwerker Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik in Lübeck, ab 2008 leitende Psychologin. 2012–2018 tätig in eigener Praxis in Hamburg Rahlstedt. Seit 2019 leitende Psychologin in der Vorwerker Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik in Lübeck. DBT-A-Therapeutin, -Trainerin und -Supervisorin.
Prof. Dr. med. Michel Kaess, geb. 1979. 1999–2007 Studium der Medizin in Heidelberg. 2008 Promotion. 2013 Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (Verhaltenstherapie). 2015 Habilitation. 2007–2017 Assistenzarzt, Oberarzt und Geschäftsführender Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universitätsklinikum Heidelberg. 2017 Trainer für DBT-A. Seit 2017 Ordinarius und Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Bern (Universitäre Psychiatrische Dienste).
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Sabine Rosenfeldt, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2023
© 2023 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2775-1; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2775-2)
ISBN 978-3-8017-2775-8
https://doi.org/10.1026/02775-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|V|Einleitung: Grundlagen und Aufbau des Buches
Jugendliche mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) haben es oft schwer, eine passende und hilfreiche Therapie zu finden. Zum einen gibt es noch zu wenig auf das Störungsbild spezialisierte Therapieangebote, zum anderen liegen aufseiten der Behandlerinnen und Behandler zum Teil weiterhin die Vorurteile vor, emotional-instabile Jugendliche seien nicht behandelbar und wahnsinnig anstrengend. Zugegeben, die Behandlung von Jugendlichen mit einer BPS und deren Eltern kann eine Herausforderung für das Behandlungsteam darstellen. Gleichzeitig wird es in der Behandlung selten langweilig, und Sie können als Therapeutin oder Therapeut viel über sich lernen. Wenn Sie das geeignete Werkzeug für die Behandlung besitzen, ist die Behandlung durchaus erfolgreich, macht Freude, und Jugendliche und Eltern zeigen sich für eine gelungene Behandlung äußerst dankbar. Mit diesem Band wollen wir dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und dazu ermutigen, sich die Diagnostik sowie die Behandlung von Jugendlichen mit BPS zuzutrauen. Wir geben umfassende Informationen über den Stand der Forschung, Diagnostik und Therapie der BPS. Das Konzept der Dialektisch-Behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A; Miller, Rathus & Linehan, 2007) liefert das entsprechende Werkzeug sowohl für den Umgang mit den Jugendlichen und ihren Eltern als auch mit den eigenen emotionalen Reaktionen. Daher wird dieses Therapieverfahren in diesem Band ausführlich und auch kleinschrittig dargestellt. Da die Vermittlung der Skills in der DBT-A an anderer Stelle ausführlich erläutert wird (von Auer & Bohus, 2017), liegt der Schwerpunkt in diesem Band auf den Rahmenbedingungen, die eine Skillsvermittlung überhaupt möglich machen. Dazu gehören die Grundhaltung den Familien gegenüber, Strategien zur Beziehungsgestaltung und Motivationsarbeit und vieles mehr. Wenn Sie fundiert nach der DBT-A arbeiten möchten, empfehlen wir den Besuch der Fortbildungsangebote des DBT-Dachverbandes (www.dachverband-dbt.de). Besonders an diesem Band ist die ausführliche Beschreibung der Elternarbeit. Der Ratgeber für Eltern oder andere Bezugspersonen ergänzt diesen Band in sinnvoller Weise (von Auer & Kaess, 2022).
Der Leitfaden unterteilt sich in insgesamt fünf Kapitel:
1 Im ersten Teil des Buches wird der Stand der Forschung hinsichtlich Symptomatik, Klassifikation, Diagnose der BPS im Jugendalter, Prävalenz, Verlauf, Komorbidität, Pathogenese und Therapie dargestellt.
2 Kapitel 2 stellt das Kernstück des Leitfadens dar. Hier werden ausführliche Leitlinien zur Diagnostik und Therapie dargestellt. Die Leitlinien zur Therapie beruhen auf der DBT-A und werden um Aspekte der Skillsarbeit mit Eltern und Aspekte des Mitgefühls und Selbstmitgefühls ergänzt.
3 Kapitel 3 stellt Verfahren zur Diagnostik ausführlich dar und gibt einen Überblick über weitere störungsspezifische Therapieansätze.
4 Das vierte Kapitel enthält für den Praxisalltag hilfreiche Materialien.
5|VI| Im fünften Kapitel wird der Umgang mit der BPS im Jugendalter anhand eines Fallbeispiels illustriert.
Um ein flüssiges Lesen dieses Bandes zu ermöglichen und keine Geschlechtergruppe zu vernachlässigen, haben wir uns dazu entschlossen, im Text zwischen männlicher und weiblicher Form abzuwechseln – sowohl in Bezug auf die Behandlerinnen und Behandler als auch in Bezug auf die Patientinnen und Patienten. Wenn wir von Therapeutinnen oder Therapeuten sprechen, ist in der Regel das gesamte therapeutische Team gemeint. Wir hoffen, dass Ihnen das Lesen des Leitfadens wichtige Informationen liefert und dazu beiträgt, dass Sie mit Freude mit jugendlichen Borderline-Patientinnen und -Patienten und deren Eltern arbeiten.
Lübeck und Bern, Mai 2022
Anne Kristin von Auer
und Michael Kaess
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Grundlagen und Aufbau des Buches
1 Stand der Forschung
1.1 Symptomatik und Klassifikation
1.2 Die Diagnose der BPS im Jugendalter
1.3 Prävalenz und Verlauf
1.4 Komorbidität und Differenzialdiagnostik
1.5 Pathogenese
1.5.1 Neurobiologie
1.5.2 Umwelteinflüsse
1.5.3 Umwelt – Genetik
1.6 Frühbehandlung
1.7 Empirische Befunde zur Behandlung der BPS
2 Leitlinien
2.1 Leitlinien zur Diagnostik und Verlaufskontrolle
2.1.1 Frühwarnzeichen erkennen
2.1.2 Screening auf Merkmale einer BPS
2.1.3 Klärung der Diagnose und Differenzialdiagnose
2.1.4 Diagnostik eines erhöhten Risikos für die Entwicklung einer BPS
2.1.5 Exploration von selbstschädigendem und riskantem Verhalten
2.1.6 Diagnostik komorbider Erkrankungen
2.1.7 Exploration der Suizidalität
2.1.8 Exploration von störungsassoziierten Faktoren
2.1.9 Rückmeldung der Diagnose und Psychoedukation
2.1.10 Verlaufskontrolle
2.2 Leitlinien zur Behandlungsindikation
2.2.1 Allgemeine Behandlungsindikation
2.2.2 Indikation zur störungsspezifischen Psychotherapie
2.2.3 Indikation zur pharmakologischen Behandlung
2.2.4 Wahl des Behandlungssettings
2.2.5 Bedingungen für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit
2.3 Leitlinien zur Therapie
2.3.1 Therapeutische Grundhaltung
2.3.2 Vorbereitung auf die Therapie
2.3.3 Psychoedukation
2.3.4 Behandlungsplanung
2.3.5 Einsatz von Verhaltensanalysen während der Therapie
2.3.6 Einsatz von Diary-Cards
2.3.7 Vermittlung von Skills
2.3.8 Telefoncoaching
2.3.9 Kontingenzmanagement
2.3.10 Verbesserung von Selbstwert und Selbstmitgefühl
2.3.11 Einbezug der Eltern bzw. Bezugspersonen
2.3.12 Den Mittelweg finden
2.3.13 Familyskills
2.3.14 Einbezug der Lehrkräfte
2.3.15 Pharmakotherapie der BPS im Jugendalter
3 Verfahren zur Diagnostik und Therapie
3.1 Verfahren zur Diagnostik
3.1.1 Screeninginstrumente zur Erfassung der BPS-Kriterien
3.1.2 Strukturiertes Assessment der kategorialen BPS
3.1.3 Selbstverletzung und Suizidalität
3.1.4 Impulsivität
3.1.5 Emotionsregulation
3.1.6 Dissoziatives Erleben
3.2 Verfahren zur Therapie
3.2.1 Mentalisierungsbasierte Therapie für Jugendliche (MBT-A)
3.2.2 Adolescent Identity Treatment (AIT)
3.2.3 Schematherapie für Kinder und Jugendliche
4 Materialien
M01 Behandlungsvertrag für die stationäre DBT-A-Behandlung
M02 Behandlungsvertrag für die ambulante DBT-A-Behandlung
M03 Verhaltensanalyse
M04 Gefühlsprotokoll – Kurzform
M05 Diary-Card/Wochenprotokoll
M06 Biopsychosoziales Modell
M07 Eine Mitgefühlsübung (… genau wie ich)
M08 Gefühlsprotokoll zu einer zwischenmenschlichen Situation
M09 Doppelte Kettenanalyse: Beispiel für das Vorgehen anhand der Spaltentechnik
5 Fallbeispiel: Lena
6 Literatur
|1|1 Stand der Forschung
1.1 Symptomatik und Klassifikation
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) zeichnet sich durch ein tiefgreifendes Muster von Instabilität der Affekte, des Selbstbildes und der zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Hinzu kommt ein hohes Maß an Impulsivität, einhergehend mit selbstschädigenden Verhaltensweisen (Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten, Substanzmittelmissbrauch) und häufig unkontrollierbarer Wut (APA/Falkai et al., 2018). Die Betroffenen pendeln in zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Extremen der Idealisierung und Entwertung des Gegenübers. Häufig bemühen sie sich gleichzeitig verzweifelt, ein tatsächliches oder vermeintliches Verlassenwerden zu vermeiden. Viele Menschen mit BPS berichten einerseits über starke und häufig unerklärbare Gefühle des „Druckes“ und der „Anspannung“. Andererseits beschreiben sie ein „Gefühl der Leere“, welches häufig in engem Zusammenhang mit dem Phänomen der Dissoziation steht, welches bei Borderline-Patienten ebenfalls gehäuft beobachtet wird (Brunner, Parzer & Resch, 2001).
Bei der Diagnosestellung der BPS sind immer auch die allgemeinen diagnostischen Kriterien zu Persönlichkeitsstörungen zu beachten. Nach der derzeit in Deutschland gültigen Klassifikation der World Health Organisation (WHO), der 10. Auflage der International Classification of Diseases (ICD-10), ist eine Persönlichkeitsstörung durch rigide und wenig angepasste Verhaltensweisen, die eine hohe zeitliche Stabilität aufweisen, situationsübergreifend auftreten und zu persönlichem Leid und/oder gestörter sozialer Funktionsfähigkeit führen, gekennzeichnet. Es handelt sich also um tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster mit starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen. Betroffen sind das Wahrnehmen, Denken, Fühlen und die Beziehungen zu anderen. Hierdurch können die Persönlichkeitsstörungen von vielen anderen psychischen Störungsbildern unterschieden werden (Dilling & Freyberger, 2010).
Zur Untersuchung und Beschreibung der BPS haben sich inzwischen die neun Diagnosekriterien der amerikanischen Klassifikation für psychische Erkrankungen, der 5. Auflage des „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM-5, APA, 2013; APA/Falkai et al., 2018) durchgesetzt. Dies zeigt sich auch in der Übernahme dieser Kriterien zur Beschreibung der BPS-Symptomatik (Borderline-Muster) in der neuen ICD-11 (vgl. Kapitel 1.2). Zur Diagnose der BPS werden im DSM-5 das Erfüllen von fünf der in Tabelle 1 genannten neun Kriterien gefordert (APA/Falkai et al., 2018), die spezifische und zeitlich überdauernde Merkmale (sogenannte „traits“) der Störung darstellen. Nach ICD-10 stellt die BPS einen von zwei Subtypen der emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung dar. Die emo|2|tional-instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ ist hier gekennzeichnet durch emotionale Instabilität und mangelnde Impulskontrolle (analog zum impulsiven Typ). Zusätzlich kennzeichnet diesen Typ eine Störung des Selbstbildes, der Ziele und der inneren Präferenzen, ein chronisches Gefühl von Leere, intensive aber unbeständige Beziehungen und eine Neigung zu selbstdestruktivem Verhalten und Suizidversuchen (Dilling & Freyberger, 2010).
Die BPS im Jugendalter zeichnet sich durch eine Dominanz der sogenannten akuten Symptome (Kriterien 4 bis 6 und 9) aus. Bei jungen Menschen steht also meist die affektive und behaviorale Dysregulation im Zentrum der Symptomatik (Kaess et al., 2013a). Diese findet nahezu immer ihren Ausdruck in diversen riskanten und selbstschädigenden Verhaltensweisen, die in der Regel auch der Vorstellungsgrund der jungen Menschen im Gesundheitssystem sind.
Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der BPS nach DSM-5 (APA/Falkai et al., 2018)1
1
Verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden. (Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind.)
2
Ein Muster instabiler und intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet ist.
3
Identitätsstörung: ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung.
4
Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen (Geldausgaben, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, „Essanfälle“). (Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind.)
5
Wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder -drohungen oder Selbstverletzungsverhalten.
6
Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung (z. B. hochgradige episodische Dysphorie, Reizbarkeit oder Angst, wobei diese Verstimmungen gewöhnlich einige Stunden und nur selten mehr als einige Tage andauern).
7
Chronische Gefühle von Leere.
8
Unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut zu kontrollieren (z. B. häufige Wutausbrüche, andauernde Wut, wiederholte körperliche Auseinandersetzungen).
|3|9
Vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome.
Im DSM-5 wurde neben den herkömmlichen, kategorialen Diagnosen für verschiedene Persönlichkeitsstörungen auch erstmals ein neues, dimensionales Modell zur Diagnostik von Persönlichkeitspathologie auf einem Schweregradkontinuum eingebracht. Dieses könnte den nuancierten Übergängen von Normalität zu Dysfunktionalität im Rahmen von Persönlichkeitsstörungen eher gerecht werden. Dieses Modell existiert allerdings bisher nur in der sogenannten Sektion III, der Sektion für potenzielle diagnostische Kategorien, die zunächst noch weiterer Forschung bedürfen. Das alternative Modell für Persönlichkeitsstörungen beinhaltet sowohl eine Schweregradeinschätzung für das Funktionsniveau der Persönlichkeit als auch die Möglichkeit zur Kodierung problematischer Persönlichkeitsmerkmale.
Als diagnostische Kriterien dienen hierbei sowohl mittelgradige als auch stärkere Beeinträchtigungen im Funktionsniveau der Persönlichkeit, die sich in Schwierigkeiten in mindestens zwei der folgenden Bereiche manifestieren: Identität, Selbststeuerung, Empathie und Nähe.
Weiterhin muss mindestens ein problematisches Persönlichkeitsmerkmal aus den folgenden fünf Domänen (bipolare Begriffe) vorliegen:
Negative Affektivität versus emotionale Stabilität,
Verschlossenheit versus Extraversion,
Antagonismus versus Verträglichkeit,
Enthemmtheit versus Gewissenhaftigkeit,
Psychotizismus versus Adäquatheit.
Dieses neue Modell wurde von der American Psychiatric Association zwar nicht als hauptsächliches Klassifikationsmodell ins DSM-5 übernommen, es hatte jedoch einen starken Einfluss auf die Entwicklung der neuen ICD-11. Diese wird in Zukunft einen ähnlichen dimensionalen Ansatz zur Klassifikation der Persönlichkeitsstörungen einführen und auf kategoriale Diagnosen einzelner Persönlichkeitsstörungsentitäten verzichten. Lediglich die BPS, zu der empirische Evidenzen und störungsspezifische Behandlungen vorliegen, wird auch nach ICD-11 weiter kategorial zu diagnostizieren sein.
Im Frühjahr 2018 ist der Erstentwurf der neuen ICD-11 von der World Health Organisation veröffentlicht worden und beinhaltet nun in der Tat einen revolutionären Vorschlag zur Klassifikation der Persönlichkeitsstörungen. Im Vorfeld besonders zu bemerken ist, dass es kein Alterskriterium zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen mehr geben wird, sondern dass die bestehenden Persönlichkeitsmuster als „nicht entwicklungsgerecht“ eingestuft werden müssen. Zudem wird auf das bis dato für Persön|4|lichkeitsstörungen zentrale Kriterium der Stabilität verzichtet und stattdessen von einer mindestens zweijährigen Dauer gesprochen.
Analog zum DSM-5-Modell werden hier die beiden Kernkomponenten der Persönlichkeitsstörung zur Schweregradbeurteilung einer gestörten Persönlichkeitsfunktion (leicht, mittel, schwer) herangezogen. Die beiden Kernkomponenten sind Beeinträchtigungen im „Selbst“ (Identität und Selbststeuerung nach DSM-5) und Beeinträchtigungen in „interpersonellen Funktionen“ (Empathie und Nähe nach DSM-5).
Gleichzeitig können zusätzlich bestimmte auffällige Persönlichkeitsmerkmale oder -muster kodiert werden:
Negative Affektivität (die Tendenz, eine Vielzahl an unterschiedlichen negativen Emotionen zu erleben, die in Häufigkeit und Intensität nicht situationsangemessen sind),
Distanz (die Tendenz, soziale und emotionale Distanz zu wahren),
Dissozialität (die Tendenz, die Rechte und Gefühle anderer zu übergehen, einhergehend mit ausgeprägter Egozentrik und geringer Empathie),
Disinhibition (die Tendenz, aufgrund von akuten internen oder externen Stimuli umgehend zu handeln, ohne mögliche negative Konsequenzen zu bedenken),
Zwanghaftigkeit (die Tendenz, sich auf eigene rigide oder perfektionistische Standards zu fokussieren und das eigene Verhalten, das Verhalten anderer sowie Situationen dahingehend zu kontrollieren),
Borderline-Muster (das Borderline-Muster entspricht den Kriterien der heutigen BPS).
1.2 Die Diagnose der BPS im Jugendalter
Heutzutage wird die BPS zunehmend als „Diagnose der Lebensspanne“ bezeichnet (Tackett, Balsis, Oltmanns & Krueger, 2009). Die Diagnose einer BPS kann und sollte daher heute auch im Jugendalter gestellt werden (Kaess, Brunner & Chanen, 2014). Dieses Vorgehen war jedoch bis vor einigen Jahren wissenschaftlich hoch umstritten (Chanen & McCutcheon, 2008). Noch heute besteht in der klinischen Praxis eine große Zurückhaltung bei der Diagnosestellung dieser Störung, da sich bestimmte Vorbehalte und zum Teil längst widerlegte Grundannahmen hartnäckig halten (Kaess et al., 2014). Diese können in drei grundlegende (Fehl-)Annahmen eingeordnet werden, die inzwischen empirisch relativ klar widerlegt wurden.
Die Lebensphase der Adoleszenz, beginnend mit dem Eintritt in die Pubertät, geht allgemein mit einem erhöhten Maß an Stimmungsschwankungen und einer vermehrten Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Identität |5|einher (Brunner & Resch, 2008). Zusätzlich zeigen viele Jugendliche auch ein erhöhtes Maß an Impulsivität mit einer deutlichen Neigung zu riskanten und selbstschädigenden Verhaltensweisen (Kaess et al., 2014). Daher entsteht bis heute oftmals der Irrglaube, dass solche „angeblichen“ Merkmale der BPS in der Adoleszenz „normativ“ sind und sich auch wieder verwachsen.
Bisherige Daten zur BPS im Jugendalter zeigen, dass diese deutlich mit einem hohen Maß an Risikoverhalten und Selbstschädigung einhergeht (Kaess et al., 2014), und zwar weit über das normative Maß im Rahmen der Adoleszenz hinaus. So ist die BPS nicht nur in hohem Maße mit nicht suizidalem selbstverletzendem Verhalten (Wilcox et al., 2012) und Suizidversuchen (Yen et al., 2013) im Jugendalter assoziiert, es besteht auch ein deutlich erhöhtes Risiko für Substanzmissbrauch (Kaess et al., 2013a) und sexuelles Risikoverhalten (Chanen, Jovev & Jackson, 2007). Im Vergleich zu einer gesunden und einer klinischen Kontrollgruppe zeigten Jugendliche mit BPS ein höheres Maß an komorbiden psychiatrischen Erkrankungen sowie ein schlechteres psychosoziales Funktionsniveau (Kaess et al., 2013a). Auch längsschnittlich fand man bei Jugendlichen mit Borderline-Persönlichkeitspathologie bis zu 20 Jahre später eine deutliche Assoziation mit verschiedensten psychischen Erkrankungen sowie einem schlechten Funktionsniveau und reduzierter Lebensqualität (Crawford et al., 2008; Winograd, Cohen & Chen, 2008).
Hinweise für eine Validität der BPS ergeben sich auch aus dem deutlichen Zusammenhang der Diagnose mit negativen Kindheitserlebnissen, rangierend von schwerer sexueller Gewalt bis zum schwierigen und feindseligen Familienklima. Im Vergleich mit einer klinischen Kontrollgruppe von kinder- und jugendpsychiatrischen Patientinnen zeigte sich bei denen mit BPS ein signifikant höheres Maß an sexueller Gewalt, aber auch elterlicher Vernachlässigung und Antipathie, sowie eines reduzierten familiären Funktionsniveaus (Infurna et al., 2016).
Da sich die Persönlichkeit bei Kindern und Jugendlichen in der Entwicklung befindet, werden im Kindes- und Jugendalter eine mangelnde Stabilität der Persönlichkeit und somit auch eine mangelnde Stabilität von Persönlichkeitsstörungen postuliert.
Die Arbeitsgruppe um Jennifer Roberts untersuchte bei 205 Kindern aus der Normalbevölkerung die Stabilität von Persönlichkeitsmerkmalen während der Transition ins junge Erwachsenenalter (bis zu 20 Jahre später). Sie fand kohärente Persönlichkeitsmuster mit deutlicher Stabilität über die Zeit, sowie eine durchgehende Assoziation von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen mit erfolgreicher psychosozialer Adaptation (Shiner, Masten & Roberts, 2003). Dieselbe Arbeitsgruppe untersuchte in einer Metaanalyse von 92 Studien die Veränderung von Persönlichkeitsmerkmalen (u. a. emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträg|6|lichkeit) über die gesamte Lebensspanne (Roberts, Walton & Viechtbauer, 2006): Die deutlichste Veränderung zeigte sich im jungen bis mittleren Erwachsenenalter (20 bis 40 Jahre) in Bereichen wie emotionale Stabilität und Extraversion, zwei Faktoren die oftmals mit der Borderline-Pathologie in Verbindung gebracht werden. Der Persönlichkeitsfaktor Verträglichkeit veränderte sich erst im höheren Alter maßgeblich. Die Befunde zeigen insgesamt eine hohe Veränderbarkeit von Persönlichkeitsmerkmalen über die Lebensspanne und weisen nicht auf eine ausgereifte Persönlichkeit im Erwachsenenalter hin.
Natürlich geht es bei den berichteten Befunden nicht um Persönlichkeitspathologie, sondern um Persönlichkeitseigenschaften im Allgemeinen. Eine Studie der Arbeitsgruppe um Professor Andrew Chanen zeigte, dass die Zweijahres-Stabilität der kategorialen und dimensionalen Persönlichkeitspathologie mit Befunden des Erwachsenenalters vergleichbar war (Chanen et al., 2004). Für die BPS lagen die Werte bezüglich der Stabilität im oberen Drittel unter den Persönlichkeitsstörungen.
Die BPS galt lange Zeit als kaum oder nur äußerst schwer therapierbar, was inzwischen sehr klar widerlegt wurde. Im Fokus der Therapie steht die störungsspezifische Psychotherapie, für die es im Erwachsenenalter schon einen hohen Grad an Evidenz gibt (Stoffers-Winterling et al., 2012). Hierdurch ergibt sich die Perspektive der möglichen Frühintervention (Chanen & McCutcheon, 2013). Erste Ergebnisse von Interventionsstudien bei Jugendlichen sind vielversprechend (vgl. Kapitel 1.7).
Zusätzlich zu den ersten Wirksamkeitsnachweisen für die Behandlung der BPS geben auch Langzeituntersuchungen von Kohorten erwachsener Borderline-Patienten Anlass zur Hoffnung. In einer Langzeitnachverfolgung von ehemaligen erwachsenen Patienten mit BPS erfüllten 85 % der Studienteilnehmer nach zehn Jahren nicht mehr die Diagnosekriterien (Gunderson et al., 2011), und diese Prozentzahl stieg in einer weiteren Kohortenstudie nach 16 Jahren auf 99 % an (Zanarini, Frankenburg, Reich & Fitzmaurice, 2012). Leider geben diese Zahlen keinen Anlass zu übertriebener Euphorie, denn viele dieser Patienten litten weiterhin unter einer Vielzahl psychiatrischer Erkrankungen und zeigten zum Teil ein besorgniserregend niedriges Funktionsniveau und eine stark reduzierte Lebensqualität. Dennoch sprechen diese Befunde ganz klar für eine Veränderbarkeit der BPS.
Leider ist die BPS mit einem hohen Maß an Stigma behaftet. Dieses Stigma existiert jedoch weniger in der Allgemeinbevölkerung, da die Diagnose der BPS hier oftmals gar nicht ausreichend bekannt ist. Das Stigma existiert bei den Patientinnen selbst (Rüsch et al., 2006), vor allem aber innerhalb der professionellen Helfersysteme (Aviram, Brodsky & Stanley, 2006). Es ist unsere eigene Berufsgruppe, die diesen Patientinnen eine Vielzahl schlechter Eigenschaften zuschreibt. Borderline-Patientinnen gelten all|7|gemein als schwer zu therapieren, wenig veränderungsmotiviert und ungemein anstrengend. Zudem „spalten“ sie therapeutische Teams, zeigen eine mangelnde Compliance und bereiten uns durch ihre chronische und intermittierende Eigengefährdung oftmals schlaflose Nächte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass gerade die Wohlwollenden unter uns es gerne vermeiden möchten, ihren Patientinnen dieses Stigma zuzumuten.
Doch auch wenn wir die Diagnose nicht aufs Papier bringen und auch wenn wir die Diagnose den Patientinnen gegenüber nicht kommunizieren, so wird trotzdem eine große Anzahl der Diagnosen einer BPS im Stationszimmer oder mindestens in unseren Köpfen gestellt. Wer hat nicht schon einmal erlebt, dass besonders schwierige oder anstrengende Jugendliche ohne adäquate Diagnostik inoffiziell mit dem Label „Borderline“ versehen wurden? In der Geschichte von Harry Potter wird die Angst vor Lord Voldemort dadurch betont, dass über ihn als „der, dessen Name nicht genannt werden darf“ gesprochen wird. So ist auch die BPS eine „Störung, deren Name nicht genannt werden darf“. Doch vermindert dies wirklich das Stigma, oder machen wir es damit vielleicht noch schlimmer?
1.3 Prävalenz und Verlauf
Eine epidemiologische Untersuchung, die das Jugendalter mit eingeschlossen hat, weist auf einen kumulativen Anstieg der Prävalenz von 1,4 % im Alter von 16 Jahren auf 3,2 % im Alter von 22 Jahren hin (Johnson, Cohen, Kasen, Skodol & Oldham, 2008). Untersuchungen zur Prävalenz der BPS im Erwachsenenalter nehmen eine Spannbreite von 0,7 % bis 2,7 % in der Allgemeinbevölkerung an (Coid, Yang, Tyrer, Roberts & Ullrich, 2006; Trull, Jahng, Tomko, Wood & Sher, 2010). Dabei zeigt sich eine geringfügige Dominanz des weiblichen Geschlechtes (Torgersen, Kringlen & Cramer, 2001), die in den klinischen Settings des Erwachsenen- wie auch des Jugendalters noch deutlich ausgeprägter wird (Chanen et al., 2008a; Kaess, Fischer-Waldschmidt, Resch & Koenig, 2017a). Untersuchungen zum Langzeitverlauf von Patienten mit einer BPS, die erstmalig im Jugendalter diagnostiziert wurden, liegen bislang nicht vor. Trotz hoher Remissionsrate von 85 % bei erwachsenen Patienten (Gunderson et al., 2011) bleibt ein substanzieller Anteil der Patienten psychiatrisch behandlungsbedürftig. Dabei weisen die meisten eine affektive Störung sowie weitere psychische Auffälligkeiten auf, ohne jedoch das Vollbild einer BPS zu erreichen. Auch wird auf einen Symptom- bzw. Syndromshift hingewiesen, vor allem in Richtung von affektiven und substanzbezogenen Störungen. Dieser Symptomshift vom direkten selbstverletzenden Verhalten hin zum Substanzmissbrauch konnte in Abhängigkeit der Borderline-Persönlichkeitspathologie auch bei einer jugendlichen Längsschnittuntersuchung gezeigt werden (Nakar et al., 2016). Zudem zeigen |8|Nachuntersuchungen bei Erwachsenen mit einer mittleren Katamnesedauer (6 Jahre) eine substanzielle Suizidrate von 4 % (Skodol et al., 2002).
1.4 Komorbidität und Differenzialdiagnostik
Wie im Erwachsenenalter besteht eine große Heterogenität im Erscheinungsbild der BPS bei Jugendlichen, die durch das Vorliegen komorbider Störungen weiter verstärkt wird und eine Etablierung effektiver Therapiemaßnahmen erschwert. Studien konnten zeigen, dass nahezu 100 % der Jugendlichen, die die Diagnose einer BPS erfüllen, zusätzlich die Diagnosekriterien für mindestens eine weitere psychische Störung erfüllen. Im Vergleich mit einer Gruppe von jugendlichen Patientinnen mit anderen Persönlichkeitsstörungsdiagnosen zeigen Patientinnen mit einer BPS häufiger eine Vielzahl von komorbiden psychischen Störungen sowie zusätzliche Persönlichkeitsstörungsdiagnosen (Chanen et al., 2007; Kaess et al., 2013a). Nach einer weiteren Studie (Ha, Balderas, Zanarini, Oldham & Sharp, 2014) weisen jugendliche Patientinnen mit einer BPS durchschnittlich zwei bis drei weitere psychiatrische Diagnosen auf. Die häufigsten komorbid auftretenden Diagnosen sind depressive Störungen, Essstörungen, dissoziative und posttraumatische Störungen sowie Substanzmissbrauchsstörungen (Feenstra et al., 2012). Bereits im Kindesalter und damit oftmals vor Diagnose einer BPS zeigen sich oft klinische Manifestationen einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS; Ditrich, Philipsen & Matthies, 2021) oder einer Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD, Disruptive Affektregulationsstörung). Im Bereich der komorbiden Persönlichkeitsstörungen zeigt sich eine gehäufte Koinzidenz mit Persönlichkeitsstörungsdiagnosen primär aus dem Cluster B (mit „dramatischem, emotionalem und launenhaftem Verhalten“) und Cluster C (mit „ängstlichem und vermeidendem Verhalten“) (Kaess et al., 2013a).
Aufgrund der starken Heterogenität der Symptomatik sowie der hohen Neigung zu Komorbidität ist die Differenzialdiagnostik der BPS eine Herausforderung und es bestehen zu einigen Störungsbildern immer wieder Abgrenzungsschwierigkeiten. Da Jugendliche mit BPS nicht selten auch in schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen sind oder von zahlreichen negativen oder sogar traumatischen Kindheitserlebnissen berichten, ist die Abklärung des Vorliegens einer posttraumatischen Belastungsstörung unumgänglich, da diese oft als komorbide Erkrankung auftritt (Yen et al., 2002).
Von der BPS differenzialdiagnostisch schwierig abzugrenzen ist die Bipolar-II-Störung, da beide Diagnosen ähnliche Symptome aufweisen (Kaess et al., 2014). Emotionale Labilität, Probleme, Wut zu kontrollieren, Impulsivität und Suizidalität sind Symptome, die bei beiden Störungsbildern vor|9|kommen (Ruggero, Zimmermann, Chelminski & Young, 2010). Personen mit BPS zeigen jedoch mehr und häufiger negative Gefühle, wechseln ihre Gefühlzustände schneller und unkontrollierter und häufig als Reaktion auf zwischenmenschliche Ereignisse. Bipolar-II-Störungen hingegen beginnen meist plötzlich im späten Jugendalter bzw. frühen Erwachsenenalter und remittieren nicht mit zunehmendem Alter. Ihre Gefühlszustände sind oft von Erregtheit gekennzeichnet und in der Regel von zwischenmenschlichen Ereignissen unabhängig (Bayes, Parker & Fletcher, 2014; Renaud, Corbalan & Beaulieu, 2012). Sie haben im Gegensatz zur BPS klassischerweise einen episodischen Charakter.
Die oben beschriebenen dissoziativen Symptome (z. B., sich nicht real zu fühlen), paranoiden Symptome (z. B., verfolgt zu werden durch unbekannte Gestalten) und halluzinatorischen Symptome der BPS (visuell und akustisch, z. B. in Form von Stimmen, Geräuschen oder Schatten) machen oft eine differenzialdiagnostische Abklärung mit Blick auf psychotische Störungen erforderlich. Diese Abklärung ist besonders wichtig, da die beiden Störungsbilder verschiedene Behandlungspfade notwendig machen. Treten die genannten Symptome eindeutig nicht im Rahmen einer psychotischen Störung auf, kann man den Patienten mit BPS eine unnötige, zeit- und kostenintensive und leider meistens zwecklose medikamentöse Behandlung ersparen. Dammann und Walter (2003) zeigen in ihrer Arbeit eine hilfreiche Zusammenfassung von Symptomen zur differenzialdiagnostischen Abklärung. So beschreiben sie, dass Borderline-Patienten in der Regel keine formalen Denkstörungen, schwerwiegende Ich-Störungen wie Verwischung der Ich-Grenzen oder eine klare Aufhebung der inneren und äußeren Realität zeigen. Allerdings hat die empirische Forschung der letzten Jahre diese klinischen Abgrenzungsmöglichkeiten zunehmend infrage gestellt, da sich in mehreren Studien keine oder nur sehr geringfügige phänomenologische Unterschiede zwischen psychotischen Symptomen bei Patienten mit BPS und Patienten mit Schizophrenie finden ließen (Cavelti, Thompson, Chanen & Kaess, 2021).
1.5 Pathogenese
1.5.1 Neurobiologie
Während neurobiologische Aspekte bei der BPS im Erwachsenenalter vermehrt Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen in den letzten zwei Jahrzehnten waren, stehen grundlagenwissenschaftliche Untersuchungen bei Jugendlichen mit einer BPS erst am Anfang. Die wenigen vorliegenden Studien (Goodman, Mascitelli & Triebwasser, 2013) beziehen sich insbesondere auf neuropsychologische und bildgebende Untersuchungen. Grund|10|sätzlich erscheinen Untersuchungen am Beginn der Manifestation der BPS besonders wertvoll. Zu diesem Zeitpunkt können biologische Befunde eher als für die Entwicklung der Störung relevant interpretiert werden. Später ist ein stärkerer Einfluss von Behandlungs- und Chronifizierungseffekten auf die Störungsentwicklung anzunehmen (Brunner et al., 2010).
Den genetischen Faktoren in der Genese der BPS wird bisher nur ein moderater Einfluss zugeschrieben (Kaess et al., 2014). Es gibt jedoch Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Temperament. Die klinisch auffällige Koinzidenz von ausgeprägten externalen Symptomen und internalisierten Symptomen ist bei Jugendlichen mit einer BPS charakteristisch und könnte Ausdruck der unterliegenden Temperamentskonstellation und weiterer assoziierter biologischer Faktoren sein (Kaess et al., 2013b). Das Vorliegen dieser Temperamentsmerkmale im Zusammenhang mit der Entwicklung von BPS-Symptomen sowie deren Interaktion mit sehr frühen negativen Bindungserfahrungen wurden kürzlich sogar in einer prospektiven Geburtskohorte nachgewiesen (Fleck et al., 2021). Grundlage der unterschiedlichen Temperamentsausprägungen stellt nach Cloninger, Przybeck, Svrakic und Wetzel (1994) die unterschiedliche Balance bzw. Prädominanz einzelner Neurotransmittersysteme dar (Serotonin, Dopamin, Noradrenalin). So könnte beispielweise eine veränderte Synthese einer dieser biogenen Amine zur Ausgestaltung von Temperamentsfaktoren beitragen. Diese wiederum könnten die Basis für eine spezifische Reagibilität auf Belastung und Ausformung einer Psychopathologie darstellen. Untersuchungen zu Kandidatengenen aus dem serotonergen und dopaminergen System haben bisher jedoch keine überzeugenden und empirisch hinreichend abgesicherten Ergebnisse erbracht (Chanen & Kaess, 2012). Eine Studie bei Jugendlichen postulierte einen Einfluss eines spezifischen Genpolymorphismus (kurzes Allel des 5-HTTLPR) als Risikofaktor für die Entwicklung einer BPS (Hankin et al., 2011). Eine kürzlich publizierte Studie konnte zwar ebenfalls keine konkreten Gene für die Entwicklung einer BPS identifizieren, BPS-Symptome im frühen Jugendalter zeigten aber einen deutlichen prognostischen Wert hinsichtlich Psychopathologie und Funktionsniveau im Erwachsenenalter, der sich hauptsächlich auf eine gemeinsame genetische Basis von BPS und anderen Formen der Psychopathologie zurückführen ließ (Wertz et al., 2020). Insgesamt scheint es sich bei der BPS ähnlich zu verhalten wie bei den meisten psychischen Erkrankungen: Es gibt eine zugrunde liegende genetische Vulnerabilität, die nicht spezifisch für die BPS ist, und selbst diese ist sehr polygen vererbt, sodass einzelne Gene kaum diese Vulnerabilität erklären können. Der genetische Anteil erklärt die Entstehung der BPS also nicht ausreichen und muss in Kombination mit Umweltfaktoren gesehen werden.
Funktionelle Bildgebungsstudien konnten Hinweise auf veränderte cerebrale Mechanismen der Emotionsverarbeitung in zahlreichen Untersuchungen (Krause-Utz, Winter, Niedtfeld & Schmahl, 2014) replizieren. |11|Neben der Hyperaktivität des limbischen Systems wurde eine gleichzeitige Deaktivierung präfrontaler Strukturen gefunden. Dies unterstützt das Modell der frontolimbischen Dysfunktion bei Patientinnen mit einer BPS. Das Modell betont eine verringerte kognitive Kontrollfähigkeit (Top-down-Regulation ist reduziert) bei gleichzeitig ausgeprägter limbischer Aktivierung (Bottom-up ist erhöht). Die Folge ist eine emotionale Dysregulation.
In einer bildgebenden Studie der Heidelberger Arbeitsgruppe (Brunner et al., 2010) bei Jugendlichen mit einer BPS fand sich eine Reduktion des Volumens im orbitofrontalen Cortex auf beiden Hirnhemisphären sowie im dorsolateralen präfrontalen Cortex linkshemisphärisch. Außerdem wurde eine signifikante Reduktion des beidseitigen Hippocampusvolumens und der rechtsseitigen Amygdala gefunden. Die Unterschiede bestanden jedoch nur im Vergleich mit einer gesunden Kontrollgruppe und nicht gegenüber einer klinischen Vergleichsgruppe, sodass eine Spezifität der Befunde nicht vorliegt (Brunner et al., 2010). Die veränderte Hirnmorphologie scheint ein potenzieller Vulnerabilitätsfaktor für die Genese psychiatrischer Störungen zu sein. Eine kürzlich erschienene Arbeit zur funktionellen Infrarotspektroskopie bei Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten konnte einen Zusammenhang von BPS-Symptomen mit niedriger frontaler Oxygenierung aufzeigen (Koenig et al., 2021).
Außerdem liegen derzeit wenige mikrostrukturelle Studien vor, die mithilfe der diffusionsgewichteten Bildgebung die Integrität der weißen Hirnsubstanz untersucht haben (Maier-Hein et al., 2013; New et al., 2013). Dabei wurden krankheitsspezifische Veränderungen in Nervenfaserverbindungen, die sowohl mit der Emotionsregulierung wie auch Emotionserkennung in Verbindung gebracht werden, gefunden. Die Autoren schlossen hieraus, dass bereits bei Jugendlichen mit einer BPS umfassende Netzwerkstrukturen der Emotionsverarbeitung gestört sein könnten.
Die klinisch so auffällig erhöhte Stressreagibilität von Jugendlichen mit einer BPS, die eng verbunden mit den aggressiven und autoaggressiven Verhaltensweisen erscheint, war Ausgangspunkt für die Untersuchung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHNA). Sowohl bei erwachsenen Patienten (Drews, Fertuck, Koenig, Kaess & Arntz, 2019; Nater et al., 2010) als auch in einer Gruppe von jugendlichen Patienten mit repetitivem selbstverletzendem Verhalten (43 % der Gruppe hatte die Diagnose einer BPS; Kaess et al., 2012) konnte eine verringerte Kortisolreaktion auf einen experimentell induzierten Stressor erhoben werden. Für Erwachsene mit einer BPS konnte zusätzlich eine chronische Aktivierung der HHNA über den Tag hinweg gezeigt werden (Drews et al., 2019). Dies geht in der Regel mit einer Erhöhung der sogenannten Kortisolaufwachreaktion einher (Rausch et al., 2015), ein Befund, der ebenfalls bei Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten repliziert werden konnte (Reichl et al., 2016). Das wahrscheinlichste biologische Modell deutet derzeit da|12|rauf hin, dass eine chronische Überaktivierung der HHNA in der Kindheit (aufgrund chronischer Stressoren, wie z. B. Erlebnissen von Vernachlässigung oder sexueller Gewalt) in einer langfristig gestörten Regulation mit chronischer Überaktivierung, aber fehlenden Möglichkeiten zur Reagibilität mündet (Kaess, Whittle, O’Brien-Simpson, Allen & Simmons, 2018).