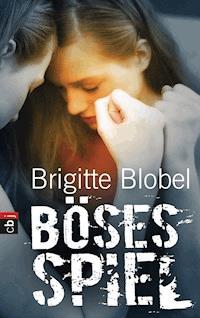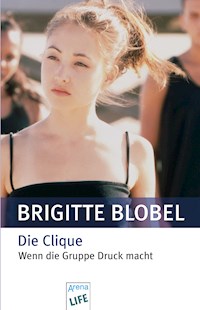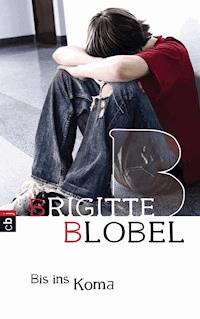Inhaltsverzeichnis
KIELER NACHRICHTEN, 28. Juni Warum wollte Svetlana sterben?
PROLOG
FEBRUAR
MÄRZ
APRIL
MAI
JUNI
EPILOG
Copyright
KIELER NACHRICHTEN, 28. Juni Warum wollte Svetlana sterben?
Einem unfassbaren Zufall ist es zu verdanken, dass der Selbstmordversuch eines 14-jährigen Mädchens in letzter Sekunde verhindert werden konnte!
Svetlana A., die als externe Schülerin das Gymnasium Erlenhof besucht, muss so verzweifelt gewesen sein, dass sie in ihrem Leben wohl keinen Sinn mehr sah.
Am gestrigen Mittag gegen 12.30 Uhr hat sie die Koppelzäune und das Brombeergestrüpp am Bahndamm zwischen den Stationen Sörup und Süderbrarup überwunden und sich auf die Gleise gelegt.
Der Regionalzug, der auf der eingleisigen Bahnstrecke im Halbstundentakt verkehrt, hätte diese Stelle um 12.42 passiert.
Da die junge Ukrainerin – sie ist mit ihren Eltern erst vor drei Jahren nach Deutschland gekommen – das Ende einer lang gezogenen Kurve gewählt hatte, spät einsehbar vom Zugführer, wäre der Bremsweg nach Auskunft der Bahnpolizei in jedem Falle zu kurz gewesen. Der Tod unvermeidbar.
Doch Svetlana sollte nicht sterben.
Denn ein türkischer Vater, Aslan Üzgül, suchte am Bahndamm die Schultasche seines Sohnes und entdeckte dabei die Schülerin.
Aslan Üzgül, der das Mädchen von den Gleisen holte, Sekunden bevor der Zug anrollte, ist noch immer tief erschüttert.
»Ich danke Allah«, sagte er dieser Zeitung, »dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, ein Menschenleben zu retten. Ich weiß nicht, warum dieses hübsche Mädchen sterben wollte. Aber ich bin ganz sicher, dass sie schon bald, wenn der Schock überwunden ist, sich wieder auf das Leben freut und auf die Zukunft, die vor ihr liegt.«
Über die Gründe, die das junge Mädchen zu diesem Kurzschluss verleitet haben, ist nichts bekannt.
Svetlana ist bislang nicht vernehmungsfähig.
PROLOG
Ich heiße Svetlana Olga Aitmatowa. Ich bin vierzehn Jahre alt und weit von hier zur Welt gekommen, in einem Zug zwischen Sibirien und der Ukraine. Meine Mutter sagt, sie hätte es damals noch bis in ein Krankenhaus geschafft, wenn der Zug wegen Schneeverwehungen nicht zwei Tage irgendwo liegen geblieben wäre. Zwei Frauen aus dem Abteil haben ihr bei meiner Geburt geholfen, und ein alter Mann hatte eine Thermoskanne mit kochendem Wasser, gerade aufgefüllt an der letzten Station. Eine der Frauen hieß Svetlana, die andere Olga. Daher habe ich meine Namen. Manche Dinge im Leben kann man sich nicht aussuchen. Ich würde gerne Jackie heißen oder Maggie. Meine Mutter wollte mir eigentlich einen deutschen Vornamen geben, wie Katja oder vielleicht Marie. Weil sie schon damals davon geträumt hat, als sogenannte Russlanddeutsche eine Ausreiseerlaubnis zu bekommen.
Ich bin ein Meter und dreiundsiebzig groß, habe die Blutgruppe Null, helles, mittelblondes Haar und graublaue Augen. Außer den üblichen Kinderkrankheiten hatte ich nur eine Blinddarmentzündung. Im Grunde bin ich ein kerngesunder Mensch. Im Grunde... Und seit ein paar Tagen geht es auch wieder aufwärts mit mir, ich fühle mich besser. Jetzt haben wir – glaube ich – schon Anfang August. Es sind Ferien.
Manchmal, wenn ich wegen der Hitzewelle, die gerade hier in Schleswig-Holstein herrscht, nicht einschlafen kann, stelle ich mir meine Schule vor, so ganz ohne Schüler. Und ohne Lehrer. Ohne Lärm und ohne Gerenne und Gelächter. Und ohne Leute, die sich auf dem Klo verstecken müssen, weil sie Angst haben. Die Tafel in deiner Klasse ist sauber gewischt. Darauf stehen keine Sachen, die dir Angst machen könnten. Auf deinem Platz klebt kein Zettel, der dich rot werden lässt. Oder dir Tränen der Wut in die Augen treibt. Niemand lauert dir im Treppenhaus auf.
In meiner Vorstellung sind im Klassenraum alle Fenster geöffnet. Die Krähen fliegen hinein und hinaus. Manche machen auf die Tische oder hocken auf der Stuhllehne und drehen ihre Köpfe hierhin und dorthin. Sie denken wahrscheinlich, dass es hier schön ist und friedlich. Und überlegen vielleicht, hier nächstes Jahr ihr Nest zu bauen, oben hinter dem Globus auf dem Kartenschrank oder auf der Fensterbank, auf die morgens der erste Sonnenstrahl fällt.
Tiere sind ahnungslos. Sie können sich nicht vorstellen, wie gemein die Menschen zueinander sind. Eine Krähe hackt der anderen eben kein Auge aus. Krähen wären die besseren Menschen.
Ich wohne bei meinen Eltern im Finkenweg Nr. 9, erster Stock, in Wohlstorf, einem kleinen Ort. (Jetzt allerdings bin ich für eine Zeit hier in der Kieler Psychiatrie...) Meine Mutter heißt Anna, Anna Leschkowa, weil mein Vater Leschkow heißt, Oleg Leschkow. Vor drei Jahren sind wir aus Dobroje nach Deutschland gekommen. Dobroje ist eine kleine Stadt in der Ostukraine. Obwohl meine Mutter deutsche Vorfahren hat und sie mir als Kind deutsche Schlaflieder vorsang, haben wir immer nur Russisch gesprochen. Ich konnte, als ich fünf Jahre alt war, zwar nachplappern: Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen... Aber wenn man mich gefragt hätte, was das heißt – keine Ahnung.
Oleg ist nicht mein leiblicher Vater. Aber er ist trotzdem ein guter Papa. Ich sage manchmal Papusch zu ihm. Er ist nur aus Liebe zu uns mit nach Deutschland gekommen. Meine Mutter sagt immer, dass Olegs Seele in der Ukraine geblieben ist.
Ich bin gerne hier in der Klinik. Alle Ärzte und Schwestern sind sehr nett zu mir. Ich fürchte mich nie, wenn die Tür aufgeht. Hier kann nicht einfach jeder hereinkommen. Auch nicht die Leute aus meiner Schule, die das böse Spiel mit mir getrieben haben. Hier ist alles abgeschlossen. Die Schwestern und die Ärzte laufen mit einem großen Schlüsselbund herum. Niemand kann einfach herein- oder herausspazieren.
Dieses ist die Jugendpsychiatrie und ich bin in der geschlossenen Abteilung. Seit ich hierhergekommen bin, war ich noch nie außerhalb der Klinikmauern. Aber das ist okay für mich. Denn zu unserer Abteilung gehört ein Garten. Mit Bänken und einem Stück Rasen. Das Schönste an dem Garten sind die hohen Mauern, die ihn umgeben. Dicke rote Backsteinmauern. In der Mitte steht eine große Kastanie. Sie hat einen Ast, der weit herausragt; ein dicker Ast, an dem man gut eine Schaukel befestigen könnte. Manchmal träume ich davon, auf einer Schaukel hin- und herzuschwingen, hoch hinaus bis zu den Vögeln.
Aber ich denke mir, es ist doch besser, dass es hier keine Schaukel gibt. Sie wäre an Seilen befestigt. Seile oder Stricke kann man sich auch gut um den Hals legen, wenn man Schluss machen will. Erhängen ist grässlich. Ich persönlich würde nie auf solch eine Idee kommen, ich weiß nicht mal, wie man eine Schlinge macht, die dazu taugt. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber das ist vielleicht der Grund, warum wir keine Schaukel haben.
Gestern habe ich im Garten mit Malte Schach gespielt. Malte hält sich für einen sehr guten Schachspieler. Er hat bestimmt ein Dutzend Eröffnungen im Kopf. Er liest Bücher über Schach, über berühmte Partien. Er weiß alles über Kasparow. Ich sehe ihn immer nur über sein kleines Taschenschachbrett gebeugt. Im Aufenthaltsraum, im Garten oder auf den Fluren des Klinikums, wenn er auf einen Arzttermin oder eine Behandlung wartet. Er spielt gegen sich selbst. »Ich gewinne immer«, sagt er. »Mich schlägt keiner.« Es klingt für mich irgendwie so, als wären diese Siege die einzigen in seinem Leben. Als wäre er sonst oft geschlagen worden. Bei Gelegenheiten, die nichts mit Schach zu tun haben. Als er herausbekam, dass ich auch gerne Schach spiele, hat er mich sofort zu einer Partie eingeladen.
Warum nicht? Es vertreibt die Zeit.
Malte hatte die weiße Dame, durfte also den Eröffnungszug machen. Zieht natürlich den Königsbauern, ich ebenfalls. Er greift meinen Bauern an. Ich zieh mit dem Läufer. Die Grundstellung der Spanischen Partie. Aber was macht er draus? Wie entwickelt er seine Figuren? Alles so leicht durchschaubar. Ich konnte drei Züge von ihm im Voraus berechnen. Das war alles so durchsichtig! Gähn! Ich hätte ihn schon nach dem achten Zug schachmatt setzen können, und ich habe außerdem immer so getan, als müsste ich wahnsinnig nachdenken vor jedem Zug. Wenn Malte erst mal weiß, dass ich ihn schlagen kann, will er bestimmt nicht mehr mit mir spielen.
Wenn wir zu Hause Rommé spielen, verliert Mama immer. Und Papa holt dann eine Schachtel Nougatkonfekt heraus, um den Sieg zu feiern. Die Kerle wollen immer gewinnen, sagt Mama. Man muss sie lassen. Ich glaube aber nicht, dass sie das wirklich ernst meint.
Meine Mutter war früher Jugendbezirksmeisterin im Schach. Sie hat es mir beigebracht. Sie hat mit mir trainiert, um mich fit zu machen für die Jugendmeisterschaften. Mama hat immer so eine Energie, so einen Riesenehrgeiz.
Aber ich interessierte mich zu der Zeit schon viel mehr für alles, was mit Medizin zusammenhing. Als ich neun war, wollte ich Ärztin werden. Ich wünschte mir zum Geburtstag ein Mikroskop. Ich hab mir von meinem Fuß einen kleinen Schnipsel Hornhaut abgeschnitten und jeden Tag unter dem Mikroskop beobachtet, wie sich die Haut verändert. Ich hab mir Haare ausgezogen, meine abgeschnittenen Fingernägel und einmal sogar meinen Nasenrotz untersucht.
Meine Lieblingsbücher in der Stadtbibliothek von Dobroje waren ausnahmslos medizinische Bücher. Dort hab ich alles Mögliche nachgelesen, wie das Blut im menschlichen Körper zirkuliert oder wie Eiter entsteht – als ich gerade eine Wunde am Knie hatte. Das war spannend.
Kinderbücher hab ich nie gelesen. So was fand ich immer langweilig. Die dritte Schulklasse damals in der Ukraine hab ich übersprungen. Ich war von da an überall die Jüngste, aber das hat mir nichts ausgemacht.
Vielleicht erzähle ich das alles irgendwann mal Malte, wenn wir genug Vertrauen zu einander haben. Mal sehn.
Ich weiß nicht, weshalb Malte hier ist. Ich könnte Dr. Wiedemann fragen, er würde es mir bestimmt sagen. Aber egal. Ich weiß nicht einmal, wie alt Malte ist, ich schätze, ein oder zwei Jahre älter als ich. Seine Nägel sind so abgekaut, dass die Fingerkuppen oft bluten. Dann trägt er Handschuhe aus dünner Baumwolle, die an den Handgelenken zugebunden sind. Meistens versteckt er seine Hände hinter dem Rücken, weil er sich vielleicht schämt. Ich verstehe nicht, wie jemand seine Finger so anknabbern kann, dass es blutet. Das tut mit Sicherheit wahnsinnig weh, weil an den Fingerkuppen die Nervenenden sind. Ganze Nervenbündel. Extrem empfindlich.
Aber vielleicht verstehe ich es doch, warum er sich selbst Schmerzen zufügt. Es ist auch eine Art, sich daran zu erinnern, dass man lebt.
Niemand kommt ohne Erlaubnis in unsere Abteilung, das hat Dr. Wiedemann mir erklärt. Er sagt, hier bin ich vor bösen Überraschungen geschützt. Jeder Besucher braucht eine Genehmigung des Klinikarztes und auch dann gelangt er nur in den vorderen, den offenen Bereich. Unsere Türen hier haben keine Klinken, sie können ohne Schlüssel gar nicht geöffnet werden.
Ich bin froh, dass es so etwas gibt. Ich bekomme hier den Schutz, den ich sonst nirgendwo habe.
Die Gitter vor meinem Fenster sind eine große Beruhigung. Ich kann schlafen bei offenem Fenster. Wenn es das Gitter nicht gäbe, hätte ich vielleicht Angst davor, dass jemand hereinklettert oder mir auch nur seine grinsende Fratze zeigt und mir die Zunge rausstreckt. Ich weiß, die Gitter sollen verhindern, dass wir einfach aus dem Fenster springen. Aber ich liege im zweiten Stock. Wenn man springen würde, wäre es überhaupt nicht sicher, dass man dann auch wirklich tot ist. Das würde also gar nichts bringen.
Hier hat man keine Handys und keine Computer. Ich bin für die anderen nicht mehr erreichbar.
Hätte ich von dieser Klinik gewusst, so hätte ich mir schon früher gewünscht, hierher zu kommen. Ganz sicher. Hier, wo niemand ein böses Spiel mit mir treibt.
FEBRUAR
»Mama! Mammutschka!!«
Ich lief durch den Supermarkt, nahm eine enge Kurve an der Salatbar vorbei, um die Getränkekisten herum, die gestapelten Bierkästen. Ich war wie blind, ich sah gar nichts, nicht einmal Monika, die Kollegin meiner Mutter, die gerade eine Pyramide aus Linsendosen aufbaute.
Offenbar ein Sonderangebot.
»Mama!«
Die Pyramide kippte in einem ohrenbetäubenden Krachen um, die Dosen kullerten über den gekachelten Boden. Es war furchtbar. Aber mir war das in dem Augenblick gar nicht wirklich bewusst. Ich sah nur, wie Monikas rote Pippi-Langstrumpf-Perücke verrutschte, sodass die energische und sonst so clevere Frau auf einmal wie ein großer trauriger Clown aussah. Ich machte einen Satz über den Dosenhaufen und fiel ihr in die Arme. »Tut mir Leid, Monika, ich bring das gleich in Ordnung, ich schwör’s, ich muss nur Mama vorher schnell etwas ganz Wichtiges sagen!« Und schon war ich weiter.
»Hoppla, Svetlana! Nicht so forsch!« Das war Herr Wischnewski, den ich fast umgerannt hätte, als ich um die Ecke mit dem Tiefkühlschrank bog. »Das hier ist keine Rennbahn.«
»Ich weiß, Herr Wischnewski, tut mir Leid. Aber ich bin so in Eile!« Ich keuchte, ich kriegte kaum Luft, weil ich so aufgeregt war, aber ich bremste und strahlte ihn an. Für ihn musste ich mir Zeit nehmen. Herr Wischnewski war der Chef meiner Mutter, er konnte ihr kündigen, sie innerhalb von einem Monat vor die Tür setzen, ohne besondere Begründung. Solche Arbeitsverträge machte er. Es gab keinen Betriebsrat und für die Branche auch keine Mindestlöhne. Aber Mama war trotzdem froh, dass sie den Job gefunden hatte ohne Vermittlung durch das Arbeitsamt.
Also musste sie mit ihm gut auskommen, auch wenn er ein Kotzbrocken war, der seinen weiblichen Angestellten gern mal wie zufällig den Hintern tätschelte und sie am Busen berührte. Gern auch ein bisschen mehr, wenn er sie zu einer Aussprache in sein Büro zitierte. Ich hasse solche Kerle, die immer so einen lüsternen Blick haben, wenn sie weibliches Fleisch sehen. Und ihre Hände nicht ruhig halten können. Ich finde, man dürfte denen das nicht durchgehen lassen, aber Mama sagte immer, wenn ich mich aufregte: »Ach Kätzchen, lass. Es gibt Schlimmeres.«
Mamas Chef trug an diesem Tag eine goldbestickte Karnevalsmütze zu einer roten Uniformjacke. Dazu leuchtend rote Apfelbacken und einen angeklebten schwarzen Schnurrbart, der ihn irgendwie als genau den schmierigen Kerl entlarvte, der er in Wirklichkeit war. Aber das merkte er wohl nicht.
Es war Faschingsdienstag, der Tag vor Aschermittwoch. Normalerweise wird das in Schleswig-Holstein nicht groß gefeiert, aber Herr Wischnewski hatte vorher bei SPAR in Köln-Porz gearbeitet, wo die Leute wie entfesselt Karneval feiern. Das war offenbar seine beste Zeit gewesen, denn in den Faschingstagen verteilte er Karnevalszeug, wie Kappen und Hütchen, Perücken und Bärte, an seine Angestellten und erwartete, dass sie karnevalistischen Frohsinn verbreiteten. Dazu lief ständig irgendeine Übertragung aus einer Karnevalshochburg wie Düsseldorf, Mainz oder Köln. Tätä! Tätä! Tätä!
Die Wursttheke, an der meine Mutter damals verkaufte, befand sich im hinteren Teil des Supermarktes, neben der Theke für Fleisch, an der Thomas arbeitete, ein Metzger, der seine Tattoos am Unterarm zeigte, indem er die Ärmel immer bis zum Ellenbogen aufkrempelte. Er hatte Hände wie Bärenpranken. Und immer Blutspritzer auf der Schürze. Aber er entsprach nicht dem Klischeebild, das er bot, er war ein netter Typ. Zwischen der Wurst- und der Fleischabteilung, hinter den Tresen, war die breite zweiflügelige Tür, die zu den Kühlräumen und ins Lager führte. Meine Mutter ist, wenn kein Kunde in Sicht war, oft mal durch das Lager nach draußen entwischt, für eine kurze Pause.
Aber an diesem Tag war so viel los, dass an eine Pause zwischendurch gar nicht zu denken war.
Komisch, dass ich das alles noch so wie einen Film vor mir sehe: Mama hatte sich als Pirat verkleidet, mit einer schwarzen Klappe über dem rechten Auge. Dazu eine weiße Perücke und ganz viele Sommersprossen auf der Nase und ein rotweiß geringeltes T-Shirt. Sie sah witzig aus. Als ich bei ihr auftauchte, hielt sie gerade eine gewaltige Mortadellawurst in der Hand und fragte die Kundin, wie dick sie die Scheiben wollte. An der Wursttheke trug Mama immer Handschuhe aus ganz dünnem Plastik, weil das hygienischer war. Die Kundin zeigte mit Daumen und Zeigefinger, wie die Scheiben sein sollten, und erklärte auch, wofür. »Cocktailhäppchen, mit einer halben Weintraube und Käsewürfeln, auf Zahnstochern.« Ich dachte, so etwas wäre im vorletzten Jahrhundert Mode gewesen. Aber meine Mama verzog keine Miene, sondern stellte die Maschine ein. Sie hatte mich zwar gesehen, ich stand keuchend und zitternd vor Aufregung an der Theke, aber sie beachtete mich einfach nicht. Der Kunde geht vor, das wusste ich, das hatte sie mir von Anfang an eingebläut. »Ganz egal, und wenn bei uns die Wohnung brennt …«
Aber das war mir an diesem Tag gleich. »Mama! Du glaubst nicht, was passiert ist!«, rief ich.
Meine Mutter schob die dicke Wurst an dem Schneideblatt vorbei und hielt die erste Scheibe hoch. Die Kundin nickte.
»Hast du im Lotto gewonnen?«, fragte eine andere Kundin. Alles lachte.
Ich war empört. »Ich spiel doch kein Lotto!«
»Dann wirst du auch nie reich«, meinte die Kundin fröhlich.
Wieder lachten alle.
»Vielleicht doch!«, sagte ich trotzig. Mein Selbstbewusstsein wuchs ins Unermessliche.
»Mama«, rief ich, »ich darf aufs Gymnasium wechseln!«
Ich sah, wie meine Mutter mitten in der Bewegung innehielt, wie alle Gesichter der Kunden sich zu mir herumwandten, ihre hellen runden Gesichter, manche mit Lippenstift, manche mit Brillen, in denen die Leuchtstrahler an der Decke des Supermarktes sich spiegelten.
Ich holte tief Luft. Es war wunderbar, im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit zu stehen. Das war mir noch nicht oft passiert. Ich wollte den Moment noch ein bisschen genießen, ihn hinauszögern. »Und weißt du, was noch besser ist?«, rief ich. »Es wird der Erlenhof sein. Ich bekomme ein Stipendium als externe Schülerin. Lernen werde ich dort und wohnen wie bisher bei uns zu Hause!«
Die Wurst rutschte meiner Mutter aus der Hand, fiel aber Gott sei Dank nicht auf den Boden, sondern zurück auf die Theke.
Mama zog ganz langsam ihre Plastikhandschuhe aus. Dann nahm sie die Klappe über ihrem Auge ab. Offenbar war es heiß dahinter, denn die Wimperntusche war ganz verschmiert, es sah aus wie ein blaues Auge, als hätte jemand ihr ein Veilchen verpasst.
»Der Erlenhof? Die Schule am Langen See?«, fragte eine der Kundinnen. Ich hörte aus ihrer Stimme so etwas wie Respekt.
»Ist das wahr? Du machst keine Witze? Vielleicht, weil Fasching ist?« Meine Mutter wollte es einfach nicht glauben.
Ich lachte, nickte, schüttelte den Kopf. »Keine Witze. Alles wahr!« Ich verschluckte mich, ich hustete, ich lachte wieder. »Ja! Meine Direktorin, Frau Feddersen, lädt dich und Papusch zu einem Gespräch ein! Am besten schon morgen! Ich hab gesagt, du hast mittwochs immer frei. Mama! Ich kann sofort auf die andere Schule wechseln, wenn ihr es erlaubt! Das viele Lernen hat sich gelohnt!«
Da sah ich meine Mutter, die immer so ernst gewesen war in der letzten Zeit, zum ersten Mal wieder lächeln. Und ich sah, wie schön sie eigentlich war, meine Mama, mit ihren großen weißen Zähnen.
Und ich fand ihren russischen Dialekt, den sie nie ablegen würde, auch in hundert Jahren nicht, ganz großartig, als sie vor allen Kunden sagte: »Siehst du, was ich immer gesagt hab? Gott schaut auf uns herab.« Meine Mutter strahlte noch einmal in die Runde, setzte die Augenklappe wieder auf, zog die Plastikhandschuhe über ihre Finger und schnitt weiter dicke Mortadellascheiben.
Ich liebte meine Mammutschka in der Sekunde mehr, als ich sie je vorher geliebt hatte.
Am nächsten Morgen ging Mama zum Friseur. Sie hatte das schon längst vorgehabt, aber irgendwie dann doch die Kosten gescheut. Sie ließ sich helle Strähnen färben und einen Pony schneiden. Papa musste den Anzug anziehen, den er sonst nur zu Weihnachten trug und bei den seltenen Feiern in seiner Firma. Dazu eine rot-weiß gestreifte Krawatte. Es sah echt vornehm aus.
Um fünf Uhr nachmittags hatten wir den Termin bei der Direktorin. Sie hatte mir ihre Privatadresse aufgeschrieben. Sie wohnte in der Ludwigsallee, einer schönen Straße mit alten Villen und modernen Bungalows, wo es automatische Garagentore gab und richtige Vorgärten. Wo man den Leuten nicht in die Fenster gucken konnte. Eben was für andere Leute als wir. Solche, die Geld haben.
Ich kannte die Straße nur, weil Mama da so gern durchfuhr, wenn wir von der Autobahn kamen. Es war ein Umweg, aber trotzdem: Sie liebte dieses ganze Viertel mit den schönen alten Straßenlaternen und den breiten Fußwegen unter großen Bäumen.
Ich glaube, meine Mutter hat, wenn sie in der Ukraine an Deutschland gedacht hat, immer solche Straßen vor sich gesehen, mit herrschaftlichen Häusern, und dazu Parks, in denen kleine Mädchen auf Schaukeln durch die Luft fliegen.
Frau Feddersen ist schätzungsweise um die fünfzig, mit einer grauen Kurzhaarfrisur. Ich wette, sie hat sich in ihrem Leben nie die Haare gefärbt. Sie trägt immer Schals oder Seidentücher, und gibt es eine Grippewelle an ihrer Schule, so legt sie den Zipfel des Schals vor den Mund, wenn sie durch die Flure geht. So eine Art Mundschutz, um die Viren abzuhalten, nehme ich an. Wer Husten oder Schnupfen hat, muss zwei Meter Abstand von ihr halten. Das wirkt oft merkwürdig, aber ich mag sie. Denn trotz dieser Marotte ist sie so ein mütterlicher Typ Frau, der gern jeden Schüler, der Kummer hat, an den dicken, weichen Busen drückt. Sie hat eine sanfte, dunkle Stimme und lutscht unentwegt Salbeipastillen, weil sie empfindliche Stimmbänder hat. Frau Feddersen singt im Kirchenchor. Alt. Einmal wurde das Weihnachtsoratorium aufgeführt, von Bach. Bei dem berühmten Lied »Schlafe mein Liebster, schlaf ein« kam bei mir totales Gänsehautfeeling auf. Boah! Danach hatte ich immer richtig Ehrfurcht vor ihr. Vorher hab ich nie darüber nachgedacht, dass die Lehrer neben der Schule auch noch ein anderes Leben haben.
Sie wohnte in einem alten Haus, das als einziges in der Straße nicht wirklich vornehm wirkte, aber von oben bis unten mit Efeu bedeckt war. Selbst im Winter waren die Blätter grün. Weil es an diesem Nachmittag geregnet hatte, glitzerten an der ganzen Wand die Wassertropfen auf den Blättern. Über dem Eingang war ein Glasdach und es gab eine Gegensprechanlage.
»Zweiter Stock!«, rief Frau Feddersen. Der Summer ging und wir drückten die Tür auf. Innen war alles weiß lackiert. Ganz frisch, man konnte die Farbe noch riechen. Ein roter Teppichläufer auf den weißen Stufen. Das sah nun doch vornehm und elegant aus, ich hatte so was vorher noch nicht gesehen. Und auf jeder Etage gab es ein Fenster, vor dem jeweils ein Gummibaum stand.
Die Direktorin wartete auf uns in der offenen Wohnungstür. Sie empfing meine Eltern so herzlich, als würde sie sie ewig kennen. Mich drückte sie an sich, als wären wir seit Jahren enge Freunde. Was wirklich nicht stimmte.
Sie hatte Tee und Kaffee gekocht, meine Eltern konnten sich aussuchen, was sie nehmen wollten. Auf dem Tisch standen Teller mit Plätzchen.
Papa setzte sich etwas verlegen auf die Kante des Sessels und sprang immer sofort auf, wenn Frau Feddersen noch irgendetwas fehlte: »Oh, wir brauchen Zucker, wie dumm von mir.« Gleich wollte er den Zucker aus dem Schränkchen neben der Tür herbeischaffen. Einige Plätzchen waren mit Marmelade gefüllt und uns klebten die Finger. Da sprang mein Vater wieder auf, um die Servietten zu holen. Es war ein bisschen peinlich, aber er wollte Kavalier spielen, wollte aufmerksam sein. Ich konnte mir meinen Vater plötzlich als kleinen Jungen vorstellen, der seiner Lieblingslehrerin die Taschen getragen hat. Ich musste innerlich grinsen.
Mama lächelte die ganze Zeit. Sie schaute sich voller Neugier, aber doch diskret, in dem Wohnzimmer der Direktorin um.
Die Sonne schien durch die kleinen Erkerfenster. Davor stand ein Klavier mit aufgeschlagenem Deckel. Noten von Wolfgang Amadeus Mozart. An den Wänden hingen schöne Bilder. Und das Zimmer war mit einem hellen flauschigen Teppichboden belegt, der allen Lärm verschluckte. Es war so eine friedliche, wohlige Ruhe in dem Raum. Ich weiß, dass Mama in dem Augenblick dachte: So würde ich auch gerne leben.
»Sie wissen«, sagte Frau Feddersen an meine Eltern gewandt, »dass Ihre Svetlana ein sehr kluges Mädchen ist!«
Mein Vater reckte sich. Er zog den Bauch ein und machte die Schultern noch breiter. »Wirklich?«, fragte er.
»O ja, daran besteht kein Zweifel, und deshalb müssen wir alles tun, um dieses Talent zu fördern.« Frau Feddersen und ich saßen nebeneinander auf dem Sofa. Sie legte einen Arm um meine Schultern, so als würden wir beide eine Front gegen meine Eltern bilden müssen.
»Svetlana ist immer gern in die Schule gegangen«, sagte meine Mutter. »Sie lernt auch gern. Sie hat viel schneller Deutsch gelernt als wir.«
»Ich nur wenig Deutsch...« Mein Vater wurde ein bisschen rot. »Männer mehr faul als Frauen.«
»Du bist nicht faul, Oleg«, widersprach meine Mutter, »dir fehlt nur die Begabung für fremde Sprachen. Svetlana hat die Begabung.«
Frau Feddersen lachte gutmütig. Sie fragte meinen Vater nach seinem Beruf.
»Ich Lastwagenfahrer bei EMROX«, sagte er, »immer unterwegs nach Weißrussland.« Er lächelte meiner Mutter zu. »Nur wenig zu Hause.«
Ach Papusch, dachte ich, rede doch in ganzen Sätzen, nur ein einziges Mal. Mir zuliebe. Nur weil wir heute bei meiner Direktorin sind. Aber hoffnungslos.
Meine Mutter spricht viel besser Deutsch als er, aber sie hat eben diesen sehr harten russischen Akzent. Ich weiß nicht, warum es mir gelungen ist, diesen Akzent fast völlig abzulegen, die andere Sprache wie eine Muttersprache zu beherrschen. Ich hab eben Glück.
Meine Mutter erzählte der Direktorin, dass sie als Wurstverkäuferin im Supermarkt angestellt war. Und dass es eine schöne Arbeit sei.
Hey, dachte ich verblüfft, wieso sagt sie das jetzt? Sie findet die Arbeit doch grässlich, seit Monaten kommt bei uns schon keine Wurst mehr auf den Tisch, weil sie den Geruch danach nicht auch noch zu Hause ertragen will. Wir müssen immer Käse essen, Quark oder Eier oder Salate. Nie Wurst. Oder Würstchen etwa, die findet Mama komplett grauenvoll. »Wenn ihr wüsstet, was da alles drin ist«, sagt sie immer, »dann würdet ihr die auch nicht wollen. Da verwenden die Fleischer alle Reste der geschlachteten Tiere. Da sind sogar Schweineaugen drin.« Und jetzt erzählte sie, während sie wie eine feine Dame ihren Kaffee trank, dass sie gerne als Wurstverkäuferin im Supermarkt arbeitete. Ich konnte das nicht mit anhören.
»Mama! Wieso erzählst du nicht, dass du eigentlich Lehrerin bist?«, rief ich empört. »Wir sind seit drei Jahren hier in Deutschland und du hast vorher als Lehrerin gearbeitet.«
Da wurde sie ganz rot und sah mich streng an. »Das ist doch nicht wichtig«, erwiderte sie.
»Doch, es ist wichtig!«, rief ich. »Mach dich doch nicht kleiner, als du bist!«
Und weil Mama nichts weiter sagte, sondern nur dasaß mit ihrem roten Gesicht, hab ich dann Frau Feddersen erzählt, dass meine Mutter in der Ukraine als Grundschullehrerin gearbeitet hat. Dass sie mal Bezirksjugendmeisterin im Schach war. Und dass sie eigentlich gehofft hatte, auch hier in Deutschland als Lehrerin arbeiten zu können. Aber daran war gar nicht zu denken gewesen. Wir sind als Spätaussiedler gekommen. Meine Mutter gehörte zu den sogenannten Schwarzmeerdeutschen, die von Stalin nach Sibirien verschickt worden waren und erst in den Siebzigerjahren von dort fort durften, in die Ukraine oder nach Weißrussland. Aber viele wollten nicht in der Ukraine bleiben oder in Weißrussland, sie hatten genug vom Kommunismus, sie wollten gleich weiter nach Deutschland.
Meine Mutter hat in Sibirien so viel erlebt, so harte Zeiten gehabt. Grausige Zeiten, denke ich, weil sie nie davon redet. Ich wünschte mir so, dass sie an diesem Tag, bei Frau Feddersen, den Mund aufmachen und etwas erzählen würde. Schon um ihre Familie (und also mich!) interessanter zu machen. Aber sie tat es nicht. Sie erzählte nicht einmal, wie ich zur Welt gekommen war, im Zug, auf einer alten Pferdedecke. Sie schaute mich nur an, während ich redete und redete, und sagte schließlich leise: »Kätzchen, es ist nicht wichtig, wirklich nicht. Außerdem bin ich wirklich lieber hier in Deutschland Verkäuferin als in der Ukraine Lehrerin. Da hab ich ja nicht mal genug verdient, um mir einen neuen Wintermantel kaufen zu können.«
Das Telefon klingelte, und dann sagte Frau Feddersen, dass sie leider doch nicht so viel Zeit für uns hätte. Und mein Vater sprang schon auf, weil er dachte, wir würden gleich wieder rausgeschmissen. Aber Frau Feddersen bat ihn, sich wieder zu setzen, denn wir hätten eines ja gar noch nicht besprochen: Ob sie denn überhaupt wollten, dass ich aufs Gymnasium gehe.
Und dann erzählte sie von der Lehrerkonferenz, wo alle Lehrer (ALLE!) sich dafür ausgesprochen hatten. Dass man mir jede Chance geben möchte, weil man glaube, dass in mir »viel Potenzial stecke«. Und auch, dass ich diesen Ehrgeiz habe, das hätten sie immer gemerkt. »Du brennst ja richtig«, sagte Frau Feddersen. »So hätte ich mir auch manch anderen Schüler gewünscht.« Sie hätten vor der Entscheidung gestanden, mich eine Klasse überspringen zu lassen oder mir eben zu empfehlen, die Schule zu wechseln. Aber sie seien sich alle einig gewesen, dass ich die Chance haben müsste zu studieren. Und das ginge mit Realschulabschluss nun einmal nicht, auch wenn ich in jedem Fach auf einer Eins stünde.
Meine Mama erzählte, dass ich oft nachts noch deutsche Bücher gelesen habe, um meinen Vokabelschatz zu vergrö ßern, und dass ich mir besonders komplizierte Redewendungen und Grammatikregeln auf kleine gelbe Post-it-Zettel geschrieben habe, die immer am Badezimmerspiegel klebten. »Ich habe oft gedacht«, sagte meine Mutter, »dass Svetlana zu viel tut, dass sie krank davon wird.«
»Aber ich bin nicht krank geworden«, warf ich ein. »Ich bin pumperlg’sund.« (Das Wort »pumperlg’sund« hatte ich gerade neu in meinen Wortschatz aufgenommen. Weihnachten war der Sissi-Film mit Romy Schneider wiederholt worden. Die Sissi sagte immer: »pumperlg’sund.«)
Frau Feddersen lächelte mich an. Ihr war wohl ziemlich schnell klar geworden, dass meine Eltern mir keine Steine in den Weg legen würden, um aufs Gymnasium zu wechseln. Sie war erleichtert und erzählte von einem anderen ukrainischen Elternpaar, das sich überhaupt nicht anstrengte, Deutsch zu lernen, und ihre zwei Söhne (ich kannte die beiden) auch nicht dazu anhielt, in der Schule Ehrgeiz zu entwickeln.
Vielleicht hat sie sich deshalb so für mich engagiert, um selbst auch ein Erfolgserlebnis zu haben.
Sie bot dann meinem Vater einen Cognac an, den er aber, obwohl er Cognac liebt, erschrocken ablehnte. Ich denke, er wollte vor der Direktorin nicht als Säufer erscheinen. Dabei hatte sie es doch nur nett gemeint.
Jedenfalls endete der Besuch damit, dass Frau Feddersen mich umarmte und mir sagte, ich könnte immer zu ihr kommen, wenn ich ein Problem hätte. Aber sie sei sicher, auch an der neuen Schule würde es keine Probleme geben.
Sie fand es auch richtig, dass ich nicht bis zu den Sommerferien warten musste, um aufs Gymnasium zu wechseln, sondern jetzt sofort gehen konnte. »Jeder Monat zählt«, sagte sie eindringlich, »und du musst ohnehin eine immense Stofffülle aufholen. Ist dir das bewusst?«
Ich nickte. Ich hatte vor Aufregung einen Kloß im Hals. Eigentlich wollte ich sagen, dass mich die Stofffülle überhaupt nicht schreckte, dass ich im Gegenteil neugierig auf alles Neue war. Aber ich bekam es irgendwie nicht heraus.
»Der Erlenhof«, sagte sie, »ist eine Schule mit angegliedertem Internat. Da herrscht eine besondere Stimmung, da halten die Schüler mehr zusammen; sie betrachten sich als eine Familie, weil sie ihre wirklichen Familien nur einmal im Monat sehen können oder in den Ferien...« Frau Feddersen erwähnte, dass sie es sich als Schülerin immer gewünscht habe, in solch einem Internat zu leben, weil es dort viel interessanter war. Aber ihre Eltern seien dagegen gewesen.
»Ich beneide dich«, sagte sie mir zum Abschied. »Sicher wirst du später, wenn du erwachsen bist und einen Beruf hast, diese Zeit als die schönste deines Lebens betrachten. Und solltest du doch einmal Sorgen haben«, wiederholte sie, »so findest du hier immer eine offene Tür. Jederzeit bist du herzlich willkommen, um deinen Kummer bei mir abzuladen.« Sie gab mir einen Kuss auf die Wange; er roch nach Salbei. »Ich möchte einfach, dass aus dir einmal etwas Großartiges wird. Du hast besondere Begabungen. Mach deine Eltern stolz«, sagte sie. »Überzeuge sie davon, dass es sich gelohnt hat, hierher nach Deutschland zu kommen.«
Ich war ziemlich aufgeregt. Mein Kopf glühte. Denn natürlich war es von Anfang an mein Wunsch gewesen, aufs Gymnasium zu kommen. Ich wollte unbedingt das Abitur machen, um später studieren zu können. – Selbst jetzt, hier in dieser Klinik, spüre ich, dass ich immer noch Lust habe, etwas zu lernen und voranzukommen. Ich bin eben so. Und Frau Feddersen und die anderen Lehrer haben das damals erkannt und wollten mir dabei helfen. Das war ein so großartiges Gefühl, dass ich vor Dankbarkeit weiche Knie hatte und beinahe losgeheult hätte.
Es war der wichtigste Tag für mich, seit wir in Deutschland angekommen waren.
Als wir die Wohnung der Direktorin verließen und durch den schönen Garten auf das schmiedeeiserne Tor zugingen und der Kies unter meinen Schuhen knirschte – da empfand ich mich zum ersten Mal als Deutsche. Wir hatten zwar schon deutsche Pässe, doch als wirklich zugehörig haben wir uns nicht gefühlt, weil die Menschen, mit denen wir redeten, uns – oder genauer: meine Eltern – immer sofort am Dialekt erkannten. Und dann fragten: Woher seid ihr?
Und wenn ich dann für uns antwortete: Wir sind Deutsche, dann fragten sie mich trotzdem: Aber woher kommt ihr? Aus Russland? Oder Ex-Jugoslawien?
Immer war da sofort eine Mauer. Unsichtbar für die anderen, aber für mich so real, dass ich glaubte, ich würde mich daran blutig stoßen.
An diesem Nachmittag war die Mauer auf einmal weg. Als habe sie nie existiert. Als habe ich mir das alles immer nur eingebildet, die Zurückweisung, das Abschätzende … Im Bus hatte ich einmal gehört, wie zwei Frauen in der Reihe vor mir über Spätaussiedler aus Russland sprachen. Die eine meinte: »Das ist doch unglaublich, dass wir von unseren Steuergeldern diese Schmarotzer finanzieren müssen. Die lassen sich alles bezahlen, kommen hier ins Schlaraffenland und unsereins rackert sich ab.« Und die andere fügte grimmig hinzu: »Sollen sie doch alle wieder dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Wir brauchen sie hier nicht. Keine Türken. Keine Russen. Überhaupt keine Fremden.«
Hey, dachte ich, als wir jetzt auf unser Auto zusteuerten, vielleicht braucht ihr uns doch? Und ich stellte mir vor, dass ich irgendwann einmal, vielleicht als Ärztin an einem Krankenhaus, genau diese beiden Frauen vor mir hätte. Beide vielleicht schwer verletzt. Und davon abhängig, dass ich es war, die wüsste, wie man sie wieder gesund machen könnte. »Da seht ihr, wie ihr uns braucht«, würde ich sagen, bevor man sie in den OP brächte. -
Beim Einsteigen ins Auto gab ich meiner Mutter einen Kuss und dann meinem Vater.
»Was hast du, Kätzchen?«, fragte Mama überrascht. Wir küssen uns nicht mehr besonders oft. Ich bin schließlich schon vierzehn. Da träumt man eher davon, einen tollen Jungen zu küssen. Besser noch: von einem tollen Jungen geküsst zu werden. Da sind die Eltern nicht unbedingt das, was man zum Kuscheln braucht.
»Dein Kätzchen ist einfach nur glücklich«, sagte mein Vater. »Siehst du das nicht?«
Papusch, dachte ich, du bist zwar nicht mein richtiger Vater, aber du kennst mich besser, als es ein leiblicher Vater könnte.
Ja, ich war superglücklich. Ich freute mich, ich war ungeduldig, ich wäre am liebsten noch am gleichen Nachmittag zu meiner neuen Schule gefahren. Ich wollte meine Eltern überreden, einen kleinen Ausflug dorthin zu machen. Dass wir uns einfach nur einmal umsehen. An meiner neuen Wirkungsstätte, sozusagen. Ich brannte darauf, endlich Schülerin eines Gymnasiums zu sein, mit der Aussicht aufs Abi, auf ein Studium. Lernen hat mir, im Gegensatz zu vielen anderen Schülern, immer Spaß gemacht. Ich hatte aber auch Glück: Es fiel mir alles so leicht. Ich war riesig neugierig auf die Schulbibliothek, die ich mir gigantisch vorstellte, ich freute mich auf schlaue Lehrer, die mir alles beibringen würden, was ich wissen wollte. Es würde großartig werden.
Aber meine Mutter wollte nicht. Sie sagte, sie habe auf einmal Kopfschmerzen. Außerdem seien ihre Füße eiskalt. Überhaupt sei ihr irgendwie nicht gut. Sie nahm mich in den Arm und sagte: »Lass uns nach Hause fahren. Wir machen es uns gemütlich.«
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommt es mir so vor, als wenn meine Mammutschka da schon so etwas wie eine Ahnung hatte, unbewusst. Von dem, was mich erwartete. So eine Art sechsten Sinn.
Der Erlenhof hat eine eigene Website. Wenn man die anklickt, dann baut sich sofort ein Bild auf von einem schlossartigen Gebäude, riesig, mit einer großen Freitreppe, davor Rasen und Kieswege. Echt beeindruckend. Darüber läuft dann die Schrift: »Ein Internat stellt sich vor: Der Erlenhof am Langen See. Ein neusprachliches Gymnasium, das Jungen und Mädchen von der fünften Klasse bis zur staatlich anerkannten mittleren Reife oder zum Abitur führt.« Dann Musik. So ein poppiger Song, in dem das Internatsleben glorifiziert wird. Dabei schwenkt die Kamera über die Nebengebäude hinweg, das Jungenhaus, das Mädchenhaus, die Sportanlagen. Man sieht eine Gruppe fröhlicher Radler,