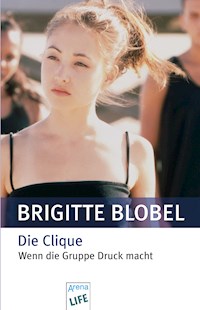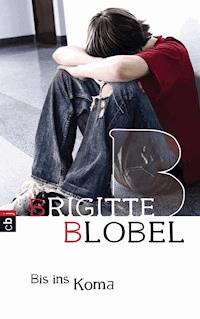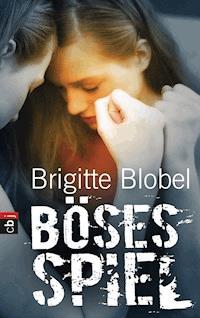4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Johanna den Job als Kindermädchen auf einer Schaffarm in Südafrika annimmt, will sie einen neuen Anfang für ihr Leben, einen zweiten Versuch. Das harte Farmerleben in der Savanne und die scheinbare Idylle der Burenfamilie lassen sie die Zurückweisung und Verlustängste in der Kindheit vergessen, den ewigen Kampf um die Liebe ihrer Mutter. In der Wildnis Südafrika und später im brodelnden Kapstadt entdeckt sie ihre Stärken und lernt zu vertrauen und zu lieben. Doch dann geschieht ein brutaler Mord. Kapstadt, die leuchtende Metropole am südlichsten Punkt Afrikas, zeigt ihr anderes, ihr dunkles Gesicht. Johanna muss um ihr mühsam erlangtes Glück kämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Brigitte Blobel
Glücksucher
Roman
Für Wolf
1
Bei Kilometerstein 412 bremste sie plötzlich, stieß die Wagentür auf, stellte sich mitten auf die Schotterpiste, breitete die Arme aus und rief: »Wahnsinn! Wie glücklich ich bin!«
Ihre Stimme hüpfte über das trockene Buschland davon wie eine Antilope, in großen Sprüngen.
Weit entfernt hoben magere weiße Rinder im Schatten eines Mopane-Baumes träge den Kopf. Ein Raubvogel zog mit sanftem Heben und Senken der Schwingen seine Kreise über einem ausgetrockneten Flussbett. Mehr war nicht. Braun die Erde, grau das Gras auf magerem Boden, selbst ihr Auto, ursprünglich kobaltblau, hatte die Farbe der Umgebung angenommen. Sie war seit fünf Stunden unterwegs, ohne Pause, von Bossiekom, an der Grenze zwischen Bushman-Land und Little-Nama-Land, im südlichsten Teil Afrikas. Fünf Stunden, in denen ihr ein halbes Dutzend Jeeps und Autos entgegengekommen waren, und ein Truck, geschmückt wie ein indischer Elefant. Einmal hatte sie einer Herde von Springböcken ausweichen müssen, die in gestrecktem Galopp direkt vor ihr die Piste überquerte.
Es war Mitte März, das Ende eines heißen Sommers nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen. Die Hochebene der Karoo, einer Halbwüste, war schrundig von monatelanger Trockenheit, auf den Feldern war nichts zu ernten. In den Astgabeln der alten staubverkrusteten Mopane-Bäume hatten sich die Würmer eingenistet, die für die Buschmänner die größte Delikatesse sind. Einmal hatte sie auch welche probiert und sogar tapfer heruntergeschluckt, weil sie von zwei feixenden Kindern beobachtet wurde. Jetzt traf sie ab und zu Frauen mit kleinen Blechkanistern und langen Spazierstöcken, die sich aufgemacht hatten, um die Würmer zu ernten. Die Rinder wehrten apathisch die Myriaden von Schmeißfliegen ab, die ihre Eier in die Augenhöhlen, in eitrige Wunden und aufgeplatzte Hufkronen legen wollten. Die Farmer im Northern und Western Cape von Südafrika sprachen bereits vom schlechtesten Erntesommer seit Jahren. Sie trafen sich in den Versammlungsräumen ihrer Dörfer, um über Notmaßnahmen zu beraten, baten in dringenden Appellen die Regierung um Hilfe. Aber die Regierung war wie jeden Sommer von Pretoria nach Kapstadt umgezogen. Die Politiker genossen die kühle Brise der Ozeane, besuchten Gartenpartys, verbrachten mit ihren Familien unbeschwerte Tage in Houtbay oder Fish Hoek und waren für die Farmer so unerreichbar wie der Mars.
Und auch sie, Johanna Marlena Studt, die kein Land besaß, um das sie sich sorgen musste, kein Vieh, das vor Durst umkam, auch keine Weinstöcke, die von der schwarzen Fäule befallen werden konnten, die überhaupt für gar nichts auf der Welt verantwortlich war außer für sich selbst, war ohne Sorgen und glücklich. Optimistisch vor allem. Mein kleines blaues Auto und ich, dachte sie, allein zwischen gelbem Himmel und braunem, unbewohntem Land: was für ein Glück für einen Menschen, der in einem Hamburger Vorort aufgewachsen ist, in Nebel und Nieselregen.
Sie drehte sich in ihrem dünnen Sommerkleid, das die Knie nicht bedeckte, und in Lederstiefeln, deren Bänder durch den Staub schleiften, im Kreis, drehte eine Pirouette nach der anderen, bis ihr vor Atemlosigkeit und Hitze ganz schwindlig war.
Wenn jemand sie so sehen könnte! Mittags, bei 39 Grad im Schatten – wenn es denn irgendwo Schatten gegeben hätte –, einen Tanz aufzuführen!
Der heiße Wind, der über die glühende Hochebene ohne Pause hinstrich, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, trocknete ihren Schweiß, von der Stirn, vom Hals und, als sie den Rock hob, auch zwischen den Schenkeln. Vor ihr das endlose Band der Straße, die nur aus Sand und Schotter bestand, mit einer tief ausgefahrenen Spur. Wenn zwei Autos sich begegneten, so verlangte es das ungeschriebene Gesetz, dass der geländegängigere Wagen auswich in die Dornenranken, Sanddünen, oder, in der Regenzeit, in den Schlamm, während der kleinere Wagen in der Spur bleiben durfte. Sie musste nie ausweichen, ihr Wagen war, egal, wer ihr entgegenkam, immer der kleinste.
Sie fuhr einen blauen Mazda, Baujahr 1996. Ohne Klimaanlage, aber mit Automatik und vor allem mit ihrem gesamten Besitz. Ihre letzten Arbeitgeber hatten darauf geachtet, dass sie genug Proviant dabeihatte: Wasserflaschen, Obst und Biltong, kleine Streifen getrocknetes Rindfleisch, das sich wie Kaugummi unendlich lange im Mund herumdrehen und einspeicheln ließ. Nelson, der Verwalter von Bossiekom, hatte ihren Mazda an der farmeigenen Zapfsäule noch vollgetankt, und er hätte ihr auch einen gefüllten Ersatzkanister mitgegeben, aber das wollte sie nicht. Sie hatte mal einen Menschen gekannt, der in seinem eigenen Auto, an dem eigenen mitgeführten Benzin verbrannt war. Gut, der Kanister hatte einen defekten Verschluss gehabt, aber trotzdem. In dieser Hitze und Trockenheit konnte sich jedes Auto in ein Pulverfass verwandeln.
Sie hatte am Vortag ihren Kindermädchen-Job in Bossiekom beendet, ganz regulär. Darauf war sie wirklich stolz. Früher hatte sie ihre Jobs immer vorzeitig hingeworfen. Auch die gut bezahlten. Auch die, auf die sie anfangs große Hoffnung gesetzt hatte. Immer war irgendetwas schiefgelaufen. Oder ein Ereignis hatte es ihr unmöglich gemacht, durchzuhalten wie alle anderen Menschen um sie herum. Jeden Tag, jede Woche, Monat für Monat, Jahr um Jahr: einfach Augen zu und durch. Bis du da angekommen bist, wo du hinwillst, hatte ihre Mutter immer gesagt. Aber wo wollte sie hin?
Jetzt jedoch, bei der Familie van Riebeck in Bossiekom, hatte sie durchgehalten. Auf achtzehn Monate lautete ihr Vertrag, und auf den Tag genau nach achtzehn Monaten hatte sie ihr Zeugnis (»Johanna ist uns allen mit ihrer Heiterkeit, ihrer Kraft und ihrem ausgeglichenen Wesen sehr ans Herz gewachsen, und wir wünschen ihr für die Zukunft nur das Allerbeste.«) und das Gehalt in Empfang genommen.
Dort, in Bossiekom, auf einer Schaffarm mit dreißigtausend Hektar Weideland, gab es einfach keine Möglichkeit, Geld auszugeben, und auch das war ein Glück. Denn früher hatte sie ihr Geld nie zusammenhalten können. War ihr das, was sie verdiente, immer zwischen den Händen zerronnen. Im nächsten Ort, von der Farm zwei Autostunden entfernt, gab es weder ein Kino, geschweige denn eine Diskothek oder eine Bar, für die sich der Weg gelohnt hätte. Und alle Kleidung, die sie auf der Farm brauchte, bestellte Marjete van Riebeck bei einem Versandhaus: Dinge wie Gummistiefel, nicht gefütterte und – für die frostigen Wintertage – gefütterte; geschnürte, halbhohe Lederstiefel, mit denen man sich bei Ausflügen vor Schlangenbissen sicher fühlte, und für den Sommer lange, dünne Baumwollhosen und Blusen mit Gummizug an Fesseln und Handgelenken: für Mücken Zutritt verboten!
Im Sommer hatte sie im Freien auf einer Holzpritsche geschlafen, in dem kleinen Patio vor ihrem Zimmer, unter einem Moskitonetz, das in den ausladenden Zweigen einer Tamarinde befestigt war. Im Winter, eingewickelt in schwere Wolldecken, in einer ungeheizten Kammer, mit einer Wärmflasche an den Füßen. Das Farmhaus, im 17. Jahrhundert von burischen Siedlern gebaut, konnte nur mit Kaminen beheizt werden. Aber Feuerholz war kostbar.
Marjete van Riebeck bestellte in einem Versandhaus, das ihrem Schwager gehörte, sämtliche Dinge des täglichen Lebens, und so bekam sie alles zum Einkaufspreis. Johanna musste nie etwas für die Dinge bezahlen, die sie im Katalog ankreuzte. Das hatte Johanna auch noch nie erlebt, dass jemand ihr etwas schenkte, einfach so. Aus Freundlichkeit. Das war eine große neue Erfahrung gewesen. Nicht dass es sich um besonders kostspielige oder extravagante Dinge gehandelt hätte – der Katalog hieß »Farm-Living« – oder dass sie viel benötigt hätte. Ihre Großstadt-Sommerfummel blieben ungenutzt im Kleiderschrank. Es gab einfach niemanden, für den sie schön sein musste. So konnte sie zur Ruhe kommen.
Jetzt trug sie einen Haufen Bargeld, verteilt in zwei gleich dicke Packen in gelben Briefumschlägen, in ihren Stiefeln. Sie wollte kein Risiko eingehen. Ihr erster Weg in Kapstadt würde sie zu einer Bank führen, um ein Konto zu eröffnen. Ha! Dieser Stolz, mit dem sie 90 000 Rand auf den Tresen legen konnte! Ein kleines Vermögen – selbst verdient!
Sie trommelte einen Tusch auf das Autodach.
In Kapstadt fanden gerade die Kricket-Weltmeisterschaften statt. Jeden Tag hatten sie bei den Fernsehübertragungen den Tafelberg gezeigt, das tiefblaue Meer am Blouwberg-Strand, die Geschäftigkeit in den Shoppingmalls, Musikläden und Designer-Stores, Rolltreppen, Palmen an der Strandpromenade, Bars, Cafés, Internet-Shops, in denen man wieder mit der Welt Kontakt aufnehmen konnte, und vor allem: junge Leute, die sich amüsierten und auch genauso aussahen.
Ja, und deshalb war sie so glücklich: weil sie nur noch dreihundert lächerliche Kilometer Schotterpiste von einer großartigen Zukunft trennten.
Weit entfernt, am Ende der schnurgeraden Piste, formte sich eine Wolke aus Staub. Ein Wagen kam ihr entgegen, mit einer für die Straßenverhältnisse unfassbaren Geschwindigkeit. Johanna stieg wieder in ihren Mazda, drehte alle Scheiben hoch und fuhr weiter, der Staubwolke entgegen.
In Kapstadt würde sie endlich neue Batterien für ihren Discman bekommen. In dem ledernen Rucksack auf dem Boden des Beifahrersitzes gab es einen Kasten mit ihren Lieblings-CDs, ihre Roadgospels – Bruce Springsteen und Sting, Norah Jones und Elton John –, ihre Freunde für einsame Stunden. Aber auf dieser Reise hatte sie einen anderen Freund dabei. Allerdings einen sehr stummen Freund, der wahrscheinlich zutiefst deprimiert war. Denn nach dem anfänglichen Gerumpel war es jetzt still in der Holzkiste auf dem Beifahrersitz.
Johanna bohrte ihren Zeigefinger in eines der Luftlöcher. »Hey Bobo, in ein paar Stunden sind wir da. Schön durchhalten, okay?«
Von Bobo kam jedoch keine Antwort. Er ließ sich noch nicht einmal dazu herab, die Kuppe ihres Zeigefingers mit der Zunge zu befächeln, wie er das vorher getan hatte.
Die Staubwolke war mittlerweile auf hundert Meter herangekommen. Johanna legte beide Hände fest um das Steuerrad. Jedes entgegenkommende Auto war eine Herausforderung. Am liebsten wäre sie jetzt noch ausgewichen, auf den weichen Sandstreifen neben der Piste, nur um sich dieses Herzklopfen zu ersparen, die Sekunden heller Panik, weil sie nicht sicher war, ob der Fahrer des entgegenkommenden Wagens sie überhaupt sah, oder ob er vielleicht völlig zugedröhnt in Trance die Kilometer fraß.
Es war ein Viehtransporter. Fahrer von Viehtransportern hatten in der Gegend einen schlechten Ruf. Sie tranken viel, waren grob zu den Tieren und kümmerten sich nicht um Straßenregeln.
»Junge«, murmelte sie, »fahr rüber! Mach keinen Scheiß!«
Wenn sie jetzt noch auswich, würde ihr Wagen unweigerlich ins Schlingern geraten. Sie hatte schon Pkws gesehen, die neben der Piste auf dem Rücken lagen. So wollte sie nicht enden.
In diesem Augenblick machte der Leguan in seiner Kiste einen Satz. Sein ganzer gepanzerter Körper bestand nur aus Muskeln. Der Deckel der Holzkiste, der nicht verschlossen war, sprang auf. Sie schaute gar nicht hin. Sie musste den Transporter im Auge behalten.
»Hey!« Sie drückte wild auf die Hupe. »Fahr zur Seite, Arschloch!«
Der Transporter war nur noch zwanzig Meter entfernt. Da hörte sie das Kreischen der Bremsen. Der Aufbau des Lasters legte sich bedrohlich zur Seite, als der Fahrer das Lenkrad herumriss und in einem Abstand von kaum zehn Metern das staubige Ackerland neben der Straße umpflügte.
»Bist du lebensmüde? Pennst du am Steuer?«
Flüchtig sah sie das schweißnasse Gesicht des Fahrers, eine Spiegelsonnenbrille und ein dunkles Polohemd und hinter den Gitterstäben des schlingernden Anhängers die rosige Haut der Mastschweine. Dann wurde sie eingehüllt von schwefelgelbem Sand, und für Sekunden sah sie nichts. Aber sie hielt das Steuer fest in den Händen, und als der Staub sich lichtete, war vor ihr wieder das lange Band der Straße und fern, am Horizont, die blauen Elefantenrücken der Berge, die sie noch bezwingen musste, bevor sie die asphaltierte N 7 erreichte, die von Windhoek nach Kapstadt führte.
Bobo starrte sie aus der offenen Kiste mit seinen kalten Echsenaugen an. Bobo war ein Leguan aus der Familie der Halsbandleguane. Ein besonders schönes Exemplar mit hellen und dunklen Tupfen auf dem Rücken und sehr hellen Streifen um den Hals und um die Schulter. Auf dem Bauch war Bobos Eidechsenhaut weich und hell.
Ein Leguan ernährt sich von Insekten, und deshalb hatten Jan und Eske ihr zum Abschied auch noch eine Schachtel mit selbst gefangenen Faltern mitgegeben.
Von Zeit zu Zeit musste sie halten, einen Falter aus der Schachtel fischen und ihn durch das Loch in Bobos Kasten schieben. Dann gab es für einen Moment heftige, aber lautlose Bewegungen, die den Kasten beben ließen, und im nächsten Augenblick war wieder Stille. Nicht, dass sie sich gewünscht hätte, einen Leguan mit auf die lange heiße Fahrt nach Kapstadt zu nehmen, aber Jan und Eske wollten ihr unbedingt ein großartiges Abschiedsgeschenk machen, als Beweis dafür, dass sie das beste Kindermädchen war, das je das Leben auf der abgelegenen Schaffarm mit ihnen geteilt hatte.
Jan und Eske waren Zwillinge, ein fröhliches und aufgewecktes Pärchen, mit Sommersprossen und karottenroten Haaren. Sie waren in diesem Sommer sechs geworden, und in den kommenden zwei Jahren sollten sie zu Hause auf der Farm unterrichtet werden. Den Lehrer, den die van Riebecks über den Internationalen Austauschdienst in England engagiert hatten, hätte Johanna gerne noch kennengelernt. Aber sein Flug war aus irgendwelchen Gründen verschoben worden, und noch eine Woche länger mochte sie nicht bleiben, nur um einem jungen Mann die Hand zu schütteln, der Andrew Forster hieß, in der Freizeit Ritter-Romane verfasste, für die er noch keinen Verleger gefunden hatte, und zuletzt auf einer Grundschule in Essex die Erstklässler unterrichtet hatte. In seinem Bewerbungsbrief, den Johanna lesen durfte, beklagte er sich über die Hektik in Europa. Er war zweiunddreißig!
In ihrem Gepäck gab es noch ein weiteres Geschenk: ein Fotoalbum, das die Familie für sie angelegt hatte. Vom Tag ihrer Ankunft in Upington, am 3. Juli, als das Thermometer morgens um acht zwei Grad unter null zeigte und ein Schleier aus Frostkristallen das Land bedeckte. Von ihrem ersten Versuch, ein Schaf zu scheren, ein Pony zu satteln, Geburtstagspartys, Kirchenfeste mit anschließendem Wohltätigkeitsbasar. Natürlich das Weihnachtsfest, zwar ohne Lichterbaum, aber mit einem Festmahl (Truthahn, gefüllt mit Nüssen), das bei 41 Grad auf der schattigen Veranda ausgerichtet wurde.
Es war der erste Job, der ihr keinen Tag langweilig war. Überhaupt hatte sich ihr Leben, seit sie zum ersten Mal den Fuß auf afrikanischen Boden gesetzt hatte, grundlegend geändert. Sie hätte jetzt wirklich gerne die Norah-Jones-CD gehört.
Das Außenthermometer zeigte 41 Grad im Schatten an. Sie fuhr wieder mit offenen Fenstern, obwohl der Wind gedreht hatte und der Staub, den der Wagen aufwühlte, zu ihr zurückblies. Sie schmeckte Sand auf der Zunge und fühlte ihn als brennenden Schmerz in den Augen. Die flimmernde Hitze machte sie schläfrig. Voller Neid blickte sie auf das Vieh, das fernab der Straße die Mittagsglut im Schatten verdösen konnte. Fünfzig Meter nach der Weggabelung, von der die van Riebecks gesprochen hatten – eine wichtige Weggabelung, die man nicht verpassen durfte –, sackte der Benzinanzeiger plötzlich auf null. Das aber war unmöglich. Sie wusste, dass der Motor mit vollem Tank fast fünfhundert Kilometer schaffte. Und sie war erst dreihundert Kilometer gefahren.
Sie bremste, stellte den Motor ab, ließ ihn wieder an. Der Benzinstandsanzeiger rührte sich nicht.
Keine Panik, dachte sie, als das Blut ihr in den Schläfen hämmerte, bloß nicht gleich aufregen. Sie versuchte es ein weiteres Mal. Den Motor ausschalten, Hände in den Schoß, warten, bis das ganze System zur Ruhe gekommen war. Alles auf Anfang.
Bobo in seiner Kiste wurde unruhig, als spüre er etwas.
Sie schaltete den Motor wieder ein. Der Motor lief, der Benzinanzeiger blieb standhaft auf dem linken unteren Teil der Skala.
Sie öffnete ihre Wagentür, schüttelte die Krümel des Truthahnsandwichs, das sie im Fahren gegessen hatte, aus dem Wagen und griff nach einer der Wasserflaschen auf dem Rücksitz. Sie schraubte die Flasche auf und setzte sie an die Lippen. Das Wasser war heiß. Vor Schreck spuckte sie es wieder aus.
Bobo wütete in seinem engen Käfig.
Sie stieg aus dem Wagen, nahm den Blechnapf, füllte ihn randvoll mit Wasser und stellte ihn in den Schatten des Autos. Dann hob sie mit beiden Händen behutsam das scheue, elegante Tier heraus. Der Echsen-Panzer fühlte sich heiß an, und sie begann, sich Sorgen zu machen.
»Wasser«, lockte sie, als sie Bobo neben die Schale setzte. »Du hast Durst, was?«
Bobo blieb reglos neben dem Blechnapf liegen, als stellte er sich tot. Aber seine Augen waren wachsam auf die ungewohnte Umgebung gerichtet. Sein Kropf blähte sich wie ein kleiner Ballon. Manchmal zuckte sein langer Schwanz und wirbelte eine winzige Staubwolke auf.
Johanna nahm aus der Proviantdose einen Apfel und setzte sich damit auf einen der großen Steine, die wie hingeworfen neben einer Pinie mit durchsichtig dünnen, biegsamen Nadeln aus verdorrtem Unkraut herausragten. Sie rieb den Apfel mit einem Rockzipfel blank.
Das Benzin reicht bis Uitspankral, dachte sie. Das ist sicher. Hundert Prozent. Der Tacho spinnt.
Merkwürdig, einem Leguan beim Trinken zuzusehen. Selbst wenn man genau hinschaut, versteht man nicht, wie die Flüssigkeitsaufnahme bei diesen Tieren funktioniert. Leguane sind diskret und unergründlich, wie alle Echsen, deren Augen so fremd blicken, als kämen sie aus einer anderen Welt. Das hätte Jan und Eske gefallen! Bobo mit seinen Fußballerbeinen! Aber dann wieder diese Haut, die an Dinosaurier denken ließ und an die Zeit, als die halbe Erde noch mit Eis bedeckt war. Der Apfel gehörte zur süßsauren Sorte, mit fleckiger, aber zarter Schale.
Als sie aufstand, um aus dem Wagen die Kleenex-Packung zu holen, sah sie plötzlich die Schlange. Grün und dick wie ein Gartenschlauch. War es eine harmlose Schlange oder trug sie ein tödliches Gift? Eine Mamba vielleicht? Sie kannte sich mit Schlangen nicht wirklich aus, hatte aber gelernt, ihnen mit dem nötigen Respekt, jedoch ohne Panik zu begegnen. Schlangen betrachteten Menschen nicht als mögliche Beute. Sie waren zu groß. Wenn sie zubissen, dann nur aus Notwehr. Lieber verkrochen sie sich im hohen Gras, unter Steinen. Für solche Lektionen eignete sich ein Job als Kindermädchen auf einer afrikanischen Farm.
Die Schlange kroch aus dem Spalt zwischen den zwei großen runden Steinen hervor, die Johanna als so perfekter Sitzplatz erschienen waren. Friedlich in der Sonne dösende Steine.
Willem van Riebeck hatte sie immer gewarnt und gesagt: »Trau der Natur nicht. Die Natur ist eine Blenderin, sie verstellt sich. Denn nur so kann sie uns alle überleben.«
Im Zeitlupentempo, mit minimalen Körperbewegungen, schnürte sie ihre Stiefel zu. Bobo hatte sich unter das Auto geflüchtet, hinter das linke Vorderrad. Ein schlechtes Versteck, um sich vor einer Schlange zu retten. Die verharrte reglos an ihrem Platz, bereit, sofort zuzuschlagen, wenn Bobo sich zeigte oder irgendetwas Unkluges tat. Johanna war einer Schlange noch nie so nahe gewesen, doch sie hatte nicht wirklich Angst. Sie spürte nur Wut auf sich selbst, auf ihre Naivität, so einen Platz zu suchen, um ein verwirrtes Tier aus dem Kasten zu lassen. Einen Platz neben einem Baum, mit einem Haufen Steine und dürrem Gestrüpp. Ein besserer Unterschlupf für Schlangen war doch gar nicht denkbar! Und was für eine leckere Beute der Leguan war! Hatte sie jetzt schon, dreihundert Kilometer von Bossiekom entfernt, alles vergessen, was man ihr auf der Farm beigebracht hatte? Was würden Jan und Eske sagen, wenn sie ihnen erzählen müsste, dass Bobo nicht einmal sechs Stunden überlebt hatte in ihrer Obhut? Dass eine Schlange ihn als Mittagssnack verspeist hatte?
Während zwei sechsjährige Kinder einen Leguan monatelang pflegen und hegen konnten, ist sie, mit ihren sechsundzwanzig Jahren, noch nicht einmal imstande, einen Tag lang für sein Leben zu garantieren?
Sie ließ die Schlange für eine Sekunde aus den Augen und schaute sich um. Das schnurgerade, endlose Band der Straße. Ein Himmel, der gelb war, und nicht blau. Der Horizont eine Fata Morgana aus Staub. Kein Motorengeräusch. Kein Vogelgezwitscher. Zwei reglose Tiere, die sich belauerten. Jäger und Beute. Ein Auto. Und eine junge Frau im dünnen Baumwollkleid und Lederstiefeln, der ein angebissener Apfel aus der Hand gerollt war.
Während sie wieder den Kopf der Schlange fixierte, dachte Johanna an dieses Bild, das in Bossiekom über ihrem Bett gehangen hatte: der Sündenfall. Wie das Paradies entweiht wurde, als Eva den Apfel nahm und sich auf einmal ihrer Nacktheit bewusst wurde, weil sie von dem Apfel probiert hatte. Diese Nacktheit empfand sie jetzt auch. Dieses Ausgeliefertsein, Schutzlosigkeit. Sie fühlte sich auf einmal entblößt. Die Schlange, einen halben Meter vom Auto entfernt, rollte sich wieder zusammen. Nur der Kopf ragte empor. Als Johanna behutsam ihre Beine bewegte, wandte die Schlange sofort den Kopf und zischte.
Nelson, der schwarze Verwalter von Bossiekom, hatte ihr erklärt, dass Tiere einen Menschen automatisch für einen Baum halten, wenn er stocksteif verharrt. »Gilt das für alle Tiere?«, hatte Johanna gefragt. Was er damals geantwortet hatte, fiel ihr jedoch in diesem Augenblick nicht ein.
Sie blickte zum Kofferraum. Da, unter dem Kofferraumdeckel, mit einer Metallklammer befestigt, steckte der Wagenheber. Ein Wagenheber war nicht die beste Waffe, um eine Schlange mit einem Hieb auf den Kopf zu töten, aber auch nicht die schlechteste. Sie erlaubte sich nicht allzu viele komplizierte Gedanken, weil sie fürchtete, das Denken könnte zu unüberlegten Bewegungen des Körpers führen. In Filmen war das immer so. Schauspieler rollten die Augen, wenn sie genervt waren, machten eine wegwerfende Handbewegung, wenn ihnen etwas missfiel, legten den Kopf in den Nacken, um nachzudenken, und kneteten die Finger bei Stress.
Vielleicht würde das Geräusch des aufspringenden Deckels die Schlange verjagen. Vielleicht aber auch nicht. Sie musste das Auto zwischen sich und die Schlange bringen. Die Stiefel reichten bis zur halben Wade, das Kleid bis knapp an die Knie. Ob die Schlange sich für ihre mageren Knie interessierte? Für weiche Menschenhaut? Oder mehr für eine Echse mit einem Panzer, der stärker als Schuhsohlenleder war?
Mit dieser Echse, dachte Johanna, hat sie eine richtige Mahlzeit. Mich aber kann sie nur beißen, fressen kann sie mich nicht. Also ist Bobo die bessere Beute. Und ich habe die Verantwortung für Bobo. Ich habe es Jan und Eske versprochen. Ich habe ihnen versprochen, jeden Monat ein Foto von Bobo zu machen, in seiner neuen Umgebung. Was für ein Irrsinn. Wie konnte ich so was nur versprechen? Ich werde Bobo an ein Terrarium geben, in den Zoo bringen, oder in eine Tierhandlung. Keinesfalls werde ich meine Zukunft belasten mit einem Tier, das gerne in einer trockenen Badewanne schläft und senkrecht die Wände hinaufklettern kann. Mit Bobo werde ich überhaupt gar nicht erst eine Wohnung finden. So sieht es doch aus.
Plötzlich hielt sie den Wagenheber in der Hand. So überwindet man die Angst, mit einem Wagenheber hoch am gestreckten Arm über dem Kopf und einen Meter entfernt eine Schlange, giftig oder nicht.
Die Schlange rollte sich gelassen herum und schlängelte davon, zurück zu den Felssteinen, dem Schatten der Pinie, den dürren, dornigen Zweigen. Ein leichtes Rascheln, dann nichts mehr. Der Wagenheber glitt ihr aus der Hand. Sie ging in die Knie, stützte ihre Handballen auf dem Boden ab und beugte sich unter das Auto. Sie musste sich räuspern, bevor sie einen Ton herausbrachte.
»Bobo«, rief sie, »komm raus.«
Von Bobo war nur der kurze Schwanz zu sehen, der sich vorsichtig bewegte. Sie pfiff leise, wie die Zwillinge es ihr gezeigt hatten, und richtete sich auf. Ihre Knie zitterten. Mit dem Unterarm wischte sie sich den Schweiß von der Stirn. Der Apfel, nur einmal angebissen, lag im Dreck. Daneben Bobos Blechnapf. Johanna kam plötzlich der Gedanke, dass die Schlange einfach nur Durst gehabt hatte. Dass sie weder an Bobo noch an ihren nackten Knien interessiert war, sondern an dem Wasser in dem kleinen Blechnapf.
Vielleicht hatte sie ja gehört, was Johanna nicht hören konnte: das Geräusch, das ein Leguan macht, wenn er trinkt.
Bobo kam vorsichtig unter dem Wagen hervor. Behutsam hob Johanna ihn hoch und legte ihn in die Kiste zurück. Bobo ließ es mit sich geschehen. Er ist wahrscheinlich auf den Lebenskampf gar nicht vorbereitet, dachte Johanna, plötzlich voller Mitgefühl. Als Eske und Jan Bobo fanden, war er noch ein Baby. 15 Zentimeter lang und 300 Gramm schwer. Sie hatten ihn mit Milch und Maisbrei aufgepäppelt, hatten ihn auf einem alten, mit Stroh gefüllten Kopfkissen neben sich schlafen lassen, und als es kalt wurde, hatten sie sogar eine Wärmflasche unter die Matratze geschoben. Woher sollte Bobo das wahre Leben kennen? Hatte sie denn das Leben verstanden, bevor sie nach Afrika gekommen war?
Sie ließ den Blechnapf auf der Straße stehen. Falls die Schlange wirklich Durst hatte. Sie kam sich großartig vor in ihrem Mitgefühl für die darbende Kreatur. Noch über Kilometer sah sie manchmal im Rückspiegel den Blechnapf aufblitzen, wie ein Brennglas. Im Fahren griff sie auf den Rücksitz nach der letzten Wasserflasche, öffnete den Verschluss mit den Zähnen und trank gierig, ohne dabei die Straße aus den Augen zu lassen. Ihre Kehle fühlte sich an wie Sandpapier, die Zunge war nur noch ein unförmiger Klumpen, der sich beim Schlucken kaum kontrollieren ließ. Marjete hatte sie davor gewarnt, in der Mittagshitze auf der Straße zu sein.
»Wir hier machen es wie die Tiere«, hatte sie zum Abschied gesagt. »Wenn die Sonne im Zenit steht, suchen wir uns Schatten und warten, bis die schlimmste Hitze vorbei ist.«
»Ich hab doch den Fahrtwind«, hatte Johanna lachend erwidert, »der kühlt mich runter.«
Das war jedoch ein Irrtum. Der Wind blies ihr wie aus einem heißen Ofen entgegen.
Eske und Jan hatten darauf bestanden, sie noch bis zum großen Tor zu bringen. Das Tor zur Farm war neun Kilometer vom Haupthaus entfernt. Die Kinder radelten neben dem Mazda her, den Nelson für die große Fahrt sogar noch mit dem Wasserschlauch abgespritzt hatte. So kobaltblau hatte sie ihn zuletzt beim Gebrauchtwagenhändler in Upington gesehen.
Eske weinte auf dem gesamten Weg zum Tor, während Jan freihändig radelte, die Arme über der Brust gekreuzt, aufrecht und stolz. Nur manchmal streckte er einen Arm aus, um auf eine Schafherde zu deuten, oder einen Zaun, der niedergetrampelt war. »Da muss ich nachher mal mit Papa hin!«, hatte er ihr zugerufen, schon ein richtiger Bure, ein Farmer, der Sorge trägt um sein Land, sein Vieh. Das hatte sie gerührt. Am Tor hatte Eske ihr Rad hingeworfen und war zu Johanna ins Auto gekrabbelt. Hatte sich ein letztes Mal an sie geschmiegt und sie geküsst, unter Tränen. »Ich werde dich ganz wahnsinnig vermissen, du Liebe, Gute.« Sie hatte Johannas Gesicht gestreichelt, und der Rotz war ihr aus der Nase gelaufen, und Jan musste das alles unheimlich peinlich gewesen sein. »Pass auf Bobo auf!«, hatte er immer nur gerufen. »Du zerdrückst die Kiste!«
Warum die Kinder ihr das Tier wohl geschenkt hatten? War das auf Marjetes Drängen hin geschehen? Die Mutter von Jan und Eske hatte sich nie an Bobos Eigenarten gewöhnen können: dass er nachts in der trockenen Badewanne schlief oder auf dem Waschbeckenrand. Kühle, glatte Keramik oder Porzellan fühlte er gern an seiner Bauchhaut. »Kann man ihm das nicht abgewöhnen?«, hatte Marjete immer wieder verzweifelt gefragt. Willem und die Kinder hatten nur gelacht.
Vor vier Monaten etwa, im Frühling, war Johanna einmal plötzlich aufgewacht von Marjetes Schrei. Gellend und lang gezogen wie ein Sirenenton, mitten in der Nacht. Bobo hatte auf dem Klodeckel geschlafen, als Marjete ihn, ohne Licht zu machen, hochheben wollte, und das Tier war ihr vor Schreck an die Brust gesprungen. Dieser Schrei hatte noch lange alle beschäftigt. Besonders die Kinder waren eine Weile sehr verhalten, fast verlegen in der Gegenwart ihrer Mutter gewesen. Marjete selbst hatte nicht die geringste Erinnerung daran, dass sie so furchterregend geschrien hatte. So herzzerreißend. Sie war eine resolute, energische und absolut furchtlose Person.
»Du hast geschrien«, hatte Johanna ihr erklärt, »als hätte dieser Schrei immer schon in deinem Körper gesteckt. Und nur eine Gelegenheit gebraucht, um rauszukönnen.«
Marjete hatte nur abwehrend die Hände gehoben. »Ach Gottogott! Verschont mich mit eurem Psychokram. Ich habe nichts, mir geht es gut.«
»Ich bringe dich in den Zoo, Bobo, da wird es dir gefallen.« Johanna klopfte mit der leeren Wasserflasche leicht gegen die Holzkiste. »Da kommst du in ein Terrarium mit lauter Artgenossen, kriegst vernünftiges Futter, und wenn es auch keine Badewanne gibt oder so was, dann aber bestimmt irgendein Becken, in dem du mit deinen Kumpels Blödsinn machen kannst. Hörst du?«
Aus der Kiste kam keine Antwort. Johanna warf die Wasserflasche hinter ihren Sitz zu den anderen, die bereits dort herumkullerten. »Freiheit ist nicht alles, weißt du, Bobo? Freiheit ist auch gefährlich.«
Eine Stunde später kam der Wegweiser: noch 67 Kilometer bis nach Uitspankral.
Der Besitzer der Tankstelle von Uitspankral hatte über zwei leere Benzinfässer ein Brett gelegt: seine Schlachtbank. Das Huhn, dem er mit einem stumpfen Messer die Kehle durchschnitten hatte, zappelte noch, als der Kopf in den Sand fiel.
Der Mann übergab den Torso mit seinem Kranz blutiger Halsfedern seiner Frau, die neben ihm gewartet hatte, die Hände unter der Schürze verschränkt. Die Frau setzte sich auf einen Hocker, bettete den Hühnerkörper auf ihrem Schoß, hob die Flügel und befühlte die Brust. Sie nickte ihrem Mann zu, der sie die ganze Zeit beobachtete. Als sie lächelte, atmete er tief durch und wandte sich Johanna wieder zu.
»Also, Sie haben wirklich keinen einzigen Tropfen Benzin für mich?« Johanna stellte diese Frage nun schon zum dritten Mal, als ob dadurch die Antwort doch noch ein bisschen positiver ausfallen könnte.
Die Zapfsäule, ein paar Meter entfernt neben einem Wellblechschuppen, der als Werkstatt diente, war ein verrostetes Ding, das noch per Hand bedient werden musste. Der gusseiserne geschwungene Schlägel war an einer Stelle blank vom vielen Gebrauch. Pfützen aus Altöl waren mit einem schmierigen Film aus Staub und Federn bedeckt. Eine schneeweiße schwanzlose Katze strich um die Beine der Frau, die hingebungsvoll das Huhn rupfte.
»Ich hab Benzin, was die Leute hier brauchen für ihre Autos«, sagte der Mann. »Ich hab auch Diesel. Aber Ihr Auto braucht bleifrei.«
Johanna nickte.
Der Mann hob den Hühnerkopf vom Boden auf und strich sanft über den Kamm, der langsam verblasste und die Farbe seiner Handflächen annahm: ein zartes Rosa. Johanna hatte in Bossiekom viel gelernt. Sie wusste auch, wie ein Hühnerkamm sich anfasst: wie zartes Gummi.
»Mein Tacho ist kaputtgegangen«, sagte sie. »Geschwindigkeitsmesser, Thermometer, Ölstand, Benzinstand: Alles steht auf null.«
Der Mann nickte bedächtig. »Das sind die Schlaglöcher. Ihr Auto gehört in die Stadt.«
»Ich bin erst dreihundert Kilometer gefahren«, erklärte Johanna. »Wahrscheinlich schaffe ich noch hundert Kilometer oder so. Aber sicher bin ich nicht.«
»Auf diesen Straßen verbraucht man mehr Benzin als normal.« Der Mann legte den Hühnerkopf auf die Schlachtbank. Die Augen waren jetzt geschlossen. Die Katze ging zu ihm und schnurrte um die Beine des Mannes. Johanna hielt die Luft an. Hoffentlich gibt er ihr nicht den Kopf, dachte sie. Aber er scheuchte die Katze weg und störte sich nicht an ihrem beleidigten Fauchen.
»Glauben Sie, ich könnte es noch bis Citrusdal schaffen?«, fragte Johanna. Bis Citrusdal waren es nach der Karte über achtzig Kilometer. Aber manchmal wurde man umgeleitet, über provisorisch angelegte Pisten, weil der Zustand der eigentlichen Straße zu schlecht war, und das konnten weitere Kilometer bedeuten. Außerdem waren da auch noch die Berge, die sie überwinden musste.
»Ich habe vorgestern bleifrei bestellt«, sagte der Tankstellenwart. »Sie haben mir versprochen, dass sie spätestens heute Morgen hier sein wollten.«
Johanna schaute auf die Uhr. »Jetzt ist es zwei.«
Der Tankstellenbesitzer nickte. Die Frau wischte mit der Hand die gerupften weißen und braunen Federn von ihrem Schoß, packte das nackte Huhn an den Füßen und verschwand in einem Durchgang zwischen dem Werkstattschuppen und einem lang gezogenen Haus, das vor Jahren einmal weiß gewesen sein musste.
»Ich versteh’s auch nicht«, sagte der Mann. »Ich habe mit ihnen so gegen zehn Uhr gerechnet.«
»Vielleicht eine Panne«, Johanna stöhnte auf. »O Gott, dann stecke ich hier fest.«
Der Tankstellenwart hob die Schultern. Pannen konnten ihn nicht aus der Ruhe bringen.
»Und es gibt wirklich keine andere Tankstelle vor Citrusdal?« Er schüttelte den Kopf.
»Und? Was mache ich jetzt?« Seufzend schaute Johanna sich um, lief ein paar Schritte nach rechts, ein paar Schritte nach links, breitete resigniert die Arme aus. Da sah sie den Mann. Der erste Weiße, seit sie aus Bossiekom abgefahren war. Er hockte vorgebeugt auf einem roten Plastikstuhl, und es sah aus, als hielte er einen Skizzenblock auf seinen Knien, als zeichnete er irgendetwas. Genau konnte Johanna es nicht sehen, weil er umringt war von den Dorfkindern, die sich gegenseitig anrempelten und kichernd den Kreis um den Fremden immer enger schlossen. Der Mann trug einen breitkrempigen Hut, unter dem strähniges, graues Haar hervorlugte. Nass geschwitzter Hemdkragen.
Hinter ihm die weiß getünchte Wand mit einer Türöffnung, die irgendwann mal blau lackiert worden war. Über der Tür stand COFFIE-BAR. Rechts und links neben der Tür, auf dem gestampften Lehmboden, drei weitere Plastikstühle und Tische. Alle unbenutzt. Der Mann riss ein Blatt aus seinem Skizzenblock und reichte es mit einem Lächeln einem der Kinder. Sofort floh das Kind (ein Mädchen mit bunten Glasperlen in den Zöpfchen, die in alle Richtungen abstanden) mit der Beute, die es wie eine Fahne über dem Kopf schwenkte, und alle anderen Kinder johlend hinterher.
Der Weiße trug ein helles, durchgeschwitztes Hemd, Kakihosen und Stiefel. Neben seinem Stuhl ein lederner Rucksack, prall gefüllt.
»Wer ist das?« Johanna deutete mit dem Kopf in Richtung Bar. Der Tankstellenwart hob gleichgültig die Schultern. »Keine Ahnung. Ist heute Morgen gekommen. Mit ein paar Leuten in einem Jeep. Aber der Jeep ist weitergefahren. Er wollte Mazeppa besuchen.«
Der Weiße nahm seinen Hut ab, legte ihn auf den Rucksack, fuhr sich mit beiden Händen durch die grauen Haare. Dann stand er auf und schüttelte sich wie ein Hund. Johanna war überrascht, wie kurz seine Arme waren, und einen leichten Bauchansatz hatte er auch.
»Aber er kann nicht mit Mazeppa sprechen«, sagte der Besitzer der Tankstelle.
Als der Weiße sah, dass Johanna ihn entdeckt hatte, hob er winkend den Arm. Johanna winkte zurück. »Und warum kann er nicht mit Mazeppa sprechen?«
»Weil wir Mazeppa vor einem Monat beerdigt haben. Wenn Sie Durst haben oder Hunger oder so«, sagte der Tankstellenbesitzer, »dann gehen Sie ruhig rein. Durch die Bar in die Küche. Da ist meine Frau. Wenn Sie Lust haben, können Sie nachher Chicken-Curry bekommen.«
»Ich überleg’s mir«, sagte Johanna.
»Möglich, dass das Benzin jeden Augenblick kommt. Dann wär es gut, wenn Sie hier in der Gegend sind.«
Johanna breitete resigniert die Arme aus. »Wo sollte ich denn sonst sein?«
Gegenüber der Bar gab es eine Art Park aus Eukalyptusbäumen. Auf der staubigen Erde, gegen die Baumstämme gelehnt, hielten Männer in orangefarbenen Overalls ein Nickerchen. Wahrscheinlich Straßenarbeiter, die auf ihren Abtransport warten, dachte Johanna, oder darauf, dass die Hitze irgendwann vorbeigeht. Der Tankstellenbesitzer folgte ihrem Blick. »Die warten auch auf das Essen«, sagte er. »Meine Frau kocht gut. Wenn Sie gestern gekommen wären, da gab es Bobotie. Dafür ist sie berühmt.«
Etwas entfernt von der Männergruppe, aber noch im Schatten der Bäume, waren Ziegen angepflockt. In ihrem Radius gab es keinen einzigen Strohhalm mehr, kein bisschen Unkraut. Eine Ziege hatte sich auf die Hinterbeine gestellt und versuchte, einen herabhängenden Eukalyptuszweig zu erreichen. Gierig streckte sie sich nach den lockenden grünen Blättern, aber es fehlten ein paar Zentimeter.
Die Kinder, die eben noch den Zeichner umringt hatten, tobten jetzt mit einem Ball herum. In der Nähe der Kirche, die sich durch einen schneeweiß lackierten Holzzaun von der Ärmlichkeit des Dorfes abhob. Grabsteine lehnten an der Backsteinfassade. Die vergitterten Kirchenfenster waren geöffnet, und für einen Moment glaubte Johanna, so etwas wie Weihrauch zu riechen. Vor der Kirche gab es einen Hinweis auf das »Museum«. Es war dem Missionar gewidmet, der sich mit seiner genügsamen Familie hier niedergelassen hatte, in dem innigen Wunsch, die heidnischen Schwarzen zu guten Christenmenschen zu machen und ihnen gleichzeitig zu bescheidenem Wohlstand zu verhelfen. Denn der Missionar hatte auf dem Ochsenwagen, mit dem er die weite Strecke aus Kapstadt gekommen war, auch alle Utensilien dabei, die man zur Herstellung von guten Lederschuhen brauchte. So entstand die Fabrik, die noch Ende der Achtzigerjahre guten Umsatz gemacht hatte. Nun war die Fabrik ein Museum, ebenso wie das armselige Strohdachhaus, in dem der Missionar mit seiner Frau und den sieben Kindern ein gottesfürchtiges Leben geführt hatte. Das alles wusste Johanna aus dem Reiseführer, den Marjete ihr ein paar Tage vor der Abreise auf den Nachttisch gelegt hatte. »Damit du auch etwas erfährst über unsere Geschichte in Südafrika«, hatte sie gesagt.
Das Museum war geschlossen. Ein Eisenbarren verriegelte die Tür. »Ja, es stimmt«, sagte der Tankstellenwart, der Johannas Blick gefolgt war. »Weit können Sie hier nicht gehen.«
Der Weiße wartete auf sie am Eingang zur Bar. Er musterte sie, so wie sie ihn gemustert hatte, so wie Weiße sich immer mustern, wenn sie sich unter Schwarzen irgendwo in der Ödnis begegnen, in dieser Mischung aus Erleichterung und Misstrauen. Johanna kannte das schon. Es war okay. »Der Generator für den Kühlschrank ist ausgefallen«, sagte er statt einer Begrüßung. »Das Einzige, was man trinken kann ohne Gefahr für Leib und Seele, ist Rooibos-Tee.«
Sie lächelte. »Okay, dann Rooibos-Tee.«
»Ich hatte mich draußen hingesetzt«, er deutete mit seinen kurzen Armen auf den Stuhl, »obwohl es wahnsinnig heiß ist. Aber drinnen sind zu viele Fliegen. In den letzten zwei Wochen hatte ich genug Fliegen für mein ganzes Leben.«
Die Frau hatte ihre Stimmen gehört. Sie band die blutige Schürze ab, als sie aus der Küche kam, und fuhr sich mit dem Ellbogen über die Stirn. »Wenn Sie etwas Kaltes trinken wollen«, sagte sie zu Johanna, »haben Sie Pech. Kein Strom.«
»Die Lady weiß schon Bescheid«, sagte der Mann, bevor Johanna etwas erwidern konnte. »Sie nimmt einen Rooibos-Tee. Und ich nehme auch noch einen.« Er lächelte Johanna zu. »Das ist dann mein fünfter. Kriegt man von Rooibos-Tee eigentlich Maden im Bauch?«
»Eher wächst da eine Teeplantage«, meinte Johanna, »wenn der Humusbelag der Magenwände gut ist. Essen Sie viel Erde?« Sie merkte jetzt, wie froh sie war, hier auf einen Weißen zu treffen.
Gemeinsam trugen sie einen der Holztische, auf den eine Wachstuchdecke getackert war, zu seinem Platz. Er holte einen weiteren Stuhl, zog aus einem Außenfach des Rucksacks ein frisches Papiertuch und wischte damit über ihren Sitz, bevor er eine einladende Geste machte. Das war komisch. Und charmant.
»Sind wir hier auf einer Party oder so?«, fragte sie amüsiert, als sie sich setzte.
»Ich dachte nur an Ihr schönes Kleid.«
Sie saßen beide mit dem Rücken zur Wand, mit dem Blick auf Kirche und Friedhof. »Wenn ich ehrlich sein darf«, sagte er, »war ich ziemlich erleichtert, als Ihr Suzuki plötzlich auftauchte.«
»Der Suzuki ist ein Mazda. Und Sie wollten einen Mann treffen, der vor einem Monat beerdigt worden ist.«
Er lachte. »Ach, bei Ihnen ist es ein Monat? Bei mir waren es nur zwei Wochen.«
»Die Zeit rast hier«, sagte Johanna.
Er lachte vergnügt in sich hinein. Sie schauten auf die Kirche. In dieser Gegend macht man lange Pausen zwischen den Sätzen. Auf einem Tablett aus Plastik brachte die Frau zwei Becher und eine dicke, bauchige Porzellankanne.
»Sie können den Tee noch ein bisschen ziehen lassen«, sagte sie. »Aber nicht zu lange. Dann schmeckt er bitter. Etwas zu essen?« Die Frau kämpfte mit ihren Haarspangen und dem drahtigen Haar.
»Was gibt es denn?«, fragte Johanna.
»Wir haben Stockfisch, Biltong, Kekse und Salzcracker«, sagte die Frau. »Aber wenn Sie noch ein bisschen bleiben: Ich mache gerade ein Hühner-Curry.«
Johanna fiel der Hühnerkopf wieder ein. »Ich glaube, ich habe keinen Hunger«, sagte sie. Der Weiße lächelte. »Ich nehme das Curry, wenn ich dann noch hier bin.«
Die Frau nickte und schlurfte in ihren ausgetretenen Schuhen zurück in die Küche. Die Schleife über ihrem breiten Hintern erinnerte Johanna an Wien, an das Café Sacher, wo Kellnerinnen mit gestärkter Schürze heiße Schokolade servieren. Genauso akkurat und kokett war diese Schleife gebunden. Sie musste lachen.
»Gefällt mir, dass Sie trotzdem lachen.« Er streckte ihr seine Hand hin. »Ich bin Colin. Und wenn Sie weiter so freundlich lächeln, werde ich Sie wahrscheinlich sehr bald fragen, ob es für mich und meinen Rucksack noch Platz in Ihrem Mazda gibt. Die Leute, die mich hier abgesetzt haben, kommen erst in zwei Tagen zurück. Weiß der Himmel, was ich mir dabei gedacht habe. Das Museum ist übrigens geschlossen. Und dieses Haus, in dem der Missionar gelebt hat, ist doch nicht zu einem Gasthaus ausgebaut worden, wie es wohl mal geplant war. Und Sie heißen?«
»Johanna.«
»Freut mich.« Er schüttelte herzlich ihre Hand. Er lächelte gewinnend. Er wollte schließlich mitgenommen werden. Sie war die Einzige, die ihn retten konnte aus diesem verlassenen Nest. Deshalb musste sie nicht ganz so herzlich zurücklächeln. »Interessiert es Sie gar nicht, wohin ich fahre?«
»Es kommen ja nur zwei Richtungen infrage«, erwiderte Colin. »Nach Norden, in die Karoo. Oder nach Süden, nach Kapstadt. Ich war mir bis eben vollkommen sicher, dass Sie auf dem Weg nach Kapstadt sind.«
»Ach ja? Und wieso?«
»Weil eine schöne junge Frau, die gerade aus Kapstadt kommt, anders gekleidet wäre.« Er lächelte. »Und überhaupt.«
Dieses »und überhaupt« ärgerte sie. »Ah! Ein Experte für junge Frauen!«, entgegnete sie sarkastisch. Wenn Männer mit Bauch und verschwitzten Hemden über schöne junge Frauen redeten, revoltierte automatisch ihr Magen.
»Ich arbeite an der Universität von Kapstadt und lebe praktisch auf dem Campus. Da bin ich umgeben von Studentinnen. Deshalb habe ich mir die Bemerkung erlaubt«, sagte Colin fröhlich. Johanna erfuhr, dass Colin für das Archäologische Institut in Kapstadt arbeitete. Er wollte zusammen mit dem Team, das im Jeep davongefahren war, alle bislang bekannten Höhlenmalereien registrieren, katalogisieren, zeitlich und thematisch zuordnen und so weiter. Er verlor sich in Fachausdrücken. Sie waren zwei Wochen unterwegs gewesen. Johanna vergaß zu fragen, warum er diese letzte Etappe alleine machen wollte, ohne seine Leute. Colin hatte in der Zeit Hunderte von Zeichnungen angefertigt, weil es zu gefährlich war, in den Höhlen mit Blitzlicht zu fotografieren, wodurch die Malereien der Buschmänner, von denen bislang niemand genau wusste, wie alt sie waren, beschädigt werden konnten.
Er zeigte Johanna, als sie ihn darum bat, ein paar seiner Skizzen. »Die Buschmänner«, sagte er, »sind echte Künstler. Ich war schon vor dieser Tour ein großer Fan und Bewunderer. Jetzt bin ich es noch mehr.«
Unterwegs hatte ihnen jemand von Mazeppa erzählt, einem alten Buschmann, der mehr als hundertzehn Jahre alt sein sollte und sich in der Gegend um Uitspankral auskannte wie kein anderer. Er hatte als Sangoma gearbeitet, als Medizinmann, und auf der Suche nach besonderen Kräutern, Steinen, Tierhaaren und so weiter war er häufig in unwegsamem Gebiet auf der Suche nach Wurzeln, Kräutern und besonderen Steinen unterwegs gewesen. Dabei hatte er zahlreiche Höhlen entdeckt, an deren Wänden Buschmänner ihr Leben in Malereien festgehalten hatten. Wie sie jagten, wie sie kämpften, wie ihr Clan sich organisierte. Und wie sie ihr hartes Leben bewältigten. Um von Mazeppa vielleicht über bis jetzt unentdeckte Höhlen zu erfahren, war Colin in Uitspankral ausgestiegen.
Diese Arbeit, mit der er jetzt schon mehr als drei Jahre beschäftigt war, faszinierte ihn noch immer, und wenn er redete, war es, als würde er nie ein Ende finden. Doch plötzlich, mitten im Satz, schüttelte er sich kurz, verschränkte die Arme über der Brust und sagte fröhlich: »Und jetzt Sie.«
»Wie ich heiße, habe ich Ihnen doch schon gesagt.«
»Klar, Johanna. Aber was machen Sie? Wo kommen Sie her, wo wollen Sie hin?«
»Ich war oben im Norden auf einer Schaffarm. Als Kindermädchen.« Sie deutete auf ihr Auto, das neben der rostigen Zapfsäule im Schatten eines Eukalyptusbaumes parkte. »Und ich habe noch jemanden dabei. Der hat auch Durst, und vor allen Dingen Hunger. Haben Sie eine Ahnung, was Leguane so alles fressen? Mir gehen langsam die Falter aus.«
»Chicken-Curry?«, schlug Colin vor.
Gegen vier, als der Mazda wieder unterwegs war mit einem bis zum Rand gefüllten Tank, benahm Colin sich bereits, als kenne er Johanna seit Ewigkeiten. Als sei sie seine Studentin und habe bei ihm einen Kurs belegt, zum Beispiel über das Verhältnis der Buschmänner zu Reptilien.
Bobo war auf den Rücksitz verbannt worden, die leeren Wasserflaschen und anderen Müll hatten sie in Uitspankral entsorgt und so Platz geschaffen für Colins Rucksack.
Bobo verhielt sich ruhig, wahrscheinlich verdaute er die Reste des Hühnerflügels, mit dem Colin ihn gefüttert hatte.
Die Sonne stand noch sehr hoch, und die Berge, denen sie entgegenfuhren, leuchteten in verschiedenen Schattierungen von Blau und Violett.
Colin rauchte seine letzte Zigarette. Er inhalierte lang und tief und blies den Rauch fast andächtig langsam aus dem offenen Seitenfenster. Er wusste inzwischen, dass sie Nichtrau cherin war. Aber sie hatten sich darauf geeinigt, dass er rauchen konnte, solange er darauf achtgab, dass der Qualm sie nicht belästigte. Sie beobachtete ihn aus den Augenwinkeln, wie er die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger hielt und ihr allmähliches Verschwinden verfolgte.
»Sie weinen doch nicht, wenn die Zigarette zu Ende ist?«, fragte Johanna.
Er nahm noch einen letzten tiefen Zug, pustete den Qualm nach draußen, dann drückte er die Kippe aus und wickelte sie in die Silberfolie der Schachtel. »Ich bin ein Mann. Männer weinen nicht wegen einer Zigarette, falls Ihnen das bislang noch nicht aufgefallen ist.«
»Wegen was weinen sie sonst?«
Er überlegte. Er drehte das Fenster so hoch, dass er seinen Kopf dagegen lehnen konnte – den Hut hatte er nach hinten auf den Rücksitz geworfen – , und lächelte versonnen.
»Fußball?«, schlug er vor. »Wenn die Lieblingsmannschaft einen Elfmeter verschießt, dann kommen mir die Tränen. Reicht das?«
Sie hob die Schultern. »Ich interessier mich nicht für Fußball.«
»In Kapstadt sind gerade alle verrückt nach Kricket«, sagte Colin. »Ist das eher was für Sie?«
Johanna schüttelte den Kopf. »Ich kenne nicht mal die Regeln.«
Als Colin sie gefragt hatte, ob sie ihn mitnehmen würde, wenigstens bis zur nächsten größeren Stadt, wo er einen Leihwagen organisieren wollte, hatte sie mit einem Zögern reagiert, das in einer Gegend wie dieser fast an Beleidigung grenzte. Denn es war klar, dass sie ihn mitnehmen müsste, falls kein anderer Wagen auftauchte, der das gleiche Ziel hatte. Sie war ja hier nicht in Berlin, wo man sagen konnte: Nimm doch die S-Bahn. Oder den Bus. Er wirkte vertrauensvoll, wie jemand wirken kann, der zwei Wochen im Busch unterwegs war, weitab von all den Errungenschaften der Zivilisation wie einer Dusche, Rasierschaum, Waschmaschine und Bügeleisen. Er verhielt sich korrekt. Und sie glaubte ihm auch seine Geschichte, Institut für Archäologie, Höhlenmalerei und so weiter. Er hatte ihr seine Skizzen gezeigt, er schien wirklich etwas von der Sache zu verstehen. Außerdem war es mindestens so gefährlich, allein die Berge zu überqueren wie in Begleitung eines Freundes. Vielleicht verstand er ja was von Autos.
Colin wirkte auf eine gewisse Weise altmodisch, wie jemand, der in England neben seinem Fach auch Etikette studiert hatte, dann konnte er aber auch wieder so ruppig und schnoddrig sein wie diese Farmer aus der Karoo, die nur einmal im Monat in die Stadt kommen. Johannas Problem war eher, dass sie um Männer, die ein gewisses Alter hatten, instinktiv einen Bogen machte. Colin hatte ihr sein Alter nicht verraten, aber er war garantiert über fünfzig und könnte also ihr Vater sein. Mit Männern, die ihr Vater sein könnten, wollte Johanna nichts zu tun haben. Das gehörte zu den Regeln, die sie für sich aufgestellt hatte, bevor sie die Stelle bei den van Riebecks angenommen hatte. Nie etwas mit einem Typen, der ihr Vater sein könnte. Wirklich nie. Andererseits gab es natürlich keinen Grund, anzunehmen, dass Colin mehr suchte als eine Mitfahrgelegenheit. Wenn statt ihrer ein Laster mit tiefgefrorenem Rindfleisch durch Uitspankral gekommen wäre, wäre es Colin sicher auch recht gewesen. Reiner Zufall, dass sie sich vor dieser Bar begegnet waren, wirklich, und es war lächerlich, dass sie aus dieser winzigen Mücke gleich einen Elefanten machte. Als hätte sie noch nie im Auto neben einem Fremden gesessen, der ihr Vater sein könnte. Und dann hatte sich Colin auch noch ein paar Bonuspunkte verschafft, indem er sich um Bobo kümmerte. Als Johanna ihn beobachtet hatte, wie er den Hühnerflügel in mundgerechte Leguanbisse zerteilte und ihm auch noch ein Salatblatt anbot, das zur Dekoration auf seinem Teller gelegen hatte, mit der Bemerkung, dass es unter Leguanen auch Vegetarier gäbe, hatte sie gesagt: »Ich nehme Sie mit, klar. Aber nur bis Citrusdal, da besuche ich Freunde.«
»Okay.« Colin hatte lächelnd mit den Schultern gezuckt. »Besser als nichts. Von da komme ich schon weiter. Kein Problem.«
Die Idee, in Citrusdal bei den Beckhams zu übernachten, war Johanna ganz plötzlich gekommen. Auf diese Weise behielt sie die Regie über ihr Leben, und das war wichtig. Wenn der Tacho nicht kaputtgegangen wäre und sie nicht in Uitspankral an diesen Archäologen geraten wäre, hätte sie in Citrusdal vielleicht nur einen kurzen Stopp bei den Beckhams gemacht – das hatte sie Marjete versprochen – und wäre weitergefahren. Die Beckhams waren alte Freunde von Marjete van Riebeck. Sie besaßen eine riesige Orangenfarm in dem Tal, das nach diesen Orangen- und Zitronenfeldern benannt war. Marjete hatte ihr gesagt, bei den Beckhams fühle man sich wie in Italien. Und gefragt: »Warst du mal in Italien?«
Klar war Johanna in Italien gewesen.
»Du warst wohl schon überall«, hatte Marjete gesagt. Und mit einem kleinen traurigen Lächeln hatte sie hinzugefügt: »Ich bin bloß bis Stellenbosch gekommen.«
Colin war ein ruhiger Beifahrer. Er geriet nicht in Panik, als die Serpentinen begannen und die Kurven immer enger und gefährlicher wurden. Es gab nur alle zwei Kilometer eine Ausweichbucht, und sie fragten sich wahrscheinlich beide insgeheim, was passieren würde, wenn ihnen jetzt ein Laster entgegenkäme. Gut, dass Colin solche Fragen nicht stellte, dass er sich auch nicht ängstlich – wie ihre Mutter zum Beispiel das immer getan hatte – am Armaturenbrett abstützte, als sie, nachdem der Bergkamm überwunden war, auf der anderen Seite wieder talwärts fuhren, in ebensolchen Haarnadelkurven. Kein einziges Auto kam ihnen entgegen. Über Kilometer fuhren sie an einem drei Meter hohen Maschendrahtzaun entlang, ohne dass sie entdecken konnten, was da geschützt werden sollte. Colin öffnete für sie die Wasserflasche und reichte sie ihr genau in dem Augenblick, als sie glaubte, ihre Zunge würde am trockenen Gaumen festkleben.
»Können Sie Gedanken lesen?«, fragte sie lächelnd, als sie die Flasche zurückgab. Er schraubte den Verschluss wieder zu, stellte die Flasche auf den Boden zwischen seinen Füßen, und fragte:
»Leben Sie allein?« Die Frage kam so unvermittelt, dass Johanna das Lenkrad verriss und sie für einen Augenblick mit der Vorderachse zwischen Himmel und Erde schwebten, und Johanna flüsterte: »O Scheiße, Scheiße.« Da griff er ihr ins Steuer, lenkte den Wagen auf die Straße zurück, ließ los, atmete tief durch und sagte: »Verzeihung, das war knapp. Sie haben sich über meine Frage erschrocken. Klingt wie aus einem schlechten Krimi, was? Ich ziehe die Frage hiermit zurück.«
Johanna fasste das Steuer fest mit beiden Händen.
Die Sonne stand jetzt sehr tief, und manchmal, wenn sie einen Berg umrundeten, blendete sie so sehr, dass sie trotz Sonnenbrille kaum etwas sehen konnte. Sie wartete, bis ihr Herz wieder seinen normalen Rhythmus gefunden hatte. Dann räusperte sie sich zweimal. »Ich hasse es, wenn man mir ins Lenkrad fasst«, sagte sie. »Aber trotzdem: danke.«
Er schwieg. Vielleicht wirkte der Schock noch nach. Oder er dachte in diesem Augenblick voller Verlangen an eine Zigarette. Vor Citrusdal würden sie mit Sicherheit keinem Zigarettenautomaten begegnen.
»Ich weiß noch nicht«, sagte Johanna schließlich, um das Gespräch wieder aufzunehmen.
Colin musterte sie von der Seite. »Was wissen Sie nicht?«
»Sie haben doch gefragt, ob ich allein lebe. Und die Antwort ist: Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Wohnung in Kapstadt. Kommt drauf an, was ich finde. Und was ich mir leisten kann. Vielleicht wird’s eine WG. Dann heißt die Antwort: Nein, ich lebe nicht allein.« Sie bremste plötzlich, und legte die Hände in den Schoß. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, ein Stück zu fahren? Kommen Sie mit Automatik zurecht?«
Colin lachte. »Sie meinen, ob es schon Automatik gab, als ein alter Sack wie ich den Führerschein gemacht hat?«
Johanna wurde rot. »Ich rede manchmal blödes Zeug.«
Kurz legte er ihr seine Hand auf den Arm. Eine versöhnliche kleine Geste, die sie nett fand. Sie stiegen gleichzeitig aus und gingen um die Kühlerhaube herum, wo sie beide zur gleichen Seite auswichen. Sie fingen im selben Augenblick an zu lachen.
»Immerhin etwas«, sagte Colin, als er es sich hinter dem Steuer bequem machte. »Sie können wieder lachen.«
Johanna entspannte sich sofort, als sie nicht mehr fahren musste. Sie spürte, dass das intensive Starren auf die Schlaglochpiste sie vollkommen erschöpft hatte.
»Bleiben Sie lange in Citrusdal?«, fragte Colin.
»Ich weiß nicht. Eine Nacht oder so. Kommt drauf an, wie nett die beiden sind.«
»Die beiden?« Colin warf ihr einen neugierigen Blick zu, konzentrierte sich dann aber sofort auf die Straße. Der Belag wechselte ständig zwischen Schotter, groben Steinen und tiefen Löchern und Querrinnen, die in der Regenzeit durch das von den Bergen herabstürzende Wasser erzeugt wurden. Die Ölwanne des Mazdas war schon mehrfach aufgeschlagen. Und einmal hatten sie halten müssen und waren unter den Wagen gekrochen, weil es sich so furchtbar angehört hatte, als die Wanne über einen Stein schabte. Bis jetzt jedoch war alles gut gegangen.
»Die beiden heißen Debbie und Dustin Beckham. Es sind Freunde von den Leuten, bei denen ich gearbeitet hab.«
»Aha«, sagte Colin.
Die Sonne versank hinter einem Berg, der seine Farbe von Blau zu Lila und dann zu einem bleichen Grau verändert hatte. Sie schwiegen eine Weile, um dem Farbenspiel des Himmels zuzuschauen. Ihr fiel ein, wie jemand, mit dem sie mal einen Joint geraucht hatte, zu ihr gesagt hatte: »Es gibt so viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben.«
Laut fuhr sie fort: »Ich habe keine Ahnung, ob es nette Leute sind.« Aus irgendeinem Grund fühlte Johanna sich bemüßigt, weitere Erklärungen abzugeben. Vielleicht aus Dankbarkeit, weil Colin am Steuer saß und sie die Beine ausstrecken konnte. »Aber auch wenn ich mich bei ihnen nur halb so wohl fühle wie bei Willem und Marjete, ist es immer noch sehr in Ordnung.«
»Verstehe.«
»Nein«, knurrte Johanna, »tun Sie nicht.«
Wenn Colin sie in diesem Augenblick gefragt hätte, wäre sie vielleicht bereit gewesen, etwas aus ihrem Leben zu erzählen. Etwas preiszugeben von sich. Aber er fragte nicht. Und die Gelegenheit ging vorüber. Darüber war sie später froh.
Sie erreichten die Asphaltstraße um zehn nach sieben. Beide atmeten tief durch, als sie auf einmal dieses surrend satte Geräusch von Reifen hörten, die über einen glatten Boden rollten. Colin ließ das Steuer los und fuhr sich durch die Haare. Er lenkte mit den Knien.
»Back to civilisation«, sagte er. »Ein gutes Gefühl, was?«
Bevor Johanna etwas sagen musste, fasste er wieder das Steuer. Jetzt kamen ihnen auch Autos entgegen, mit aufgeblendeten Scheinwerfern.
Johanna blinzelte. »Ich glaube, meine Augen sind rot wie bei einem Fisch.«
»Seit wann haben Fische rote Augen?«
Johanna suchte in ihrem Rucksack nach der Wegbeschreibung für »Tuscany House«, dem Besitz der Beckhams. Marjete hatte am Rand die Telefonnummer notiert. Johanna prüfte ihr Handy. »Wir haben hier Empfang«, sagte sie. »Ich versuche mal, ob ich die Beckhams erreiche. Oder wollen Sie erst telefonieren? Wegen eines Mietwagens?« Einladend hielt sie Colin ihr Handy hin.
Aber er schüttelte energisch den Kopf. »Ich fahre Sie bis vor die Haustür. Mit Ihren roten Augen lasse ich Sie nicht mehr ans Steuer. Und lassen Sie sich den Weg noch mal beschreiben.« Langsam fuhr er über eine Kreuzung, die von einem hohen Lichtmast beleuchtet wurde. »Da steht ein Schild: Leewen Kloof«, sagte er. »Hier gab es mal Löwen.« Er imitierte das tiefe rollende Rufen eines Löwen.
Johanna tippte die Nummer ein und wartete. Sehr schnell meldete sich jemand. »Tuscany House. Sie sprechen mit Philemon.«
»Kann ich Mr. oder Mrs. Beckham sprechen?« Johanna warf Colin einen Blick zu. »Auf jeden Fall sind sie zu Hause.« Sie deutete nach vorn. »Da, die Apotheke. Da müssen wir rechts.«
Debbie Beckham kam ans Telefon. Sie war völlig außer Atem und beteuerte, sie sei hingerissen, Johanna zu empfangen. »Marjete hat so viel von Ihnen erzählt!«, sagte sie. »Ich bin ganz neugierig auf Sie. Wo sind Sie jetzt? Wir essen immer um acht. Glauben Sie, dass Sie das schaffen?«
In diesem Augenblick machte Colin eine Bemerkung, und Debbie fragte: »Sind Sie nicht allein?«
»Ich hab in Uitspankral einen Archäologen aufgegabelt«, sagte Johanna. »Er muss auch nach Kapstadt. Aber er will sich hier in Citrusdal einen Wagen mieten. Im Augenblick sitzt er gerade am Steuer.«
»Und lässt schön grüßen«, rief Colin.
»Ist er nett?«, fragte Debbie. »Wenn er nett ist, bringen Sie ihn doch einfach mit. Weiß er schon, wo er schlafen wird?«
»Sekunde, ich frage ihn.« Johanna wandte sich an Colin, der vorgebeugt hinter dem Steuer saß und die Beschriftungen der Straßen studierte. »Debbie fragt, ob Sie schon wissen, wo Sie schlafen werden.«
Colin schüttelte den Kopf. Er konzentrierte sich lieber auf die Straße. »Fragen Sie bitte, ob es richtig war, bei der Apotheke rechts abzubiegen. Wir kommen in eine stockfinstere Gegend.«
»Wir sind bei der Apotheke rechts abgebogen«, sagte Johanna ins Telefon, »und kommen in eine stockdunkle Gegend.«
»Es wird immer noch dunkler«, erwiderte Debbie fröhlich. »Aber dann sehen Sie auf einmal eine Sandsteinmauer. Mit Türmchen. An der Mauer fahren Sie ungefähr sieben Kilometer entlang, bis zum Haupttor. Ich schicke jemanden runter, der euch aufmacht. Ich freue mich.«
»Sie freut sich«, sagte Johanna, als sie das Handy ausschaltete.
Ganz gleich, wie oft Johanna später an diesen Abend in Debbie Beckhams feudaler Villa zurückdachte, immer bekam sie einen heißen Kopf und dachte: Nein, das hätte nicht passieren dürfen. Und weil sie schon dabei war, diesen Abend wieder und wieder in Gedanken durchzuspielen, so suchte sie mit einer geradezu selbstquälerischen Beharrlichkeit nach dem Punkt, dem Augenblick, wo ihre inneren Warnblinkleuchten versagt hatten, an dem alles aus dem Ruder lief. The point of no return, wie es so schön heißt. Als wenn man jemals als derselbe irgendwohin zurückkommt. Egal, wo man war und wie lange man fort gewesen ist.
Sie waren die sieben Kilometer an einer beeindruckenden Steinmauer entlanggefahren, hatten das Tor gefunden, mit zwei Säulen, auf denen Fackeln brannten – oder Lampen, die wie Fackeln aussehen sollten. Am offenen Tor wartete ein Wärter. Das Einzige, was man in der Dunkelheit von ihm sah, waren die weißen Handschuhe, mit denen er winkte und die Richtung andeutete, in der das Haupthaus wohl lag. Sie fuhren kilometerweit über frisch geharkten Kies, eine gewundene Straße, zu beiden Seiten eingefasst mit blühendem Lavendel. Manchmal, in einer Kurve, erfasste der Scheinwerfer die kugelrunde Krone eines Orangenbaumes. Dann kamen sie an eine zweite Mauer mit einer Balustrade aus hellen Sandsteinsäulen und Terrakottatöpfen mit Buchsbäumen in Pyramidenform. Dahinter ragte die Fassade eines zweistöckigen Wohnhauses auf, siena-rot, von Scheinwerfern angestrahlt. Ein weiterer Hausangestellter, ebenfalls in weißen Handschuhen, wartete am Fuß einer breiten Treppe.
»Das ist ja bizarr«, murmelte Johanna.
Colin lächelte. »Wir hätten den Dienstboteneingang nehmen sollen«, sagte er. Sie grinsten sich verlegen an.
Colin war es, der sie an den Leguan erinnerte. Johanna hatte ihn vollkommen vergessen, da auf der Rückbank, reglos in seiner Holzkiste. Er wollte die Kiste aus dem Wagen heben, aber der Diener hatte schon weiteres Personal herbeigewinkt. So trug ein Mädchen in hellblauem Kleid und leuchtend weißer Schürze Johannas Koffer, während ein älterer Diener sich mit Colins Sachen beschäftigte. Ein dritter folgte ihnen, die Holzkiste in den ausgestreckten Händen, als sei es ein Schrein oder eine Schmuckschatulle.
»Ein bisschen wie die Heiligen Drei Könige, oder?«, flüsterte Colin ihr ins Ohr, als sie hinter den dreien die Steintreppen hinaufschritten.
In der Eingangshalle kam ihnen Debbie Beckham entgegen, lachend, mit ausgebreiteten Armen. Eine zierliche, auffallend blasse, blonde Person in einem hellen Hosenanzug. Sie hielt ein Whiskyglas in der Hand, in dem Eisstückchen verlockend klimperten.
»Ihr habt es also gefunden!« Debbie stellte das Glas ab, um die Arme auszubreiten und beide, erst Johanna, dann Colin, mit einer warmen Umarmung zu begrüßen. »Ich habe schon befürchtet, Sie würden gleich durchfahren nach Cape Town und mich in meinem Elend allein lassen!« Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, bevor sie Johanna küsste. Ihr Atem roch nach Whisky. »Was zuerst?«, fragte sie dann fröhlich. »Ein Drink? Oder eine schöne heiße Dusche?«
»Für mich weder noch«, sagte Colin. »Ich habe Johanna nur hier abgeliefert und bin praktisch schon wieder weg.« Er hob die Hände, aber irgendwie nur halbherzig, wie Johanna fand, und Debbie protestierte auch sofort. »Kommt überhaupt nicht infrage! Sie bleiben hier, mein Lieber!« Dabei legte sie den Arm um Johannas Schultern, als seien sie die besten Freundinnen. Sie lehnte ihren Kopf gegen Johannas Kopf, und für einen Augenblick dachte Johanna, das tut sie nur, damit Colin sieht, wie zart und hell sie ist, und wie grob und dunkel ich bin. Sie spürte einen leisen Stich.
»Sagen Sie Ihrem Freund, dass es ganz unhöflich wäre, wenn er uns so einfach verlässt, Johanna! Sagen Sie ihm«, sie ließ Colin nicht aus den Augen, während sie zu Johanna sprach, »dass sein Zimmer schon vorbereitet ist. Das Bett aufgedeckt, das Bad für eine ausgiebige Dusche hergerichtet, und wenn er ein frisches Hemd braucht, dann soll er nur seine Kragenweite sagen. Unser Haus ist auf alles vorbereitet.«
Colin verbeugte sich. Er steckte die Hände in die Hosentaschen, und als er aufschaute, blinzelte er Johanna zu.
»Entscheiden Sie, Johanna.«
»Ich? Wieso ich?«
»Sie entscheiden«, beharrte Colin.
Debbie strahlte Johanna an. »Na?«
Und Johanna sagte, was sie bereits eine Weile lang dachte: »Ich fände es schön, wenn Sie bleiben.«