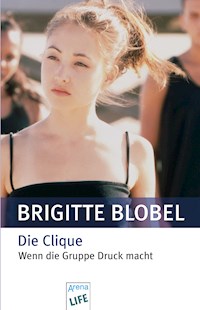4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mallorca in der Hitze des Sommers: Eine Traumhochzeit ist das gesellschaftliche Ereignis des Jahres. Ysabel, die einzige Tochter aus dem Clan der Villalongas, und Felipe, der Sohn des mächtigen Anwalts Jaume Sureda, wollen sich das Jawort geben. Aber es kommt zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein alter Mann verschafft sich Zuritt in die Hochzeitskapelle und schleudert den Anwesenden Worte des Hasses entgegen: „An euren Händen klebt Blut! Eine Mörderbande seid ihr!“ Als der letzte Orgelton verklingt, ist der Alte tot. Dennoch feiert die Gesellschaft, trunken von Prunk und Glanz, als wäre nichts geschehen. Doch die dunkle Vergangenheit des spanischen Bürgerkriegs bricht wieder auf. Die Schuld der Väter ist noch nicht beglichen. Die Liebenden, Felipe und Ysabel, geraten in einen Sog aus Intrigen, Lügen und Familienfehden, der ihr Leben dramatisch verändert. Und nicht zuletzt auch ihre Gefühle füreinander. Brigitte Blobel hat einen wunderbaren kraftvollen Roman geschrieben, voller Leidenschaft und einer Atmosphäre, die den Leser in Atem hält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Brigitte Blobel
Die Liebenden von Son Rafal
Roman
Für Lobo
Alonso
An diesem Morgen, der wie alle anderen Tage mit einem Seidenhimmel und vollkommener Windstille beginnt, möchte Alonso wetten, dass er noch hundert wird. In der heiligen Stunde des Sonnenaufgangs hält er alles für möglich. Die Welt ist nur für ihn da. Die Gasse schläft, für ihn allein der Tau auf den Oleanderbüschen, die sich durch die Gitterstäbe des Balkons auf der anderen Straßenseite drängen, für ihn allein der Gesang der Vögel, die süße Fäulnis von überreifen Kakifrüchten, der Teergeruch, den er aus der Ferne, vom Hafen zu riechen meint. Die Schönheit verschlossener Persianas in altem Mauerwerk, Stromleitungen, die wie gebündelte Seile an den Fassaden entlangführen, die blasse Sommerfarbe des Himmels, alles nur für ihn, den Alten auf dem Korbstuhl in der Carrer Font Agustín in einem Altstadtviertel von Palma im letzten Sommer des Jahrtausends. Er lehnt den Kopf zurück und fixiert die Madonnenstatue im dritten Stock des Hauses Nr. 25, das seiner Wohnung gegenüberliegt. Eine goldene Madonna in einer Nische, die man aus den Steinen herausgehauen hat. Wenn der erste Sonnenstrahl die Stola der Madonna berührt, entrinnt seiner Brust ein Seufzer. Und er lächelt. Dabei ist er kein gläubiger Mensch, läuft nicht in Kirchen, um zu beten oder für seine Sünden um Verzeihung zu bitten. Wenn er glaubte, es würde helfen, hätte er es längst getan, vor Jahren schon, Jahrzehnten.
Seine rechte Hand streichelt die Hündin, die wie jeden frühen Morgen neben seinem Korbstuhl schläft. Das tut sie schon seit mindestens vierzehn Jahren, die Sommernächte neben ihrem Herrn draußen in der Gasse, von den wenigen Stunden abgesehen, die der Alte in seinem Bett in der Wohnung im zweiten Stock verbringt. Aber im Sommer ist die Wohnung, im Winter kalt und feucht, für ihn zu heiß. Und das Bett zu groß für einen kleinen, alten, einsamen Mann. Lieber schleppt er den Stuhl die zwei Stockwerke hinunter auf die Gasse.
Der Korbstuhl, eigentlich ein Schaukelstuhl, der nicht schaukeln kann, ist von der Sonne gebleicht und von den heftigen Herbstregen, die es vor vielen Jahren einmal gab, aus der Form geraten. Aber der Alte liebt diesen Stuhl wie sonst nichts in seiner Wohnung. Der Kamerad der stillen Nächte in seiner Gasse. Carrer Font Agustín Nr. 22. Da wohnt er, seit fünfzig Jahren. Hier kennt er jeden Pflasterstein, jede schmiedeeiserne Balustrade, er könnte im Schlaf die Schilder über den Ateliers der Handwerker malen, Alfarería (Töpferei), Fontanería (Klempnerei), Electricista (Elektriker).
Alonso hat eine Körperhaltung für diesen Stuhl entwickelt, die ihm größtmögliche Behaglichkeit verschafft. Der Kopf ruht zwischen den Schultern wie in einer Mulde, die Beine leicht gespreizt, sodass er die Gicht in den Knien nicht spürt, der Bauch vorgewölbt, um dem Magen genug Raum zum Verdauen zu schaffen, die rechte Hand streichelt das Fell der Hündin, die neben ihm döst. Um die lästigen Fliegen zu vermeiden, hat sie die Ohren über Augen und Schnauze geklappt, gleichgültig gegen die Schönheit des heranbrechenden Tages.
Die andere Hand des Alten streicht über die Melonen, kühl und glatt, die Manuel, der Gemüsehändler, genau neben seinem Korbstuhl in einer Schubkarre abgestellt hat, noch bevor er auf den Markt gefahren ist, um frisches Gemüse und Obst für den Tag zu kaufen. Sobald er bemerkt, dass Alonso seinen Korbstuhl vor die Haustür schleppt, kommt er schon mit der Schubkarre. Manuel ist zwanzig Jahre jünger als Alonso, der im nächsten Jahr seinen 85. Geburtstag feiern wird, auch er hat weißes Haar und einen Schnurrbart, den er pflegt wie sonst nichts.
Obgleich er geizig und voller Misstrauen gegen die Ehrlichkeit der Nachbarn ist, überlässt Manuel es dem Alten, die Melonen zu bewachen. Alonso hat ihm einmal erklärt, dass ihn an diesen Früchten nur die Form, die Beschaffenheit der Schale und ihre sanfte Kühle reizt: Den Geschmack einer Melone hält er für vollkommen überbewertet. Denn eine Melone, so Alonso, schmeckt wie Wasser, in das man zwei Spritzer Kakisaft gegeben hat.
So, beide Hände angenehm beschäftigt, begrüßt Alonso jeden neuen Tag. Er seufzt, wenn die goldene Madonna aufleuchtet, er begrüßt feierlich den ersten Sonnenstrahl, der auf die Spitzen der Yuccapalme oben im Dachgarten des Hauses Nr. 23 fällt, bevor der gleiche Strahl die Geranienblüten auf dem tiefer liegenden Balkon aus ihrer Trägheit weckt.
Die Sonne, denkt Alonso, ist ein Maler, der einen goldenen Pinsel in der Hand hält. Das Fell der Katze, die zwischen Kräutertöpfen auf dem Fenstersims schläft, leuchtet wie die Batterie leerer Weingläser nebenan. Wenn das Licht schon fast das Pflaster der Gasse erreicht hat und die Temperatur um mindestens fünf Grad gestiegen ist, wird der erste Fensterladen aufgestoßen, und immer sind es die dunkelgrünen Persianas vor dem Schlafzimmer der Nadal-Witwe. Es ist der einzige Augenblick des Tages, an dem man diese Frau, die einmal zu den Schönsten des Viertels gehört hat, in einem Kleidungsstück sehen kann, das nicht schwarz ist. Jolanda trägt morgens, wenn sie sich gewaschen, aber noch nicht frisiert hat, einen Kimono aus grüner Seide. Vielleicht das letzte Geschenk ihres Mannes, der sein Leben mit Reisen verbracht hat, ohne seine Frau ein einziges Mal zu bitten, ihn zu begleiten.
Alonso schließt die Augen zu einem Spalt, sodass die misstrauische Witwe meinen könnte, er schliefe, oder dass er geblendet werde von der Sonne, die in diesem Augenblick sein Gesicht mit dem goldenen Pinselstrich trifft. Denn jetzt beginnt die Nadal-Witwe vor der offenen Balkontür mit ihren Freiübungen. Züchtige Übungen, ein bisschen Kniebeugen und Armekreisen, aber dennoch. Alonso ist mit seinen über achtzig Jahren in einem Alter, wo auch sechzigjährige Witwen in manchen Augenblicken begehrenswert erscheinen.
Da schiebt Bautisata, der Panadero, die eisernen Rollos vor seiner Bäckerei hoch, und wie jeden Morgen verbarrikadiert die Witwe wieder die Balkontüren, als müsse sie immer noch ihre Unschuld hüten.
Dabei kommt jetzt das Schönste: der süße Hefegeruch der Ensaimadas (Blätterteiggebäck aus Mallorca), der auch die Hündin an Alonsos Seite aus ihrem Schlummer weckt. Sie hebt den Kopf, schlägt die Ohren zurück, schaut zu ihrem Herrn hoch und wedelt mit dem staubigen Schwanz. Alonso beugt sich zu der Hündin, ohne jedoch das Streicheln der Melonen für einen einzigen Augenblick zu unterbrechen.
»Schau dir die Welt an, Putanita«, sagt er, »wie schön das alles ist. Schau es dir an, bevor die Gasse sich mit widerlichem Volk füllt. Schau dir so viel Schönheit an, mein Hürchen. Und sei dankbar, dass wir das sehen dürfen.«
Die Hündin wedelt etwas heftiger und legt den Kopf schief, um zu zeigen, dass sie an jedem Wort ihres Herrn interessiert ist. Sie wedelt, als wisse sie, welche Schönheit der Alte meint: Es ist die Schönheit der Friseurgehilfin Magdalena, die im ersten Stock des gegenüberliegenden Hauses lebt, nicht hinter dunkelgrünen, sondern als einzige Bewohnerin der Carrer Font Agustín hinter himmelblauen Persianas. Und es ist der einzige Balkon, der von sich sagen kann: Auf mir wächst eine Dattelpalme. Nicht ein einziges Mal hat sie Früchte getragen, aber das ist kein Wunder. Denn warum sollten die Insekten mit dem Blütenstaub der Dattelpalme sich hier in diese Gasse mitten in der Altstadt von Palma verirren, nur um der Palme auf dem Balkon der Friseurgehilfin Magdalena einen Gefallen zu tun. Datteln gibt es im Supermarkt, auf dem Mittwochsmarkt auf der Plaza Europa, Datteln gibt es bei dem geizigen Gemüsehändler, der genau gegenüber wohnt. Man kann eine Dattelpalme auch verehren, wenn sie keine Früchte trägt, dafür jedoch auf einem Balkon wächst, der viel zu klein für sie ist. Inzwischen verdunkelt ihre Krone bereits die Fenster im dritten Stock, und bald wird sie über die Dächer aller Häuser der Gasse Font Agustín hinausgewachsen sein.
Und es gibt bereits eine Bürgerinitiative, die das Halten von Palmen auf Balkonen verbieten will, aus Sicherheitsgründen. Denn jeden Augenblick kann der Balkon mit der Palme in die Tiefe stürzen, und wer weiß, welche Katastrophen das nach sich zieht.
Aber das stört die schöne Magdalena nicht. Hingebungsvoll hackt sie jeden Morgen mit einem kleinen Spatel die Erde auf, bevor sie die Palme gießt. In einem hauchdünnen Sommerkleidchen beugt sie sich dabei so weit vor, so selbstvergessen, dass Alonsos Finger tatsächlich für einen Augenblick das Streicheln der Melonen vergessen …
In diesem wohligen Dämmerzustand zwischen Träumen und Wachen empfängt Alonso also jeden neuen Tag wie ein Geschenk. Eine Versöhnung. Ein Trost für alles Gewesene und Vergangene. Als Entschädigung für das im Leben Versäumte. Und es ist ihm, als könne so ein Leben niemals aufhören.
Wenig später zerreißt das Knattern einer Vespa die Zeit der schönen Träume. Teresa, die jeden Montag kommt, um seine Wohnung zu putzen, die Wäsche zu waschen und ihm das Leben schwer zu machen mit ihren Vorhaltungen. Was weiß ein junges Kind wie sie schon über das Leben im Alter. Was hat es sie zu kümmern, ob er im Bett raucht oder wo er die Weinflaschen aufbewahrt. Wenn er es für praktisch hält, eben im Kleiderschrank.
Heute hat der Fahrtwind Teresas Rock über den Knien hochfliegen lassen, und ihre Schenkel leuchten weiß. Die Hündin, die ihre Abneigung gegen Teresa mit Alonso teilt, knurrt leise. Mehr ein Grummeln als ein Knurren, mehr um Alonsos grimmes Lachen herauszufordern denn als wirkliche Warnung.
Teresa stellt ihre Vespa an der Hauswand ab und nimmt von dem Hund keine Notiz. Sie hebt das Körbchen vom Gepäckträger, Wäsche, frisch gewaschen und gebügelt, eingeschlagen in einem Tuch. Daneben Putzmittel, die sie unentwegt von seinem Geld anschafft, obgleich sie weiß, dass er ebenso wie die Hündin den Geruch von Lauge, Seife und Scheuerpulver nicht vertragen kann.
»Bom dia, Señor Alonso. Das ist eine Hitze, was? Ich habe heute Nacht kein Auge zugemacht. Wie in einem Backofen, habe ich meinem Jorge gesagt, ist es im Haus. Wie in einem Backofen. Die Bettwäsche habe ich nicht geschafft, in der Hitze die großen Stücke bügeln, das ist einfach zu viel, verstehen Sie, da läuft einem der Schweiß zwischen den Brüsten runter.«
Alonso streckt die Beine, bewegt die Zehen und wartet, dass das Blut zirkuliert. Dann rollt er sich etwas zur Seite und gräbt in der Hosentasche nach dem Wohnungsschlüssel.
»Heute werde ich mich gründlich mit der Küche beschäftigen, Señor Alonso.« Teresas Stimme vibriert vor Tatendrang, trotz der Hitze.
Alonso nickt ergeben. Was immer er gegen eine Generalreinigung der Küche einzuwenden hätte: Teresa würde es trotzdem genau so machen, wie sie es sich vorgenommen hat. Manchmal scheint es Alonso wie eine Strafe Gottes, dass er immer von Frauen umgeben ist, die sich nur mit der Kommandosprache des Militärs verständigen. Alonso erlaubt sich die Ansicht, dass alles Militärische Männersache zu sein hat. Und dann ist es in Ordnung. Aber Frauen, die Männer herumkommandieren, sind etwas äußerst Unangenehmes. Eigentlich kennt Alonso nur eine Sorte Frauen, die noch fürchterlicher sind: und das sind Frauen, die ihre Männer einfach wegschicken. Weg aus ihrem Leben. Die irgendwann genug davon haben, mit ihrem Mann weiter Tisch und Bett und Badezimmer zu teilen. Die einfach sagen: Es reicht. Verschwinde aus meinem Leben. Sieh zu, wie du allein zurechtkommst. Aber an diese große Erniedrigung seines Lebens will Alonso so früh an diesem verheißungsvollen Morgen nicht denken.
Stattdessen wird seine Aufmerksamkeit gefangen von einem Fremden in kurzer Hose und formlosem Polohemd, der eine Kamera vor dem Bauch trägt und ehrfürchtig, fast andächtig die Gasse betritt. Er schaut nach rechts, nach links, betrachtet die Bäckerei, den Balkon mit Magdalenas Palme, die goldene Madonna unter dem Dachfirst im dritten Stock des Hauses Nr. 25. Alonso auf seinem Korbstuhl, der nicht schaukeln kann, die Hündin, die Schubkarre mit den Melonen, die Zöpfe aus getrockneten Pimientos, frischem Knoblauch, Tomaten fürs Pa’amb Oli (Brot mit Olivenöl, Knoblauch und Tomaten), grüne, frische Pimientos, scharlachrote Paprika in der Form eines Schnabelschuhs. Auberginen, groß wie Rugbybälle, Kürbisse, Zucchini, Artischocken, Kapern in Körbchen, getrocknete Aprikosen, frische Aprikosen und Aprikosenkonfitüre, welche die Frau des Gemüsehändlers in ihren schlaflosen Nächten auf dem heimischen Küchenherd kocht.
Der Fremde in der kurzen Hose fotografiert alles, ohne zu fragen. Ohne jemanden zu grüßen. Er hält seine Kamera vor die Augen, weicht zwei Schritte von Alonso zurück, dann noch einen, noch einen, bis er sich an dem Fenstersims des Hauses Nr. 25 den Hinterkopf schlägt. Alonso lacht grimmig, greift nach seinem krummen Stock aus Olivenholz, klopft auf die Schenkel und sagt: »Zeit fürs Frühstück, Putanita.«
Bevor der Fremde abdrücken kann, hat sich Alonso mit erstaunlicher Geschicklichkeit aus dem tiefen Stuhl erhoben, die Lehne gepackt und den Stuhl hinter sich her in den Hauseingang gezogen.
Er wartet hinter der Tür, bis der Fremde weitergegangen ist. Dann pfeift er nach seinem Hund und geht in entgegengesetzter Richtung davon.
Das Barrio, in dem Alonso seit fünfzig Jahren wohnt, gehört nicht zu den Vierteln der Altstadt, welche in Reiseführern angepriesen werden. Hier ist man noch verschont von Touristen. Auch wenn manche Trödler und Töpfer und Verkäufer von Souvenirs das bedauern mögen, ebenso wie der Maler im Haus Nr. 17, der seine Bilder jeden Abend auf die Gasse hinunterträgt und sie, an den Häuserfassaden angelehnt, zum Verkauf anbietet. Er müsste in eine andere Gegend ziehen.
Alonso, der viel Zeit hat, die Fremden zu beobachten, weiß, was sie suchen: das andere Mallorca, das andere Palma, jenes, welches sie aus den Reiseprospekten kennen. Gassen mit malerischen Trödlerläden, in denen man geflochtene Körbe, gusseiserne Straßenlaternen und Keramikgeschirr kaufen kann. Balkone, auf denen es üppig blüht: Oleander und Geranien in Hülle und Fülle, manchmal der betäubende Duft von Küchenkräutern, und dann wieder Leinen mit zarter Wäsche, geöffnete Fenster, hinter denen sich ein Leben abspielt, das die Touristen sich ausmalen, aber nicht wirklich sehen können. Sie stellen sich sowieso immer das Falsche vor: Huren – gekleidet wie Flamenco-Tänzerinnen – bei der Morgentoilette, Hausfrauen im Streit mit dem Dienstmädchen, oder Familienväter, die Wäscherin begrapschend, die sich über einen Trog mit duftender Lauge beugt. Mädchen mit flachen Brüsten, die von einer Karriere beim Film träumen, während ihre nackten Füße über den Steinboden fliegen.
Hier verfolgen alte Männer am Transistor-Radio politische Sendungen in katalanischer Sprache. Auch diese Bars betreten die Touristen nicht. Sie sind ihnen zu schmutzig, zu vulgär, Neon-Lampen, die Tische aus Kunststoff, die Stühle aus Plastik, die Kellnerinnen verhärmt, das Spülwasser hinter der Theke wird nur einmal täglich erneuert, die Biergläser sind stumpf. Es ist nicht das richtige Mallorca. Die Tapas, die kleinen Vorspeisen, die man zu einer Copa di Vino oder einem Fino (trockener Sherry) bestellt, Otifarra (mit Zimt gewürzte Schweineblutwurst), Albigondas (Fleischbällchen mit Majoran), Calamares oder Bolets (Pilze) würde ein Beamter der Gesundheitsbehörde sofort beschlagnahmen, käme er je auf die Idee, diese Gasse aufzusuchen. Kein Priester kommt mehr vorbei, seit die Església de Nostra Senyora wegen Einsturzgefahr gesperrt wurde. Jetzt muss in dieser Gasse niemand mehr auf irgendwen oder irgendwas Rücksicht nehmen.
Noch sind fast alle Persianas verschlossen, sodass die zwei- und dreistöckigen Häuser rechts und links der Gasse einen abweisenden, ja verlassenen Eindruck machen. Nur aus einem der Fenster dringt Rap-Musik, ein hämmernder, monotoner Rhythmus, den Alonsos Krückstock sofort aufnimmt. Die Musik geht vom Stock in beide Beine. Normalerweise zieht er das rechte Bein nach, heute sieht man davon nichts. Im vorletzten Winter hat ein Zechbruder im Rausch einen Stuhl auf seinem Knie zerschlagen.
Es ist elf Uhr vormittags, und pünktlich setzt der Wind aus der Serra de Tramuntana ein. Er wirbelt Papierfetzen und Plastiktüten zwischen Hauswänden, Laternen und Balkongittern hin und her, der Staub tanzt im Sonnenlicht, die Quecksilbersäule steigt beständig, aber Alonso spürt an diesem Tag nicht den Feuerball hinter seiner Stirn. Seine Laune steigt. Er macht Pläne für den Tag. Er wird nach dem Cortado (Kaffee mit wenig Milch) und nachdem er seinen Hund mit dem Würfelzucker gefüttert hat, den es dort gratis gibt, ans Meer hinuntergehen. Vielleicht kann er sich dem einen oder anderen Touristen als Führer durch die Kathedrale La Seu anbieten. Eine der vollkommensten und großartigsten Kathedralen der Welt. So steht es geschrieben, und genau so wird Alonso diese Kirche auch erklären: als großartiges und vollkommenes Meisterwerk, an dem seine Vorfahren mitgewirkt haben. Natürlich wird niemand ihm glauben.
Alonso wendet sich zweimal um. Das erste Mal, um sicher zu sein, dass Teresa die Persianas vor der Haustür wieder verschlossen hat, das zweite Mal, als er hinter sich die Rufe eines Zeitungsverkäufers hört. Der Junge brüllt die Schlagzeilen des Tages hinauf zu den geschlossenen Fenstern der schmalen Gasse, wie jeden Vormittag. An einigen der Häuser läuft er schnell vorbei, bei anderen nimmt er sich Zeit. Bleibt sogar manchmal erwartungsvoll stehen.
»Última Hora! Mallorca dieses Wochenende Treffpunkt des internationalen Jetsets! Die Hochzeit des Jahres!
Ysabel Pilar de Villalonga y Duquesa de Sa Carrotxa und Felipe Ramón, der Sohn des Königlichen Anwalts Don Jaume Sureda! Das Traumpaar des Jahres! Lesen Sie alles über Mallorcas große Familien, das große Geld, das Leben der Reichen und Schönen!«
Alonso bleibt stehen. Er winkt dem Zeitungsjungen zu. »Was brüllst du da?«
Der Verkäufer nimmt von ihm keine Notiz, denn oben im zweiten Stock des Hauses Nr. 9, eines Hauses mit einem runden Torbogen aus Marés-Steinen, in den Tierköpfe gemeißelt sind, fliegen die Fenster auf. Eine Frau, den Kopf voller Lockenwickler, beugt sich heraus. »Wer heiratet?«
»Die Villalongas verheiraten sich mit dem Sohn des Millionärs Don Jaume Sureda!«
Die Frau lacht bitter. »Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, was?« Sie knallt das Fenster wieder zu.
»Hey!« Alonso schlurft zu dem Zeitungsjungen zurück. Er schlägt mit der Krücke auf den Zeitungsstapel, den der Junge unter dem Arm trägt. »Was kostet es, wenn man in deine Zeitung nur mal reinschauen will?«
Der Zeitungsjunge, ein schmaler, vielleicht fünfzehn- oder sechzehnjähriger Junge, lässt seinen abschätzenden Blick über die Gestalt vor ihm gleiten. »Hundert Peseten«, sagt er.
»Hundert Peseten? Ich will die Zeitung nicht kaufen, Bursche, ich will nur diese Geschichte da auf Seite eins kurz überfliegen!«
»Ich verleihe keine Zeitungen. Ich verkaufe sie.« Der Junge schiebt den Alten zur Seite und ruft: »Alles über die Hochzeit des Jahres! Die Partido Nacional kündigt neue Gesetze an! Grausiger Mord in Arenal! Última Hora!«
Alonso folgt dem Jungen die Gasse hinunter. Die Sonne steht im Osten, und er hat seinen Hut vergessen. Das Licht blendet ihn.
»Warte! Ich kaufe sie dir ab! Halt an, Bursche!« Er muss sich heiser schreien, bis der Zeitungsverkäufer tatsächlich stehen bleibt. Aber nur, um der Friseurgehilfin, die seit langem von einem reichen Bräutigam träumt, eine Zeitung zu verkaufen. Endlich, als er lässig die Münzen in seine Hosentasche gleiten lässt, dreht er sich noch einmal zu Alonso um. »Du hast kein Geld«, sagt er. »Ich verhandle nicht mit Leuten, die pleite sind.«
»Was? Ich habe kein Geld? Wie kommst du darauf, du Rotznase?«, schreit Alonso.
»Du stinkst, arme Leute stinken immer.« Der Bursche rennt lachend davon. »Das kann ich mit meiner Rotznase riechen.«
Der Alte schleudert ihm seinen Krückstock hinterher. »Weißt du überhaupt, mit wem du redest, Bastard?«, schreit er. Seine Stimmbänder sind rau wie Schmirgelpapier. Er leidet seit Monaten unter einem Katarrh der Luftwege. Er muss sich an den Häuserwänden abstützen, als er weitergeht. Sein Stock ist in einer Pfütze aus Schmieröl gelandet. Er bückt sich ächzend, um mit seinen gichtigen Händen den Griff zu erfassen, wischt ihn an seiner Hose ab und macht mitten in der Gasse kehrt.
»Margalida Pilar de Villalonga«, knurrt er. »Du stinkst auch. Selbst wenn du dich mit französischer Seife wäschst. Ihr alle stinkt. Und du, Pepe, halt deine Nase in deine Achsel und versuch, nicht das Gesicht zu verziehen von dem Aasgeruch!«
Jeden Morgen der gleiche Weg durch die Gasse hinunter zum Passeig Maritim. Vorbei an den Booten, den Fischern, die zwischen den Palmen der Promenade ihre Netze ausbreiten, an den Parkplätzen, wo eine neue, junge Generation kleiner Gangster auf eine günstige Gelegenheit wartet, die abgestellten Autos auszuplündern. Alonso kann es ihnen an der Nasenspitze ansehen, was sie vorhaben. Er knurrt sie an, manchmal wirft er seinen Stock nach ihnen. Aber sie lachen ihn aus, springen behänd über die Abgrenzungen und verschwinden unten am Pier. Jede Woche werden es mehr. Alonso hat irgendwann aufgehört, sich ihre Namen und ihre Gesichter zu merken.
Die Hündin kneift feige den Schwanz ein, als er an Gruppen junger Männer in saloppen Anzügen und zu dunklen Sonnenbrillen vorbeihumpelt.
»Sie nehmen uns die Stadt weg, Putanita«, knurrt der Alte. »Sie nehmen uns alles weg. Irgendwann gehört uns hier nichts mehr.«
Es ist Anfang des Sommers. Der letzte Sommer des Jahrtausends. Das meteorologische Institut von Porto Pí verspricht einen langen und heißen Sommer. Das ist einfach, denn die Sommer auf Mallorca sind immer lang und heiß. Aber was es bedeutet, wenn das meteorologische Institut, das sich immer irrt, das Selbstverständliche verspricht, gehört zu den Mysterien, die Alonso nie begreifen wird.
Es ist elf Uhr vormittags, die Touristen in ihren Hotelburgen haben sich an den Frühstücksbüffets satt gefressen und streben an die Strände oder in die Strandbars, Busunternehmen karren neugieriges Volk über die Insel, an andere Strände, in die Berge oder zu den alten Windmühlen, den Grotten, den Weinkellern, den Keramik-Fabriken, den Manufakturen von Mallorca-Perlen. Notare beurkunden den Verkauf von Hunderten Quarteradas Land an einem Vormittag. Land, das über Jahrhunderte den Mallorquinern gehörte, Weideland, Ackerland, Strand, Felsenklippen und Buchten. Land, auf dem im Februar die Mandelbäume blühen, ein Jahrtausend lang, und Aprikosenbäume, deren Früchte im Juni auf Steinmauern trocknen. Land, auf dem schwarze Schweine Feigen fressen, schlafen und sich paaren. Land für die Schafherden, die Ziegen, die Taxifahrer, Köche und Zimmermädchen, vererbt von einer Generation auf die nächste. Hunderte Quarteradas Land verscherbelt an einem Tag, oder noch mehr, wer weiß das schon.
Alonso humpelt weiter zum Camp del Mar. An der Ampel klopft er mit dem Stock gegen das Hosenbein. Eine Aufforderung an die Hündin, ganz nah heranzukommen. Er bückt sich, packt die Hündin am Nackenfell und flüstert: »Hochzeit bei den Villalongas. Wie findest du das?« Er kichert, und dabei füllen sich seine von Alkohol und anderen Drogen geröteten Augen mit Tränen. »Wir lassen sie hochgehen, meine Schöne, das schwör ich dir bei dem größten Hammelknochen, den es auf dieser verdammten Insel je zu fressen gab.« Er gibt dem Tier einen Schubs, die Ampel springt auf Grün, die Hündin wetzt über den glühenden Asphalt und bleibt auf dem kleinen Rasenstück auf der anderen Straßenseite stehen, um auf ihren Herrn zu warten.
Trotzig wischt der Alte die Tränen weg, wirft den Kopf in den Nacken und überquert die Straße wie einer, dem die Welt noch zu gehorchen hat: den Krückstock wie eine Lanze nach vorn gerichtet, den Kopf mit dem schlohweißen Haar weit in den Nacken gelegt, das Kinn gereckt, der Adamsapfel groß wie eine reife Feige.
Fast immer halten die Autofahrer voller Respekt oder Verwunderung.
Der Alte tut, als merke er nicht, wie das Toben und Brodeln der Stadt ganz plötzlich, für eine einzige Sekunde, innehält. Denn das ist der letzte Respekt, den er von dieser Stadt, von dieser Insel, die seiner Familie Wohlstand und Ansehen verdankt, erwarten kann.
Ysabel
Ysabel Pilar de Villalonga sind gewisse Dinge immer schon peinlich gewesen. Man sitzt einfach nicht mit einem welkenden Moosröschenstrauß auf dem Schoß auf dem Mittelplatz in der Economyclass. Besonders dann nicht, wenn man auf dem Weg zur eigenen Hochzeit ist.
Jessica hat ihr diesen Blumenstrauß beim Abflug einfach in die Hand gedrückt, und Jessica ist ihre beste Freundin. Es ist ihre eigene Entscheidung gewesen, das Businessclass-Ticket, das die Eltern ihr geschickt hatten, im Büro der British Airways auf einen Economy-Flug umschreiben und sich den Betrag in bar auszahlen zu lassen. Es war exakt der Betrag, der für Felipes Hochzeitsgeschenk noch fehlte. Es hatte sie mit einigem Stolz erfüllt, dass sie das Geld schließlich doch noch zusammenbekommen hat, ohne irgendjemanden in der Familie oder im Freundeskreis anzupumpen.
Die Businessclass ist ausgebucht von Männern, die alle ähnlich langweilige Anzüge und fantasielose Krawatten tragen. Die Hemden natürlich makellos. Sie tragen Aktentaschen und Laptops und kennen sich offenbar alle. Ysabel vermutet, dass es sich um Politiker handelt, vielleicht Repräsentanten der EU, die in Palma einen Kongress abhalten wollen. Seit Palma wie eine schaumgeborene Meerjungfrau von Jahr zu Jahr immer schöner und strahlender wird, hat man im Ausland die Stadt als idealen Ort für Kongresse entdeckt.
Ihr Nachbar, der den Gangplatz hat, gehört höchstwahrscheinlich auch dazu. Der gleiche Anzug (er hat das Sakko, damit es keine Falten wirft, an den Halteknopf des Vordersitzes gehängt), die gleiche fahle Gesichtsfarbe. Er blättert in Akten. Als sie ihn verstohlen mustert, schaut er von den Papieren auf. »Schöne Blumen«, sagt er.
»Ich muss zu einer Hochzeit. Ich weiß, es sieht ein bisschen lächerlich aus, im Flugzeug mit Blumen auf dem Schoß.«
»Wieso? Es ist nett«, sagt ihr Nachbar, »netter als so was hier.« Er deutet auf seine Akten. »Aber man erwartet von mir, dass ich das alles vor der Landung gelesen habe. Und verstanden.« Er konzentriert sich wieder auf die Papiere. Bis zur Landung, denkt Ysabel erleichtert, wird er nichts mehr sagen.
Sie versucht, von Felipe zu träumen. Aber es gelingt ihr nicht. Sie ist zu aufgeregt. In den letzten Wochen hat sie sich manchmal wie im Schleudergang einer Waschmaschine gefühlt. Ein Leben im Schnelldurchlauf. An einem einzigen Tag musste sie oft mehr Entscheidungen treffen als sonst in einem Monat. Der Text für die Hochzeitsanzeigen, die Trauringe, die Gästeliste, die Wunschliste für Hochzeitsgeschenke, die Wahl der Trauzeugen, der Blumenmädchen, ihr Geschenk für Felipe, die Hochzeitsreise (nach Mexiko!!!). Und das alles genau zu dem Zeitpunkt der wichtigsten Prüfungen.
Schriftliche Prüfung im Aktienrecht, mündliches Examen über Vor- und Nachteile von Rentenfonds, ein Referat vor der englisch-spanischen Handelsgesellschaft über Doppelbesteuerung. Zur gleichen Zeit musste ihre Bewerbungsmappe fertig sein.
Jetzt, mit dem Moosröschenstrauß im Schoß, fragt sie sich, wie sie das alles bewältigt hat, ohne den Verstand zu verlieren. Im Augenblick befindet sich ihre Examensarbeit in der Druckerei Jeffry & Oerkins in der Downhill Road zum Binden. Erst in der Nacht ist ihr eingefallen, dass sie die Arbeit irgendjemandem widmen muss. Jessica musste sie eine Stunde früher abholen, um den Umweg über die Downhill Road zu machen.
»Meinen Eltern, Margalida Pilar und Pepe Antonio de Villalonga, mit innigstem Dank und ewiger Liebe. Ysabel.«
Es war einfach ihre Pflicht, den Eltern das Werk zu widmen. Sie hatten schließlich vier Jahre lang die Studiengebühren am Economic Institute in London bezahlt, die Wohnung im Rainbow House in Mayfair, ihre Kleider, ihr Essen, die Drinks abends im Pub, die Wochenend-Picknicks in den Yorkshire Heights, die Monatskarte für die Underground, die Bibliothek, das Abonnement für das Fitnesscenter und den Pool im Dorset Hotel. Ach, eben alles. Ysabel hat es nicht geschafft wie Jessica, einen der begehrten Assistentenjobs am Institut zu bekommen. In einer Studentenkneipe zu kellnern, hat der Vater ihr verboten. Und zum ersten Mal im Leben – ganz erleichtert – hat sie den Eltern gehorcht. Für Dienstleistungsjobs bin ich nicht geschaffen, hat sie zu Felipe gesagt.
Felipe Ramón arbeitete während des Studiums (er hat sein Juraexamen vor drei Monaten bestanden) in einer befreundeten Kanzlei seines Vaters. Jemand wie Felipe würde überall auf der Welt einen Job in einer Rechtsanwaltskanzlei bekommen, denn sein Vater, der Starjurist Jaume Llorrenc Sureda, hat Verbindungen nach überallhin.
Ysabels Eltern hingegen sind nur mallorquinischer Landadel, nette und harmlose Leute, wie Ysabel immer sagt, die sich am liebsten nie von der Insel wegbewegen würden. Ihre Eltern interessieren sich nur für Menschen, die auch große Häuser und viel Land besitzen, die zum Jagen, zum Fischen und zum Segeln gehen, ihre Campesinos ausbeuten und – wenn sie Geld brauchen – die eine oder die andere Finca an vermögende Ausländer verkaufen.
Überhaupt sind ihre Eltern nur zwei- oder dreimal während der ganzen Studienzeit nach London gekommen. Papa kommt in der Stadt nicht zurecht, hat ihre Mutter immer wieder gesagt. Du kennst ihn doch, er fühlt sich nur wohl, wenn er auf seiner Insel ist. Woanders wird er krank.
Stell dir vor, er fängt jetzt wilde Ziegen mit dem Lasso, hat ihre Mutter gestern am Telefon erzählt, wusstest du das? Früher hat er sie geschossen. Zwei Jahre lang hat er mit dem Lasso geübt, jetzt kann er es. Wie die Bauern aus dem Dorf. Du glaubst nicht, wie stolz er darauf ist! Hoffentlich erzählt er nicht deinen Freundinnen davon. Sie werden in Ohnmacht fallen, wenn sie hören, was dein Vater für ein Mann ist.
Mamá, meine Freundinnen sind nicht aus Zucker, hat Ysabel geantwortet. Bislang haben alle Papá sehr charmant gefunden.
Charmant? Dein Vater und charmant? Das ist das Neueste, was ich höre, und ich bin dreißig Jahre mit ihm verheiratet …
Das Flugzeug dreht sich in die Landeschleife ein. Ysabel reckt den Hals. Unter der Tragfläche glitzert das Meer, tanzen Boote, schäumt es weiß gegen Felsklippen.
Dann eine weitere Kurve, und auf einmal ist der Puig de Alaró zum Greifen nah, ihr Lieblingsberg, dieser riesige, runde Knubbel, wie von einem Riesen gegen die hohen Berge der Tramuntana geschleudert, abgewaschen von Jahrmillionen, mit Erde bedeckt, die der Wind herübergetragen hat, angefüllt mit Kiefernsamen.
Und da, direkt über der blinkenden Tragfläche, genau in diesem Augenblick, als der Pilot das Flugzeug über die Nase ein bisschen absenkt zum Landeanflug, sieht sie es. Die lange Einfahrt, gesäumt von Palmen. Die hohe Mauer, hinter der die Olivenbaum-Plantagen beginnen. Das Viereck des ersten Innenhofs, es ist ihr fast, als könne sie die blauen Jakarandas sehen, vor dem Gebäude, drei Stockwerke hoch, mit Türmen und Erkern, warmer Stein im Vormittagslicht …
Sie zieht tief die Luft ein, lächelt. Der Nachbar, der eben auch aus dem Fenster gesehen hat, klappt seine Akten zu. »Schön?«, fragt er.
»Und wie«, seufzt Ysabel. »Das ist immer der schönste Augenblick, wenn ich Els Sant Castells vom Flugzeug aus sehen kann.«
»Els Sant Castells?« Der Nachbar schiebt mit dem Daumen die Brille nach oben und mustert sie neugierig. »Darf ich mich vorstellen. Mein Name ist Gordon Brown. Ich bin zum ersten Mal auf der Insel. Sie wohnen hier?«
»Da unten, mein Elternhaus«, sagt Ysabel. »Da unten. Wenn Sie zurückschauen. Diese lange Einfahrt mit den Palmen, auf dem Hügel vor diesem runden Berg. Sehen Sie? Dahinter, der weiße Ort, das ist Alaró. Aber das Gut, da leben meine Eltern.«
Der Nachbar beugt sich vor, blickt angestrengt hinaus, hebt die Schultern, schaut sie wieder an. »Els Sant Castells«, sagt er gedehnt, »davon habe ich gehört.«
Ysabel lacht. »Das ist bestimmt eine Verwechslung. Unser Gut ist nichts Besonderes. Das kennen nur die Einheimischen. Das gehört seit Generationen unserer Familie.«
Der Nachbar nimmt die Brille ab, klappt sie zusammen, steckt sie in die Jackentasche. »Els Sant Castells«, murmelt er, »ich bin fast sicher. Ein großes Stück Land, nicht wahr?«
»8000 Hektar«, sagt Ysabel stolz. »Die Hälfte davon Wald, der Rest Obstbau und Ackerland.«
»8000 Hektar«, der Nachbar drückt die Finger in die Augenhöhlen, eine Angewohnheit offenbar, die ihm das Erinnern erleichtert. »Wie merkwürdig. Es ist mir, als habe ich auch diese Zahl gehört. Sie sind sicher, dass Ihre Eltern diese Finca nicht zum Verkauf angeboten haben?«
Ysabel lacht. »Ganz sicher.«
»Auch nicht in letzter Zeit? Sagen wir, vor drei, vier Wochen?«
»Hören Sie«, sagt Ysabel, und ihre Stimme wird ein wenig schärfer, »ich bin wirklich ganz sicher. Auf dieser Finca werde ich am Sonnabend meine Hochzeit feiern. Ich habe jeden Tag mindestens ein halbes Dutzend Mal mit Mamá oder Papá telefoniert. Glauben Sie nicht, sie hätten mir davon erzählt?«
Der Nachbar mustert sie. Er lächelt. »Sie haben recht«, sagt er, »ganz sicher eine Verwechslung. Wie weit ist diese Finca Ihrer Eltern von der Hauptstadt entfernt?«
»Mit dem Auto vierzig Minuten«, sagt Ysabel.
»Ah, vierzig Minuten. Für einen Hubschrauber also höchstens ein Trip von fünf oder zehn Minuten.«
»Wir haben aber leider keinen Hubschrauberlandeplatz«, sagt Ysabel. »Und ich glaube auch nicht, dass meine Eltern mit dem Gedanken spielen, so etwas einzurichten.«
Der Nachbar nickt. Er blickt jetzt wieder angestrengt nach draußen, unter ihnen werden die Felder kleiner, die Häuser zahlreicher, man sieht Windmühlen und Schuppen, eine Schnellstraße, eine Autobahn, einen Steinbruch. Und dann wieder das Meer. Die Bucht von Palma.
Obwohl die Anschnallzeichen aufleuchten, steht ihr Nachbar noch einmal auf, macht sich oben im Gepäckfach zu schaffen. Sein Jackensaum streift ihr Gesicht. Ysabel lehnt sich zurück, den Blick unverwandt auf das Meer gerichtet, das Licht. Während sie dieses Meerblau und Himmelweiß in sich aufnimmt, kommt Ruhe in ihr Herz, in ihre Seele, in ihr Blut.
So war es immer gewesen, wenn sie diese Insel, auf der sie geboren ist und ihre Kindheit verbracht hat, endlich wieder erreicht hatte. Diese Momente des Landeanflugs sind die kostbarsten, die reinsten. Später vermischt sich wieder alles. Freude und Erschrecken, Glück und dunkle Erinnerungen. Jetzt aber ist das alles wunderbar: Schaumkronen auf dem Meer, tanzende Schiffe, eine weiße Küstenlinie, abgelöst von schroffen Felsen, rot das Land, weiße Dörfer, Windmühlen, Straßen, Kirchtürme, Weizenfelder, gelb und reif. Und immer wieder das Meer. Jetzt sind sie über der Bucht von Palma und drehen eine Kurve über der Insel Sa Dragonera, bevor sie über Andraitx Kurs auf den Flughafen von Son Sant Joan nehmen. Die Kathedrale so nah, dass man die Stützbögen zählen kann.
Ihre Mutter hätte es am liebsten, wenn die Hochzeit in dieser Kathedrale stattfinden würde, aber Felipes Vater meinte, es sei doch viel stilvoller, in der Familienkapelle auf ihrem Landsitz Els Sant Castells zu heiraten.
Ob sie Felipe überreden kann, sofort vom Flughafen ans Meer zu fahren? Ob sie sich noch ein bisschen Glück stehlen können, bevor die Hektik sie nicht mehr zum Atmen kommen lässt?
Seit Wochen arbeitet ihre Familie schon an den Vorbereitungen dieser Hochzeit. Jeden Tag hat ihre Mutter Faxe in ihre Londoner Wohnung geschickt. Der täglich wechselnde Stand der Gästeliste, das Menü, die Blumendekoration, der Fragebogen des Priesters, die Kosten für das Brautkleid, die Unterbringung der Gäste, Papas Frack, der nicht eintrifft, die Tischreden, die Ansprachen, die Kleider der Blumenmädchen, die Farbe der Rosenblüten, die gestreut werden sollten, die Tanzkapelle nach dem Dinner. Möchte sie lieber arabische oder amerikanische Zelte, soll es schon bei der Begrüßung Kanapees zum Champagner geben … Philip meint, dein Schwiegervater rät …
Und jedes Mal unterschrieb ihre Mutter mit dem gleichen Satz: In Eile, Mamá.
Damit wollte sie ihrer Tochter, die bis zum letzten Moment in London blieb, ein schlechtes Gewissen machen, und sie hat es geschafft.
Felipe ist ein wunderbarer Mann. Sie ist sicher, dass sie mit ihm ein Leben lang glücklich sein wird. In guten wie in schlechten Tagen. Sie ist sich vollkommen sicher. Sie hat andere Freunde gehabt, andere Liebhaber, aber nie war es so gewesen wie mit Felipe. Er ist ihr Freund und Geliebter, Bruder und Vater, er ist einfach alles.
Vor fünf Monaten und drei Tagen hat Felipe ihr den Heiratsantrag gemacht, morgens um halb vier, in ihrem zerwühlten Bett. Er wollte sie wecken, weil sie auf seinem Arm eingeschlafen war.
Vorsichtig zog er seinen Arm unter ihrem Kopf hervor. Sie knurrte nur und hielt im Schlaf, aber mit schneller Reaktion, seine Hand fest, stöhnte und kuschelte sich wieder ein.
Da richtete er sich ein wenig auf und steckte die Zungenspitze in ihr Ohr. Das Innere ihres Ohres ist eine ihrer erogenen Zonen. Sie stöhnte, presste die Augen fester zusammen.
»Mi pasión«, murmelte Felipe, »willst du mich heiraten, Ysabel?«
Beim letzten Wort schreckte sie hoch, warf sich rum, starrte Felipe an und fragte: »Ja?«
Draußen fiel Schnee. Die Nacht mitten in London war ungewöhnlich still, wie immer, wenn Schnee fällt.
»Ich habe dich gefragt, ob du mich heiraten willst, und du hast ja gesagt!« Felipe lachte, küsste sie, rollte sie herum, zog sie an sich, presste wieder seinen Bauch gegen ihren Rücken, streichelte ihr Gesicht und sagte: »Schlaf, schöne Braut, schlaf wieder ein.«
Sie hat einen winzigen Augenblick noch zum Fenster und auf den Schneeflockenwirbel im Lichtkegel der Straßenlaterne gesehen, »schön« gemurmelt und ist wieder eingeschlafen.
Am nächsten Morgen war sie verlobt. Nicht, dass sie eine einzige Sekunde darüber unglücklich gewesen wäre. Felipe musste einen Trick erfinden, um ihr dieses »Ja« abzuluchsen. Er hatte sie schon oft gefragt, und sie hatte immer ausweichend geantwortet: nach dem Examen, ich bin noch zu jung, wieso sollen wir uns schon festlegen, das ganze Leben liegt doch noch vor uns, ich will keine Kinder. Ich möchte frei sein, glaube ich.
Felipe wusste es besser. Er wusste, dass sie sich vor Entscheidungen fürchtete, dass sie Angst hatte, ihm seine Zukunft zu verbauen, dass sie Angst hatte, von ihm nicht mehr geliebt zu werden, Angst vor der Normalität der Ehe, dem Alltag, der Gewöhnung, all dieser Dinge, die schließlich aus einer Ehe das machen, was sie bei ihren Eltern beobachtet hatte. Felipe wusste, sie würde nie ja sagen, wenn ihm nicht eine List einfiel.
Als sie den Eltern von dem Heiratsantrag erzählte, weil es eine lustige Geschichte war, sagte ihr Vater, er habe geheiratet, weil Margalida ihm die Pistole auf die Brust gesetzt hätte. Es habe ihn schon sehr beeindruckt, wie sie mit glühenden Augen gesagt habe: »Heirate mich, oder du bist tot, hombre.«
»Pepe«, sagte die Mutter, »du lügst schon wieder.« Und lächelte.
María-Magdalenas Tagebuch
20. Januar 1937
Sie wollen mich nach Son Rapinya ins Spital bringen, aber das werde ich nicht zulassen. Mamá und Papá sind ganz bleich vor Sorge um mich. Seit Doktor Vigo mich untersucht und nichts gefunden hat, was meinen Zustand erklärt, kann Mamá nicht mehr schlafen. Der Doktor hat ihr gesagt, wenn ich nicht gegen meinen Zustand kämpfe, werde ich sterben. Aber genau das ist ja mein einziger Wunsch: im Tod wieder mit Victoriano vereint zu sein. Es sieht aus, als habe Mamá ihren Finger in Ruß getaucht und sich damit Ringe um die Augen gemalt. Alle zwei Stunden kommt sie in mein Zimmer und stellt einen Becher heißer Milch an mein Bett. Dabei weiß sie, dass ich die Milch nicht trinken werde. Ich schütte sie einfach aus dem Fenster. Es ist eine Sünde, ich weiß, wenn man in dieser Zeit, wo die Leute hungern, kostbare Milch einfach wegschüttet. Aber was für eine kleine Sünde gegen die großen, die ungeheuerlichen Sünden, die täglich begangen werden auf dieser Insel. Seit Monaten Terror und Tod. Sünden, die im Namen der heiligen Kirche begangen werden, oder im Namen des Vaterlandes, im Namen von General Franco oder im Namen des Sozialismus. Ich weiß schon lange, dass in unserer Stadt Menschen aus ihren Häusern gezerrt und irgendwohin verschleppt werden, wo man sie quält, bis sie Dinge gestehen, die sie nie begangen haben. Victoriano hat mir erzählt, was diese Blauhemden, die Falangisten, mit denen machen, die nicht auf ihrer Seite sind. Damals wollte ich es nicht glauben. Damals habe ich gesagt: Mein Liebster, das stimmt nicht. An den Füßen aufhängen, die Zunge abschneiden oder noch anderes: Das tun sich doch die Menschen nicht an. Sie sind doch Brüder. Wir sind doch Christen. Ich darf nicht daran denken, wie Victoriano mich angeschaut, mein Gesicht in seine Hände genommen und meine Augenlider geküsst hat. Erst das linke Auge, dann das rechte. Der Abdruck seiner warmen, trockenen Lippen auf meinen Lidern, seine Hände auf meinen Wangen. Ich darf nicht daran denken.
Mamá war eben schon wieder da. Ich musste dieses Büchlein unter dem Bettlaken verstecken. Für die Nacht werde ich mir ein anderes Versteck suchen, denn sie kommen auch nachts in mein Zimmer. Mamá stellt die Lampe vor der Tür ab, öffnet sie einen Spalt und schlüpft herein. Ihre Füße stecken in dicken Wollsocken, und sie hat sich eine Decke um die Schulter gelegt. Niemand kann sich erinnern, wann es zuletzt im Januar so kalt gewesen ist. Die Menschen frieren bis ins Herz. Victoriano hat ausgesehen, als wäre er eben erst gestorben, weil es so kalt war. Ich habe vorher nicht gewusst, dass Blut gefrieren kann wie Wasser. Jetzt weiß ich es. Ich habe nicht gewusst, wie sich das Gesicht eines Toten anfühlt. Die Haut eines Toten, wenn man sie mit den Lippen berührt. Jetzt weiß ich es. Nicht gewusst, dass ich imstande sein könnte, einen Toten zu waschen, ihm die Augen zu schließen und die Hände über der offenen Brust zu falten. Eine Wunde zu küssen, bis das gefrorene Blut sich von meinem Körper wärmt und wieder zu rinnen beginnt. Auf mein Gesicht. Und über meine Hände, weil ich meine Hände in dieses Blut getaucht habe.
Seitdem ich das getan habe, fürchte ich gar nichts mehr.
Wenn Mamá nachts an mein Bett kommt, an den Ecken die Laken und Decken wieder feststopft, täusche ich tiefen Schlaf vor. Die letzte Milch lasse ich auf meinem Nachttisch stehen, damit Mamá nicht mitten in der Nacht durch das eisige Haus bis in die Küche gehen muss, um frische Milch zu wärmen. Damit nicht noch mehr vergeudet wird. Ich weiß, dass die ganze Milchration für mich aufgespart wird. Weil Doktor Vigo sagt, dass Milch gesund ist, und weil ein unterernährter Körper keine Kraft hat, gegen eine Krankheit zu kämpfen, wie immer sie heißt.
An die Lebenden kann ich keinen Gedanken verschwenden, während ich mich darauf konzentriere, zu sterben. Früher haben die Mönche oft gehungert, und manche sind heiliggesprochen worden, ich weiß nicht, ob sie schon tot waren, bevor man sie heiliggesprochen hat. Vielleicht darf man einen Lebenden nicht heiligsprechen. Er könnte ja noch eine Sünde begehen. Etwas Schreckliches tun, weil die Umstände es erfordern. Ich könnte keine Heilige werden, auch wenn ich von nun an ein Leben führte, wie es dem Allerheiligen gefiele. Für die Sünde, die ich begangen habe, kennt Gott nur die schlimmsten Strafen, aber auch die fürchte ich nicht mehr.
Seit sieben Tagen habe ich kein Stückchen Brot mehr gegessen, keine getrocknete Aprikose, keine Feige. Ich habe, weil Mamá und Doktor Vigo mich dazu gezwungen haben, zwei Tassen Brühe getrunken, aber als sie das Zimmer verlassen hatten, habe ich mir einen Finger in den Hals gesteckt, so tief, bis alles wieder ganz von unten aus dem Magen heraufgekommen ist. Ich bin nicht sicher, ob etwas von der Bouillon schon vom Körper verbraucht war, aber wenn, kann es nur eine winzige Menge gewesen sein. Ich fühle mich so schwach, dass ich immer schlafen möchte. Aber dann träume ich vom Essen.
An Kuchen darf ich nicht denken, zum Beispiel an die Mandeltorte, die Cecilia sonntags immer gebacken hat, als noch kein Krieg war. Mandeln aus unserem Garten, frisch gerieben, Milch, Eier, Vanillezucker, dazu steif geschlagene Sahne. Daran darf ich nicht denken, ich dürfte das auch gar nicht hinschreiben, weil sich mein Magen vor Hunger zusammenkrampft. Er ist so vollkommen leer, dass er sich nach innen stülpt. Seine Wände sind wund, das kann ich fühlen. Aber ich muss den Schmerz aushalten. Was ist das gegen die Schmerzen, die Victoriano ertragen hat. Den Schmerz, als man ihn an den Füßen aufgehängt hat.
Eben war mein Bruder bei mir. Obwohl er weiß, wie ich das hasse, kommt er zu mir in diesem blauen Hemd, mit diesen Soldatenstiefeln, diesem prahlerischen braunen Gürtel mit der silbernen Schnalle. Er erzählt von ihren Siegen. Er sagt immer: unsere Siege, wenn er Francos Armee meint. Er tut, als wäre er Soldat, dabei hat ihn niemand gerufen. Er und seine Freunde bilden sich ein, sie haben das Recht auf ihrer Seite, wenn sie ihre Parolen herausschreien. Aber von Victoriano weiß ich, dass das nicht stimmt.
Recht hat nur der, der Gerechtigkeit fordert, für alle, hat Victoriano mir erklärt, denn das Wort Recht steckt in dem Wort Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit muss für alle gelten, für die, die kein Land besitzen, ebenso wie für Leute wie wir, denen seit Generationen ein Teil der Insel gehört. Victoriano hat dafür gekämpft, dass alle, auch die Campesinos in ihren Casitas, heiße Milch trinken und Schuhe für ihre Kinder kaufen können, damit sie zur Schule gehen können, ohne sich zu schämen. Und er hat gefordert, dass die Kinder von Campesinos das Recht auf Schulbücher haben sollten.
Victoriano hat gesagt, Leute wie meine Familie haben seit Generationen dafür gesorgt, dass die Landarbeiter dumm blieben, damit sie sich nicht auflehnen gegen die da oben, damit sie keine Pamphlete schreiben oder lesen können und nicht erfahren, was in den Zeitungen steht und in den Büchern.
Juan ist in mein Zimmer gekommen, um mir von einem Sieg der Falangisten zu berichten, in der Nähe von Burgos. Die Basken kämpfen länger als alle anderen, aber wir werden sie auch kleinkriegen, hat Juan gesagt, wie alle anderen, die nicht begreifen, dass der Caudillo ein Gott ist. Wenn er das sagt, schaut er mich aus den Augenwinkeln an, als erwarte er, dass ich ihm widerspreche. Aber den Gefallen tue ich ihm nicht. Nur damit er sich noch mehr aufplustert und noch groteskere Geschichten erzählt? Angeblich hat General Goded – das ist der, der zuerst diese Insel in die Gewalt der Franquisten brachte – den Faschisten Mussolini um Hilfe gebeten, und der wird nun Schiffe über das Meer zu uns schicken, mit Kanonen und Panzern, und Hitler will U-Boote schicken und Helme und Granaten. Und bei dem Wort Granaten leuchteten seine Augen. Ich glaube, mein Bruder wird verrückt.
Tag für Tag zwingt er die Familie, vor dem Essen aufzustehen und dieses schreckliche Lied zu singen, das sie alle Stunde im Radio verbreiten: Cara al Sol.
Juan streckt dabei den Arm zum Faschisten-Gruß. Und sein Gesicht verzerrt sich vor Leidenschaft zu einer hässlichen Grimasse.
Mamá sagt, er ist noch ein dummer Junge. Sie verschließt vor der Tragödie die Augen. Man muss das nicht ernst nehmen. So war sie immer schon.
Aber Papá fürchtet sich. Das kann ich spüren. Seit Pater Antonio aus Inca in unserer Kapelle die Messe gelesen hat, fürchtet er sich. Denn da hat Papá auf einmal begriffen, dass die Priester und die Falangisten gemeinsame Sache machen. Und dass die Kirche nichts dagegen tun wird, wenn in ihrem Namen gemordet wird. Pater Antonio hat meinem Bruder die Oblate auf die Zunge gelegt und gelächelt. Mir wurde ganz übel. Früher hat Papá über die Weinernte, die Jagd und seine Hunde gesprochen. Wenn er heute das Wort »Hunde« in den Mund nimmt, meint er entweder die Anarchisten, die Kommunisten oder die Politiker. Für ihn sind sie alle Verbrecher, denn sie haben den Frieden unserer schönen Insel zerstört.
Es schneit schon wieder. Wenn es so weitergeht mit den eisigen Nächten, wird die Mandelblüte erfrieren. Ich möchte die Blüten pflücken und mir daraus ein Bett machen. Ein Brautbett. Ein Totenbett.
Der Gedanke an Victoriano quält mich immerzu. Ich wundere mich, dass ich noch lebe bei dem Schmerz, den ich ertragen muss.
Von Gabriel keine Spur. Seit er mich zu Victoriano geführt hat, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich glaube, er fürchtet um sein Leben, weil er den Mörder kennt. Ich muss jemanden finden, der für mich nach Palma fährt und Gabriel einen Brief von mir bringt. Ich muss jemanden finden, den sie unterwegs nicht anhalten und ausfragen, ins Gefängnis stecken oder einfach über die Klippen werfen. Aber wer könnte der sein? Wer weiß heute noch, ob er morgen nicht einen Toten in seiner Familie beklagen muss?
Ich darf nicht einmal weinen. Keinen Schmerz zeigen. Ich darf nicht laut über den Tod meines Geliebten klagen. Jeder Schrei muss in der Kehle erstickt werden. Ich presse mir ein Handtuch, ein Kissen, ein Kleidungsstück vor den Mund, wenn ich es nicht mehr aushalte. Denn sie wissen nichts von Victoriano und mir.
Papá hat gehört, dass Amerika ein Embargo gegen uns erlassen hat. Er sagt, bald werden wir kein Öl mehr haben, keinen Brennstoff. Die Fabriken werden nicht mehr arbeiten können, die Schiffe nicht mehr auslaufen. In Palma hungern sie, seit die Bäckereien geplündert und die Brotfabriken verwüstet sind. Die einen werden ermordet, weil sie auf der Seite von General Goded sind, die anderen, weil sie gegen Goded sind. Was man hier auch tut und denkt: Man hat immer einen Feind. Das hat Victoriano mir schon vor Monaten erzählt. Wie recht er hatte. Ich traue niemandem mehr, meinem Bruder schon gar nicht.
Jaume Sureda
Es ist Montagmorgen, und Dr. Jaume Sureda ist seit einer halben Stunde überfällig. Mathilda hat schon zweimal in seiner Villa angerufen, diesem magischen Platz am Meer, den sie einmal sehen durfte, ein einziges Mal nur anlässlich des Firmenjubiläums am 1. Juni. Seitdem wird sie nicht nur von Wunschträumen geplagt, die im Büro stattfinden, nein, sie kann es nicht verhindern, dass sie sich als Ehefrau, als Hausherrin dieser schneeweißen Villa über den Klippen der Cala Oscura sieht, auf den Terrassen Blumen schneidend, einen Tisch für die Abendgesellschaft herrichtend oder durch die Zimmerfluchten schlendernd, barfuß, und womöglich sogar nackt …
Die Fahrstuhltür gleitet zurück, und Sureda betritt den Empfangsraum seiner Kanzlei. Mathilda errötet, wie sie immer errötet, wenn sie ihren Chef erblickt, weil sie fürchtet, er könne ihre Gedanken erraten haben. Dr. Sureda sieht aus, als besitze er die Gabe, Gedanken zu erraten. Denn irgendetwas muss ihn ja unterscheiden von anderen Anwälten. Irgendeine Begabung muss ihm dazu verholfen haben, der Reichste und Mächtigste unter den Anwälten Mallorcas zu werden. So reich und so mächtig, dass er nicht nur im Laufe der Jahre Land gekauft hat im Herzen der Insel, viel Land in der Gegend zwischen Sineu und Alaró, sondern dass er das Vertrauen der Tochter des spanischen Königspaares, Elena, gewonnen hat. Mehrfach durfte Mathilda ihren Chef bereits mit dem Palast in Madrid verbinden. Das allein war schon wunderbar. Aber noch wunderbarer war es für Mathilda, ihren Chef zu beobachten, wenn er mit einem Mitglied der königlichen Familie sprach: Nichts an seinem Tonfall, an der Lautstärke, an seiner Gestik, an irgendeiner Regung seines Gesichts zeigte an, dass er mit besonderen Menschen sprach. Nicht anders redete Dr. Sureda mit der Infantin, als er mit ihr, der unbedeutenden Vorzimmerdame Mathilda, redete. Wenn Mathilda nachdachte, war es dies, was ihren Chef so unvergleichlich machte. Dass es für ihn keinen Unterschied gab zwischen einer gewissen Mathilda Catalina Arbona und der Infantin von Spanien.
Mathilda ist davon überzeugt, dass die Klienten recht haben. Es gibt zwischen Palma und Paris, zwischen den Balearen und den Britischen Inseln keinen besseren Anwalt, keinen, der geschickter wäre, raffinierter. Zynisch, wo es sein muss, und großartig, wo es angeraten ist. Großartig im Sinne von genial, aber auch großzügig. Mathilda zögert noch, ob ihr Chef ein so großes Herz hat, dass es für alle reicht, oder vielleicht gar keines, oder eins, das er nur gut verbirgt.
Manchmal entdeckt sie in seinen Augen ein kaltes Leuchten, das sie erschreckt. Aber dann entschuldigt sie es mit dem einfallenden Licht, mit seiner Müdigkeit oder der Erregung, in die ihn ein Klient oder ein Telefongespräch versetzt hat.
In anderen Augenblicken kann sie unter seinem Lächeln dahinschmelzen wie ein Backfisch. Immer jedoch, vom Augenblick, wo Dr. Jaume Sureda die Kanzlei betritt, bis zu dem Augenblick, wo er sie wieder verlässt, ist sie in äußerster Alarmbereitschaft. Wagt nicht, länger als unbedingt nötig in den Waschräumen zuzubringen, eilt vorzeitig von der Mittagspause zurück, nervöser als eine Mutter, die ihr Baby allein gelassen hat. Immer in Sorge, er könnte sie gerufen haben, während sie fort war, immer in der Anspannung, dass ausgerechnet in diesem winzigen Augenblick, den sie sich gestattete, etwas Unwiederbringliches geschehen ist, etwas Wichtiges, das sie nun versäumt und womit sie ihren Chef womöglich verärgert haben könnte.
Niemals würde sie sich erlauben, später als ihr Chef im Büro zu sein, und nie, nie würde sie vor ihm das Haus verlassen. Eher würde sie die Opernkarten verfallen lassen und den Termin beim Zahnarzt, als den Chef allein zu lassen. Könnte doch sein, dass er sie ausgerechnet dann dringend braucht. Weil er eine Akte sucht, einen Vorgang, den sie bearbeitet hat und von dem nur sie weiß, wo er abgelegt wurde. Dass er eine Telefonnummer benötigt, die sie unter einem anderen Namen gespeichert, oder dass er sich an eine der Tochterfirmen eines Klienten nicht erinnern kann, denn es gibt viele Klienten mit vielen Tochterfirmen, überall in der Welt, und das Telefonbuch, das sie verwaltet, birgt mehr als zweitausend Eintragungen.
So sitzt sie in ihrem Büro, in einer kleinen Kammer direkt neben seinem gigantischen Arbeitszimmer, sie hat den gleichen Blick über die Bahía de Palma wie er, allerdings aus einem sehr kleinen Fenster. Rechts der Hafen mit der Mole Nr. 3, an der die Fährschiffe aus Barcelona anlegen, dahinter der Hafen für die Kreuzfahrtschiffe, weiter links der Jachthafen, der Club Náutico mit einer Terrasse, die in den Jachthafen hinausreicht, wo man zwischen schaukelnden Segeljachten sitzen und dem Kellner seine Wünsche vortragen kann. Dr. Jaume Sureda verbringt hier regelmäßig die Mittagsstunden, wenn er sich auf der Insel befindet und nicht mit Klienten in Puerto Andraitx oder Puerto Portals zum Mittagessen verabredet ist.
Während er dort sitzt, schaut Mathilda zu ihm hinüber. Natürlich kann sie ihn nicht sehen, es genügt ihr zu wissen, dass er dort sitzt, vor einer Schüssel mit Mejillones (Miesmuscheln) oder Frito Mallorquín (mallorquinisches Gericht aus frischen Innereien mit Gemüse), einem Cortado, einem Gin Tonic. Dr. Sureda schätzt – wie die Engländer – die erfrischende Wirkung eines Gin and Tonic zur Mittagszeit. Mathilda sitzt und blickt auf diese kaum sichtbare Linie zwischen Himmel und Meer, die sich gegen Mittag fast vollständig auflöst, auf dieses Blau, das ihre Gedanken ansaugt wie ein Vakuum. Durchsichtiger Himmel vor ihrem Bürofensterchen, in dem sich alles verliert. Jeder klare Gedanke, jeder vorformulierte Brief, jedes noch zu führende Telefonat. Wenn Mathilda zu lange hinausschaut auf diesen Platz, an dem sie ihren Chef vermutet, möchte sie sich zu einer Meerschwalbe verwandeln und flügelschlagend im endlosen Blau verschwinden.
Manchmal fürchtet sie, vor Verlangen nach ihrem Chef verrückt zu werden. Ihre Kollegen lachen sie aus. Ihre Kollegen haben eine andere Meinung von Dr. Sureda. Manche halten ihn für durchtrieben, andere sagen, er sei ein strenger, unnachsichtiger Chef. Ein Anwalt, der seine Gegner mit Totschlag-Argumenten vernichte. Mathilda weiß nicht, was sie damit meinen. Schließlich wird er dafür bezahlt – und man bezahlt ihn gut –, dass er den Gegner vernichtet. Dr. Jaume Sureda hat einen Beruf erwählt, der zwischen Siegern und Besiegten klar unterscheidet. Er hat einen Beruf erwählt, der den Kompromiss zwar für möglich, aber nicht für erstrebenswert hält. Besser ist, auf voller Linie zu siegen, in jedem einzelnen Punkt. Wenn er wieder einen großen Sieg errungen hat, ist Dr. Sureda der charmanteste, heiterste Mensch der Welt. Niederlagen akzeptiert er nicht. Grußlos betritt er dann das Büro, und grußlos geht er wieder. Schließt sich in seinem Arbeitszimmer ein und spricht mit lauter Stimme unentwegt die Berufungsschrift in sein Diktiergerät. Eine Niederlage ist für ihn nie endgültig.
Seit vierzehn Jahren ist sie seine Sekretärin, sie hat in dieser Zeit viele Niederlagen hinnehmen müssen. Vielleicht, eines Tages, vielleicht heute sogar, wird Dr. Sureda aufschauen, wenn sie sein Zimmer betritt, wird lächeln, sich zurücklehnen, mit seinen schönen Händen durchs Haar fahren und sagen: »Wissen Sie eigentlich, Mathilda, dass ich mir ein Leben ohne Sie nicht mehr vorstellen kann?«
Wie aus dem Erdboden ist er plötzlich da.
»Guten Morgen, Mathilda. Wissen Sie, was dieser Kerl im Radio heute Morgen gesagt hat?«
»Keine Ahnung, Chef. Aber in Ihrem Büro wartet …«
Mathilda steht auf, um ihrem Chef aus dem Sakko zu helfen. Eine Liebenswürdigkeit, die er jedes Mal mit einem »Das müssen Sie nicht tun, Mathilda« quittiert. Und einem Lächeln.
Mathilda schenkt ihm dann das Lächeln zurück und sagt: »Aber wenn ich es doch gerne tue …«
»Er hat gesagt: Willkommen auf der Wüsteninsel Mallorca. Und wissen Sie, warum er es gesagt hat? Weil es seit zehn Wochen nicht geregnet hat. Ich bitte Sie, was sind zehn Wochen? In Mali hat es seit zehn Jahren nicht geregnet.«
Sureda schaut auf die Uhr. Er trägt ein kurzärmliges Polohemd in einem Blau, das von der Sonne ausgebleicht ist, dazu weite, bequeme Leinenhosen und Segelschuhe. Keine Socken.
Mathilda registriert alles mit einem einzigen Wimpernschlag.
»Es stimmt, ich bin heute ein bisschen spät. Aber heute ist auch ein besonderer Tag, oder? Der Ehevertrag zwischen Felipe Ramón und Ysabel.«
Mathilda errötet wieder. Wenn sie an die Hochzeit denkt, spürt sie ein schmerzhaftes Ziehen im Unterleib. Sie hatte sich so sehr gewünscht, dass Dr. Sureda auf die Idee kommen könnte, sie zu der Hochzeit zu bitten, als Gast, als langjährige Vertraute. Wenn sie ganz ehrlich war: Eine Zeit lang war es ihr selbstverständlich erschienen, dass ihr Name irgendwann auf der Gästeliste auftauchen müsste. Einmal in der Woche korrigierte Mathilda die Liste nach Absagen und Zusagen, notierte Namen von Menschen, die um jeden Preis noch eingeladen werden wollten, und andere, bei denen Dr. Sureda aus unerklärlichen Gründen wollte, dass sie dabei waren.
Nur ihr Name ist bis heute auf keiner der Listen aufgetaucht, die sie mit einem Kurier nach Els Sant Castells schickt, zu Händen von Doña Margalida Pilar de Villalonga, einer Frau, die Mathilda nur einmal gesehen und sofort durchschaut hat, wie sie meint.
»In einer halben Stunde landet Ihre Schwiegertochter. Haben Sie daran gedacht, dass Sie mit Felipe zusammen zum Flughafen fahren wollten?«
»Natürlich habe ich daran gedacht. Seit Tagen denke ich an nichts anderes.« Sureda beugt sich über den Schreibtisch und versucht, in dem Terminkalender zu lesen. »Sagen Sie für heute alle Termine ab.«
»Verzeihung, Chef, aber für sechzehn Uhr ist Mister Gordon Brown eingetragen.«
Sureda runzelt die Stirn. »Gordon? Für heute?«
»Er hat doch den Termin verlegt, wenn Sie sich erinnern. Er kommt heute mit dem Flugzeug aus London. Er bringt alle Unterlagen mit, die Sie angefordert haben.«
»Ah. Das ist gut.« Dr. Sureda nickt zufrieden. »Eines Tages, wenn wir diese Sache unter Dach und Fach haben, Mathilda, dann dürfen Sie sich etwas wünschen.«
Mathilda hält die Luft an, fasst sich an den Hals.
»Irgendetwas Besonderes. Denn wenn wir mit Gordon Browns Hilfe den ersten Akt unterschriftsreif haben, dann ist der Rest ein Kinderspiel.« Er schnippt mit den Fingern.
Mathilda steht und wagt nicht zu atmen. Wird er sie jetzt fragen, was sie sich wohl wünscht an jenem Tag X?
»Es wird der größte Deal sein für diese Insel, Mathilda, und es wird ein Dienst sein an unserem Land. Alles beides.« Er lacht.
»Vielleicht wird man einen Platz in Palma nach mir benennen.«
»Die Plaza Mayor«, sagt Mathilda.
Sureda wechselt, wie es seine Art ist, unvermittelt das Thema. »Heute Mittag gehe ich mit den Kindern ins Caballito zum Essen. Das hat Felipe sich gewünscht. Danach kommen wir ins Büro, um den Ehevertrag zu unterzeichnen. Ist alles bereit?«
»Er liegt auf Ihrem Schreibtisch, Chef.«
»Gut.«
»In sechsfacher Ausführung. Ich dachte, ich ziehe noch eine weitere Kopie. Wegen der komplizierten Grundbesitze und der Pachtverträge, die auf diesen einzelnen Gütern noch liegen. Damit – im Falle irgendwelcher Komplikationen – jederzeit die Kopie an das Grundbuchamt geschickt werden kann.«
»Sie sind ein Schatz, Mathilda.« Sureda kommt zu ihr zurück. Mathildas Lider zucken. Einen Augenblick hält sie es für möglich, dass ihr Chef, dieser wunderbare, attraktive Mann, breitschultrig, dunkles Haar und haselnussbraune Augen, auf sie zukommen, ihr Gesicht zwischen seine Hände nehmen und sie küssen würde.
»Sie denken wirklich an alles. Aber ich bin ganz sicher: Es wird keine Komplikationen geben. Die beiden lieben sich. Sie sind beide klug, haben beide einen wunderbaren Beruf, Ehrgeiz, gesellschaftlich die gleiche Position, sie freuen sich auf die neuen Aufgaben in Madrid, sie sind modern, in England erzogen. Es wird nichts schiefgehen, Mathilda. Diese Ehe wird glücklich sein. Und zwar ein Leben lang. Und sie werden wunderbare Eltern sein für ihre Kinder.«
Mathilda wagt nicht, aufzusehen. Etwas in der Stimme ihres Chefs verwirrt sie. Macht ihr Angst. Diese Intensität, mit der er redet, als wolle er das Schicksal beschwören.
»Ich sollte mich spätestens in zehn Minuten auf den Weg machen, was?«
»Keine Minute später, Doktor.« Mathilda fängt sich, weil auch Sureda sich gefangen hat. Mutig sagt sie: »Aber so können Sie Ihre Schwiegertochter an diesem Tag nicht empfangen.«
Verwirrt schaut der Anwalt an sich herunter. In den heißen Sommermonaten sind Polohemd, Leinenhose und Segelschuhe seine traditionelle Bürokleidung, schließlich kommen auch die Klienten nicht im dunklen Anzug in seine Kanzlei, sondern oft genug direkt von ihrer Jacht oder dem Golfplatz. Schließlich ist Mallorca nicht Madrid.
In der Ankunftshalle herrscht ein Gedränge wie auf dem Markt.
Da, im Menschengewimmel, der elegante Herr, hoch aufgerichtet, offenes Jackett: Das ist Don Jaume Llorrenc Sureda. Doktor der Rechte. Berater des Königs, seiner Hoheit El Rey Juan Carlos. Mit einem Seidentuch im Knopfloch. Ihr zukünftiger Schwiegervater.
Ysabel lacht. Sureda breitet die Arme aus, sein ganzes Gesicht ist ein einziges großes »Willkommen!«
Sie fliegt ihm in die Arme.
»Die Braut!« Gerührt küsst er sie. »Meine zukünftige Schwiegertochter. Was für ein Glückspilz ich bin.«
Er riecht nach teurem Rasierwasser und einem Auto mit Klimaanlage. Er schiebt die weiße Manschette zurück und zeigt auf die Uhr, die wahrscheinlich zwei Millionen Pesetas gekostet hat. »Dreißig Minuten Verspätung! Diese Fluglinien werden immer unpünktlicher. Was ist da los?«
»Wo ist Felipe? Ist Felipe nicht gekommen?«
»Er ist draußen. Er versucht, unseren Wagen aus den gierigen Klauen der Guardia Civil zu befreien. Die lauern jetzt rund um die Uhr hier Parksündern auf, schleppen Wagen ab und schicken Rechnungen, für die man fast ein neues Auto bekommt.«
»Felipe sollte ihnen erklären, dass er seine Braut erwartet. Eine gute Liebesgeschichte erweicht jedes Polizistenherz.«