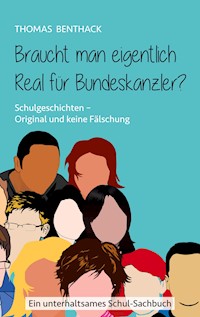
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie geht es eigentlich zu in einer Stadtteilschule in einem sogenannten Problemstadtteil? Wie verhalten sich Schüler und Schülerinnen wirklich? Probleme, Spaß, Erfolge und Misserfolge in 50 Geschichten aus der Praxis - in Originalsprache. Keine Geschichten über Schüler, sondern mit ihnen selbst erlebte. Amüsant zu lesen, trotzdem nachdenklich, ohne große Ratschläge aber mit Ideen für Unterricht, Klassenleitung und das Leben in der Schule.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
SCHÜLER - LEHRER - BLICK
Heimat
Dinge, die es gar nicht gibt
Nutzlos
Leider arm
Erwürgt
Buch
Quecksilber
Subtext mit Gurke
Bundeskanzler
5 - Uhr - Piercing
Wie man mit einer Frau umgeht
Schwierigkeiten
Gips
ALLTAG
Acht Stunden Schule mit Nägeln und Nilpferd
Acht Stunden Schule mit Schönheit, Schuh und Sauerland
Leider im Tag vertan
Schule im Corona-Blues … das Lüftungskonzept
Schule im Corona-Blues … das Desinfektions- und Kohortenkonzept
Überlebt – 22mal Klassenreise
Vom Scheitern – oder: Demut
PARADOXE AKTION UND INTERAKTION
Check, Diggah!
Da bin ich
Absolute Stille
Dyskalkulie
ERFREULICHE ENTWICKLUNG
Gut so?
Cousine
Zwischen den Welten
Wenn es um ernste Sachen geht, schafft sie das!
Erstmal pullern
EINSATZ FÜR NORMEN UND WERTE
Hässliga
Zurückbeleidigt – Original und keine Fälschung
Beobachtet
Original und Provokation
Beim Guten erwischt
Nicht gleich diskutieren
Metalltoilette
VERSTÄNDNIS – KEIN VERSTÄNDNIS
Mitgebracht!
Verständnis und Unverständnis
Ratlos bei Gericht
Grill und Igel
Raubtiere in der Mittagshitze
WEISE SCHÜLER*INNEN
Bildungsauftrag Venedig
Geschenk
Elfchen
Hobbys
Nicht unterkriegen lassen
Feedback
VORWORT
Oft habe ich keine Lust gehabt, Geschichten aus meinem Schulleben zu erzählen, weil ich Reaktionen wie diese einfach nicht mochte: „Das ist ja furchtbar! Wie kannst du das nur aushalten? Was bin ich froh, dass ich nicht Lehrer bin!“
Ich bin doch gern Lehrer gewesen! Daher habe ich es mal mit diesen Geschichten versucht: original, in Verzweiflung und Freude, in Erfolg und Scheitern. Schüler*innen sind anders: verständnislos und großartig, wild und rücksichtsvoll, ablehnend und lernbegierig, ideenreich und einfallslos, liebevoll und aggressiv. Auf jeden Fall anders. Wer dort arbeitet, muss sich darauf einlassen, einfache Lösungen gibt es nicht.
Also: Wie geht es eigentlich wirklich zu in einer Stadtteilschule in einem sogenannten „Problemstadtteil“? Wie verhalten sich Schüler*innen dort wirklich?
Probleme, Spaß, Erfolge und Misserfolge in 50 Geschichten aus der Praxis - Schüler*innen in Originalsprache. Keine Geschichten über sie, sondern mit ihnen selbst erlebte. Hoffentlich amüsant zu lesen, nicht zu nachdenklich, ohne Ratschläge, aber mit vielen Ideen für Unterricht, Klassenleitung und das Leben in der Schule.
In Filmen und Büchern über Schule geht es oft komplett unernst zu, Schüler*innen werden zu Witzfiguren, coole Lehrer*innen bringen die Sache ganz einfach in Ordnung, nur mal einen Chor oder eine Band gründen, mal Fußball spielen und es läuft wie von selbst. Aber das allein ist es eben nicht.
Es gibt keine dummen Schüler*innen. Das haben wir im ganzen Kollegium so gesehen. Über Schüler*innen wurde sich nicht lustig gemacht, auch nicht im Lehrerzimmer. Ihre Probleme und Wünsche wurden ernst genommen.
Mir haben meine Lehrerjahre sehr gefallen. Auch wenn es oft anstrengend war, bin ich froh und dankbar, diesen Beruf gewählt zu haben und erinnere mich gern daran zurück.
Ich habe für diese Geschichten natürlich nie die richtigen Namen von Schüler*innen und Kolleg*innen verwendet und, um Anonymität zu gewährleisten, auch Merkmale verändert, zum Beispiel das Geschlecht, das Alter, die Funktion, die Klassenstufe oder die Herkunft, soweit diese überhaupt eine Rolle spielt.
SCHÜLER-LEHRER-BLICK
HEIMAT
Die Schule liegt zwischen den Stadtteilen Lurup und Osdorf, die meisten Schüler und Schülerinnen kommen aus Osdorf. Das alte Dorf namens Osdorf ist klein und liegt auch ziemlich versteckt neben dem, wofür Osdorf heute in Hamburg bekannt ist, dem Stadtteil mit den Hochhaussiedlungen. Zwar gibt’s in nächster Nähe viel Grün (den Osdorfer Born), aber eben auch die Hochhäuser, teilweise etwas vernachlässigt. Ab und zu gibt es Probleme, selten kommt es zu Verzweiflungstaten oder Gewalt. Und darüber wird dann groß berichtet. Der Osdorfer Born hat oft eine schlechte Presse. Darüber ärgern wir uns seit Jahr(zehnt)en. Viele Menschen bemühen sich um den Born, es werden Projekte initiiert und gefördert, oft erfolgreich, aber es ist auch schwierig.
Viele Schüler kommen wenig aus dem Born heraus, sie kennen kaum etwas von Hamburg. Zum Beispiel ist von einer Schülergruppe aus der 8. Klasse, mit der ich zur Betriebserkundung in einem Hotel am Elbstrand unterwegs bin, vorher noch niemand in Blankenese gewesen. So weit ist das doch gar nicht! Da kann ich den jungen Leuten ja mal was Tolles zeigen, denke ich und los geht’s durch Blankenese zum Treppenviertel, dann die Treppen hinab. Blick auf die Elbe? Uninteressant. Herr Benthack, warum sind hier so viele alte Häuser? Die sehen doch toll aus, meine ich. Keine Antwort. Könn‘ die hier nicht mal richtige Treppen bauen? Nee, ich will da nicht runter. Der Born ist schöner! Da bin ich nun ziemlich platt, lerne aber, dass man alles auch mit anderen Augen sehen kann und man dem Born gegenüber nicht voreingenommen sein sollte.
Fast alle Schüler identifizieren sich mit ihrem Stadtteil. In Bernas erstem Power-Point-Vortrag, hier noch mit frei gewähltem Thema, klingt das dann so:
„Herzlich Willkommen zu meinem Vortrag über Osdorf.
Osdorf ist mein Lieblingsstadtteil - er ist in Hamburg sehr beliebt. Osdorf ist der schönste Stadtteil von Hamburg. Es gibt hier 3 Einkaufszentren: Das Elbe, das Borncenter und das ScheEZ in Schenefeld. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.“
Na gut, war ja nur zur Übung.
Je nach persönlichem Entwicklungsstand werden die offensichtlichen Unterschiede zwischen Stadtteilen auch schon ironisiert. So stellen Anna und Jolanda Blankenese und Osdorf im Vergleich zu passenden Fotos so vor: „Hier sehen Sie auf dem ersten Bild eine alte Frau aus Blankenese, sie ist reich und trägt nur Designer-Klamotten. Auf dem 2. Bild sehen Sie ein paar Leute aus Osdorf (dazu Bild einer Rapper - Gang), alle leben noch bei ihrer Mama und sie tragen keine Designer-Klamotten. ... Dann sehen Sie auf diesem Bild einen Porsche. Viele Leute (fast alle) in Blankenese fahren so ein Auto. Auf dem Bild dahinter sehen Sie auch ein Auto (ein vollkommen kaputter, nicht mehr fahrtüchtiger alter Opel Rekord), mit solchen Autos fahren die Leute in Osdorf rum.“ Das war überraschend, ich habe wieder sehr gelacht. Natürlich sympathisieren Anna und Jolanda mit dem ja sehr viel cooleren Osdorf.
Auch Bert gefällt Osdorf. „Es ist sehr schön mit den ganz vielen Hochhäusern, weil wir hier richtig viele Freunde haben und weil immer was los ist und ... als ich Leute in Osdorf interviewt habe, haben sie nicht nein gesagt, sondern ‚natürlich darfst du mich interviewen‘ gesagt und ganz viel über Osdorf erzählt.“
Auch Erhan findet viel gut in Osdorf: „... Zum Beispiel ist jeder immer hilfsbereit, wenn mal was passiert, sind sie immer da, auch die Jugendlichen.“ Und Halil meint: „... heutzutage ist der Osdorfer Born ins Positive umgewandelt und es gibt wenig sowie gar keine Kriminalität, die Leute sind ... netter geworden und höflicher, viele haben an Bildung zugenommen, ... man kann sich sicher fühlen. ... Osdorf ist schöner und sicherer geworden und viele Leute aus anderen Stadtteilen kommen hier hin, wie z.B. aus Altona oder Schnelsen.“ Das freut mich wirklich.
Trotzdem wird der Born von vielen Schüler*innen „Ghetto“ genannt und so stehen auch fast alle Schüler auf Rap und Hiphop, die einzigen Musikstile, mit denen ich leider bis heute irgendwie nichts anfangen kann. Ich hab‘s oft probiert, aber ...
Besonders die Jungen dichten, was das Zeug hält für ihre Rapper-Karriere: „Osdorf voller Ehre und Stolz, Schnelsen wir schenkten euch ein Leben, ihr konntet uns nix geben, drum geht ihr jetzt drauf, los Schnelsen geh und lauf!“ Oder: „Ich bin geborn im Born, du bist game over hast leider jetzt verlorn. ... denn es ist Osdorf, wo die Träume krepiern, wo die Schwachen verliern und die Starken regiern.“
Zettel mit Songtexten dieser Art liegen oft irgendwo herum.
Viele Schüler schreiben auch gern über ihre verlassene Heimat und die damit verbundenen Verluste. Pjotr erinnert sich: „Überall, wo man hinguckt, gibt es riesige Wälder und Felder. Man riecht fast gar keine Abgase, Meer riecht man von morgens bis abends. ... Fast immer sind wir draußen, TV gucken wir fast nie.“ „Ich wünschte ich könnte in Polen leben!“ meint dazu auch Anna und ergänzt, dort gebe es nicht so viele Hochhäuser, ..., hier spielten alle immer nur drinnen, in Polen nur draußen. Die Gärten dort seien viel größer, ... und: „Ich mag am meisten viel Gras und wenn es frei ist“, sagt sie dann noch.
Auch Verena schreibt einen Text über ihre Heimat Polen und trägt ihn auf einer der jährlichen Veranstaltungen zu „Schule gegen Rassismus“ vor. Sie fährt immer im Sommer dorthin zu ihrer Oma. Es ist geradezu eine Huldigung an Polen, wo sogar die Luft polnisch rieche. Diesen Text besitze ich leider nicht, aber ich erinnere mich gut an ihren Vortrag.
„In unserem Dorf gelten folgende Regeln.“, erklärt uns dann Nalan, hin- und hergerissen zwischen sehr verschiedenen Welten. „Man darf sich den Älteren nicht widersetzen, damit ist gemeint, wenn z.B. mein Onkel zu mir sagt: ‚Geh jetzt mir einen Tee bringen!‘, dann kann ich nicht sagen: ‚Nein, mach ich nicht oder warte, gleich!‘, sondern ich gehe auf dem direkten Weg in die Küche ohne Wenn und Aber und bringe ihm einen Tee. Außerdem haben bei uns die Männer das Sagen. … Wenn in unserem Dorf jemand heiratet und mein Onkel sagt: ‚Wir gehen dort nicht hin!‘, dann wird nicht diskutiert und wir gehen nicht hin.“ Da verhält sie sich in Hamburg komplett anders. Da diskutiert sie sogar sehr viel.
Mehmet stammt aus Syrien. „2014 sah mein Vater vor seinem Laden die Revolutionäre einen militärischen Stützpunkt aufbauen.“, schreibt er, „Da wusste er, dass die Arbeit gefährlich wird. ... er hat seine Werkstatt dahin transportiert, wo er noch ruhig arbeiten konnte. 2015 wurde die Werkstatt dann zweimal kaputt gemacht, einmal durch einen Kurzschluss ... mit Brand, das zweite Mal wegen einer Bombe, die auf das Dach der Werkstatt gefallen war. ... Politik? In Syrien darf man über alles frei sprechen, außer über Politik. ... stellen Sie sich vor, Sie fragen mich in Syrien, was hier mit der Politik los sei. Ich sag dann: ‚Weil der große Onkel das so will.‘ Wenn Sie z.B. nachfragen: ‚Wer ist denn das?‘, dann sag ich: ‚Äh, ich muss leider meinen Bruder besuchen, tschüss.‘ In Deutschland gibt es Meinungsfreiheit, aber in Syrien nicht, alle Menschen wissen dort, warum alles so teuer ist, warum es Syrien so schlecht geht, aber keiner kann darüber sprechen.“
Ardas Eltern stammen aus der Türkei, sie war auch schon oft dort, ihre Heimat sei aber Deutschland, meint sie. Bei „Schule gegen Rassismus“ trägt sie einen bewegenden Text vor, in dem sie Deutschland lobt, ihre Freiheiten hier und die gute Ausbildung. Trotz der vielen Schwierigkeiten, die sie all die Jahre auf der Schule hatte.
DINGE DIE ES GAR NICHT GIBT
Unterricht ist leider nicht immer erfolgreich. Das ist traurig, kommt aber immer wieder vor, wie hier einige Beispiele vor allem aus dem Biologieunterricht zeigen:
So erklärt Ugur zwar mit viel Phantasie, aber dann doch nicht ganz zutreffend wichtige Begriffe: „Ein Symptom ist, wenn es Dinge sind, die es gar nicht gibt und Inkubationszeit ist, wenn nach der OP man sich ausruhen kann.“ Und er hat noch etwas herausgefunden: „Die Funktion des Herzens ist, dass man atmen kann.“
Christine hat die Abbildung im Buch irgendwie ... nicht ganz ... richtig interpretiert. Sie meint: „Es gibt ja 2 Lungen und bei beiden ist was unterschiedlich. Bei einer Lunge kommt das Essen rein und bei der andern atmet man aus und ein.“
Ihre Nachbarin ist anderer Meinung: „Die Speiseröhre ist ja in der Lunge und wenn man isst, kommt das ganze Essen in die Speiseröhre und das Unnötige läuft bei der Lunge durch.“ Ihre Nachbarin ergänzt: „Sie macht aus der Luft Kohlendioxid.“
Zum Glück sieht Olga da noch eine Alternative: „Die Aufgabe der Lunge ist zu schlucken, zu atmen, zu reden und sich zu übergeben.“ Sie weiß auch, welche Folgen es hat, wenn man zu wenig Vitamine zu sich nimmt: „Keine Energie, dumm, man weiß nicht, was man macht.“
Auch zur Leber gibt es überzeugende Erklärungen: „Mit der Lunge atmet man und wenn man isst, dann flutscht‘s auch durch die Leber.“
Nach gründlicher Recherche oder möglicherweise auch eigener Beobachtung hat Anika dann herausgefunden, wie sich Einzeller vermehren: „Sie legen Eier, so vermehren sie sich!“
Wirklich bemerkenswert ist Isabelles enorme Planungskompetenz. So beginnt sie ihre Ausarbeitung über die Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt im Laufe der Erdgeschichte so: „Vor 600 Millionen Jahren fing ich mit meinem Referat an, …“
Gewisse kulturelle Vorurteile treten bei Norias Frage nach den Ernährungsgewohnheiten in Afrika zu Tage. „Stimmt es, dass die Afrikaner Steine essen?“, fragt sie mich in ihrem Heft fürs 5 - Minuten - Schreiben, „Sie zermatschen die Steine und essen das wie Brot, stimmt das?“, spezifiziert sie noch, aber nach Lage der Dinge kann ich das eindeutig verneinen.
Einem Text über die Bedeutung des Immunsystems entnimmt Batuhan folgende Erkenntnisse: „Einen Generalstreik könnten wir keine 48 Stunden überleben.“ Und außerdem: „Fieber ist, wenn es sehr kalt ist und man zittert und Kopfschmerzen hat.“
Leider führen im Deutschunterricht Formulierungshilfen nicht immer zum gewünschten Ergebnis, wie Batuhan in seiner Inhaltsangabe verdeutlicht: „In der Kurzgeschichte „der Feigling“ geht es darum“, schreibt er, „ ... dass es um einen Jungen geht, ... und dass was passiert, ist ein Streit, aber er hat noch nicht alles gesagt ...“ Puh! Es ist aber auch wirklich anstrengend.
Abschließend macht sich Achmed Gedanken über Frauen in Männerberufen und Jungs in Frauenberufen: „...Teilweise ist es gut, aber es ist nicht gut bei Frauen, beispielsweise bei Metall, die können nicht mit dem Material umgehen, haben Angst und bei den Jungs ist es Putzen, sie haben keinen Bock, wollen nicht, wollen lieber Videospiele spielen ...“
Wie man sieht, es bleibt noch einiges zu tun.
NUTZLOS
Auch wohlmeinende Schüler reagieren oft mit Unverständnis, wenn andere als die gewöhnlich benutzten Zeiten besprochen und gelernt werden sollen. Rufen schon Plusquamperfektformen wie „Er hatte dazu keine Lust gehabt.“ oder „Sie war in der Türkei gewesen.“ Kopfschütteln hervor, so ist es bei Futur II oder auch einigen Passivformen endgültig aus. „Der Zug wird angekommen sein“ oder „Der Lohn wird ausgezahlt worden sein“…
Can lächelt mich freundlich an und schüttelt ein bisschen den Kopf. „Jetzt übertreiben Sie aber echt“, meint er und glaubt, dass ich mir das ausgedacht habe. „Mal ehrlich, wer hat das schon mal gehört?“ Fröhlich schaut er in die Runde. Natürlich niemand. Na also! Und auch Adile will da nicht mehr mitziehen, auch wenn sie den Unterschied zwischen gesprochener und Schriftsprache eigentlich schon verstanden hat. „Och, Herr Benthack“, mault sie, „warum soll’n wir die Wörter denn lernen, wir gebrauchen die doch nie!“ Spätestens 6 Jahre später, wenn sie mit der Oberstufe fertig ist, wird sie ihr Wissen gebraucht haben können.
Manchmal verliere ich auch die Geduld, wenn alle so tun, als wüssten sie gar nichts, zumindest was Grammatik betrifft. Da rutscht mir schon mal ein „Das kann doch nicht sein, dass das niemand weiß! Ihr habt jetzt schon 9 Jahre lang Grammatik gehabt!“ heraus. Da ernte ich Zustimmung der besonderen Art:
„Ja, Herr Benthack, wir wissen noch nicht mal, was letzte Woche war, wie sollen wir Sachen von vor 9 Jahren wissen?“
Motivationsprobleme auch im Mathematikunterricht. Der Unterschied zwischen Umfang und Fläche. Wir haben im Heft Flächen ausgelegt und Umfänge mit Stiften umfahren, sind in der Klasse und im Schulgelände umhergelaufen und sind Umfänge abgelaufen und haben uns in Flächen hineingelegt, haben Anwendungsbeispiele gesucht und uns den Nutzen im praktischen Leben versucht klarzumachen. Monica und einige ihrer Freundinnen verstehen es aber einfach nicht. Das macht sie traurig. Mich auch. „Wozu brauchen wir das denn? Lassen Sie uns was anderes machen.“ „Na, überleg mal, wenn du später eine eigene Wohnung hast, musst du dir Farbe kaufen und dann ist es ja gut, wenn du weißt, wie groß die Fläche ist. Sonst hast du nachher zu wenig oder du gibst viel zu viel Geld aus, weil du zu viel gekauft hast.“
„Ach was“, meint Monica, „das macht mein Freund für mich.“
LEIDER ARM
Für meine neue 5. Klasse habe ich zum Thema „Der Urmensch“ in der Bücherhalle eine Blockausleihe gemacht und deswegen heute eine ganze Menge verschiedener Bücher für die Schüler mitgebracht.
Im Moment liegen sie aber noch im Kofferraum meines Autos. In der großen Pause will ich diese Bücher mit einigen Schülern, die mir beim Tragen helfen, in die Klasse bringen.
Im Alter von 11/12 Jahren machen Schüler so etwas fast alle sehr gern und ich wähle für solche Dienste oft Schüler aus, mit denen es im Unterricht Schwierigkeiten gibt, damit ich sie mal loben kann und vielleicht auch etwas mit ihnen ins Gespräch komme. Heute sind es Caner und Ferhat, deren Eltern aus dem Libanon bzw. aus der Türkei stammen. Begeistert folgen sie mir auf den Parkplatz, froh über die wichtige Aufgabe, die sie erledigen sollen und das Vertrauen, das ich ihnen schenke.
Allerdings interessiert sie auch sehr, was für einen Wagen ihr neuer Klassenlehrer denn wohl fährt. Da sind sie einiges gewöhnt, ein BMW sollte es wohl schon sein. Das fällt mir aber erst später auf, als die Eltern zum ersten Elternabend kommen.
Jetzt merke ich, wie Caners Schritte sich verlangsamen, als wir uns dem alten Polo nähern, den ich letztens unserer Nachbarin abgekauft habe. Sein Blick wandert von diesem Wagen, den er nun richtig als meinen erkennt, zu mir und wieder zurück. Langsam kommt er hinterher und scheint etwas sagen zu wollen. Traut sich aber nicht. Dann, während ich den beiden die Bücher zum Tragen auf die Arme lege, fasst er sich doch ein Herz und versucht es diplomatisch:
„Herr Benthack, sagen Sie mal, …was verdient man eigentlich so als Lehrer?“
ERWÜRGT
Sprache dient der Verständigung, meistens jedenfalls. Manchmal auch der Missverständigung.
So verlassen mindestens 50 Prozent der Schüler*innen den Biologieunterricht mit der Vorstellung von einem „Zwergfeld“ in ihrem Bauchraum. Was sollte denn auch so ein Zwerch sein? Ein Zwerg in den Eingeweiden dagegen könnte ja noch irgendeine Funktion haben. Aber Zwerch? Ähnliches beim Trommelfell. Was ist überhaupt ein Fell? Feld ist doch viel wahrscheinlicher. „Trommelfeld“ - da kann man sich wirklich irgendwie mehr vorstellen. Und der Begriff „Feld“ knüpft ja auch an die Lebenswelt der Schüler an. Fußballfeld, Spielfeld, er fällt ... hin. Ein sogenanntes „Trommelfeld“ im Ohr ist dann natürlich die logische Folge.
Am liebsten aber habe ich das „Gehörn“. Hört sich ja auch fast genauso an wie Gehirn. Der Schädelknochen schützt das Gehörn. Die Fortentwicklung des Menschen zeigt sich an der zunehmenden Größe seines Gehörns. Das erklärt ja wohl alles!
Da Bakterien ja ohnehin ziemlich eklig sind und man mit ihnen nichts zu tun haben möchte, ist es irgendwo auch nachvollziehbar, dass sie außen keine Hülle, sondern eine sogenannte „Schleimhölle“ besitzen.
Witzig finde ich auch den Wunsch, endlich einmal eine „Schneeballschlag“ machen zu dürfen, denn hier stimmt die Wortschöpfung mit dem schon oft Beobachteten geradezu perfekt überein.
Manchmal ist es auch schwierig mit Wortkombinationen. So bleibt die Frage „Welcher Datum ist der Woche?“ ein wenig im Unklaren, und auch die Seitenangabe „Nein, ich bin auf hundertdrei und etwas Seite!“ kann zu Verwirrung führen. Aber macht nichts, bedenklicher ist da: „Lieber Michael, ich wollte mich bei dir entschuldigen, weil ich dich erwürgt habe, ich wusste ja nicht, dass es so ernst war, es tut mir leid und hoffentlich nimmst du die Entschuldigung an.“ Na hoffentlich kriegt Michael das noch hin.
Auch Schulleitungen formulieren nicht immer ganz klar, ob mangels sprachlicher Kompetenz oder zur Verschleierung inhaltlicher Leere ist dabei nicht immer eindeutig zu unterscheiden. Immerhin konnte der Satz: „Wir haben hier eine gute Möglichkeit, strategisch da was zu setzen“, das Kollegium nicht davon abhalten, dann doch einen Beschwerdebrief an den Senator zu verfassen.
Möglicherweise hat Nataschas Mutter einige durch ihre Herkunft geprägte Vorstellungen über die Machtverhältnisse an der Schule, wirkt aber durchaus noch optimistisch, wenn sie schreibt: „Natascha hat um 13 Uhr ein Vorstellungsgespräch und deswegen bitte ich Ihnen sie um 12.30 Uhr freilassen.“ Freilassen ohne Haftprüfungstermin, so weit kommt das noch.
Nicht ganz korrekt, aber absolut verständlich drückt sich dagegen Natalie aus, als sie im Regen und auf schlammigem Untergrund stehend, nass und kurz vor Beginn des zumindest unter diesen Bedingungen ungeliebten Laufs um den See („Sponsored Walk“) bemerkt, dass gleich um die Ecke Edonas Mutter mit ihrem Auto steht und auf ihre Tochter wartet: „Wenn ich du wär, ich würd so heftig in mein Auto reingehen, ich schwör!“, ruft sie aufgebracht, und ich muss so lachen, als ich mir vorstelle, wie Natalie heftig in ihr Auto reingeht und versuche auch dieses Einsteigen mal pantomimisch ... Na gut, darin bin ich kein Meister, aber Natalie und die anderen Mädchen aus der Klasse sind fröhlich und lachen auch. Natalie ist sowieso meistens fröhlich. Und Schule kann auch im Kleinen schön sein.





























