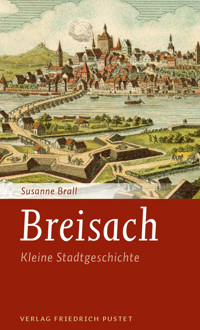
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kleine Stadtgeschichten
- Sprache: Deutsch
Breisach am Rhein kann auf über 1.650 Jahre turbulenter Geschichte zurückblicken. Die strategische Lage des Breisacher Münsterbergs am Rhein hat seit frühester Zeit Siedler und Krieger angezogen und die Geschichte der Stadt entscheidend geprägt. Vom keltischen Fürstensitz zur stärksten Militärfestung am Oberrhein bis hin zur fast völligen Zerstörung; umkämpft und umworben von Staufern, Zähringern, Burgundern, Habsburgern und Bourbonen gleichermaßen: Die Stadt erlebte kaum ruhige Phasen in ihrer Geschichte. Mit einem Blick auf besondere Ereignisse und Persönlichkeiten der Stadt, gespickt mit unterhaltsamen Anekdoten, schildert die Autorin die Geschichte von Breisach am Rhein, dem bereits 1964 der Titel "Europastadt" verliehen wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Brall
Breisach
Kleine Stadtgeschichte
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATION DER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg
Tel. 0941/920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3430-9
Reihen-/Umschlaggestaltung und Layout: www.martinveicht.de
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2023
eISBN 978-3-7917-6244-9 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie unter www.verlag-pustet.de
Inhalt
Ein Berg mit Anziehungskraft – von der Antike bis zum Mittelalter
In grauer Vorzeit / Keltische Siedlungsspuren / Mons Brisiacus – das römische Breisach / Ein lang verschollener Grabstein / Im frühen Mittelalter / Die erste Belagerung der Geschichte
Häufige Herrschaftswechsel: das unruhige Mittelalter
Vom Herzogtum Schwaben zum Bistum von Basel / Die Breisacher Stadtpatrone / Der Vertrag von 1185 / Das Breisacher Münster / Berthold V. von Zähringen und Breisach / Der Radbrunnen / Wieder unter den Staufern / Zurück zum Bistum Basel / Breisach als Reichsstadt / Das Stadtrecht von 1275
Breisach als Teil Vorderösterreichs – der Weg zur Festung
Breisach wird habsburgisch / Das Pestpogrom / Breisach und Burgund / Langsamer Wandel von der Handelsstadt zur Festung / Die Reformation / Der Bauernkrieg / Das Haasentörle – eine misslungene Predigt und ihre Folgen / Vom Bauernkrieg bis zum Dreißigjährigen Krieg / Das Kloster Marienau – ein Opfer des Bauernkrieges / Hexenverfolgungen
Der Dreißigjährige Krieg
Belagerung durch die Schweden / Belagerung durch Bernhard von Sachsen-Weimar
Spielball zwischen Habsburg und Frankreich
Breisach wird französisch / Neuf-Brisach – das letzte Meisterwerk Vaubans / Erneute Belagerung / »Troja in Breisach« / Das Ende der Festung / 1793 – fast das Ende der Stadt / Pantaleon Rosmann / Das Herzogtum Breisgau-Modena
Von Ruinen zur Garnisonsstadt: das 19. Jahrhundert
Breisach und Baden / Die Revolution kommt nach Breisach / Der Deutsch-Französische Krieg / Die Rheinbegradigung bei Breisach / Vom Deutsch-Französischen Krieg zum Ersten Weltkrieg / Neuer Wind und umfassende Modernisierung
Not, Zerstörung und Hoffnung: Breisach im 20. Jahrhundert
Der Erste Weltkrieg / Die Folgen des Versailler Vertrags / Die »Elsässer-Häuser« / Zwischen den Weltkriegen / Die Breisacher Festspiele / Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs / Das Schicksal der jüdischen Gemeinde / 1944–1945: Der Untergang der Stadt / Der Wiederaufbau / Spuren des Krieges im Münster / Aufbruch in die Zukunft
Anhang
Zeittafel / Literaturverzeichnis / Stadtplan / Register / Bildnachweis
Ein Berg mit Anziehungskraft – von der Antike bis zum Mittelalter
In grauer Vorzeit
Im Jahr 369 n. Chr. besuchte Kaiser Valentinian I. (312–375) das römische Kastell auf dem Breisacher Münsterberg. Er erließ hier ein Gesetz, dessen Inhalt mit seinem Aufenthaltsort gar nichts zu tun hatte, ihn aber ausdrücklich benannte: Mons Brisiacus – die Wurzeln des heutigen Breisachs. Dies war die erste schriftliche Erwähnung Breisachs, weshalb die Stadt im Jahre 2019 stolz ihr 1650-jähriges Bestehen feierte. Die Anfänge der Besiedlung des Breisacher Bergs, der sich ungefähr 40 m über der Rheinebene erhebt, reichen aber noch weiter zurück.
Wer heute nach Breisach kommt, findet eine völlig andere Topografie vor als die Siedler der Antike. Durch Rheinbegradigung und Flurbereinigung hat sich die Landschaft vor allem in den letzten 200 Jahren stark verändert. Die Rheinauen waren breite sumpfartige Gebiete, die eine Besiedlung der Ufer nahezu unmöglich machten. Bis ins 19. Jh. floss der Hauptarm des Rheins westlich eng am Fuße des Breisacher Bergs vorbei, allerdings gab es auch östlich des Berges Nebenarme. Hochwasser veränderten häufig den Lauf des Flusses, so dass der schroffe Felsen manchmal sogar zur Insel wurde und auf beiden Seiten direkt vom Rhein umflossen wurde. Diese Situation spiegelt auch der spätere keltische Name des Ortes wider: »Brisiac«, der Wasserbrecher.
Der Münsterberg, geologisch ein Teil des längst erloschenen Vulkangebietes Kaiserstuhl, lag isoliert im Gewirr verschiedener Rheinarme und bot sich mehr als Schutz- und Fluchtort an, weniger als permanenter Siedlungsort. Er sah ursprünglich anders aus als heute: Es gab zwei Kuppen, im Süden und im Norden, mit einer deutlichen Senke dazwischen. Die Senke wurde aber schon zur Zeit der Kelten aufgefüllt, als die Menschen begannen, den Berg nach ihren Vorstellungen zu formen. So wurde das Plateau geschaffen, auf dem die Oberstadt heute liegt.
Ansicht des Breisacher Bergs aus dem 19. Jahrhundert. Bis zu seiner Begradigung floss der Rhein direkt an der Westseite des Bergs vorbei.
Keltische Siedlungsspuren
Die Frage, ab wann Menschen den Breisacher Berg besiedelten, lässt sich noch nicht abschließend beantworten, auch wenn einzelne Funde nahelegen, dass schon die Menschen der Jungsteinzeit auf dem Berg lebten. Im 2. Jh. vor Chr. gründeten Kelten die Siedlung Breisach-Hochstetten. Sie verfügten über ausgezeichnete Handelsbeziehungen, wie Grabungsfunde belegen, und machten damit die Siedlung zu einem Warenumschlagplatz für Importgüter aus dem Süden.
Das Plateau des Breisacher Bergs misst ungefähr 550 auf 200 m und war daher zu klein, um eine größere Bevölkerungsgruppe allein durch Landwirtschaft und Viehzucht zu ernähren. Dafür aber bot der Berg erhebliche strategische Vorteile: Er fällt nach Osten, Westen und Süden schroff ab, nur im Norden neigt er sich etwas sanfter ins Tal, was das Anlegen von Zufahrtswegen erleichterte. Der offene Blick ins gesamte Umland war aus militärischer und strategischer Sicht ebenfalls vorteilhaft, konnte man doch schon frühzeitig erkennen, ob sich jemand in feindlicher Absicht näherte. Und nicht zuletzt konnte von dort oben der Verkehr auf dem Rhein kontrolliert werden, der schon in der Vor- und Frühgeschichte eine wichtige Rolle als Handelsroute spielte.
In der einschlägigen Literatur wird oft von einem keltischen »Fürstensitz« in Breisach gesprochen. Eine dichtere Besiedlung mit größerer Bevölkerungszahl und entwickelten Strukturen wird erst für das 1. Jh. vor Chr. angenommen. Münzfunde legen nahe, dass sich in Breisach in der späten Latènezeit eine keltische Münzstätte befand. Andere Funde zeigen, dass man auf dem Berg Importe aus südlichen Ländern wie Wein aus Marseille schätzte. Breisach war militärisch und wirtschaftlich nach Basel der wichtigste keltische Standort in der Oberrheinebene. Im 1. Jh. vor Chr. finden die keltischen Großsiedlungen am Hoch- und Oberrhein, ob nun in der Ebene oder auf den Höhen, ein abruptes Ende. Die Gründe dafür sind noch nicht klar – die Vermutungen reichen von innerkeltischen Machtkämpfen hin zu externen kriegerischen Bedrohungen durch einfallende Germanenstämme, die die einheimischen Kelten zur Auswanderung bewegten. Grabungsfunde legen nahe, dass die Besiedlung um 30 v. Chr. endete, und der Berg vermutlich völlig verlassen wurde.
Der Breisacher Berg mit der Oberstadt, von Westen. Am Südende des Berges steht das Münster.
Mons Brisiacus – das römische Breisach
Wann also entdeckten die Römer den Breisacher Berg für sich? Funde aus dem späten 3. Jh. n. Chr. lassen vermuten, dass der Berg nach 300 Jahren, in denen keine fortlaufende Besiedlung nachgewiesen werden kann, wieder bewohnt wurde. Der Oberrhein wurde durch die Krisen und Kriege des 3. Jhs. n. Chr. mit der Aufgabe des obergermanischen Limes und der Einrichtung der Provinz Sequania unter Kaiser Diokletian (um 236–um 312) zu einem Randbereich des Römischen Reichs und so zum Grenzgebiet, das es zu befestigen galt. Damit empfahl sich der Breisacher Berg von neuem als idealer Militärstützpunkt: Die Grenze der Provinz Sequania verlief ungefähr 12 km nördlich von Breisach bei Sasbach über den Rhein, und der Breisacher Berg lag an einem römischen Verkehrsknotenpunkt, an dem sich gleich mehrere Fernstraßen kreuzten. In unmittelbarer Nähe gab es weitere römische Stützpunkte, mit denen Breisach im Austausch stand: Kembs und Oedenburg-Biesheim im Elsass.
Dank mehrerer Ausgrabungen auf dem Berg im späten 20. Jh. kann man den römischen Siedlungsbeginn aufgrund von Münzfunden in das letzte Viertel des 3. Jhs. datieren. Bei einer Baumaßnahme im Jahr 1969/1970 wurde auf dem Münsterplatz ein großer Mauerkomplex gefunden, der teilweise unter dem heutigen Münster liegt. Das war das Prätorium, das Hauptverwaltungsgebäude des Lagers, in dem es auch Unterkünfte für höher gestellte Persönlichkeiten und Gäste gab.
Trotzdem ist es nicht ganz einfach, das Aussehen der römischen Festung nachzuvollziehen, da spätere Siedlungen sowie die großen Zerstörungen im Laufe der Geschichte kaum etwas vom römischen Breisach bewahrt haben. Mittelalterliche Terrassierungen, Befestigungsanlagen, Zerstörungen und Wiederaufbauten haben das Terrain stark verändert und die Spuren der Vergangenheit beseitigt. Gesichert ist heute, dass sich das Kastell vom Münsterplatz bis kurz vor den Radbrunnenturm erstreckte. Mit einer Fläche von über 3 Hektar zählte es zu den größten spätrömischen Kastellanlagen am südlichen Oberrhein.
Rekonstruktionsskizze des Römerlagers Mons Brisiacus. Das große Gebäude am Südende ist das Prätorium, dessen Fundamente unter dem heutigen Münsterplatz gefunden wurden.
Auch wenn Schildbuckel, Reitersporne und Helme zeigen, dass die Siedlung überwiegend militärisch geprägt war, öffnen die archäologischen Funde ein Fenster in den Alltag auf dem Mons Brisiacus: Verschiedene Typen von Amphoren zeigen, dass in Breisach Olivenöl aus Spanien verwendet wurde; gute Weine kamen aus Süditalien und Gallien und sogar aus Nordafrika. Auch die bei den Römern so beliebte Fischsauce, Liquamen genannt, wurde aus Südspanien nach Breisach geliefert. Der Mons Brisiacus war gut an das Wege- und Handelsnetz angeschlossen und man war in der Lage, einen Kaiser angemessen unterzubringen und zu versorgen. Kaiser Valentinian I. kümmerte sich maßgeblich um eine Verstärkung der Grenzen durch den Ausbau von Militäranlagen. Das war auch der Hintergrund seiner Reise an den Oberrhein, bei der er 369 n. Chr. sowohl Basilia (Basel) und Augusta Raurica (Kaiseraugst) sowie den Mons Brisiacus besuchte. Dank des Besuchs des Kaisers findet sich Breisach im Codex Theodosianus, einer spätrömischen Gesetzessammlung, in der auch Datum und Ort des Erlasses genannt wurden. Valentinian I. unterzeichnete hier am 30. August 369 n. Chr. einen Erlass über die Urlaubszeiten der Beamten und anderer kaiserlicher Angestellter. So kann Breisach übrigens auch als einzige Stadt in Baden-Württemberg sicher von sich sagen, dass sie von einem römischen Kaiser besucht wurde. Dieser Erlass war die eingangs angesprochene erste schriftliche Erwähnung Breisachs.
HINTERGRUND
EIN LANG VERSCHOLLENER GRABSTEIN
2013 bemerkte Pfarrer Werner Bauer, dass eine Stufe der Außentreppe in den Keller seines Pfarrhauses mit seltsamen Zeichen versehen war. Er zeigte seine Entdeckung dem Stadtarchivar Uwe Fahrer, der den Stein dank seiner großen Bibliothek zuordnen konnte: Der Stein wurde um 1843 bei der Freilegung eines Fundaments gefunden, fotografiert und in den Pfarrhof gebracht, da sich der damalige Pfarrer für historische Artefakte interessierte. Dort lag er im Garten und galt seit Mitte des 19. Jhs als verschollen. Es handelt sich um das Fragment eines römischen Grabsteins. Saturninus Boudillius war ein Bewohner des Münsterbergs, der im Alter von 30 Jahren hier starb. Nach 1859 wurde die Außentreppe zum Pfarrhauskeller erneuert. Der Steinmetz hatte sich verrechnet, und am Ende fehlte die letzte Stufe. Statt nun eine neue Sandsteinstufe zu besorgen, nahm er – ohne Wissen des Pfarrers – den im Pfarrgarten liegenden »Römerstein«, teilte ihn in der Mitte und benutzte ihn als oberste Stufe für die Treppe. Dort blieb seine wahre Bedeutung über ein Jahrhundert lang unbemerkt … bis zu seiner Wiederentdeckung! Heute steht der Grabstein im Museum für Stadtgeschichte, an der Mauer des Pfarrhauses befindet sich eine originalgetreue Kopie.
Im ersten Drittel des 5. Jhs. wurde das Kastell Mons Brisiacus aufgegeben. Nur ein paar Jahre später fielen Germanenstämme in den Westen des römischen Reichs ein. Die Rheingrenze brach zusammen. Die Zerstörung großer Teile der römischen Militär- und Verwaltungsstrukturen führte dazu, dass viele Befestigungsanlagen aufgegeben wurden. Dazu gehörte auch das Kastell in Breisach.
Im frühen Mittelalter
Nach dem Abzug der Römer setzt eine Zeit von ungefähr 500 Jahren ein, in der schriftliche Quellen über Breisach bislang vollkommen fehlen. Daher gingen die meisten Historiker lange Zeit davon aus, dass der Breisacher Berg in der letzten Phase der Spätantike und im Frühmittelalter nicht besiedelt war.
Im späten 20. und frühen 21. Jh. wurden auf dem Münsterberg mehrfach an verschiedenen Stellen archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Dabei fanden Archäologen Keramikscherben, welche sie zweifelsfrei in die zweite Hälfte des 5. Jhs. datieren konnten, also in die Zeit, in der das Römerkastell Mons Brisiacus bereits aufgegeben worden war. Es lässt sich somit mit Sicherheit sagen, dass nach Abzug der Römer auf dem Berg sowohl innerhalb als auch außerhalb des ehemaligen Kastells Menschen siedelten, vermutlich Angehörige von mit den Römern verbündeten Germanenstämmen wie den Alamannen.
Die römischen Mauern des Kastells standen nachweisbar noch bis ins 12. Jh. hinein und boten den frühen Bewohnern Breisachs Schutz. Inwieweit römische Gebäude innerhalb der Mauern noch genutzt wurden, ist nicht zu belegen. Den neueren Ausgrabungen verdanken wir nun auch die Sicherheit, dass der Berg während der »quellenarmen« Zeit durchgehend besiedelt war, denn mittlerweile wurden auch Funde in die Zeit nach dem 5. Jh. n. Chr. datiert. Reste von frühmittelalterlichen Grubenhäusern deuten auf eine größere frühmittelalterliche Siedlung hin, während andere Funde, wie importierte Keramik und das Bodenfragment eines Glasbechers, sogar zeigen, dass die Bewohner einen recht gehobenen Lebensstandard genossen. Weitere Funde erbrachten den Beweis für die Existenz verschiedener Werkstätten – von Knochenschnitzerei bis hin zur Herstellung von Textilien, Lederwaren und Gegenständen aus Buntmetall. Auch Glas wurde auf dem Münsterberg hergestellt. Waffenfunde wie Pfeilspitzen, Schildbuckel und eine Lanzenspitze weisen darauf hin, dass das frühmittelalterliche Breisach durchaus wehrhaft war. Diese Beweise für die Besiedlung des Berges setzen sich bis ins 11. Jh. fort. Aus den Funden lässt sich weiterhin eine recht rege Handelstätigkeit ableiten, mit Handelsbeziehungen, die weit den Rhein entlang reichten. Die Qualität der Funde legt eine wohlhabende Gesellschaft, vielleicht sogar einen Herrschaftssitz nahe.
HINTERGRUND
DIE ERSTE BELAGERUNG DER GESCHICHTE
Der Chronist Liutprand (920–um 972) beschreibt im Jahre 938 Breisach als eine befestigte Siedlung, die vom Rhein umflossen wurde und über schroff aufragende Felswände verfügte. Diese günstigen Voraussetzungen sollten sich ein Jahr später bezahlt machen, als Breisach sich plötzlich im Mittelpunkt einer kriegerischen Auseinandersetzung wiederfand. Im Jahr 939 musste sich König Otto I. (912–973), ab 962 als »Otto der Große« römisch-deutscher Kaiser, mit einer Rebellion gegen seine Herrschaft auseinandersetzen: Sein jüngerer Bruder Heinrich (um 919–955), sein Schwager Herzog Giselbert von Lothringen (890–939) und Herzog Eberhard von Franken (885–939) lehnten sich gemeinsam gegen ihn auf. Ein großer Teil der Truppen des Frankenherzogs hatte sich auf dem Berg in Breisach verschanzt. Ob die Breisacher Bevölkerung das unterstützte oder ob sie besetzt worden war, ist leider nicht feststellbar. Im Spätsommer 939 belagerte Otto Breisach, konnte es aber nicht einnehmen. Einmal mehr erwies sich der Breisacher Berg als von strategisch und militärisch herausragender Bedeutung. Letztendlich blieb er aber ein Nebenschauplatz dieses Aufstands. Während Otto erfolglos Breisach belagerte, entschied sich der Konflikt ohne Ottos direkte Einflussnahme weiter nördlich: In der Schlacht von Andernach im Oktober 939 überraschte Herzog Hermann von Schwaben, ein Gefolgsmann Ottos, mit seinen Truppen die Aufständischen beim Überqueren des Rheins. Dabei kamen die beiden aufständischen Herzöge ums Leben: Eberhard wurde erschlagen, Giselbert ertrank im Rhein.
Für Breisach hatte die Schlacht von Andernach direkte Konsequenzen. Der Krieg war vorbei, und die Truppen des toten Frankenherzogs Eberhard, die immer noch auf dem Breisacher Berg ausharrten, unterstellten sich König Otto I., der Breisach nun offiziell in Besitz nahm und seinem treuen Kriegsgefährten Herzog Herrmann von Schwaben zu Lehen gab.
Häufige Herrschaftswechsel: das unruhige Mittelalter
Während des 10. Jhs. blieb Breisach Teil des Herzogtums Schwaben. Die kleine Siedlung auf dem Berg war im Begriff, eine erfolgreiche Stadt zu werden. Die Quellenlage für diese Zeit ist zwar weiterhin relativ dürftig, aber es kann davon ausgegangen werden, dass die Stadt sich langsam, aber stetig weiterentwickelte, Handelsbeziehungen entlang des Rheins intensivierte und einen gewissen Wohlstand hervorbrachte. Das Mittelalter in Breisach war vor allem durch häufige Herrschaftswechsel geprägt. Der strategische Wert des Breisacher Bergs direkt an einer der damals schon wichtigsten Wasserstraßen Europas machte die Stadt nämlich zu einem begehrten Besitztum.
Vom Herzogtum Schwaben zum Bistum von Basel
Wann genau die Herrschaft des schwäbischen Herzogs über Breisach endete, und die Stadt unter die Herrschaft des Basler Bischofs geriet, kann nicht mit Sicherheit datiert werden. Aus dem Jahr 1146 hat sich immerhin eine päpstliche Urkunde erhalten, der zu entnehmen ist, dass Breisach irgendwann zwischen den Jahren 1000 und 1140 an das Bistum Basel überging.
Eine der kuriosesten Nachrichten der Stadtgeschichte stammt aus dem Jahr 1143: Der Chronist des Klosters St. Blasien schreibt in den Annalen des Klosters, dass wohl ein Meteorit auf den Breisacher Münsterberg stürzte! Er berichtet, dass ein »feuriger Stein, gleichsam eine Masse glühenden Eisens vom Himmel vor die Türflügel der Kirche heruntergefallen« sei. Abgesehen davon, dass ein Meteoritenfall an sich schon erwähnenswert ist, haben wir hier auch den allerersten schriftlichen Verweis auf eine Kirche auf dem Münsterberg. Das heutige Münster wurde erst nach 1185 errichtet. Es muss sich also um einen Vorgängerbau gehandelt haben, von dem wir aber leider keine weitere Beschreibung haben und auch nicht wissen, wie alt diese Kirche im Jahr 1143 bereits war. Was aus dem Meteoriten geworden ist, ist ebenfalls nicht bekannt: Der »feurige Stein« ist bis heute verschollen.
HINTERGRUND
DIE BREISACHER STADTPATRONE
Ein herausragendes Ereignis für Breisach war die Ankunft der Reliquien der beiden Stadtheiligen Gervasius und Protasius, die sich der Legende nach so zugetragen haben soll: Nach der Eroberung Mailands 1162 durch Kaiser Friedrich Barbarossa (um 1122–1190) übergab der Kaiser dem späteren Kölner Erzbischof Rainald von Dassel (um 1120–1167) eine große Anzahl von Reliquien, die er in Mailand erbeutet hatte. Das waren vor allem die sterblichen Überreste der Hl. Drei Könige, die heute im Kölner Dom aufbewahrt werden. Aber auch für die Mailänder noch heute sehr bedeutende Heilige wie die beiden frühchristlichen Märtyrer Gervasius und Protasius (gest. um 300) befanden sich darunter. Auf seiner Reise von Mailand nach Köln machte Rainald von Dassel in Breisach Rast, bevor er mit dem Schiff rheinabwärts weiterfuhr. Um sich für die große Gastfreundschaft der Breisacher zu bedanken, schenkte Rainald der Stadt die Gebeine des Protasius. Sein Bruder Gervasius war damit aber offensichtlich nicht einverstanden: Als Rainald am nächsten Tag ablegen wollte, war das Schiff nicht von der Stelle zu bewegen. Gervasius und Protasius waren im Leben Zwillingsbrüder gewesen, und Gervasius hatte anscheinend nicht vor, sich im Tode von Protasius zu trennen. Rainald blieb letztendlich nichts anderes übrig, als den Breisachern auch die Reliquien des Gervasius zu überlassen. Als sich schließlich die Gebeine beider Brüder sicher an Land und in den Händen der Breisacher befanden, löste sich der Bann und Rainalds Schiff konnte davonsegeln.
Viele Details rund um die Geschichte der Breisacher Stadtpatrone bleiben im Dunkeln. Über ihr Leben ist nichts durch verlässliche Dokumente belegt, sodass wir uns auf Legenden stützen müssen. Nach ihrem Märtyrertod gerieten sie in Vergessenheit, bis der Hl. Bischof Ambrosius von Mailand (339–397) im Traum erfuhr, wo sie begraben waren. Er ließ die Gebeine heben und in seine neu gebaute Kirche bringen, die später nach ihm in Sant’Ambrogio umbenannt wurde. Bis heute werden in der Basilika ebenfalls Reliquien der beiden Märtyrer ausgestellt. Das ist aber kein Widerspruch zu den Breisacher Reliquien: Die Körper von Heiligen wurden häufig geteilt und an verschiedene Kirchen gegeben. Es ist somit möglich, dass sowohl in Breisach als auch in Mailand authentische Knochen der Brüder verwahrt werden.
Auch wenn die Verehrung der Stadtheiligen in Breisach über Jahrhunderte durchaus Schwankungen unterlag, sind sie aus dem geistlichen und kulturellen Leben der Stadt nicht wegzudenken: Jedes Jahr am Sonntag nach dem 19. Juni, dem Gedenktag der Heiligen, feiern die Breisacher seit Jahrhunderten das Stadtpatrozinium, bei dem der silberne Reliquienschrein in einer feierlichen Prozession durch die geschmückte Stadt getragen wird.
Der Vertrag von 1185
Das Jahr 1185 markiert eine große politische Veränderung in Breisach. Bischof Heinrich I. von Basel (gest. um 1191) und der römische König und spätere Kaiser Heinrich VI. (1165–1197) schlossen einen Vertrag, in dem die gemeinsame Herrschaft über Breisach und dessen weiterer Ausbau vereinbart wurde. Der Bischof von Basel trat die Hälfte des Hofguts und des Breisacher Berges sowie die Hälfte des Eckartsbergs an Heinrich VI. ab. Die Konsequenz dieses Vertrages war, dass der Bischof und der König Breisach nun gemeinsam besaßen und verwalteten.
Der Vertrag regelte detailliert die Besitzverhältnisse sowie die Nutzung und die Teilung aller Einkünfte und Erträge. Er erlegte dem Bischof und dem König aber auch Pflichten auf: So einigten sie sich darauf, Breisach gemeinsam zu befestigen. Die Mauern des römischen Kastells haben zu diesem Zeitpunkt vermutlich zumindest zum Teil noch gestanden. Die Siedlung war mittlerweile aber über diese Begrenzungen hinausgewachsen. Eine neue Befestigung des Berges war somit sicherlich längst notwendig.
Der Vertrag von 1185 wirft allerdings eine Frage auf: Warum hielt der Bischof von Basel es für nötig, sich mit dem König einen Mitbesitzer ins Boot zu holen? Es ist wahrscheinlich, dass beide Parteien mit dem militärischen Ausbau von Breisach ein Zeichen gegenüber einer anderen Adelsfamilie der Region setzen wollte: den Zähringern. Dieses ursprünglich schwäbische Adelsgeschlecht war seit dem 11. Jh. durch seine Stadtgründungen und Aktivitäten im Südschwarzwald wie Rodungen und Bergbau zu einer der mächtigsten Adelsfamilien des Südwestens aufgestiegen. Die Zähringer hatten durch den Bau und Erwerb von etlichen Burgen im Laufe des 12. Jhs. mehr und mehr Kontrolle über das Wegenetz und die Hauptverkehrsadern im Breisgau erreicht. Was sich aber vollkommen ihrem Einfluss entzog, war die Schifffahrt auf dem Rhein, bis sie um 1170 die Stadt Neuenburg am Rhein gründeten. Damit erwuchs dem Bischof von Basel, der mit Basel und Breisach zwei wichtige Handelsplätze am Rhein besaß, nun auch in diesem Bereich erhebliche Konkurrenz. Der Wunsch nach einer stärkeren Befestigung Breisachs könnte sowohl beim Bischof als auch beim König auch deshalb in den Vordergrund gerückt sein, weil die Zähringer im Jahr 1120 Freiburg gegründet hatten, das sich im Laufe des 12. Jhs. rasch von einer kleinen Marktsiedlung zu einer erfolgreichen, aufstrebenden Stadt entwickelte. Eine starke Machtbasis der Zähringer so nahe an Breisach musste beim Bischof Unruhe auslösen. Das Motiv des Königs dürfte weitergehender gewesen sein: Mit ihrem stetigen Machtausbau kamen die Zähringer den Machtansprüchen der Staufer im Südwesten ins Gehege – der Familie Heinrichs VI.
Der Bischof achtete jedoch im Vertrag von 1185 darauf, dass ihm der Schutz der Staufer auch erhalten blieb. Der König durfte seine Rechte nicht veräußern und dem Bischof so irgendeinen anderen Mitbesitzer vor die Nase setzen. Auch die Erbregelung ist interessant: Der Mitbesitz an Breisach sollte an einen Sohn Heinrichs fallen, der seinem Vater nicht als König nachfolgte. Damit ging der Mitbesitz in den Familienbesitz der Staufer über und war nicht an die Reichskrone geknüpft.
Zwölf Jahre lang verhalf der Vertrag von 1185 Breisach zu stabilen Verhältnissen. Es ist zwar nicht feststellbar, wie viel genau von dem ambitionierten Befestigungsprogramm in die Tat umgesetzt wurde, aber das Vorhaben wurde auf jeden Fall in Angriff genommen. Ein Bauvorhaben aus dieser Zeit, das zwar nicht von militärischer Bedeutung war, aber bis heute für Breisach von unschätzbarem Wert ist, war der Bau des Münsters.
Das Breisacher Münster, begonnen nach 1185.





























