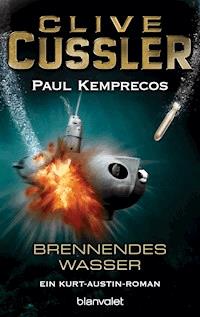
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Kurt Austin leitet eine Mannschaft der NUMA (National Underwater & Marine Agency), die an der mexikanischen Küste zunächst nur den plötzlichen Tod einer seltenen Walart untersuchen soll. Zusammen mit seinem Mini-U-Boot wird er dabei um ein Haar für immer außer Dienst gestellt. Erst nach und nach wird erkennbar, dass die Attacke mit einem scheinbar ganz anderen Spezialauftrag einer weiteren NUMA-Truppe zusammenhängt: Die ist auf den Spuren einer Legende im venezolanischen Regenwald unterwegs. Es geht die Kunde von einer weißen Göttin und einem mysteriösen Stamm mit erstaunlichen technischen Errungenschaften. Kaum jemand glaubt an die Existenz dieses Stammes - und fast niemand hält es tatsächlich für möglich, dass das Wissen um diese Gottheit tatsächlich den Lauf der Geschichte verändern könnte. Doch zu diesen wenigen gehört eine mordlustige Bande von Biopiraten, die es auf Geheimnisse von unermesslichem Wert abgesehen haben. Hinter ihnen steckt ein steinreicher Industrieller aus Kalifornien, der davon überzeugt ist, dass er durch dieses Geheimwissen ein Monopol auf die knapp gewordenen globalen Trinkwasserreserven erlangen kann. Denn er hofft auf eine Formel zu stoßen, durch die man große Mengen Salzwasser in Trinkwasser verwandeln kann. So will er die Welt erpressen und regieren. Mittlerweile hält es auch Austin für möglich, dass die mythische Göttin des venezolanischen Stammes echte wissenschaftliche Wurzeln hat. Aber mit jedem weiteren Schritt in den Urwald hinein fühlen er und sein NUMA-Team sich immer mehr als Fische auf dem Trockenen. Verfolgt von den mörderischen Feinden, müssen sie sich durch einen tödlichen Dschungel aus Verrat, Erpressung und Mord ihren eigenen Weg zur Enthüllung der Geheimnisse um die weiße Göttin bahnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Paul Kemprecos
Brennendes Wasser
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Haufschild
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Blue Gold« bei Pocket Books, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2000 by Clive Cussler
All rights reserved by the Proprietor throughout the world
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2002 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Sabine Wiermann
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15178-2
www.blanvalet.de
Prolog
Flughafen São Paulo,
Brasilien, 1991
Mit kraftvollem Schub der beiden Triebwerke hob die elegante Privatmaschine von der Startbahn ab und stieg in den Himmel über São Paulo empor. Kurz darauf erreichte der Learjet über der größten Stadt Südamerikas seine Reiseflughöhe von zwölftausend Metern und schoss mit einer Geschwindigkeit von achthundert Kilometern pro Stunde in Richtung Nordwesten davon. Auf einem bequemen Sessel im hinteren Teil der Kabine saß mit dem Rücken zur Flugrichtung Professor Francesca Cabral und blickte wehmütig aus dem Fenster auf die flauschige Wolkendecke. Die in Smog gehüllten Straßen und die knisternde Energie ihrer Heimatstadt fehlten ihr schon jetzt. Ein gedämpftes Schnarchen von der anderen Seite des schmalen Gangs riss sie aus ihren Gedanken. Sie warf einen Blick auf den schlafenden Mann mittleren Alters in dem zerknitterten Anzug und fragte sich kopfschüttelnd, was ihren Vater wohl dazu bewogen haben mochte, ihr ausgerechnet Phillipo Rodriques als Leibwächter zuzuweisen.
Francesca zog eine Mappe aus ihrem Aktenkoffer und begann damit, den Rand eines Manuskripts mit Notizen zu versehen. Es enthielt den Text eines Vortrags, den sie auf einer internationalen wissenschaftlichen Umweltkonferenz in Kairo zu halten gedachte. Sie hatte den Entwurf bereits ein Dutzend Mal überarbeitet, doch absolute Gründlichkeit war ihr zur zweiten Natur geworden. Francesca war eine erstklassige Ingenieurin und galt weithin als hervorragende Professorin, aber in einer männlich dominierten Gesellschaft und auf einem ebenso geprägten wissenschaftlichen Fachgebiet musste man als Frau stets ein wenig perfekter sein als alle anderen.
Die Worte auf dem Papier verschwammen. Am Vorabend war Francesca lange aufgeblieben, hatte ihre Sachen gepackt und die Fachunterlagen zusammengestellt. Außerdem war sie viel zu aufgeregt gewesen, um schlafen zu können. Jetzt musterte sie neidisch den dösenden Leibwächter und beschloss, ebenfalls ein Nickerchen zu machen. Sie legte das Redemanuskript beiseite, stellte die Rückenlehne ihres dick gepolsterten Sessels in Ruheposition und schloss die Augen. Das dumpfe Grollen der Turbinen wirkte zusätzlich beruhigend, und schon bald war Francesca eingeschlafen.
Sie träumte. Sie trieb auf dem Meer und stieg in der sanften Dünung wie eine Qualle sachte auf und ab. Es war ein angenehmes Gefühl, bis eine Woge sie plötzlich hoch in die Luft hob und dann wie einen defekten Aufzug steil nach unten stürzen ließ. Ihre Lider öffneten sich zitternd, und ihr Blick schweifte durch die Kabine. Sie fühlte sich seltsam beklommen, als hätte jemand gierig eine Hand nach ihrem Herzen ausgestreckt. Aber alles wirkte normal. Aus den Lautsprechern ertönte leise die betörende Melodie von Antonio Carlos Jobims »One Note Samba«. Phillipo schlief nach wie vor tief und fest. Dennoch blieb der Eindruck, dass etwas nicht in Ordnung war. Francesca beugte sich über den Gang und rüttelte leicht an der Schulter des Mannes. »Phillipo, wachen Sie auf.«
Der Leibwächter schreckte augenblicklich hoch, und seine Hand zuckte zu dem Holster unter der Jacke. Als er Francesca sah, beruhigte er sich wieder.
»Senhora, es tut mir Leid«, sagte er gähnend. »Ich bin eingeschlafen.«
»Ich auch.« Sie hielt inne, als würde sie angestrengt lauschen. »Irgendetwas stimmt hier nicht.«
»Was genau meinen Sie?«
Sie lachte nervös. »Ich weiß es nicht.«
Phillipo lächelte wissend. Er wirkte wie ein Mann, dessen Frau mitten in der Nacht einen Einbrecher zu hören glaubte. Besänftigend tätschelte er Francescas Hand. »Ich schaue mal nach.«
Er stand auf und streckte sich. Dann ging er nach vorn und klopfte an die Tür zum Cockpit. Die Tür öffnete sich, und er steckte den Kopf hindurch. Francesca hörte eine gedämpfte Unterhaltung und leises Gelächter.
Als Phillipo zurückkam, grinste er breit. »Die Piloten sagen, dass alles in Ordnung ist, Senhora.«
Francesca dankte dem Leibwächter, lehnte sich wieder auf dem Sessel zurück und atmete tief durch. Ihre Befürchtungen waren töricht. Die Aussicht, nach zwei Jahren anstrengender Arbeit nicht länger unter solch enormem Druck stehen zu müssen, hatte ihr anscheinend einen regelrechten Schreck eingejagt. Das Projekt hatte sie völlig mit Beschlag belegt, sie zahllose Tag- und Nachtstunden gekostet und ihr Privatleben arg in Mitleidenschaft gezogen. Ihr Blick fiel auf das Sofa, das sich quer über die Rückwand der Kabine erstreckte, und sie widerstand der plötzlichen Regung, sich davon zu vergewissern, dass der Metallkoffer auch weiterhin in dem Versteck hinter den Kissen verstaut war. Sie betrachtete das Gepäckstück am liebsten als eine umgekehrte Büchse der Pandora. Statt Unheil würde Gutes daraus hervorquellen, wenn man den Deckel aufklappte. Francescas Entdeckung würde Gesundheit und Glück für viele Millionen Menschen bedeuten, und die Welt wäre danach niemals mehr wie früher.
Phillipo brachte ihr eine kalte Flasche Orangensaft. Francesca bedankte sich und musste daran denken, wie sehr ihr der Leibwächter in der kurzen Zeit ihrer Bekanntschaft bereits ans Herz gewachsen war. Mit seinem zerknitterten braunen Anzug, dem schütteren grau melierten Haar, dem schmalen Schnurrbart und der runden Brille hätte man ihn problemlos für einen zerstreuten Akademiker halten können. Francesca wusste nicht, dass er viele Jahre darauf verwandt hatte, diesen schüchternen, unbeholfenen Eindruck zu vervollkommnen. Dank seiner sorgsam kultivierten Fähigkeit, wie eine ausgeblichene Tapete mit dem Hintergrund zu verschmelzen, war er zu einem der besten Undercover-Agenten des brasilianischen Geheimdienstes geworden.
Francescas Vater hatte sich mit Bedacht für Rodriques entschieden. Anfangs gefiel es ihr überhaupt nicht, dass ihr Vater auf der Begleitung durch einen Leibwächter bestand. Immerhin war sie bei weitem zu alt für einen Babysitter. Als sie erkannte, dass er wirklich nur aufrichtig um ihr Wohlergehen besorgt war, willigte sie schließlich ein. Allerdings argwöhnte sie, dass ihr Vater sich eher Gedanken um gut aussehende Mitgiftjäger als um eine echte Gefährdung von Francescas Sicherheit machte.
Auch ohne das beträchtliche Vermögen ihrer Familie hätte Francesca die Aufmerksamkeit der Männer erregt. In einem Land mit vornehmlich dunkler Haar- und Hautfarbe stach sie deutlich aus der Masse hervor. Die blauschwarzen mandelförmigen Augen, die langen Wimpern und den nahezu perfekten Mund verdankte sie ihrem japanischen Großvater. Ihre deutsche Großmutter hatte ihr das dunkelblonde Haar, den hohen Wuchs und den teutonischen Starrsinn vererbt, der in ihrem anmutig geformten Kinn zum Ausdruck kam. Und ihre mehr als passable Figur, so hatte sie vor langer Zeit beschlossen, musste wohl mit dem Leben in Brasilien zusammenhängen. Die Körper der brasilianischen Frauen schienen speziell für den Nationaltanz des Landes gestaltet zu sein, die Samba. Francesca hatte die Gaben der Natur zudem durch viele Stunden im Fitnessraum verbessert, wo sie Ablenkung von den Strapazen der Arbeit fand.
Als das japanische Kaiserreich unter zwei Atompilzen zu Schutt und Asche zerfiel, stand Francescas Großvater als untergeordneter Diplomat im Dienst der japanischen Botschaft in Brasilien. Er blieb im Land, heiratete die Tochter eines nun ebenfalls brotlosen Gesandten des Dritten Reiches, wurde brasilianischer Staatsbürger und wandte sich seiner früheren Leidenschaft zu, dem Gartenbau. Dann zogen er und die Familie nach São Paulo, wo er mit seiner Firma als Landschaftsgärtner für die Reichen und Mächtigen arbeitete und im Laufe der Zeit enge Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten aus Regierung und Militär knüpfte. Sein Sohn, Francescas Vater, nutzte diese Kontakte, um mühelos eine hohe Position im Handelsministerium zu erlangen. Ihre Mutter war eine ausgezeichnete Ingenieurstudentin, gab jedoch zugunsten der Ehe und des Kindes die Karriere auf. Sie bereute diese Entscheidung nie – zumindest ließ sie sich nichts dergleichen anmerken –, aber sie war hocherfreut, als Francesca beschloss, in ihre akademischen Fußstapfen zu treten.
Ihr Vater hatte vorgeschlagen, sie mit seinem Privatjet nach New York fliegen zu lassen, wo sie zunächst mit Vertretern der Vereinten Nationen zusammentreffen und dann per Linienflug nach Kairo weiterreisen würde. Sie freute sich über diesen – wenngleich kurzen – Abstecher in die Vereinigten Staaten und wünschte, sie könnte die Maschine schneller fliegen lassen. Das mehrjährige Ingenieurstudium an der Stanford University in Kalifornien würde ihr stets in angenehmer Erinnerung bleiben. Sie sah aus dem Fenster und stellte fest, dass sie nicht wusste, wo genau sie sich derzeit befanden. Die Piloten hatten seit dem Start in São Paulo keinerlei Angaben über den Verlauf des Fluges gemacht. Sie entschuldigte sich kurz bei Phillipo, ging nach vorn und steckte den Kopf ins Cockpit.
»Bom dia, Senhores. Ich frage mich nur gerade, wo wir sind und wie lange der Flug noch dauert.«
Der Kapitän hieß Riordan, ein grobknochiger Amerikaner mit strohblondem Bürstenhaarschnitt und texanischem Akzent. Francesca hatte ihn noch nie zuvor gesehen, aber das war nicht erstaunlich. Genauso wenig wie der Umstand, dass Riordan eine ausländische Staatsangehörigkeit besaß. Die Maschine befand sich zwar in Privatbesitz, doch die Wartung oblag einer einheimischen Fluggesellschaft, die zudem die Piloten stellte.
»Guten Tag«, erwiderte er mit schiefem Grinsen. Sein gedehnter Tonfall und das furchtbar schlechte Portugiesisch taten Francesca in den Ohren weh. »Verzeihen Sie, dass wir Sie nicht auf dem Laufenden gehalten haben, Miss. Ich hab Sie schlafen sehen und wollte nicht stören.« Er zwinkerte seinem Kopiloten zu, einem untersetzten Brasilianer, dessen muskulöse Statur darauf schließen ließ, dass er häufig mit Gewichten hantierte. Der Mann lächelte einfältig und ließ die Augen über Francescas Körper wandern. Sie kam sich wie eine Mutter vor, die zwei unartige Jungen bei einem Streich erwischt hatte.
»Wie sieht unser Zeitplan aus?«, fragte sie betont sachlich.
»Tja, im Augenblick sind wir über Venezuela. In ungefähr drei Stunden dürften wir in Miami eintreffen. Dann vertreten wir uns ein wenig die Beine, während die Maschine aufgetankt wird, und etwa weitere drei Stunden später müssten wir in New York landen.«
Francescas wissenschaftlich geschulte Aufmerksamkeit richtete sich auf die Monitore in der Instrumententafel. Der Kopilot registrierte ihren Blick und konnte nicht umhin, bei der hübschen Frau Eindruck schinden zu wollen.
»Dieses Flugzeug ist dermaßen schlau, dass es von ganz allein fliegen kann, während wir uns im Fernsehen die Fußballspiele angucken«, sagte er und entblößte seine großen Zähne.
»Lassen Sie sich von Carlos nichts vormachen«, sagte der Pilot. »Das hier ist das EFIS, das elektronische Fluginstrumenten-System. Statt der früheren Zeigerskalen verfügen wir heutzutage über Bildschirme.«
»Danke«, entgegnete Francesca höflich. Sie wies auf ein anderes Instrument. »Ist das dort ein Kompass?«
»Sim, sim«, sagte der Kopilot, der hörbar stolz auf seine fachkundige Unterweisung war.
»Warum zeigt er dann an, dass wir fast genau nach Norden fliegen?«, fragte sie stirnrunzelnd. »Müssten wir nach Miami nicht eine etwas westlichere Richtung einschlagen?«
Die beiden Männer sahen sich an. »Sie sind ziemlich aufmerksam, Senhora«, sagte der Texaner. »Stimmt genau. Aber in der Luft ist eine gerade Linie nicht immer der schnellste Weg von einem Punkt zum andern. Das hat mit der Erdkrümmung zu tun. Wenn Sie zum Beispiel von den USA nach Europa fliegen, verläuft der kürzeste Weg zunächst nach oben und dann in einem weiten Bogen nach rechts. Außerdem müssen wir den kubanischen Luftraum berücksichtigen. Schließlich wollen wir dem alten Fidel ja keinen Schreck einjagen.«
Wieder dieses schnelle Zwinkern und Grinsen.
Francesca nickte verständnisvoll. »Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Gentlemen. Es war höchst aufschlussreich. Und jetzt überlasse ich Sie wieder Ihrer Arbeit.«
»Kein Problem, Ma’am. Jederzeit gern.«
Francesca schäumte vor Wut, als sie wieder Platz nahm. Idioten! Hielten die sie für komplett bescheuert? Die Erdkrümmung, lachhaft!
»Alles in Ordnung, wie ich gesagt habe?«, fragte Phillipo und blickte von einer Zeitschrift auf.
Francesca beugte sich über den Gang. »Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, dass dieses Flugzeug vom Kurs abgewichen ist«, sagte sie leise und ruhig und berichtete ihm dann von der Kompassanzeige. »Ich habe im Schlaf irgendwas Seltsames gespürt. Vermutlich war es die Lageänderung der Maschine, als sie die Richtung gewechselt haben.«
»Vielleicht irren Sie sich.«
»Vielleicht. Aber ich glaube, ich habe Recht.«
»Haben Sie die Piloten nach einer Erklärung gefragt?«
»Ja. Sie haben mich mit einer absurden Geschichte abgespeist und behauptet, aufgrund der Erdkrümmung sei die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten keine gerade Linie.«
Er zog eine Augenbraue hoch. Die Erklärung verblüffte ihn offenbar, doch er war noch immer nicht überzeugt. »Ich weiß nicht…«
Francesca fiel noch ein andere Unstimmigkeit ein. »Erinnern Sie sich noch, was die beiden gesagt haben, als sie an Bord gekommen sind? Dass sie Ersatzpiloten seien?«
»Ja, klar. Sie haben gesagt, ihre Kollegen hätten kurzfristig einen anderen Flug übernehmen müssen und sie gebeten, stattdessen einzuspringen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Komisch. Warum haben sie es überhaupt erwähnt? Fast so, als wollten sie von vornherein jede eventuelle Frage abwimmeln. Aber wieso?«
»Ich verstehe auch ein wenig von Navigation«, sagte Phillipo nachdenklich. »Ich werde mich mal selbst überzeugen.« Dann schlenderte er erneut zum Cockpit. Sie hörte die Männer lachen, und nach ein paar Minuten kehrte er lächelnd an seinen Platz zurück. Das Lächeln verschwand, als er sich setzte.
»Im Cockpit befindet sich eine Anzeige, auf der man die ursprüngliche Flugroute sehen kann. Wir befinden uns nicht länger auf der blauen Linie, wie es eigentlich der Fall sein müsste. Und mit dem Kompass haben Sie ebenfalls Recht gehabt«, sagte er. »Wir sind nicht auf dem korrekten Kurs.«
»Was, in Gottes Namen, geht hier vor, Phillipo?«
Seine Miene wurde ernst. »Da ist etwas, wovon Ihr Vater Ihnen nichts erzählt hat.«
»Was denn?«
Phillipo blickte zur geschlossenen Cockpittür. »Ihm ist einiges zu Ohren gekommen. Nichts, das auf eine konkrete Gefahr für Sie hingedeutet hätte, aber genug, um ihn wünschen zu lassen, dass ich mich in Ihrer Nähe befinde, falls Sie Hilfe brauchen.«
»Anscheinend könnten wir jetzt beide etwas Hilfe gebrauchen.«
»Sim, Senhora. Aber leider müssen wir allein zurechtkommen.«
»Haben Sie eine Waffe?«, fragte sie unvermittelt.
»Aber sicher«, erwiderte er und schien leicht amüsiert zu sein, dass diese hübsche und kultivierte Frau ganz nüchtern eine solche Frage stellte. »Soll ich die beiden erschießen?«
»Ich wollte damit… nein, natürlich nicht«, sagte sie niedergeschlagen. »Haben Sie eine Idee?«
»Eine Waffe ist nicht nur zum Schießen da«, sagte er. »Man kann sie auch zur Einschüchterung benutzen und andere Leute dadurch veranlassen, etwas gegen ihren Willen zu tun.«
»Uns beispielsweise in die richtige Richtung zu fliegen?«
»Das hoffe ich, Senhora. Ich gehe nach vorn und bitte die beiden ganz höflich, auf dem nächsten Flughafen zu landen, weil Sie es angeblich so wünschen. Falls die Männer sich weigern, zeige ich ihnen meine Waffe und sage, ich würde sie nur ungern benutzen.«
»Sie dürfen sie nicht benutzen«, warf Francesca beunruhigt ein. »Falls Sie in dieser Höhe ein Loch in die Bordwand schießen, fällt der Kabinendruck ab, und wir alle sind innerhalb weniger Sekunden tot.«
»Gutes Argument. Das wird deren Angst verstärken.« Er nahm ihre Hand und drückte sie. »Ich habe Ihrem Vater versprochen, ich würde auf Sie aufpassen, Senhora.«
Sie schüttelte den Kopf, als ließe die Angelegenheit sich dadurch bereinigen. »Was ist, falls ich mich irre und die beiden bloß unschuldige Piloten sind, die ihre Arbeit tun?«
»Ganz einfach«, entgegnete er achselzuckend. »Wir melden uns über Funk beim Tower, landen auf dem nächsten Flughafen, rufen die Polizei, klären die Sache und setzen dann unsere Reise fort.«
Er verstummte schlagartig. Die Tür zum Cockpit öffnete sich, und der Kapitän betrat die Kabine. Gemächlich näherte er sich den Fluggästen und musste in dem niedrigen Raum den Kopf einziehen.
»Der Witz, den Sie eben erzählt haben, war wirklich gut«, sagte er mit seinem schiefen Grinsen. »Kennen Sie noch einen?«
»Leider nicht, Senhor«, sagte Phillipo.
»Tja, aber ich hab hier einen für Sie«, erwiderte der Pilot und musterte ihn dabei träge unter schweren Lidern. Alles andere als träge war jedoch die flüssige Bewegung, mit der Riordan auf einmal hinter sich griff und eine Pistole aus dem Hosenbund zog.
»Her damit«, sagte er zu Phillipo. »Schön langsam.«
Behutsam schlug Phillipo das Revers seiner Jacke zurück und gab dadurch den Blick auf sein Schulterholster frei. Dann zog er mit den Fingerspitzen die Waffe daraus hervor. Der Pilot nahm sie ihm ab und steckte sie sich in den Gürtel.
»Danke, Amigo«, sagte er. »Es ist stets angenehm, mit einem Profi zu tun zu haben.« Er nahm auf einer Armlehne Platz und zündete sich mit der freien Hand eine Zigarette an. »Ich habe mich mit meinem Partner besprochen, und wir sind beide der Meinung, dass Sie womöglich Lunte gerochen haben. Irgendwie kam es uns so vor, als wollten Sie uns beim zweiten Besuch im Cockpit ausspionieren, und daher haben wir beschlossen, für klare Verhältnisse zu sorgen, damit es keine Missverständnisse gibt.«
»Kapitän Riordan, was geht hier vor?«, fragte Francesca. »Wohin bringen Sie uns?«
»Man hat mich gewarnt, Sie seien ziemlich clever«, sagte der Pilot und lachte leise. »Mein Kumpel hätte lieber nicht mit der Technik des Flugzeugs prahlen sollen.« Er stieß den Tabakrauch durch die Nasenlöcher aus. »Sie haben Recht. Wir fliegen nicht nach Miami, sondern wir sind unterwegs nach Trinidad.«
»Trinidad?«
»Es soll dort wirklich sehr hübsch sein.«
»Was soll das?«
»Ganz einfach, Senhorita. Am Flughafen wartet bereits ein Empfangskomitee auf Sie. Fragen Sie mich nicht, um was für Leute es sich handelt, denn ich habe keine Ahnung. Ich weiß lediglich, dass wir angeheuert wurden, Sie dort abzuliefern. Alles sollte ganz reibungslos vonstatten gehen. Wir hätten Ihnen erzählt, es sei wegen technischer Probleme eine Zwischenlandung notwendig.«
»Was ist mit den Piloten geschehen?«, fragte Phillipo.
»Die hatten einen Unfall«, erwiderte Riordan und zuckte die Achseln. Dann ließ er die Zigarette fallen und trat sie aus. »Ich sage Ihnen, wie es jetzt weitergeht, Miss. Sie rühren sich nicht vom Fleck, dann gibt’s auch keine Schwierigkeiten. Und was Sie anbelangt, cavaleiro, so bedauere ich, dass Sie dank uns wohl Ärger mit Ihren Bossen bekommen dürften. Ich könnte Sie zwar beide fesseln, aber ich vermute, Sie werden keine Dummheiten machen, solange Sie diese Kiste nicht selbst fliegen können. Ach ja, eines noch. Hoch mit Ihnen, Kumpel, und umdrehen!«
Phillipo glaubte, er solle gefilzt werden, und so gehorchte er widerspruchslos. Francescas Warnung kam zu spät. Der Lauf der Waffe sauste wie ein silbriger Schemen herab und traf den Leibwächter mit einem widerlichen Knirschen oberhalb des rechten Ohrs. Phillipo stieß einen lauten Schrei aus und brach zusammen.
Francesca sprang von ihrem Platz auf. »Was soll das?«, rief sie trotzig. »Sie haben seine Waffe. Er hätte Ihnen doch gar nichts tun können.«
»Tut mir Leid, Miss, aber ich gehe lieber auf Nummer Sicher.« Riordan stieg über die auf dem Gang liegende Gestalt hinweg, als handelte es sich um einen Sack Kartoffeln. »Um einen Kerl von Unklugheiten abzuhalten, geht wirklich nichts über einen Schlag auf den Schädel. Da drüben an der Wand hängt ein Verbandkasten. Kümmern Sie sich um den Mann. Damit dürften Sie bis zur Landung genug zu tun haben.« Er tippte sich mit der Hand an den Schirm seiner Mütze, ging zurück ins Cockpit und schloss die Tür hinter sich.
Francesca kniete sich neben ihren bewusstlosen Leibwächter, tränkte einige Stoffservietten mit Mineralwasser und drückte sie auf die Verletzung, bis die Blutung gestillt war. Nach einer gründlichen Reinigung besprühte sie die Platzwunde und den umliegenden Bluterguss mit einem Antiseptikum, fertigte aus einer weiteren Serviette einen Umschlag voller Eiswürfel und presste diesen dann auf den Kopf des Mannes, um die Schwellung zu lindern.
Während Francesca dort neben ihm saß, versuchte sie, eine mögliche Erklärung für die Vorfälle zu finden. Eine Entführung aus finanziellen Gründen schloss sie aus. Allein das von ihr entdeckte Verfahren konnte der Anlass für eine solch groß angelegte Aktion sein. Wer auch immer hinter diesem verrückten Vorhaben steckte, wollte mehr als ein maßstabsgetreues Modell und ein paar Unterlagen über Francescas Projekt. Andernfalls hätte man einfach in ihre Arbeitsräume einbrechen oder am Flughafen ihr Gepäck entwenden können. Doch man brauchte Francesca, denn nur sie persönlich war in der Lage, die Details des Prozesses zu überblicken. Die von ihr entwickelte Methode wirkte dermaßen unergründlich, andersartig und abseits der wissenschaftlichen Norm, dass niemand sonst bislang darauf gekommen war.
Das alles ergab keinen Sinn! In ein oder zwei Tagen wollte sie den Ländern dieser Welt das besagte Verfahren völlig unentgeltlich zur Verfügung stellen. Ohne Patente. Ohne Copyright. Ohne Tantiemen. Absolut kostenfrei. Sie spürte immer größere Wut in sich aufsteigen. Diese skrupellosen Leute hielten sie davon ab, das Los vieler Millionen Menschen zu verbessern.
Phillipo stöhnte. Er kam wieder zu sich. Zunächst blinzelte er benommen, dann klärte sich sein Blick.
»Wie fühlen Sie sich?«, fragte sie.
»Es tut höllisch weh, also bin ich wohl noch am Leben. Bitte helfen Sie mir, mich aufzurichten.«
Francesca legte einen Arm um Phillipos Schultern und zog ihn hoch, bis er sich mit dem Rücken gegen einen Sitz lehnen konnte. Sie schraubte den Verschluss von einer Flasche Rum, die sie aus der Bar geholt hatte, und hob sie an seine Lippen. Er nippte vorsichtig an dem Alkohol, stellte fest, dass sein Magen nicht sofort revoltierte, und trank einen kräftigen Schluck. Dann verharrte er einen Moment lang, um die weitere Wirkung abzuwarten. Als er sich noch immer nicht übergeben musste, begann er zu lächeln. »Jetzt geht’s mir schon besser. Vielen Dank.«
Sie reichte ihm seine Brille. »Ich fürchte, die ist bei dem Schlag zerbrochen.«
Er warf das Gestell beiseite. »Das war ohnehin nur Fensterglas. Ich komme bestens ohne zurecht.« Der kühle Blick, mit dem er Francesca nun tief in die Augen sah, war nicht der eines verängstigten Mannes. Er schaute zu der geschlossenen Cockpittür. »Wie lange war ich bewusstlos?«
»Ungefähr zwanzig Minuten.«
»Gut, dann bleibt noch genug Zeit.«
»Zeit wofür?«
Seine Hand glitt hinunter zum Knöchel und kam mit einem stupsnasigen Revolver wieder zum Vorschein.
»Falls unser Freund nicht so versessen darauf gewesen wäre, mir eins überzubraten, hätte er den hier vermutlich gefunden«, sagte er mit grimmigem Lächeln.
Das war eindeutig nicht mehr derselbe zerknitterte Mann, der eher wie ein zerstreuter Professor als wie ein Leibwächter gewirkt hatte, doch Francescas Erleichterung legte sich sogleich wieder. »Was können Sie denn schon ausrichten? Die beiden haben mindestens zwei Waffen, und wir können die Maschine nicht fliegen.«
»Verzeihung, Senhora Cabral, das ist noch so ein Versäumnis meinerseits.« Er klang beinahe schuldbewusst. »Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich vor meinem Wechsel zum Geheimdienst bei der brasilianischen Luftwaffe war. Bitte helfen Sie mir auf.«
Francesca war sprachlos. Welche weiteren Kaninchen würde dieser Mann wohl noch aus dem Hut ziehen? Sie stützte ihn, bis er sich allein auf zitternden Beinen halten konnte. Eine Minute später schien ihn neue Kraft und Entschlossenheit zu durchströmen. »Sie bleiben hier, bis ich Ihnen weitere Anweisungen erteile«, sagte er im Tonfall eines Mannes, der es gewöhnt war, dass man seinen Befehlen gehorchte.
Dann trat er vor und öffnete die Tür. Der Pilot warf einen Blick über die Schulter. »Na, sieh mal an, wer jetzt schon aus dem Schattenreich zurückgekehrt ist. Ich habe anscheinend nicht hart genug zugeschlagen.«
»Eine zweite Gelegenheit werden Sie nicht erhalten«, sagte Phillipo und drückte dem Texaner schmerzhaft den Lauf des Revolvers hinter das Ohr. »Wenn ich einen von Ihnen erschieße, kann der andere immer noch das Flugzeug fliegen. Meldet sich jemand freiwillig?«
»Verdammt, du hast doch gesagt, du hättest ihm die Waffe abgenommen!«, rief Carlos.
»Ihr Gedächtnis lässt zu wünschen übrig, cavaleiro«, entgegnete der Pilot mit ungerührter Stimme. »Wenn Sie uns umlegen, kann niemand mehr die Kiste in der Luft halten.«
»Doch, cavaleiro. Ich selbst. Leider habe ich meinen Pilotenschein heute nicht dabei. Sie müssen sich schon auf mein Wort verlassen.«
Riordan wandte den Kopf ein kleines Stück zur Seite und sah das kalte Lächeln auf dem Gesicht des Leibwächters.
»Ich nehme zurück, was ich vorhin über den Umgang mit Profis behauptet habe«, sagte Riordan. »Was nun, Kumpel?«
»Geben Sie mir die beiden Waffen. Eine nach der anderen.«
Der Pilot kam der Aufforderung nach, und Phillipo reichte die Pistolen an Francesca weiter, die inzwischen hinter ihm stand.
»Jetzt aufstehen«, befahl Phillipo und wich in die Kabine zurück. »Ganz langsam.«
Riordan blickte zu Carlos und stemmte sich aus dem Sitz. Dann deutete er mit ausgestreckten Fingern eine Drehbewegung an, während sein Körper die Geste vor Phillipo abschirmte. Der Kopilot nickte kaum merklich.
Der Leibwächter trat immer weiter in die Kabine zurück, und der Pilot folgte ihm wie an einer imaginären Leine. »Ich möchte, dass Sie sich mit dem Gesicht nach unten auf das Sofa legen«, sagte Phillipo und behielt die Waffe unterdessen auf Riordans Brust gerichtet.
»Prima, ich habe mich schon auf ein Nickerchen gefreut«, sagte der Pilot. »Das ist wirklich nett von Ihnen.«
Francesca war seitlich auf einen Sitz ausgewichen und hatte die beiden Männer an sich vorbeigelassen. Phillipo bat sie, einige Müllsäcke aus dem Stauraum unter einem der vorderen Plätze zu holen. Er wollte den Piloten mit Hilfe der Plastiktüten fesseln. Sobald Riordan kaltgestellt war, würde der Leibwächter sich nur noch mit dem Kopiloten auseinandersetzen müssen.
Die Kabine war knapp vier Meter lang. Aufgrund der Enge musste Phillipo zur Seite treten, um den anderen Mann passieren zu lassen. Er warnte Riordan, keine Tricks zu versuchen, denn aus dieser Entfernung würde jeder Schuss unweigerlich treffen. Riordan nickte und ging auf die Rückwand zu. Die beiden Männer befanden sich nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, als der Kopilot die Maschine über die linke Seite abkippen ließ.
Riordan hatte mit dieser Aktion gerechnet, wenngleich ohne den genauen Zeitpunkt zu kennen, doch die Heftigkeit des Manövers überraschte ihn. Er verlor das Gleichgewicht, wurde auf einen Sitz geschleudert und schlug mit dem Kopf gegen die Wand. Phillipo kam ebenfalls ins Straucheln, flog quer durch die Kabine und landete auf Riordan.
Der Pilot bekam den rechten Arm frei und hieb mit seiner großen Faust gegen Phillipos Kinn. Der Leibwächter sah augenblicklich Sterne und hätte fast erneut das Bewusstsein verloren, doch es gelang ihm, die Waffe festzuhalten. Riordan holte zu einem weiteren Schlag aus, den Phillipo jedoch mit dem Ellbogen abblocken konnte.
Beide Männer waren erfahrene Nahkämpfer. Phillipo stieß mit gekrümmten Fingern nach Riordans Augen, doch der Pilot biss ihm in den Handballen. Dann hämmerte der Leibwächter sein Knie in Riordans Unterleib, und als der Pilot den Mund aufriss, ruckte Phillipos Kopf nach vorn und zertrümmerte dem Gegner das Nasenbein. Er hätte wahrscheinlich die Oberhand gewonnen, doch in diesem Moment steuerte der Kopilot das Flugzeug scharf nach rechts.
Die beiden Kontrahenten flogen auf die andere Seite des Ganges. Jetzt lag der Amerikaner oben. Phillipo wollte ihn mit dem Revolverlauf schlagen, aber der Pilot umschlang mit beiden Händen seine Faust, drückte sie erst zur Seite und dann nach unten. Phillipo war stark, doch Riordans beidhändiger Angriff war stärker. Der Lauf näherte sich immer mehr Phillipos Leib.
Jetzt packte der Pilot die Waffe und zerrte daran. Phillipo versuchte, sich die Pistole nicht abnehmen zu lassen, und beinahe hätte er sie auch wieder zu fassen bekommen, aber das Blut, das unaufhörlich aus Riordans Nase strömte, ließ das Metall schlüpfrig werden. Mit einem kraftvollen Ruck riss der Pilot den Revolver an sich, legte den Finger um den Abzug und drückte ab. Es ertönte ein gedämpfter Knall. Phillipo bäumte sich auf und sackte dann in sich zusammen. Die Kugel war tief in seine Brust gedrungen.
Der Kopilot brachte die Maschine wieder in eine waagerechte Flugposition. Riordan ließ die Pistole fallen, stand auf und taumelte in Richtung Cockpit. Dann blieb er stehen und wandte sich um, weil er anscheinend spürte, dass etwas nicht stimmte.
Phillipo hatte den Revolver ergriffen und bemühte sich gerade, die Waffe in Anschlag zu bringen. Riordan stürzte sofort auf ihn zu. Ein Schuss peitschte auf und erwischte den Piloten an der Schulter, ohne ihn dadurch stoppen zu können. Phillipos Gehirn hörte auf zu arbeiten, doch sein Finger krümmte sich noch zwei Mal. Die nächste Kugel traf Riordans Herz und tötete ihn auf der Stelle. Die dritte verfehlte ihn. Als der Pilot krachend auf dem Boden der Kabine aufschlug, fiel Phillipos Hand zurück auf die Brust.
Der gesamte Kampf hatte nur wenige Sekunden gedauert. Francesca war ebenfalls zwischen den Sitzen hin und her geschleudert worden und hatte sich nicht gerührt, als der blutüberströmte Pilot zurück zum Cockpit wankte. Die folgenden Schüsse ließen sie abermals den Kopf einziehen.
Vorsichtig schaute sie hinaus auf den Gang und sah den reglosen Körper des Piloten. Sie kroch an Phillipos Seite, entrang seiner blutigen Hand die Pistole und ging zum Cockpit. Sie war viel zu wütend, um Angst zu empfinden. Ihr Zorn verwandelte sich alsbald in Entsetzen.
Der Kopilot war in sich zusammengesunken und wurde nur durch den Sicherheitsgurt gehalten. In der Trennwand zwischen Kabine und Cockpit befand sich ein kleines Loch. Phillipos dritter Schuss war erst durch die Wand und dann durch die Rückenlehne des Kopiloten gedrungen.
Francesca richtete den Mann auf. Sein Stöhnen verriet, dass er noch am Leben war.
»Können Sie sprechen?«, fragte sie.
Carlos verdrehte die Augen. »Ja«, krächzte er.
»Gut. Sie haben eine Schussverletzung erlitten, aber ich glaube, es wurden keine lebenswichtigen Organe getroffen«, log sie. »Ich werde die Blutung stillen.«
Sie holte den Verbandkasten und dachte dabei, dass jetzt eigentlich ein Ärzteteam aus der Notaufnahme eines Krankenhauses erforderlich gewesen wäre. Als sie das Blut sah, das aus der Wunde des Mannes hervorquoll, den Rücken hinunterrann und sich in einer Pfütze auf dem Boden sammelte, wurde sie fast ohnmächtig. Die Kompresse färbte sich sofort dunkelrot, aber vielleicht ließ sich der Blutverlust dadurch zumindest ein wenig aufhalten. Es war schwer zu sagen. Francesca wusste lediglich, dass der Mann auf jeden Fall sterben würde.
Mit plötzlicher Angst blickte sie auf die beleuchtete Instrumententafel, denn ihr wurde auf einmal bewusst, dass sie auf diesen Sterbenden angewiesen war. Sie musste ihn unbedingt am Leben erhalten.
Sie holte die Flasche Rum und hielt sie Carlos an die Lippen. Der Alkohol tröpfelte sein Kinn hinab, und der kleine Schluck, den er trank, ließ ihn husten. Er bat um noch einen Schluck. Der starke Rum rötete seine bleichen Wangen, und sein glasiger Blick schien an Stärke zu gewinnen.
»Sie müssen fliegen«, flüsterte Francesca ihm ruhig ins Ohr. »Das ist unsere einzige Chance.«
Die Nähe einer schönen Frau wirkte anscheinend zusätzlich belebend auf ihn. Seine Augen waren immer noch leicht getrübt, aber er sah sie aufmerksam an. Er nickte und streckte die zitternde Hand nach dem Funkgerät aus, über das er direkt mit der Flugsicherung in Rio verbunden war. Francesca glitt auf den Pilotensitz und streifte sich das Headset über. Die Stimme des Fluglotsen meldete sich. Carlos sah Francesca Hilfe suchend an. Sie ergriff das Wort und schilderte die missliche Lage.
»Was raten Sie uns?«, fragte sie.
Die Pause schien endlos zu dauern. »Fliegen Sie umgehend nach Caracas.«
»Zu weit«, stieß Carlos unter großer Anstrengung ächzend hervor. »Irgendwo näher.«
Erneut vergingen einige quälend langsame Sekunden.
Der Fluglotse meldete sich zurück. »Ein Stück vor Caracas, in San Pedro, rund dreihundert Kilometer von Ihrer gegenwärtigen Position, befindet sich ein kleiner Provinzflughafen. Ein Instrumentenanflug ist dort nicht möglich, aber wir haben erstklassige Wetterbedingungen. Können Sie das schaffen?«
»Ja«, sagte Francesca.
Der Kopilot machte sich an der Tastatur des Flugcomputers zu schaffen. Unter Aufbietung aller Kräfte erkundigte er sich bei dem Lotsen nach der internationalen Kennung San Pedros und gab sie in den Computer ein.
Das Flugzeug beschrieb wie von Geisterhand eine Kurve.
Carlos lächelte matt. »Ich hab Ihnen ja gesagt, dass diese Maschine ganz allein fliegen kann, Senhora.« Seine keuchend hervorgestoßenen Worte klangen irgendwie schläfrig. Der Blutverlust schwächte ihn zusehends. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis er das Bewusstsein verlieren würde.
»Mir ist egal, wer fliegt«, sagte Francesca barsch. »Bringen Sie uns nur heil nach unten.«
Carlos nickte und erteilte per Computer den Befehl, die Flughöhe automatisch auf sechshundert Meter zu senken. Die Maschine begann mit dem Abstieg durch die Wolken, und schon bald war unter ihnen grüne Vegetation zu erkennen. Der Anblick des Bodens beruhigte Francesca, aber er ängstigte sie auch. Ihre Furcht nahm zu, als Carlos plötzlich wie unter einem Stromschlag erzitterte. Er packte Francescas Hand und umklammerte sie fest.
»Ich schaff’s nicht bis San Pedro«, keuchte er.
»Sie müssen«, beharrte Francesca.
»Unmöglich.«
»Verdammt, Carlos, Sie und Ihr Partner haben uns in diese Klemme gebracht, und Sie werden uns jetzt gefälligst auch wieder herausbringen!«
Er lächelte geistesabwesend. »Was wollen Sie tun, Senhora? Mich erschießen?«
Ihre Augen funkelten wütend. »Sie werden sich noch wünschen, ich hätte es getan, falls Sie diese Kiste nicht landen.«
Er schüttelte den Kopf. »Notlandung. Unsere einzige Chance. Suchen Sie nach einer geeigneten Stelle.«
Durch das große Cockpitfenster war nur dichter Regenwald zu erkennen. Francesca kam es fast so vor, als würden sie über ein endloses Feld voller Brokkoli fliegen. Erneut suchte sie den grünen Horizont ab. Hoffnungslos. Halt. Irgendetwas funkelte im Sonnenlicht.
»Was ist das?«, fragte sie und zeigte darauf.
Carlos schaltete den Autopiloten ab, nahm den Steuerknüppel in beide Hände und hielt auf die Spiegelung zu, die von einem riesigen Wasserfall stammte. Ein schmaler, gewundener Fluss kam in Sicht. Daneben befand sich eine unregelmäßig geformte Lichtung mit gelbbrauner Vegetation.
Auch Carlos schien nun beinahe automatisch zu reagieren. Er flog an dem offenen Gelände vorbei und dann mit dreißig Grad Schräglage in eine Rechtskurve, um sich der Lichtung in weitem Bogen erneut aus der ursprünglichen Richtung anzunähern. Durch eine weitere enge Rechtskurve brachte er das Flugzeug schließlich auf den endgültigen Kurs. Sie befanden sich jetzt in fünfhundertfünfzig Metern Höhe und sanken auf einer lang gezogenen, flachen Geraden nach unten. Carlos fuhr die Landeklappen aus, um die Geschwindigkeit weiter zu senken.
»Zu tief!«, knurrte er. Die Baumwipfel rasten ihnen entgegen. Mit der übermenschlichen Kraft der Verzweiflung streckte Carlos die Hand nach dem Gashebel aus und gab mehr Schub. Die Maschine begann wieder ein wenig zu steigen.
Seine Sicht verschwamm. Ihn verließ der Mut. Es war ein furchtbarer Landeplatz, uneben und winzig wie eine Briefmarke. Ihre Geschwindigkeit betrug zweihundertfünfzig Kilometer pro Stunde. Zu schnell.
Seiner Kehle entfuhr ein rasselndes Pfeifen. Der Kopf sackte ihm auf die Schulter. Ein Blutschwall schoss aus seinem Mund hervor. Die Finger umklammerten auch weiterhin den Steuerknüppel, jetzt nutzlos im Todesgriff darum verkrampft. Sogar noch während seiner letzten Sekunden hatte Carlos hohes fliegerisches Geschick bewiesen und die Maschine perfekt getrimmt. Das Flugzeug blieb auf Kurs, und als es den Boden berührte, sprang es mehrfach wieder in die Luft empor, wie ein Stein, der in flachem Winkel über eine Wasserfläche hüpfte.
Dann schlug der Rumpf endgültig auf und protestierte mit dem ohrenbetäubenden Kreischen gepeinigten Metalls. Die Reibungskräfte bremsten die Maschine ab, doch noch immer betrug die Geschwindigkeit mehr als hundertfünfzig Kilometer pro Stunde, und der Jet durchfurchte den Untergrund wie ein Pflug. Die Tragflächen rissen ab, und die Treibstofftanks explodierten, sodass die Maschine auf den nächsten dreihundert Metern zu beiden Seiten einen Schweif aus orangefarbenen Flammen und tiefschwarzem Qualm hinter sich herzog, während vor ihr viel zu schnell eine Biegung des Flusses in Sicht kam.
Das Flugzeug wäre zerbrochen, hätte der grasbedeckte Boden sich nicht plötzlich in weichen morastigen Uferschlick verwandelt. Der blau-weiße Rumpf des Jets war inzwischen über und über mit Dreck verschmiert und wirkte ohne die Tragflächen wie ein riesiger Wurm, der sich im Sumpf vergraben wollte. Er schlitterte über die Schlammfläche und kam schließlich mit einem Ruck zum Stehen. Francesca wurde nach vorn gegen die Instrumententafel geschleudert und verlor das Bewusstsein.
Dann herrschte weitgehend Stille, lediglich das brennende Gras knisterte leise, der Fluss plätscherte an die Ufer, und Dampf zischte auf, als das heiße Metall der Maschine mit dem Wasser in Berührung kam.
Wenig später tauchten aus den Tiefen des Waldes gespenstische Schatten auf und glitten lautlos auf das Flugzeugwrack zu.
1
San Diego,
Kalifornien, 2001
Die elegante Motorjacht Nepenthe ankerte vor Encinitas an der Pazifikküste. Sie war das prächtigste Schiff einer Flottille, die sämtliche Segel- und Motorboote San Diegos zu umfassen schien. Der anmutig gestreckte Rumpf, das speerähnliche Spriet an der Spitze des kühn aufragenden Klipperbugs und der stolze Achtersteven verliehen der sechzig Meter langen Nepenthe das Aussehen eines edlen weißen Porzellanschiffs auf Delft-blauer See. Ihr Anstrich war auf Hochglanz poliert, und sämtliche Metallteile funkelten in der kalifornischen Sonne. Von vorn bis achtern flatterten unzählige Flaggen und Wimpel im Wind, und mitunter riss ein Luftballon sich los und stieg hoch in den wolkenlosen Himmel empor.
Der geräumige Salon der Jacht war ganz im Stil des britischen Empire gehalten. Ein Streichquartett spielte ein Stück von Vivaldi, und eine bunt gemischte Gesellschaft aus schwarz gekleideten Hollywood-Größen, korpulenten Politikern und aalglatten Fernsehmoderatoren drängte sich um eine mächtige Mahagonitafel und vertilgte Pasteten, Beluga-Kaviar und Shrimps, als hätte es wochenlang nichts zu essen gegeben.
Draußen auf den sonnendurchfluteten Decks saßen zahllose Kinder in Rollstühlen oder stützten sich auf Krücken, kauten schmatzend an Hotdogs und Hamburgern und genossen die frische Seeluft. Eine attraktive Frau Mitte fünfzig wachte wie eine Glucke über sie. Millionen von Menschen hatten Gloria Ekharts Filme und ihre beliebte Fernseh-Sitcom gesehen und kannten dieses Gesicht mit den vollen Lippen und den kornblumenblauen Augen nur zu genau. Jeder Fan wusste von ihrer Tochter Elsie, dem hübschen sommersprossigen Mädchen, das hier ebenfalls in einem Rollstuhl über das Deck flitzte. Auf dem Gipfel ihrer Schauspielkarriere hatte Ekhart beschlossen, ihr Geld und ihre Zeit fortan in den Dienst von Kindern zu stellen, die das schwere Schicksal ihrer Tochter teilten. Die einflussreichen und betuchten Gäste, die unterdessen im Salon Dom Perignon in sich hineinschütteten, würden später gebeten werden, ihre Scheckbücher für die Ekhart Foundation zu öffnen.
Gloria Ekhart wusste, wie eine gelungene Werbeaktion auszusehen hatte, und deshalb war ihre Wahl auch auf die Nepenthe gefallen, als es darum ging, einen geeigneten Veranstaltungsort für die Party zu mieten. Schon als das Schiff 1930 in der Glasgower Werft G. L. Watson vom Stapel lief, gehörte es zu den elegantesten Motorjachten, die jemals die Weltmeere befahren hatten. Der erste Eigentümer, ein englischer Graf, verlor die Nepenthe während einer nächtlichen Pokerrunde an einen spielfreudigen Hollywood-Mogul, der zudem einen Hang zu endlosen Partys und minderjährigen Starlets hatte. Es folgte eine Reihe ebenso gleichgültiger Besitzer, und am Ende diente die Nepenthe sogar eine Weile als Fischkutter. Schließlich landete die verrottete und nach Fisch und Ködern stinkende Jacht in der hinteren Ecke eines Schiffsfriedhofs. Die Rettung kam in Gestalt eines Magnaten aus dem Silicon Valley, der einen Teil der für die Restaurierung erforderlichen Millionen wieder einzuspielen erhoffte, indem er die Nepenthe zu Anlässen wie der Ekhartschen Wohltätigkeitsveranstaltung vermietete.
Ein Mann in einem blauen Blazer, auf dessen Brusttasche ein offiziell wirkendes Abzeichen prangte, hatte mit einem Fernglas die flache, grüne Weite des Pazifiks abgesucht. Jetzt rieb er sich die Augen und schaute erneut durch die Linsen. Am Horizont hoben sich vor dem blauen Himmel schmale, weiße Gischtstreifen ab. Der Mann ließ das Fernglas sinken, nahm eine Gasdruckfanfare zur Hand und betätigte dreimal den Knopf.
Tuuut… tuuut… tuuut.
Das ohrenbetäubend laute Hupen schallte über das Wasser wie der Paarungsruf eines gewaltigen Gänserichs. Die Flottille nahm das Signal auf. Eine Kakophonie aus Glocken, Pfeifen und Hörnern erfüllte die Luft und übertönte mühelos die Schreie der hungrigen Möwen. Hunderte von Zuschauern griffen aufgeregt nach ihren Ferngläsern und Kameras. Manche Boote neigten sich bedenklich, als die Passagiere sich alle an einer Seite versammelten. Auf der Nepenthe schlangen die Gäste ihr Essen hinunter und strömten aus dem Salon, während sie weiterhin an ihren Sektgläsern nippten. Sie schirmten die Augen vor der Sonne ab und spähten in die Ferne, wo die weißen Markierungen immer deutlicher zu erkennen waren. In der Luft hing plötzlich ein Geräusch, das wie ein wütender Schwarm Bienen klang.
Dreihundert Meter über der Nepenthe kreiste in einem Helikopter ein stämmiger italienischer Kameramann namens Carlo Pozzi. Jetzt tippte er dem Piloten auf die Schulter und deutete nach Nordwesten. Dort näherten sich auf dem Wasser parallele weiße Streifen, als würden sie von einer riesigen, unsichtbaren Egge stammen. Pozzi überprüfte sein Sicherheitsgeschirr, stellte einen Fuß hinaus auf die Kufe und wuchtete sich eine mehr als zwanzig Kilo schwere Fernsehkamera auf die Schulter. Geübt lehnte er sich in den Wind, der seinen Körper durchschüttelte, und richtete das überaus starke Teleobjektiv auf die herannahenden Linien. Er schwenkte mit der Kamera von links nach rechts und verschaffte so den Zuschauern in der ganzen Welt einen Überblick über die zwölf Rennboote, die dort das Meer zerfurchten. Dann zoomte er auf die zwei Boote, die zirka vierhundert Meter vor dem Rest des Feldes in Führung lagen.
Die beiden Kontrahenten rasten über die Wellenkämme, und die zwölf Meter langen Rümpfe zeigten dabei steil empor, als wollten sie den Fesseln der Schwerkraft entfliehen. Das führende Boot war in einem leuchtend hellen Feuerrot gestrichen. Der Verfolger, weniger als neunzig Meter dahinter, funkelte wie ein goldenes Nugget. Im Aussehen glichen die Gefährte eher futuristischen Raumjägern als irdischen Wasserfahrzeugen. Ihre flachen Tragdecks verbanden jeweils zwei messerscharfe Katamaranrümpfe miteinander, über deren Maschinenräumen aerodynamische Schwingen angebracht waren. In jedem der spitz zulaufenden Rümpfe befand sich nach ungefähr zwei Dritteln der Länge eine geschlossene Kanzel, nicht unähnlich dem Cockpit eines Kampfflugzeugs.
In der rechten Kanzel des roten Boots saß eingezwängt Kurt Austin. Sein sonnengebräuntes Gesicht glich einer starren Maske, und er musste allen Mut zusammennehmen, während das acht Tonnen schwere Gefährt immer wieder auf die betonharte Wasseroberfläche schlug. Im Gegensatz zu einem Landfahrzeug war dieses Boot überhaupt nicht gefedert, nichts dämpfte die markerschütternden Stöße. Jeder Aufprall fuhr aufs Neue durch den gesamten Rumpf, der in einem Stück aus einer Kevlar-Kohlenstoff-Verbindung gefertigt war, setzte sich durch Austins Beine fort und ließ seine Zähne aufeinander schlagen. Trotz seiner breiten Schultern, der kräftigen Oberarme und des Fünfpunktgurtsystems, das Austins neunzig Kilo an Ort und Stelle hielt, fühlte er sich wie ein Basketball, der von Michael Jordan quer über das Spielfeld gedribbelt wurde. Er brauchte jede Muskelfaser seiner hundertfünfundachtzig Zentimeter Körpergröße, um mit fester Hand Trimmruder und Gashebel zu bedienen, während sein linker Fuß per Pedal den Druck in den mächtigen Zwillings-Turboladern kontrollierte, die den Katamaran über das Wasser donnern ließen.
José »Joe« Zavala saß in der linken Kanzel über das Steuer gebeugt. Seine behandschuhten Finger umklammerten ein kleines schwarzes Lenkrad, das kaum geeignet schien, ein solches Gefährt auf Kurs zu halten. Zavala kam sich vor, als würde er das Boot genau genommen gar nicht lenken, sondern vielmehr damit zielen. Seine Lippen waren zu einem entschlossenen Strich zusammengepresst. Die großen dunkelbraunen Augen hatten jeglichen Anschein ihrer sonst so seelenvollen Tiefe verloren und starrten angestrengt durch das getönte Plexiglasvisier, um selbst kleinste Veränderungen von Windstärke oder Wellenhöhe sofort zu bemerken. Die stetige Auf-und-ab-Bewegung des Bugs machte die Aufgabe nur noch schwieriger. Während Austin das Verhalten des Boots buchstäblich mit Hilfe seines Hosenbodens einschätzte, spürte Zavala die Wogen und Wellentäler im Wesentlichen über das Lenkrad.
Austin meldete sich über die Sprechanlage, mit der die beiden Kanzeln verbunden waren. »Wie ist unsere Geschwindigkeit?«
Zavala warf einen Blick auf die Digitalanzeige. »Eins sechsundneunzig.« Dann überprüfte er Satellitennavigation und Kompass. »Genau auf Kurs.«
Austin sah auf die Uhr und dann auf die Seekarte, die er sich an den rechten Oberschenkel geschnallt hatte. Die knapp zweihundertsechzig Kilometer lange Rennstrecke begann in San Diego, machte zwei scharfe Kurven rund um die Insel Santa Catalina und führte dann zum Ausgangspunkt zurück, sodass von den Stränden aus Tausende von Zuschauern den dramatischen Endspurt verfolgen konnten. Die letzte Kurve musste jetzt unmittelbar bevorstehen. Austin spähte durch die mit Gischt besprühte Kanzel und entdeckte rechts von sich erst eine, dann noch eine vertikale Linie. Die Masten von Segelbooten! Die Zuschauer flankierten hier mit ihren Schiffen eine breite Schneise im offenen Fahrwasser. Wenig später würde dann das Küstenwachboot samt der Wendeboje auftauchen und den Beginn des letzten Streckenabschnitts markieren. Kurt schaute kurz über die rechte Schulter zurück und sah etwas Goldenes in der Sonne aufblitzen.
»Gehe auf zwei zehn«, sagte er.
Die harten Stöße am Lenkrad deuteten darauf hin, dass die Wellenhöhe zunahm. Außerdem hatte Zavala vereinzelte weiße Flecke und eine unverkennbare Marmorierung des Wassers bemerkt, was auf eine anwachsende Windstärke schließen ließ.
»Ich weiß nicht, ob das ratsam ist«, rief er über das Heulen der Motoren hinweg. »Das Wetter wird unruhiger. Wo ist Ali Baba?«
»Er sitzt uns praktisch im Genick!«
»Er wäre verrückt, es jetzt darauf ankommen zu lassen. Er kann doch weiterhin in Ruhe zusehen, wie wir durchgeschüttelt werden, und auf der Zielgeraden dann den Angriff starten. See und Wind sind viel zu unberechenbar.«
»Ali verliert nicht gern.«
Zavala stöhnte auf. »Okay. Versuch’s mit zweihundert. Vielleicht reicht das ja schon.«
Austin gab sachte Gas und spürte die Maschinen kraftvoll aufheulen.
»Sind jetzt bei zwei null fünf«, meldete Zavala kurz darauf. »Scheint alles zu klappen.«
Das goldene Boot fiel zunächst zurück, legte dann aber ebenfalls an Tempo zu und holte wieder auf. Austin konnte die schwarze Beschriftung am Rumpf lesen: Flying Carpet. Der Fahrer des Boots war hinter der getönten Kanzel nicht zu erkennen, doch Austin wusste, dass der bärtige junge Mann, der beinahe wie Omar Sharif aussah, jetzt bestimmt von Ohr zu Ohr grinste. Ali Bin Said war der Sohn eines Hotelbesitzers aus Dubai und gehörte zu den härtesten Konkurrenten im Offshore-Hochgeschwindigkeitsrennen, einer Sportart, die zu den weltweit gefährlichsten zählte, und zudem von extrem ehrgeizigen Sportlern betrieben wurde.
Im Vorjahr hatte Austin ganz knapp vor Ali den Dubai Duty Free Grand Prix gewonnen, und eine Niederlage auf eigenem Kurs und vor heimischem Publikum war natürlich besonders ärgerlich. Daraufhin hatte Ali die beiden Lamborghini-Triebwerke des Carpet noch etwas mehr auf Leistung trimmen lassen, doch auch die Red Ink verfügte inzwischen über einige zusätzliche Reserven. Austin schätzte die beiden Boote ungefähr gleich stark ein.
Bei der Fahrerbesprechung vor dem Rennen hatte Ali ihm im Scherz vorgeworfen, Austin habe die National Underwater and Marine Agency zu Hilfe gerufen, damit diese ihm ein bisschen unter die Arme greifen würde. Zwar standen Austin als dem Leiter des NUMA-Teams für Sonderaufgaben tatsächlich die Mittel dieser mächtigen Behörde zur Verfügung, doch dachte er nicht im Traum daran, sich dadurch einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Ali war nicht durch eine überlegene Motorleistung besiegt worden, sondern durch die Tatsache, dass Austin und sein Partner von der NUMA so hervorragend als Team funktionierten.
Zavala wäre mit seiner dunklen Hautfarbe und dem dichten, immer nach hinten gekämmten, glatten schwarzen Haar problemlos als Restaurantchef eines feudalen Luxushotels in Acapulco durchgegangen. Er schien stets ein wenig zu lächeln, so dass man ihm die stählerne Entschlossenheit kaum ansah, die er sich während seiner Collegezeit als Mittelgewichtsboxer antrainiert und im Laufe der vielen herausfordernden NUMA-Aufträge weiter vervollkommnet hatte. Der gesellige und einnehmende Schiffsingenieur konnte auf Tausende von Flugstunden am Steuerknüppel von Hubschraubern, kleinen Jets und Turboprop-Maschinen verweisen und fand sich im Cockpit eines Rennboots schnell zurecht. Austin und er arbeiteten zusammen wie die Teile eines Präzisionsinstruments, und so setzten sie sich sofort an die Spitze des Feldes, als der Schiedsrichter die grüne Startflagge hob.
Bereits die Abfahrt gelang ihnen in einem nahezu idealen Winkel, und so rasten sie mit einer Geschwindigkeit von knapp zweihundertzehn Kilometern pro Stunde über die Startlinie. Am Anfang gab jeder der Teilnehmer Vollgas, was dazu führte, dass schon auf der ersten Etappe zwei Konkurrenten mit Motorschaden ausfielen und einer sich in der ersten Kurve überschlug. Nachdem dieser wahrscheinlich gefährlichste Teil eines jeden Rennens überstanden war, wurde der Rest der Fahrer durch die beiden führenden Teams schlicht und einfach deklassiert. Die Red Ink ließ die anderen hinter sich, als hätten sie Sand im Getriebe. Nur die Flying Carpet hielt Schritt. Während der ersten Kehre bei Santa Catalina manövrierte Zavala die Red Ink dermaßen eng um die Boje herum, dass Ali nach außen ausweichen musste. Seitdem jagte die Flying Carpet ihnen hinterher.
Jetzt legte die Carpet an Tempo zu und befand sich auf gleicher Höhe mit der Red Ink. Austin wusste, dass Ali in letzter Minute auf eine kleinere Schiffsschraube gewechselt hatte, die sich besser für raue See eignete. Kurt wünschte, auch er könnte seinen großen Glattwasser-Propeller noch umtauschen. Ali hatte sich schlauerweise lieber auf sein Gespür verlassen als auf die Wettervorhersage.
»Ich lege noch einen Zahn zu!«, rief Austin.
»Wir sind jetzt bei zwei fünfundzwanzig«, rief Zavala zurück. »Der Wind nimmt zu. Sie wird noch abheben, falls wir es nicht langsamer angehen lassen.«
Austin wusste, wie riskant eine Kehre bei zu hoher Geschwindigkeit war. Die Rennkatamarane glitten praktisch ohne jeden Wasserwiderstand über die Oberfläche. Dasselbe Design, das ihnen ein solch hohes Tempo über den Wellenkämmen gestattete, machte sie anfällig für plötzliche Windböen, die unter den Rumpf dringen und das gesamte Boot wie einen Drachen in die Luft heben oder, was weitaus schlimmer war, zu einem kompletten Überschlag führen konnten.
Die Flying Carpet ging immer weiter in Führung. Austins Finger schlossen sich um die Gashebel. Er hasste es, zu verlieren. Die Angriffslust hatte er von seinem Vater geerbt, genau wie die Statur eines Footballspielers und die hellblaue Augenfarbe, die an ein Korallenriff in klarem Gewässer erinnerte. Eines Tages würde ihn dieser Charakterzug noch um Kopf und Kragen bringen. Aber nicht heute. Er nahm die Hand vom Gas und rettete ihnen damit vermutlich das Leben.
Der weiße Kamm einer fast anderthalb Meter hohen Woge kam von backbord heran und schien sich mit beinahe wütendem Fauchen auf sie zu stürzen. Zavala sah die Gefahr, schickte ein Stoßgebet zum Himmel und wusste doch im selben Moment, dass ihr Timing erbärmlich war. Wie eine Katzenpfote schloss die Woge sich um einen der Rümpfe und ließ die Red Ink wirbelnd emporsteigen. Mit blitzschnellem Reflex lenkte Zavala in Richtung der Drehbewegung, ganz wie ein Autofahrer, der auf eine Eisfläche geraten war. Das Boot schlug seitlich ins Wasser, geriet ins Schlingern, sodass die Kanzeln überspült wurden, und richtete sich dann schwankend wieder auf.
Ali wurde langsamer, doch sobald er sah, dass die beiden Konkurrenten alles glimpflich überstanden hatten, gab er wieder hemmungslos Vollgas. Er wollte mit möglichst großem Abstand vor Austin ins Ziel kommen. Obwohl sein erfahrener Kopilot Hank Smith ihm davon abriet, setzte Ali sämtliche Reserven des Boots frei. Hinter der Flying Carpet stieg eine gewaltige Gischtfontäne in die Luft, und die beiden Schrauben durchpflügten die See mit einer tiefen Doppelfurche. Die Fahrspur war noch nach mehreren hundert Metern deutlich zu erkennen.
»Tut mir Leid«, rief Zavala. »Die Welle hat mich voll erwischt.«
»Du hast erstklassig reagiert. Holen wir uns den zweiten Platz.«
Austin schob die Gashebel nach vorn, und mit laut heulenden Motoren nahm die Red Ink die Verfolgung auf.
Hoch über der Rennstrecke hatte der italienische Kameramann den dramatischen Führungswechsel beobachtet. Der Helikopter flog einen großen Bogen, bis er auf Höhe der Flottille genau über der Fahrrinne schwebte. Pozzi wollte in einer Totale festhalten, wie das einzelne Boot vorbei an den Zuschauern zur Wendeboje raste, um dort auf die letzte Etappe zurück nach San Diego zu gehen. Der Kameramann schaute hinunter aufs Wasser, um sich zu orientieren, und bemerkte kleine Wellen, die von einem großen, gräulich schimmernden Objekt ausgingen, das an der Oberfläche trieb. Eine Lichtspiegelung. Nein, da war tatsächlich etwas. Er winkte dem Piloten zu und deutete direkt nach unten.
»Was, zum Teufel, ist das?«, fragte der Pilot.
Pozzi richtete die Kamera auf das Objekt und zoomte mit einem Knopfdruck nah heran.
»Ein balena«, sagte er, als er Genaueres erkennen konnte.
»Mein Gott, sprechen Sie gefälligst Englisch.«
»Wie heißt es doch gleich? Ein Wal.«
»Ach so«, erwiderte der Pilot. »Die sieht man hier häufig. Keine Angst, er wird tauchen, wenn er die Boote hört.«
»Nein«, widersprach Carlo und schüttelte den Kopf. »Ich glaube, er ist tot. Er bewegt sich nicht.«
Der Pilot ließ den Hubschrauber ein Stück zur Seite schweben, um besser sehen zu können. »Verdammt, Sie haben Recht. Da ist noch einer. Ich zähle insgesamt drei – nein, vier. Verflucht! Die sind ja überall hier.«
Er schaltete auf den Notrufkanal. »San Diego Küstenwache, bitte kommen. Hier ist der Fernsehhelikopter über der Rennstrecke. Dies ist ein Notfall!«
Aus dem Funkgerät ertönte krächzend eine Stimme. »Hier ist die Küstenwache in Cabrillo Point. Fahren Sie fort.«
»Ich sehe Wale genau auf der Rennstrecke.«
»Wale?«
»Ja, ungefähr ein Dutzend. Ich glaube, sie sind tot.«
»Roger«, entgegnete der Mann. »Wir veranlassen unser Boot dort unten, sich die Sache mal anzusehen.«
»Zu spät«, sagte der Pilot. »Sie müssen das Rennen abbrechen.«
Einige Sekunden lang herrschte gespanntes Schweigen. Dann: »Roger. Wir versuchen’s.«
Kurz darauf verließ das Küstenwachboot als Reaktion auf einen entsprechenden Funkspruch der Zentrale seine Position an der Wendeboje. Orangefarbene Leuchtsignale stiegen in den blauen Himmel empor.
Ali bemerkte die Leuchtraketen nicht, und auch den aufgedunsenen grauen Kadaver in seiner Bahn registrierte er erst im letzten Moment. Er riss das Steuer herum, verfehlte das Hindernis nur um wenige Zentimeter und wich einer zweiten Tierleiche aus. Der nächste Zusammenstoß ließ sich nicht mehr abwenden. Ali versuchte es dennoch und brüllte Hank im selben Moment zu, vom Gas zu gehen. Smith zog blitzschnell die Hebel zurück, und das beinahe fliegende Boot senkte sich aufs Wasser. Die Geschwindigkeit beim Aufprall betrug immer noch rund achtzig Kilometer pro Stunde. Mit lautem Knall platzte der Kadaver wie ein riesiger Ballon voller Tran und ließ stinkende Gase entweichen. Das Boot legte sich auf die Seite, kippte, vollführte einen Salto und landete wie durch ein Wunder richtig herum auf beiden Rümpfen.
Nur dank ihrer Helme kamen die beiden Insassen des Katamarans ohne Schädelbruch davon. Wie durch einen schwarzen Schleier griff Ali halb betäubt nach dem Lenkrad und versuchte zu wenden, doch das Ruder reagierte nicht. Er rief nach seinem Kopiloten. Hank war über den Gashebeln zusammengesackt.
Der Kapitän der Nepenthe hatte die Brücke verlassen und sprach unten auf Deck gerade mit Gloria Ekhart, als die Schauspielerin sich plötzlich über die Reling beugte und den Arm ausstreckte. »Verzeihen Sie, Käpt’n. Was macht denn das goldene Boot da?«
Die Flying Carpet torkelte wie ein angeschlagener Boxer, der sich in die neutrale Ecke retten will. Dann fuhr der Zwillingsbug herum, und der Katamaran hörte auf zu schwanken. Mit zunehmender Geschwindigkeit hielt er genau auf einen Punkt mittschiffs der Jacht zu. Der Kapitän wartete darauf, dass die Flying Carpet abdrehen würde. Nichts geschah. Erschrocken entschuldigte er sich mit ruhiger Stimme, trat ein Stück beiseite und nahm ein Walkie-Talkie vom Gürtel. Sein Verstand berechnete unterdessen, wie lange es dauern würde, bis das goldene Boot mit ihnen kollidierte.
»Hier spricht der Käpt’n«, bellte er ins Funkgerät. »Setzen Sie das Schiff in Bewegung!«
»Jetzt, Sir? Während des Rennens?«
»Sind Sie taub? Anker lichten, und Fahrt aufnehmen. Sofort.«
»Fahrt aufnehmen? Wohin, Sir?«
Ihnen blieb nur eine minimale Chance, rechtzeitig vom Fleck zu kommen, und dieser Steuermann wollte unbedingt ein Quiz veranstalten.
»Nach vorn!«, brüllte er, beinahe panisch. »Fahren Sie einfach los!«
Doch noch während er den Befehl erteilte, wusste er bereits, dass es zu spät war. Das Rennboot hatte schon die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht. Der Kapitän fing an, die Kinder auf die andere Seite der Jacht zu scheuchen. Vielleicht ließen sich so ein paar Leben retten, wenngleich er daran zweifelte. Der hölzerne Rumpf würde zersplittern, die Treibstofftanks in einem Feuerball explodieren und die Jacht innerhalb weniger Minuten auf den Meeresgrund sinken. Er packte einen Rollstuhl, in dem ein kleines Mädchen saß, und schob ihn quer über das Deck, während er die anderen Leute aufforderte, es ihm gleichzutun. Gloria Ekhart war vor Schreck wie erstarrt und sah den goldenen Torpedo immer schneller auf die Jacht zueilen. Instinktiv tat sie das Einzige, wozu sie noch imstande war: Sie legte schützend einen Arm um die schmalen Schultern ihrer Tochter und drückte das Mädchen fest an sich.
2
Austin war nicht überrascht, dass Ali die Kontrolle über das Boot verlor, denn schließlich hatte der Araber sein Schicksal geradezu herausgefordert, doch die Art des Unfalls gab Kurt zu denken. Die Flying Carpet wurde ruckartig herumgerissen und schleuderte in einer Schaumfontäne zur Seite. Dann wurde sie ihrem Namen gerecht und stieg steil in die Luft empor, wobei ein Rumpf tiefer als der andere hing. Sie sah aus wie ein Stuntfahrzeug, das über eine niedrige Rampe und dann auf zwei Rädern weiterfuhr. Fliegend legte sie mehrere Bootslängen zurück, überschlug sich dabei, ließ bei der Landung einen gewaltigen Schwall Wasser aufspritzen, verschwand kurz aus der Sicht und tauchte schwankend wieder an der Oberfläche auf, als wäre nichts passiert.
Austin und Zavala hatten festgestellt, dass gegenwärtig eine Geschwindigkeit von rund einhundertfünfzig Kilometern pro Stunde ausreichte, um einerseits den Abstand zum Verfolgerfeld zu halten und andererseits den wechselnden Wasser- und Windbedingungen Rechnung zu tragen. Es herrschte geringer bis mittlerer Seegang, und die meisten Wogen trugen weiße Schaumkronen. Nicht gerade Stärke 12 auf der Beaufort-Skala, aber dennoch nicht zu unterschätzen. Mit Argusaugen hielten sie nach plötzlichen Irrläuferwellen Ausschau, um nicht noch einmal in Gefahr zu geraten.
Zavala fuhr einen großen Bogen und hielt auf Alis Boot zu, um sich zu vergewissern, ob die Männer Hilfe brauchten. Als die Red Ink über den Kamm einer Woge stieg und ins nächste Wellental glitt, musste er jäh einem riesigen grauen Objekt ausweichen, dessen Länge die des Boots noch übertraf. Dann folgten drei weitere große schieferfarbene Hügel, die Joe zu einem hektischen Slalom zwangen. Die Rümpfe der Red Ink ächzten protestierend unter der großen Belastung.
»Wale!«, rief Zavala aufgeregt. »Überall Wale!«
Austin reduzierte ihre Geschwindigkeit um die Hälfte. Neben dem nächsten leblosen Kadaver trieb ein kleineres Tier, vermutlich ein Kalb. »Grauwale«, sagte Kurt verwundert. »Eine ganze Herde.«
»Die sehen nicht allzu gesund aus«, merkte Zavala an.
»Für uns sind sie das leider auch nicht«, sagte Austin und nahm die Hand vom Gas. »Das ist ja wie ein Minenfeld.«
Alis Boot hatte ziellos auf den Wogen getrieben, sodass die Schrauben lediglich die Luft durchpflügten. Auf einmal hob sich der Doppelbug, das Heck sank ins Wasser, die Propeller gaben Schub, und die Flying Carpet schoss davon wie ein Kaninchen auf der Flucht vor einem Jagdhund. Sie beschleunigte schnell, glitt alsbald über die Wellenkämme und hielt auf die Zuschauerflotte zu.
»Macho hombre!«, stieß Zavala bewundernd hervor. »Rammt einen Wal und fährt dann seine Fans begrüßen.«
Auch Austin glaubte, Ali wolle sich für den Beifall bedanken. Die Flying Carpet sauste über das Wasser wie ein goldener Pfeil auf dem Weg ins Schwarze einer Zielscheibe. In Gedanken verlängerte Kurt den Kurs des Boots und sah, dass er genau auf die Flanke einer großen weißen Jacht gerichtet war, die parallel zur Rennstrecke ankerte. Die anmutige Silhouette ließ auf ein luxuriöses Schiff älteren Datums schließen. Bewundernd stellte Austin fest, wie gut der hölzerne Rumpf Form und Funktion miteinander vereinte. Dann erneut ein Blick auf Alis Boot. Es wurde immer schneller und hielt nach wie vor genau auf die Jacht zu.
Wieso halten sie nicht an oder drehen ab?
Austin wusste, dass der Rumpf eines Rennboots praktisch unverwüstlich war, aber die Steuerruder samt dem Verbindungsgestänge lagen ungeschützt. Sofern das Gestänge sich verbogen hatte, klemmten die Ruder womöglich fest. Aber dennoch… Auch wenn das der Fall war, musste man bloß die Maschinen abschalten. Und falls der Mann an den Gashebeln nicht entsprechend reagieren konnte, besaß auch der Steuermann einen Notschalter, der über eine kurze Schnur mit seinem Arm verbunden war. Das Boot hatte den Wal nicht voll erwischt, doch der Aufprall dürfte trotzdem heftig gewesen sein, gefolgt von einem noch brutaleren Schlag bei der Landung nach dem Salto. Das Wasser musste sich hart wie Beton angefühlt haben. Trotz der Helme und Sicherheitsgurte waren Ali und sein Kopilot zumindest benommen, vielleicht sogar bewusstlos. Austin schaute erneut zu der Jacht und bemerkte die jungen Gesichter auf den Decks. Um Gottes willen! Kinder. Die Jacht war voller Kinder.
Die Leute an Deck liefen hastig durcheinander. Alle hatten das herannahende Rennboot bemerkt. Der Anker der Jacht hob sich aus dem Wasser, aber inzwischen hätte sie Flügel haben müssen, um der verheerenden Kollision noch entrinnen zu können.
»Das gibt ein Unglück!«, sagte Zavala und klang dabei eher verblüfft als besorgt.
Austins Hand schien sich von ganz allein zu bewegen und schob die Gashebel nach vorn. Mit donnernden Motoren schoss die Red Ink davon, als wäre sie ein Rennpferd und von einer Biene gestochen worden. Die plötzliche Beschleunigung kam für Zavala überraschend, doch er umklammerte das Lenkrad und hielt mit der Red Ink auf das führerlose Boot zu. Die Fähigkeit, intuitiv zu erfassen, was der andere gerade dachte, hatte Kurt und Joe während ihrer NUMA-Aufträge bereits mehr als einmal die Haut gerettet. Austin gab Vollgas. Der Katamaran hob sich empor und raste über das Wasser. Sie waren doppelt so schnell wie die Carpet und würden im schrägen Winkel ihre Bahn kreuzen. Nur noch wenige Sekunden…
»Bring uns auf parallelen Kurs und möglichst nah heran«, sagte Austin. »Auf mein Zeichen schubst du ihn nach steuerbord.«
Austins Verstand arbeitete auf Hochtouren. Die Red Ink





























