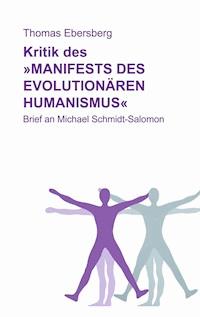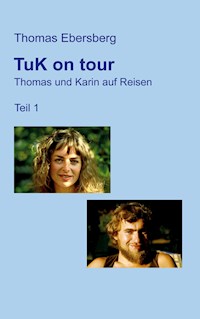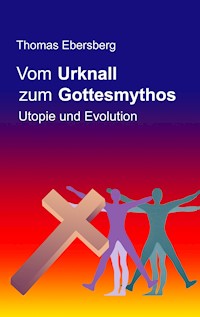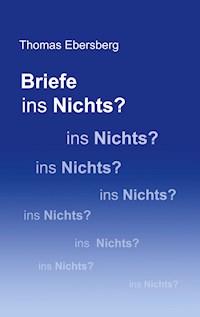
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Briefe an prominente Vertreter aus Medien, christlichen Kirchen, Theologie, Philosophie und Humanismus zu den Themen Christentum, Humanismus und polares Weltbild.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor:
Thomas Ebersberg, Jahrgang 1945, trat nach dem Abitur in den Jesuitenorden ein. Nach drei Jahren verließ er den Orden und studierte Pharmazie und Psychologie. 1987 veröffentlichte er die ironisch-polemische Zeitkritik »Zarte Stachel – Süße Ohrfeigen, Ein Kulturstrip ohne Scham und Traurigkeit«, 1990 »Abschied vom Absoluten, Wider die Einfalt des Denkens«, das Plädoyer für ein polares Weltbild, 2014 »Christentum adieu! Das leise Sterben eines Mythos«, die kritische Auseinandersetzung mit Inhalt, Geschichte und Auflösungserscheinungen des Christentums, und 2016 »Kritik des Manifests des evolutionären Humanismus«, in Form eines offenen Briefs an Michael Schmidt-Salomon. 2020 folgte »Vom Urknall zum Gottesmythos, Utopie und Evolution«, eine Antwort auf die drei klassischen Fragen der Philosophie, mit kritisch vergleichendem Blick auf das christlich transzendentale und das humanistisch säkulare Weltbild.
Inhalt
Vorbemerkung
1.
Journalisten
Thomas Assheuer
Joachim Fest
Justus Fetscher
Mathias Greffrath
Ulrich Greiner
Jens Jessen
Robert Jungk
Christian Matthiesen
2.
Redakteure / DLF
Christiane Florin
Andreas Main
3.
Moderatoren / TV
Jürgen Becker / Wolfgang Schmickler
Gero von Boehm
Gert Scobe
4.
Schriftsteller
Rolf Hochhuth
Walter Jens
Adolf Muschg
5.
Philosophen
Carl G. Hempel
Harald Lesch
Odo Marquard
Peter Sloterdijk
Wolfgang Welsch
Walther Zimmerli
6.
Soziologen / Psychologen
Hans Joas
Horst-Eberhard Richter
7.
Theologen / Kirchenvertreter
Hans-Martin Barth
Heinrich Bedford-Strohm
Roman Bleistein SJ
Eugen Drewermann
Karl-Josef Kuschel
Hans Küng
Jörg Lauster
Thomas Löhr
Reinhard Marx
Johanna Rahner
Michael Seewald
Magnus Striet
8.
Humanisten
Helmut Fink
Arek Platzek
Michael Schmidt-Salomon
Frieder Wolf
Vorbemerkung
Für jemanden, der gerne Briefe schreibt, stellen sich die Fragen: Was macht den Reiz meines Schreibens aus, an wen richte ich mich, wer ist mein nächstes »Opfer«? Und weiter – wenn es nicht um den Austausch relativ banaler persönlicher Erlebnisse geht – welche Themen treiben mich an, wie erkläre ich mein Anliegen, meine Argumente dem Gegenüber? Und wenn ich geschrieben habe – wie nimmt mein Gegenüber das auf, ist der Angesprochene bereit, sich auf meine Argumentationen einzulassen und womöglich in einen Dialog einzutreten? Daraus folgernd: Hat mein Schreiben überhaupt einen Sinn, eine Wirkung oder verlieren sich meine Worte im Nichts?
Der Reiz des Briefschreibens ist das persönliche Gegenüber, jemand, den man sich vorstellen und auf dessen Argumente man sich einlassen kann. Der stilistische Reiz ist die Gesprächsform. Sie ist lebendiger als jede sachliche Abhandlung, veröffentlicht in einem »Medienorgan«. Hinzu kommt der Zwang, die eigene Position für sich selbst zu schärfen und sie überzeugend verständlich zu machen.
Vorliegende Briefe wandten sich an ein breites Spektrum von Adressaten. Anknüpfungspunkte waren deren Aussagen in Zeitungen oder Interviews, die zu kritischen Anmerkungen reizten. Vorwiegend – aber nicht nur – ging es um weltanschauliche Fragen, meistens bezogen auf Positionen des christlich religiösen Weltbilds und dessen humanistisch säkularer Gegenseite. Zugleich war es der Versuch, den eigenen Gegenentwurf eines »polaren Weltbilds« einzubringen, schmackhaft zu machen..
Was waren die Reaktionen? Nur selten kam es zu einem Dialog. Die meisten Angesprochenen schwiegen. Müßig, dieses Schweigen zu interpretieren. Desinteressiertes Schweigen? Betroffenes Schweigen? Sprachloses Schweigen…?
Wer in eine Diskussion eintritt, weiß oder sollte wissen, dass gerade bei weltanschaulichen Fragen das angesprochene Gegenüber nicht aus seiner bewährten Trutzburg aufzuschrecken oder gar zu vertreiben ist. Sollte man deshalb grundsätzlich auf solche Aktionen verzichten? Bleibt dem Schreibenden nicht die – wenn auch vage – Hoffnung, einen zarten Stachel gesetzt zu haben, der den Angesprochenen zumindest in Momenten des Selbstzweifels nicht mehr loslässt und einen Denkprozess in Bewegung setzt? Ist das Schreiben von Briefen also vielleicht doch nicht völlig wirkungslos? Sind es vielleicht doch nicht nur »Briefe ins Nichts«?
1. Journalisten
Thomas Assheuer
26.05.2015
Anmerkungen zum Ihrem Artikel in der ZEIT vom 21. Mai 2015: »Das Ich ist die Sonne«
Sehr geehrter Herr Assheuer,
ich weiß, dass es wagemutig bis zwecklos ist, mit einem Gläubigen über etwas zu diskutieren, was ihm heilig ist. Da aber Sprachlosigkeit zu nichts führt und ich mich als ehemals gläubiger Jesuit einigermaßen gut in Ihre Gedanken- bzw. »Glaubenswelt« einfühlen kann, unternehme ich doch den Versuch, Sie auf einige Fragwürdigkeiten Ihres Artikels »Das Ich ist die Sonne« aufmerksam zu machen.
Mit Ihrer Kritik an dem kapitalistisch bedingten Egokult bin ich völlig einverstanden. Die Frage ist nur, ob wir diesen und die kultur- und machtbedingten kriegerischen Konflikte unserer heutigen Welt mittels des »Pfingstwunders« überwinden können. Die Chance dazu bestand ja schon seit zweitausend Jahren. Doch zunächst sind es ein paar Punkte in Ihren Ausführungen, die ich so nicht stehen lassen kann.
Sie beginnen Ihre historischen Anmerkungen zu der Situation des Pfingstereignisses mit der »schiefen« bis falschen Feststellung, Pilatus habe Jesus hinrichten lassen, »nachdem ihm dessen Friedensbotschaften gefährlich geworden waren«. Sie sollten die Passionsgeschichte noch einmal nachlesen. Pilatus hielt Jesus für einen eher harmlosen Eiferer, der sich als »Messias« oder »König der Juden« sah. Er hätteihn sogar im Zuge einer traditionellen Amnestie freigelassen, wenn die Hohepriester und das aufgehetzte Volk ihn nicht zu dessen Verurteilung gedrängt und seine Kreuzigung gefordert hätten. Nicht seine »Friedensbotschaft«, sondern der Konflikt mit der hierarchischen Elite wurde jenem Jesus von Nazareth zum Verhängnis. Pilatus ließ ihn, um den Hohepriestern einen Gefallen zu tun, kreuzigen, obwohl er selbst ihn für unschuldig hielt.
Zweiter Punkt: Sie nennen Jesus einen »charismatischen Intellektuellen«. Ich weiß nicht, wie Sie das »Charisma« und den »Intellektuellen« definieren. Ein Charisma, d.h. eine Ausstrahlungskraft, die auf die Emotionen seiner Zuhörer wirkt – diese gewissermaßen in Verzückung setzt – darf man jenem Jesus sicher zugestehen. Ihn aber als einen »Intellektuellen« zu betrachten, der seine Sendung »intellektuell« zu ergründen und erklären suchte, das erscheint mir mehr als gewagt. Nennen Sie Ihn einen charismatischen Prediger, Propheten, Utopisten oder Moralisten, nicht aber einen charismatischen Intellektuellen!
Als Messias und Heilsbringer sah jener Jesus sich nicht als einen »Philosophen«, der die Welt verstehen möchte. Und wenn er die »Armen im Geiste« selig pries oder forderte: »Wenn Ihr nicht werdet wie die Kinder…«, dann beweist das, dass er auf Seiten naiver Gutgläubigkeit, nicht aber auf Seiten kritischer Reflexion stand. Jener Jesus sprach in Bildern, er erzählte »Gleichnisse«, Geschichten mit anrührenden oder provokanten Inhalten; aber er erklärte nicht, analysierte nicht, wie Sie es als Intellektueller in Ihren Artikeln tun.
Nächster Punkt: Wie Sie das Pfingstwunder »wörtlich genommen«, quasi als reales Ereignis beschreiben, zeigt, dass Sie sich mit der Interpretation der biblischen Texte ziemlich weit hinter den Standards moderner Exegese befinden.
Kein Exeget glaubt heute noch ernsthaft, dass die Apostel in verschiedenen, ihnen selbst fremden Sprachen gesprochen haben. Ja, diese wundersame Erzählung soll die Botschaft eines die Kulturen und Sprachen übergreifenden Glaubens versinnbildlichen. Aber sie ist nicht der dokumentarische Bericht eines historischen Ereignisses. Wenn Sie die Bibel so naiv und wörtlich auslegen, dann dürfen Sie sich nicht darüber beklagen, wenn die Muslime ihren Koran »wörtlich« nehmen, Wort für Wort vom Engel Gabriel dem Propheten »geoffenbart«.
Ob so oder so, ob wörtlich oder bildlich gemeint – es stellt sich die Frage, warum das »Pfingstwunder« trotz der erfolgreichen Christianisierung, von den bescheidenen Anfängen in Rom und Kleinasien bis zu dem geschichtsmächtigen »christlichen Abendland«, historisch nicht wirksam wurde, warum das, wovon Sie träumen, die »Differenz ohne Feindschaft und Gewalt«, nicht stattfand. Weiter stellt sich die Frage, warum die hoffnungsvolle Utopie der »Gleichheit und Brüderlichkeit«, der »Demokratie und Menschenrechte« nicht vom Christentum, sondern von einer eher antiklerikalen, »säkularen« Revolution herbeigeführt wurde. Der Vatikan mit Papst Franziskus hat jene UNO-Menschenrechts-Resolution bekanntlich noch immer nicht unterschrieben, weil er das »jus divinum« durch ein »jus humanum« gefährdet oder infrage gestellt sieht.
Wer hat den »Schritt nach vorn« in eine sozialere Gesellschaftsordnung gemacht, das Christentum oder die »Säkularen«? Und auch der moderne Sozialstaat ist nicht die späte Frucht christlicher Nächstenliebe. Er wurde mit Streiks und Revolutionen erkämpft.
Ich fürchte, wir werden die derzeitige »Differenz mit Feindschaft und Gewalt« zwischen Menschen und Kulturen, die sich zum Teil noch auf Offenbarungen mit absolutem Wahrheitsanspruch berufen, mit einer transzendental begründeten Argumentation und der Hoffnung auf eine Wiederholung des »Pfingstwunders« wohl kaum überwinden. Sollten wir es nicht lieber mit »säkularen«, d.h. human begründeten und für jedermann nachvollziehbaren Argumenten versuchen, den Egokult und die Differenzen, wenn nicht auszuhebeln, so doch wenigstens auf ein annehmbares Maß zu relativieren?
Die »hyperempathische« Botschaft der undifferenzierten Nächsten- und Feindesliebe des Jesus von Nazareth hat dies offensichtlich trotz der Unterstützung des Heiligen Geistes bisher nicht geschafft. Ich denke, die Gläubigen – die Naiven und die »Aufgeklärten« – müssen sich auf eine andere als die transzendentale Argumentationsebene begeben, wenn sie gehört und verstanden werden wollen.
Sie werden sich damit abfinden müssen, dass sich die Transzendenz aus dem Bewusstsein der von Ihnen so genannten »religiös unmusikalischen Zeitgenossen« verflüchtigt hat. Den Begriff »religiös unmusikalisch« halte ich übrigens für eine unerträgliche Mischung aus Mitleid und Arroganz. Auch halte ich es für »intellektuell« nicht überzeugend, dem religiösen, einem angeblich »essenziellen Bedürfnis« des Menschen eine besondere Begabung, eine Art »Musikalität«, zugrunde zu legen.
Das Verschwinden der Transzendenz, beginnend mit Säkularisation und Aufklärung, wird sich wohl fortsetzen, solange Evolution und das damit einhergehende unvollendete Projekt Aufklärung am Werk sind.
Auch Sie hoffen wohl eher auf ein »säkulares Pfingsten« als auf die Wiederholung jenes biblischen Ereignisses. Ja, die Sehnsucht nach jener Utopie »Differenz ohne Feindschaft und Gewalt« ist da. Sollten Sie nach einer philosophischen Lösung des Problems suchen, gründend auf einem Weltbild, das auch jenem »Das Ich ist die Sonne« widerspricht, dann empfehle ich Ihnen – nicht unbescheiden –, in mein Buch »Abschied vom Absoluten – Wider die Einfalt des Denkens« hineinzuschauen.
Meine kritische Auseinandersetzung mit dem Christentum: »Christentum adieu! – Das leise Sterben eines Mythos« habe ich vor einiger Zeit Ihrer Redaktion GLAUBEN & ZWEIFELN zur Ansicht geschickt. Wenn ich allerdings Ihre Rubrik GLAUBEN & ZWEIFELN über mehrere Ausgaben betrachte, muss ich leider feststellen, dass Sie dem Glauben offensichtlich mehr Raum und Gewicht geben als dem Zweifeln. Zweifel, die nicht in den Glauben einmünden, sollten, denke ich, doch wohl erlaubt sein. Ich kann nur hoffen, dass die ZEIT nicht zu einem Konkurrenzblatt von »Christ & Welt« mutiert.
Zu Pfingsten hätte man z.B. auch den »Heiligen Geist«, den extra-personifizierten Geist eines als »Geist« definierten Gottes inklusive Heiliger Dreifaltigkeit zur Debatte stellen können. Gott-Vater, Gott-Sohn, der schon vor seiner Zeugung von Ewigkeit zu Ewigkeit bei seinem Vater thront, und über beiden als »dritte Person« der Heilige Geist (der Geist Gott-Vaters) – dieser männlich dominierte, patriarchalische Drei-Personen-in-Eins-Gott ist schon ein bizarres Konstrukt, für einen denkenden Menschen eine schiere Zumutung. Aber da sind wir wieder bei einem jener »Glaubensgeheimnisse«, die nur den »religiös musikalischen« Zeitgenossen zugänglich sind und jenen Hasardeuren des Glaubens, die fröhlich trotzig sagen: »Credo, quia absurdum…«, ich glaube, gerade weil es absurd ist!
Nach Ihrem etwas »schwärmerisch überhitzten« Ausflug in die religiösen Gefilde wünsche ich Ihnen und mir, dass Sie wieder zur kühlen, gewohnt intellektuellen, wohlformulierten Analyse des Zeitgeschehens zurückfinden.
In diesem Sinne grüße ich Sie
31.5.2015
Sehr geehrter Herr Assheuer,
erschrecken Sie nicht. Ich möchte Sie keinesfalls in eine Endlosdiskussion verwickeln, zumal ich annehme, dass Sie mit genügend Themen geistig beschäftigt sind. Nur zur abschließenden Klärung ein paar Anmerkungen zu Ihrer Mail.
Wie Sie auf die »jesuanische Kritik der antiken Mythologie« kommen, ist mir rätselhaft. Ich kenne keine Passage in den Evangelien, wo Jesus sich mit der »Antike« und deren Mythen auseinandersetzt. Wenn er Kritik übte, dann an der formalistischen Fixierung der Schriftgelehrten und Pharisäer auf die Einhaltung der Regeln und des Kultes. Die »blasphemische« Gleichsetzung der Nächstenliebe mit der Gottesliebe war ja für die hierarchische Elite das Sakrileg, die Häresie schlechthin. Zugleich war sie seine eigentliche historische Leistung innerhalb der Mythengeschichte oder – wenn Sie »Mythos« und »Religion« auseinander halten wollen – der Religionsgeschichte. Ja, dieser Jesus von Nazareth war in Ansätzen »säkular« ausgerichtet, zumindest in seiner verkündeten Moral und Blickrichtung. Dass er den »Mühseligen und Beladenen« keine Besserstellung im Diesseits, sondern den Lohn im Jenseits in Aussicht stellte, zeigt aber, dass er letztlich kein diesseitiger »Sozialrevolutionär« war, sondern immer noch gefangen im Blick auf seinen »Vater im Himmel« und auf ein Reich, das »nicht von dieser Welt« sein sollte. Da war er noch Kind seiner Zeit. Dennoch könnte man die »Säkularisation«, etwas provokant gedeutet, durchaus mit jenem Jesus von Nazareth beginnen lassen. Geistige Entwicklungen geschehen ja nicht unbedingt in Brüchen, schlagartig und radikal, sondern zumeist im »Überblendverfahren«.
Die christlichen Kirchen sind übrigens längst »teilsäkularisiert«. In der Verkündigung konzentrieren sie sich nicht mehr auf die Themen Sünde und Vergebung, auf Lohn oder Strafe im Jenseits, sondern auf Frieden, soziales Engagement, fairen Umgang mit der Dritten Welt etc. Insofern sind sie, von einigen Fundamentalisten abgesehen, natürlich wesentlich harmloser als Religionen, die den »Gottesstaat« postulieren und ihren »Märtyrern« einen phantastischen Lohn im Jenseits versprechen.
Dass das Christentum es heftig ablehnt, sich in die Evolution der »Mythen« einordnen zu lassen, in eine Reihe mit dem »heidnischen Aberglauben« seiner Vorgängermythen/-religionen gestellt zu werden, ist verständlich, aber etwas naiv. Die von Ihnen genannte »unendliche Differenz zwischen Mythos und Monotheismus« zu postulieren, erscheint mir gewagt. Es sei daran erinnert, dass jener Gott Jahwe, den sich die jüdischen Nomaden aus dem vorhandenen Götterangebot als ihren Stammesgott aussuchten, vor der Niederlegung des Alten Testaments noch eine Partnerin, die Göttin Aschera hatte. »Monotheismus«? Oder nur die patriarchalisch bereinigte Fassung eines Götterpaares?
Natürlich meint jede Religion, die »letzte« und die mit der finalen »absoluten Wahrheit« zu sein. Mit dem Gedanken einer Evolution des menschlichen Bewusstseins und der Weltbilder über hunderttausend und mehr Jahre Kulturgeschichte des Homo sapiens kann ein statisches Weltbild, das auf der Idee einer einmalig und für alle Zeiten geoffenbarten Wahrheit gründet, nichts anfangen. Sich irgendwo in einem Entwicklungsprozess zu befinden, der keineswegs abgeschlossen ist, das beleidigt den, der sich im Besitz der Wahrheit und womöglich noch von seinem Gott »auserwählt« wähnt. Mit dieser Art von Selbstrelativierung oder Selbstbescheidung können Heilsutopien nichts anfangen. Sie haben immer einen apokalyptischen Aspekt: Ob es das »Reich Gottes auf Erden« oder ein säkularer Heilsmythos wie der Kapitalismus bzw. die Marktideologie ist, immer herrscht der Glaube, dass die Geschichte auf ein paradiesisches Happyend zusteuert – Geschichte, gedeutet nicht als Entwicklungsgeschichte, sondern als Heilsgeschichte. Wer soll es dem naiven Gläubigen verdenken, sich einer »von allem Übel erlösenden« Utopie hinzugeben?
»Die Erfolglosigkeit von Ideen ist kein Beweis für ihre Unwahrheit« sagen Sie. Ich würde sagen, sie ist ein Beweis für ihre utopische Unmöglichkeit. Das Gebot der undifferenzierten Nächsten- und Feindesliebe kann keinen Erfolg haben, weil sie der Natur – ja, der Natur – des Menschen widerspricht. Man kann zwar versuchen, die natürlichen Impulse der menschlichen Empathie z.B. im Lauf der Erziehung zu trainieren, ihnen ein positives Image zu verleihen und dadurch dem »Egokult« Paroli zu bieten oder ihn zumindest zugunsten eines Gemeinschaftsgefühls zu relativieren; aber damit verlassen wir die utopische, »übernatürliche« Sphäre der von Jesus geforderten Moral und bescheiden uns mit einer »natürlich« begründbaren humanen Fassung. Und – über die »Wahrheit« von Ideen, die in »Ideale« einmünden, darf trefflich gestritten werden. (s. »Abschied vom Absoluten,,,«) Vielleicht sind gerade diese Verabsolutierungs- und Idealisierungsversuche einzelner Aspekte des Menschseins die Wurzel unnötiger menschlicher Konflikte und historischer Katastrophen.
»Säkularisten« wie der von Ihnen zitierte George Steiner sind für mich kein Vorbild. Auch den dezidierten Atheisten – Gläubige mit umgekehrtem Vorzeichen – stehe ich skeptisch gegenüber, es sei denn, sie lehnen »nur« die Existenz eines gütigen »Gottes der Liebe« als Schöpfer oder Urprinzip dieser unserer Wirklichkeit ab. Das Problem der Theodizee unter der Kategorie der »Glaubensgeheimnisse« per Denkverzicht zu lösen, halte ich für wohlfeil und eines denkenden Menschen unwürdig. Zumal die Negativseite der Wirklichkeit ihre Logik und damit ihre Berechtigung hat. Nur mit der tabuisierten Prämisse eines »Gottes der Liebe« hat man Schwierigkeiten, das »Ganze« dieser Welt zu verstehen und zu akzeptieren. Aber das ist ein anderes Thema.
Säkulare, »entspannte« Agnostiker verzichten auf apodiktische Aussagen über die Existenz einer »höheren Macht« oder eine »anderen Welt«. Ja, sie lassen sich gerne überraschen – ob nach dem Tod oder auch schon hienieden; sie halten alles für möglich. Aber die Angebote der Mythen/Religionen schauen sie sich schon genauer an. Unstimmigkeiten, intellektuell und emotional nicht Nachvollziehbares, sind für sie Grund genug, der jeweils angebotenen Antwort auf existenzielle Fragen eine Absage zu erteilen. Soviel »Stolz«, oder sagen wir: »berechtigtes Selbstwertgefühl« darf sein, muss sein!
Wenn Sie das christliche Gottesbild als eines personalen Gegenübers, mit dem sie Zwiesprache halten können und der es mit allen Menschen »nur gut meint«, in Ihrem Innersten überzeugt, dann erübrigt sich jedes weitere Wort. Dann gehören Sie in der Tat zu jenen wenigen Auserwählten: »Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt!« Auch so eine der jesuanischen, elitär angehauchten »Frechheiten«.
Solange Sie Dinge glauben, die Ihnen nicht nur rational, weil von einer Koryphäe geschrieben (»rationalisieren« kann man, s. Freud, alles), sondern auch emotional, ihren innersten Instinkten entsprechen, einleuchten, Ihnen »schmecken« – solange sehe ich keine Probleme für Sie. Das einzige Problem allerdings aus einer überindividuellen Sicht heraus dürfte die Unterschiedlichkeit der Bewusstseinsstufen sein.
Ja, dann hapert es mit der Einigkeit, mit der »Differenz ohne Feindschaft und ohne Gewalt«. Wir sind nun mal keine homogene Masse Mensch. »Den« Menschen gibt es nicht. »Mit den Unterschieden leben« ist ja wohl auch so eines der von Papst Benedikt als »relativistisch« bezeichneten und heftig bekämpften Lebensprinzipien. Ich persönlich habe kein Problem mit dem bunten Gewimmel. Wenn ich allerdings die weltweiten Konflikte sehe, zum Teil begründet mit Argumenten aus der Welt der Mythen/ Religionen, dann hoffe ich doch, dass dieser Homo sapiens irgendwann einmal zu einer gemeinsamen, allen verständlichen Weltanschauung und Weltordnung findet – es muss ja kein Paradies sein! Eine »utopische« Hoffnung?
Vermutlich arbeiten auch Sie mit derselben Hoffnung im Hintergrund. Ich wünsche Ihnen dabei Erfolg und nicht nachlassendes Engagement und grüße Sie mit den besten Wünschen
Joachim Fest
19.11.90
Sehr geehrter Herr Fest,
Sie sagten einmal vor längerer Zeit in einem Fernsehinterview mit Gero von Boehm. Sie würden gerne ein Buch über die Utopien und deren unheilvolle Folgen schreiben – über »den Ursprung aller menschlichen Tragödien aus dem Geist der Utopie«... Und Ihr Essay »Schweigende Wortführer« in der FAZ Ende letzten Jahres (Nr.302/S.25) machte Ihre utopiekritische Einstellung einmal mehr ebenso eloquent wie vehement deutlich. Die im Weiteren angeführten Zitate stammen aus eben jenem Essay.
Die – vermutete – Kongruenz unserer Denkungsart hat mich dazu animiert, Ihnen mein Buch »Abschied vom Absoluten« vorzustellen. Es ist ein Buch über Utopie und durchleuchtet die »gesellschaftlichen Beglückungsprojekte«, die »Projekte der imaginären Paradiese«, wie Sie die Ziele des utopischen Denkens so trefflich nennen. Ich habe versucht, der fatalen Faszination dieses Denkens auf die Spur zu kommen und zugleich dessen Absurdität aufzuzeigen.
Welches Bewusstseinsmuster, welches Weltbild liegt ihm zugrunde? Wo beginnt es historisch? Stellt es eine – womöglich unvermeidliche – Entwicklungsstufe der kulturellen Evolution, die auch Bewusstseinsevolution ist, dar? Gibt es Analogien zwischen der Onto- und Phylogenese des Homo sapiens? Derlei Analogien sind ja mehr als amüsante Spielerei. Durch die Entdeckung der Fraktale wurden sie neuerdings »mathematisch abgesegnet«.
Was ist die Mechanik des utopischen Denkens? Warum muss es geradezu zwanghaft scheitern, warum ist es zerstörerisch? Zitat (Fest): »Denn die Utopien haben durchweg in einem jener Unterjochungssysteme geendet, die gerade nicht eine Abirrung, sondern die unvermeidliche Logik aller verwirklichten Ismen sind.«
Ich möchte Ihnen die Lektüre meines Buches nicht per Kurzinhaltsangabe »ersparen«. Die nachfolgende grobe Skizze meiner Gedankengänge sind eher als Appetitmacher zu verstehen.
Das Fundament des utopischen Erlösungsdenkens scheint mir das monistische Weltbild und dessen Utopie des Absoluten zu sein, erstmals manifestiert im Monotheismus. Die Wurzeln der von Ihnen angeführten politischen und ökonomischen Heilsutopien des neunzehnten Jahrhunderts dürften also sehr weit zurückliegen. Das Absolute tauchte im Lauf der Geschichte in den verschiedensten Metamorphosen auf. Ich nenne diese Periode das monistische Intermezzo.
Als individualpsychologisches Pendant aus der Ontogenese bietet sich das Phänomen des infantilen Größenwahns und Narzissmus auf einer egoemanzipatorischen Entwicklungsstufe des Kindes an. Das omnipotente, sich selbst verabsolutierende Ich – der absolute Gott und sein vollkommenes Paradies – ist die illusionäre Zielprojektion dieses Bewusstseinsstadiums.
Monistische Utopie versucht ja gewöhnlich, von der »Negativseite des Seins« zu erlösen. Sie verstößt damit gegen die Polarität – in meiner Diktion – gegen die »Meta-Struktur« des Seins.
Diese »einfältige« Sicht der Dinge bestimmt neben der simplifizierenden ontologischen Deutung der Welt auch die Taktik der monistischen Utopien, sprich Ideologien. Ihre negativen Folgen und ihr Scheitern sind vorprogrammiert. Die verkündete »Erlösung« erweist sich, in Wirklichkeit umgesetzt, als Auflösung, als Zerstörung.
Infantiler Größenwahn und Narzissmus werden gewöhnlich von den Realitäten des Lebens zurechtgestutzt. Im individuellen Reifungsprozess – wenn er denn stattfindet – folgt auf die Phase der emanzipatorischen (Selbst-)Verabsolutierung die der emanzipierten (Selbst-)Relativierung.
Parallel zu den individuellen Entwicklungsprozessen ließe sich also historisch, in Form einer »Triade«, die Entwicklung des Bewusstseins vom unbewusst polar-pluralen Weltbild des Mythos (politisches Pendant sind Polykratie und Oligarchie) über das monistische der monotheistischen Religionen und Ideologien (Monarchie/Absolutismus/Faschismus) zum bewusst polar-pluralen, postideologischen Weltbild der Gegenwart (Demokratie, offene Gesellschaft) diagnostizieren.
Vermutlich befinden wir uns an dem Punkt, wo die monistische Ur-Utopie, das Absolute, und dessen methodische Konsequenz, das Verabsolutieren, an ihr absurdes Ende gekommen sind – und zwar in allen ihren Varianten, von der Großideologie bis hin zu den kleinformatigen Ismen.
Den »Markt« beurteile ich vielleicht etwas kritischer als Sie, zumal ich ihm latent ideologische, d.h. totalitäre Tendenzen vorwerfe. Mir scheint, der naiv unreflektierte Glaube an die Allmacht des »freien Marktes« die letzte Variante monistisch utopischen Erlösungsdenkens zu sein. Verspricht nicht auch die Marktideologie die »Erlösung von allem Übel«?
Religiöse, philosophische (monistische »Primat«-Metaphysik auf der Suche nach dem Einen/Absoluten), politische und ökonomische Utopien liegen meiner Meinung nach auf der gleichen Linie. Die Geschichte hat ihnen, in der Tat, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach dem Zeitalter der Verabsolutierungen scheint ein Zeitalter der Relativierungen anzubrechen.
Zitat (Fest): »Die manchem schmerzhafte Lektion der Epoche heißt am Ende wohl, dass die Utopie, die Sehnsucht nach einer Welt der Eintracht, Ordnung und Gerechtigkeit, überhöht vom spirituellen Glanz, nur ein Trugbild ist. Vielleicht wird man doch ohne Utopie leben müssen.«
Was nun wäre die Alternative zu »Utopie«? Sollten wir den durch die monistische Tradition zerschlissenen Begriff auf die Sprachmüllhalde werfen oder einen revidierten Utopiebegriff, eine Meta-Utopie, ins Spiel bringen, der den positiven Aspekt von Utopie, die Verwirklichung des schlummernden Noch-Möglichen – nicht des Unmöglichen! – aufgreift und in konstruktive Bahnen lenkt?
Geschmackssache, gewiss! Ein solcher revidierter Utopiebegriff würde ein Entgegenkommen gegenüber jenen bedeuten, die glauben, »ohne Utopie nicht leben zu können«. Unabdingbare Voraussetzung allerdings wäre der Abschied vom monistischen Weltbild und, im Gegenzug, die Wiederentdeckung, das Weiterdenken des Phänomens oder »Seinsprinzips« Polarität, das eigentlich kein »Prinzip« ist, da es auch seinen Gegenpol, das Nichtprinzipielle, einschließt.
Das Nachdenken über die Polarität, die der Idee des Absoluten und allen monistischen Utopien widerspricht, hat zwar eine gewisse Tradition – von Heraklit über die fernöstliche Philosophie bis zu Goethe, es kommt jedoch, wie mir scheint, gerade in der aktuellen Diskussion über »Paradigmenwechsel« und »Postmoderne« zu kurz – mit der Folge, dass diese Postmoderne auf einen schon wieder als »ideologisch« zu bezeichnenden Pluralismus (»Beliebigkeit«) zusteuert.
Ansätze zu einem postmonistischen Zeitalter samt polarem Weltbild gibt es ja schon auf breiter Front: in Naturwissenschaft, Kunst, Ästhetik und Ethik bis hin zur Ökologiebewegung. Es käme darauf an, die heimlichen Querverbindungen der scheinbar getrennten Bereiche aufzuzeigen und die isoliert gewonnenen Erkenntnisse interdisziplinär zu einer universalen – nicht totalitären! – Theorie zu verknüpfen.
Genau das ist die Intention meines Buches »Abschied vom Absoluten«, konzipiert in einer Form, die nicht nur der »Elite«, sondern auch dem wissenschaftlich und philosophisch »unbedarften« Leser zugänglich ist. Kommunikation – horizontal und vertikal.
Vielleicht spricht Sie das Buch an und Sie halten es für wert, den Lesern Ihrer Zeitung vorgestellt zu werden.
Ich würde mich jedenfalls freuen, von Ihnen zu hören und grüße Sie
Justus Fetscher
18.12.90
Sehr geehrter Herr Professor Fetscher,
Sie erinnern sich noch an Ihren Besuch beim Donat- Verlag auf der Frankfurter Buchmesse, wo Sie von zwei hübschen Damen eingerahmt und mit Lebkuchen versorgt wurden? Ich nützte damals die Chance, Ihnen, dem prominenten und erklärten Ideologiekritiker, mein Buch »Abschied vom Absoluten« als Lektüre mit auf den Weg – nach Neapel und nach Cambridge? – zu geben.
Diesmal ist es Ihre Rezension in der ZEIT (Nr. 50) »Der Ethiker im Zweifel«, die mich veranlasst, Sie noch einmal auf mein Buch aufmerksam zu machen. Eine Passage Ihres Artikels erinnert an einen Grundgedanken, auf dem mein »Abschied vom Absoluten« aufbaut. Sie schreiben: »Es gibt keine Aussage über den Menschen, die nicht ambivalent, zweideutig wäre.«
Genau diese Ambivalenz ist eines meiner Hauptargumente gegen das monistische Weltbild, gegen die Einfalt des ideologischen Denkens. An der Ambivalenz scheitert alle monistisch totalitäre Metaphysik und Nach-Metaphysik – vom Philosophen-Logos über den Monotheismus bis zum Kommunismus und Kapitalismus, pardon, dem »freien Markt« – und was sonst noch an Heilsutopien angeboten wird.
Ich meine, es wäre an der Zeit, das Scheitern, den Verlust dieses Kindheitsmythos nicht nur zu diagnostizieren oder gar zu bedauern, sondern einen »sinnstiftenden« – was für ein hehrer Anspruch, ich weiß! – Gegen- bzw. Neuentwurf zu riskieren, will sagen: dem monistischen ein polares Weltbild gegenüberzustellen, mit dem sich zwar bescheidener, aber besser leben lässt als mit der grandiosen Utopie des Absoluten. Und mit dem sich manch ethisches Problem – z.B. der »verantwortliche Umgang mit der Natur« – in effizienterer, d.h. existentiell überzeugenderer Weise angehen ließe, jenseits von Lamento und sinnlosen moralischen Appellen.
Was halten Sie davon, den diversen Heilsgeschichten eine Entwicklungsgeschichte des Homo sapiens entgegenzusetzen, die nach folgendem Muster verläuft: mythischer Polytheismus, emanzipatorischer Monotheismus, aufgeklärter Polytheismus – oder: Polykratie, Monarchie (Ideologie), Demokratie (plurale Gesellschaft) – oder: unbewusst polar-plurales Weltbild, monistisches Weltbild (»Intermezzo«), bewusst polar-plurales Weltbild?
Klingen Ihnen solche »Triaden« nach simplifizierender Geschichtsphilosophie oder sehen Sie in ihnen Entwicklungsprozesse, die sich historisch großdimensional in den verschiedenen Kulturkreisen und analog – oder moderner: fraktal – in der Geschichte des Individuums abspielen?
Immerhin, eine solche Deutung der Geschichte ergäbe für die (Post-)Moderne, die sich auf Schlingerkurs zwischen Fundamentalismus und Beliebigkeit befindet, eine Perspektive.
Ich hoffe, Ihnen mit diesen wenigen Anmerkungen noch einmal Appetit auf den »Abschied vom Absoluten« gemacht zu haben und grüße Sie
Mathias Greffrath
17.07.2020
Sehr geehrter Herr Greffrath,
In Ihrem Essay letzten Sonntag (12.07.2020) im DLF haben Sie sich redlich Mühe gemacht, all die schönen Träume und Utopien, die durch die Geschichte geisterten, aufzuzählen, immer mit einem Touch Melancholie und Enttäuschung darüber, dass aus den Träumen nichts oder nur sehr wenig wurde. Nur, die Antwort auf die Überschrift Ihres Essays »Warum Utopien scheitern« blieben Sie schuldig. Liegt es tatsächlich nur daran: »Die Ideen sind da, doch wir noch nicht so weit«? Wer oder was ist schuld daran, dass sich »die utopischen Bilder idealer Gesellschaften« als unerfüllbar erweisen?
Getreu dem Schema der meisten enttäuschten oder frustrierten Utopisten halten auch Sie den »bösen« Menschen für die Ursache allen Übels. Dementsprechend nennen sie das Anthropozän »die verdorbene Epoche«. Nur zu gerne wird dem Menschen als »Krone der Schöpfung« Hochmut vorgeworfen. Sie kennen vielleicht noch den Auftrag des Schöpfers in der Bibel: »Macht euch die Erde untertan!«
Diesen Auftrag hat der Mensch in der Tat erfüllt. Das war die logische Folge seiner ihm verliehenen Potentiale. Der Mythos ahnte die Dominanz des Homo sapiens, warnte ihn aber nicht vor den möglichen Folgen. Nur, nicht die Dominanz ist das Problem, sondern der Umgang mit ihr. Und in diesem Punkt, in der Folgenabwägung, ist Homo sapiens ja inzwischen ins Grübeln gekommen.
Ist wirklich nur der »böse, sündige Mensch« schuld am »Scheitern der Utopien«? Oder sind diese Idealvorstellungen grundsätzlich fragwürdig, gehen sie an der Wirklichkeit vorbei? Liegt es womöglich an der Natur (des Menschen)? Ist diese anti-utopisch gestrickt, konzipiert? Hat sich – um in der Bildwelt des Mythos zu bleiben – der Schöpfer einen Konstruktionsfehler erlaubt? Kann eine Natur, die auf Konflikt, auf »natürliche Feindschaft«, auf Konkurrenz programmiert ist, ein Nährboden für ideale Vorstellungen von »Friede, Freude, Eierkuchen« sein?
Womit wir bei der polaren Struktur der Wirklichkeit wären, die allen Utopien, allen Idealen einen Strich durch die Rechnung macht. Diese »Schöpfung« gründet eben nicht auf Gleichheit, Gerechtigkeit, Harmonie, Frieden, ... Ja, auch diese positiven Elemente gibt es, aber niemals ohne ihre polaren Gegenspieler. Und das nicht ohne Grund. Denn ohne die Gegenspieler von Gleichheit, Gerechtigkeit, Harmonie, Frieden, Glückseligkeit... wären diese nicht vorstellbar, nicht existent, sie machten keinen Sinn. Man kann die Wirklichkeit nicht halbieren und auf das Positive reduzieren. Ideale, die auf der Verabsolutierung positiver Aspekte gründen, haben keine Chance zur Verwirklichung, sind zum Scheitern verurteilt. Das ist meine Begründung, »warum Utopien scheitern«.
Vielleicht sollten wir uns statt auf konfliktfreie Ideale auf die Abschwächung der natürlichen Konfliktpotentiale auf ein sozialverträgliches Maß konzentrieren. Da entstünden dann allerdings keine utopisch-paradiesischen Zustände, sondern »nur« Verhältnisse, die sich mit der »Natur des Menschen« vereinbaren lassen. Mit der »Übernatur« hat es bisher ja nicht geklappt.– weder mit der »christlichen Nächsten- und Feindesliebe« im »christlichen Abendland« noch mit dem kantischen »ewigen Frieden« der Aufklärung. Vielleicht sollten wir die Träume vom Paradies auf das Jenseits, in die »andere Welt«, an die noch ein paar Menschen glauben, verschieben. Vielleicht gelten dort andere Regeln als im Diesseits. Sorry, das war leicht polemisch.
Mit der »Heimat« als »Gegenbegriff zur Utopie« versuchen Sie den Spagat zwischen dem derzeitigen »heimelig« anmutenden Heimat-Hype und dessen globaler Ausweitung auf die Erde als unser aller gemeinsamen Heimat. Das ist ein etwas überstrapazierter Heimatbegriff. Denn zur Heimat gehört im allgemeinen Verständnis als polarer Gegenspieler die »Fremde«. Die können Sie nicht wegzaubern. Ebenso gut oder schlecht könnten Sie die »Familie« ins Spiel bringen als die eine, große »Menschheitsfamilie«.
Sie wissen aber, weder die Heimat noch die Familie sind Orte ungetrübter, harmonischer Idylle. Den natürlichen Konfliktpotentialen entkommen Sie nirgends und diese werden Sie auch niemals auflösen können. Auf den Traum von der »Erlösung von allem Übel« wird der Mensch wohl schwerlich verzichten. Er wird die ewige, nicht einlösbare Utopie bleiben.
»Vier Stunden Regelarbeitszeit... der Lebenskunst untergeordnet... in einer solaren Weltgesellschaft...« Glauben Sie, Herr Greffrath, noch an derlei Träume oder hoffen Sie nur darauf? In meinem »Abschied vom Absoluten« entwarf ich die »Meta-Utopie« eines »postideologischen Zeitalters« und einer »pluralen Weltgesellschaft«. Inzwischen bin ich dreißig Jahre älter geworden und meine Zweifel an der Verwirklichung dieser Meta-Utopie mehren sich.
Wenn Sie meine Argumentation etwas genauer kennenlernen möchten, empfehle ich Ihnen, neben dem »Abschied vom Absoluten«, mein neues schmales Büchlein: »Vom Urknall zum Gottesmythos, Utopie und Evolution«. Dort geht es um den Vergleich der transzendentalen und säkularen Utopien, um deren Charme und Scheitern.
Beste Grüße
Ulrich Greiner
12.04.2015
Anmerkungen zum Ihrem Artikel in der ZEIT vom 1. April 2015: »Gott opfert sich selbst«
Sehr geehrter Herr Greiner,
ich habe es mir lange überlegt, ob ich Ihnen – gemäß dem Ausspruch: »Verschwende deine Zeit nicht mit Andersdenkenden!« – schreiben soll. Nun, bestimmte Aussagen, zumal wenn sie öffentlich vorgetragen werden, sollte man doch nicht unkommentiert lassen, wenn sie zum Einspruch reizen.
»Gott opfert sich selbst« – schon die Überschrift Ihres Artikels ist »schief« bis reichlich fragwürdig. »Gott«, im Verständnis des durchschnittlichen abendländischen Christen als Schöpfergott oder »Gott Vater« betrachtet, opfert gemäß der Bibel nicht »sich selbst«, sondern seinen Sohn. Von ihm verlangt er das Opfer, das übrigens entgegen Ihrer späteren Behauptung ein klassisches, grausames »Menschenopfer« ist. Das »Selbstopfer Gottes« können Sie nur mit dem bizarren Konstrukt der Dreifaltigkeit teilweise retten: »Gott Sohn« thront schon vor seiner Zeugung bei »Gott Vater«, zusammen mit dem Heiligen Geist, dem personifizierten Geist eines als Geist definierten Gottes, »von Ewigkeit zu Ewigkeit«. Aber auch unter dem Aspekt der »Heiligen Dreifaltigkeit« opfert sich nur »Ein-Drittel-Gott«, die zweite Person dieses männlich patriarchalischen göttlichen Triumvirats. In der Tat ein »Glaubensgeheimnis«!
Dieser Gottessohn schien – laut zitiertem Text von Chesterton – in seiner Gottverlassenheit »eine Sekunde lang Atheist zu sein«. Das klingt provokant, aber wenig überzeugend. Wenn ein Mensch an Gott zweifelt – und das tat jener Jesus von Nazareth vermutlich –, ist das verständlich. Aber den Zweifel eines Gottes an der eigenen Existenz zu konstruieren – dazu gehört schon eine Portion kecker Dreistigkeit und die Ausschaltung jeglicher Reflexion. Es sei denn, jener Jesus hätte eine schizophrene Persönlichkeitsstruktur gehabt.
Ebenso bizarr die Vorstellung, dass Gott (welche der drei Personen auch immer) »augenblicksweise die ganze menschliche Erbärmlichkeit erleidet«. Das hätte er nicht müssen, wenn er als Schöpfer des Universums dieses anders konzipiert hätte. Ja, wenn man alles Leid dieser Welt inklusive Krankheit, Tod und Naturkatastrophen der »Erbsünde«, dem sündigen Menschen zuschreiben könnte, wie dies die christliche Lehre tut...
Der Kreuzestod des Jesus wird übrigens von der christlichen Lehre nicht als solidarischer Akt Gottes mit den Menschen und seinem Leiden gedeutet, sondern als Sühneopfer »zur Vergebung der Sünden«. Ein Opfertod für wen? Für so harmlose Sünder wie Sie und mich und die Mehrzahl unserer Mitmenschen? Halten Sie ein solches Opfer tatsächlich für angemessen oder nötig? Verbirgt sich hinter der Idee eines für die Menschheit geopferten Gottes nicht sogar etwas wie menschlicher Größenwahn?
Die von Ihnen zitierte »Unermesslichkeit irdischen Leids« hätte ein »Gott der Liebe«, wie er vom Christentum emphatisch gepriesen wird, zu verhindern gewusst. Die Sünden der Menschen hätte er in einem einfachen Akt barmherziger Liebe vergeben können. Nein, der Christusmythos ist nicht völlig neu und anders als die anderen Mythen. Er reiht sich ein in die Tradition der transzendentalen Opferkulte und führt sie mit der Vorstellung des »geopferten Gottessohnes« an einen scheinbar grandiosen, aber absurden Höhepunkt. Und vermutlich an ihr Ende. Nicht mehr Gott, sondern der Mensch, die »Erlösung des Menschen« steht im Mittelpunkt der Geschichte.
Weil die Passion des Jesus dem Modernen fremd und abstrus anmutet (wie Ihnen als Junge), wird sie in Ländern wie Spanien zwar noch als folkloristische Tradition zelebriert. Aber selbst die »Auferstehung von den Toten« interessiert den gläubigen Zeitgenossen weniger als ein »gutes Leben« im Diesseits. Und auch die ebenfalls »teilsäkularisierten« Verkünder der Frohen Botschaft versuchen eher mit dem Blick auf das Diesseits, mit sozialer Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, fairem Umgang mit der Dritten Welt etc. zu punkten als mit den Themen Vergebung der Sünden und ewiger Glückseligkeit.
Die christliche Religion ist nicht so »überaus komplex und nicht immer so leicht zu verstehen«, wie es Ihnen zuweilen vorkommt. Sie ist im Gegenteil überaus einfach gestrickt. Sie hat eine Erklärung für alle Übel dieser Welt: den per »Erbsünde« prinzipiell sündigen Menschen. Die Erlösung bringt der Opfertod des »Menschensohnes«, und als Heilsversprechen winkt das ewige Leben, die »ewige Glückseligkeit«, letztendlich die Unsterblichkeit. Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werde oder zumindest Gottähnlichkeit erlange. Und die christliche Moral, die in der ebenso »sülzigen« wie utopischen Nächsten- und Feindesliebe gipfelt, ist auch nicht gerade Ausbund eines differenzierten Umgangs mit den komplexen Realitäten dieser Welt.
So tragisch der Kreuzestod für jenen Wanderprediger Jesus von Nazareth gewesen sein mag, es gab schlimmeres menschliches Leiden. Und »heimatlosen Trauerüberschuss bei öffentlichen Katastrophen« zu konstatieren, nur weil die Passion als Ritual nicht mehr »zum festen Bestand der Christenheit« gehört, eine solche Deutung erscheint mir mehr als gewagt. Der Trauer bei »öffentlichen (und wohl auch privaten) Katastrophen« als erste und oberste »Heimat« den Karfreitag zuzuordnen und sie damit quasi tröstlich umzuleiten oder auf ein »beheimatetes« Maß zu reduzieren, das erscheint mir, mit Verlaub, etwas »billig«, oder sagen wir »wohlfeil«. Aber diese Art von Trost ist allen Mythen gemein.
Ihre Redaktion GLAUBEN & ZWEIFELN hat auf den zwei Seiten zu Ostern leider nur Glaubende zu Wort kommen lassen. Obwohl die Zahl der Zweifelnden zum Leidwesen der Kirchen doch täglich zunimmt. Die Interpretation der Osterbotschaft fiel denn auch ziemlich einseitig aus. Schade!
Vielleicht lohnt es sich hin und wieder doch, »seine Zeit mit Andersdenkenden zu verschwenden«?
7.5.15
Sehr geehrter Herr Greiner,
vielen Dank für Ihren Brief und dass Sie sich noch einmal die Mühe gemacht haben, auf einige Punkte einzugehen. Um einem Missverständnis vorzubeugen – ich habe nicht das geringste Bedürfnis, einem Gläubigen seinen Glauben zu nehmen. Was »Glauben« heißt, kenne ich aus meiner eigenen Geschichte. Schließlich war ich einmal, wenn auch nur für relativ kurze Zeit, Mitglied des Jesuitenordens. Ich weiß also, wovon ich spreche. Warum sollte ich einem Menschen, der in seinem Glauben Trost in seinem Leid, die Hoffnung auf eine »bessere Welt« und eine fantastische Perspektive, die Aussicht auf Unsterblichkeit, auf die »ewige Glückseligkeit«, findet und sich in seinem Glauben »aufgehoben« fühlt, warum sollte ich ihm diesen Glauben madig machen?