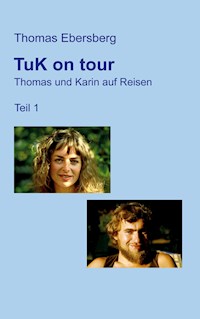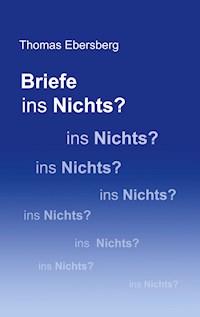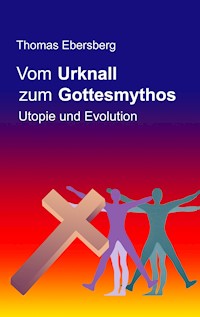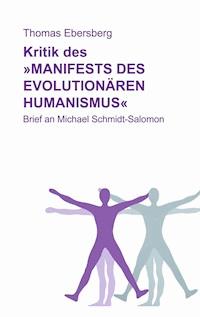
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Autor, selbst einem säkularen Weltbild verpflichtet, setzt sich in seinem offenen Brief an Michael Schmidt-Salomon kritisch mit dessen »Manifest des evolutionären Humanismus« auseinander. Er stellt einige Thesen des Manifests infrage, weist auf Defizite und innere Widersprüche in der Argumentation hin und gibt Denkanstöße für einen erweiterten Blickwinkel und eine alternative philosophische Begründung. Ein Diskussionsbeitrag zur Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Weltbilds.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Text
Der Autor, der sich in seinen bisher veröffentlichten Büchern selbst als Kritiker von Religion und Ideologie sieht, setzt sich in seinem offenen Brief an Michael Schmidt-Salomon kritisch und zugleich konstruktiv mit dem »Manifest des evolutionären Humanismus« auseinander. Er stellt einige Thesen des Manifests infrage, verweist auf Defizite und innere Widersprüche in der Argumentation und gibt Denkanstöße zur Erweiterung des Blickwinkels und zu einer alternativen philosophischen Begründung.
Thomas Ebersberg, Jahrgang 1945, trat nach dem Abitur in den Jesuitenorden ein. Nach drei Jahren verließ er den Orden, studierte Pharmazie und Psychologie und war als Reisefotograf weltweit unterwegs. 1987 veröffentlichte er die ironisch-polemische Zeitkritik »Zarte Stachel – Süße Ohrfeigen, Ein Kulturstrip ohne Scham und Traurigkeit«, und 1990 »Abschied vom Absoluten, Wider die Einfalt des Denkens«, ein Plädoyer für ein realitätsgerechtes polares Weltbild, das auf Heilsutopien verzichtet. In seinem neuesten Buch »Christentum adieu! Das leise Sterben eines Mythos« beschreibt er neben Sinn und Funktion der Mythen die Fragwürdigkeit des Christentums und dessen Auflösungserscheinungen und versucht, die positive Kraft der Mythen, einem säkularen, humanen Weltbild entsprechend, neu zu definieren.
Inhalt
Die Anmerkungen folgen den Kapiteln des »MANIFESTS DES EVOLUTIONÄREN HUMANISMUS«, 2. Auflage, 2006
Vorbemerkung
Fundamentale Kränkungen, S. 9 ff.
Der Affe in uns, S. 14 ff.
Brot für die Welt – die Wurst aber bleibt hier, S. 17 ff.
Sinn und Sinnlichkeit, S. 24 ff.
Abschied von der Traditionsblindheit, S. 29 ff.
Glaubst du noch oder denkst du schon? S. 36 ff.
Wissenschaft, Philosophie und Kunst, S. 39 ff.
»Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion«, S. 47 ff.
Dem imaginären Alphamännchen auf der Spur, S. 55 ff.
Ethik ohne Gott, S. 65 ff.
Alte Werte – neue Scheiterhaufen? S. 69 ff.
Kant versprach den »ewigen Frieden« – gekommen ist Auschwitz… S.83 ff.
»
Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach«? S. 93 ff.
Den Eigennutz in den Dienst der Humanität stellen! S. 106 ff.
»Macht euch die Erde untertan«? S. 120 ff.
Leitkultur Humanismus und Aufklärung, S. 131 ff.
Ein Tier, so klug und freundlich, S. 145 ff.
Anhang
Die Zehn Angebote des evolutionären Humanismus, S. 156 ff.
Fazit – Zusammenfassende Kritik
Sehr geehrter Herr Schmidt-Salomon,
meine kritischen Anmerkungen sind nicht gedacht als Fundamentalkritik, zumal auch ich mich dem Projekt eines säkularen Weltbilds verpflichtet fühle. Mir fielen in Ihrem Manifest einige Schwachpunkte auf, wie z.B. ein fehlendes philosophisches Fundament, innere Widersprüche und vor allem Einseitigkeiten, die einer gewissen, sagen wir: »monistischen« Denkungsart geschuldet sind. »Einfachen« Begründungen, Prinzipien, Postulaten und Lösungen stehe ich aufgrund meines polaren Weltbilds, das ich in meinem Buch »Abschied vom Absoluten – Wider die Einfalt des Denkens« entwickelt habe, skeptisch gegenüber. Vielleicht dienen meine Überlegungen dazu, einige Thesen Ihres Manifests nicht nur praktisch, wie Sie es tun, sondern auch philosophisch fundiert zu relativieren und den Blick zu erweitern. Auf nicht hinterfragbare, dogmatische Aussagen verzichten Sie ja und fordern zur »kritischen Auseinandersetzung« auf. Nun denn. Meine Anmerkungen folgen den einzelnen Kapiteln Ihres Manifests.
Fundamentale Kränkungen (S. 9 ff.)
Sie singen das Loblied auf die Wissenschaft, genau genommen auf die Naturwissenschaft. Ihr verdanken wir in der Tat Fortschritt und Wohlstand. Was Sie dank Kopernikus, Darwin u.a. »Kränkungen« nennen, würde ich »Desillusionierungen« nennen. Eine Desillusionierung muss nicht kränkend sein. Sie erscheint mir eher positiv, als ein neuer Blick auf die Wirklichkeit, als ein Akt der Befreiung von einer verführerischen, aber letztlich erfolglosen Selbsttäuschung.
Einen elementaren Anstoß der Naturwissenschaft in Richtung Philosophie vermisse ich in Ihrer Auflistung, nämlich die Frage: »Wie ist diese Wirklichkeit bis in die Welt der subatomaren Teilchen und Antiteilchen konstruiert? Was für ein Weltbild ergibt sich daraus?« Auf dieser fundamentalen Frage hätten Sie aufbauen können bei Ihrem »Parforceritt« durch Natur und Kultur. Sie ahnen vielleicht, ich steuere auf mein »polares Weltbild« zu, das sich weit über Physik und Chemie bis in die feinsten Verästelungen menschlicher Kultur, vor und nach »dem Affen in uns«, bemerkbar macht und das eine Deutung von Leben, Moral, Sinn etc. und einen realitätsgerechten Umgang mit der Wirklichkeit ermöglicht.
Der Affe in uns (S.14 ff.)
Ich verstehe ja Ihre Lust an der Provokation. Ob sie immer zielführend ist, steht auf einem anderen Blatt. Humanismus als Verzicht auf »imaginäre Götter oder Heilserzählungen«, okay. Aber was Sie als »kategorischen Imperativ des Humanismus« von Marx und Engels zitieren, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist…«, das könnte man in der Tendenz auch aus der Botschaft jenes Wanderpredigers Jesus von Nazareth herauslesen, die sich ja gerade an die Unterprivilegierten, an die »Mühseligen und Beladenen« wandte, auch wenn er diesen die Erlösung erst im Jenseits versprach. Das ist nicht so wahnsinnig neu und originell.
Ihre Hoffnung, dass Homo sapiens »sich zu einem »ungewöhnlich sanften, freundlichen und kreativen Tier entwickeln könnte«, ist natürlich ebenso naiv – den Homo sapiens gibt es nicht – wie Ihr verklärender Blick auf unsere nächsten Verwandten.
Ihre Tiervergleiche bis hin zu den »Würmern« sind gut gemeint, aber ziemlich kurios und, sagen wir, strategisch nicht gerade klug. Damit schrecken Sie Menschen, die nicht unbedingt mit Würmern in einen Topf geworfen werden wollen, unnötigerweise ab. Ausflüge in die Natur empfehle ich Ihnen bei Ihren Überlegungen zur Ethik. Dort sind Sie mit Rückgriffen auf die Natur auffällig zurückhaltend, wohl unbewusst ahnend, dass Ihre Ethik mit der »Natur des Menschen« unsanft kollidieren könnte.
Auch über das »zufällige Produkt der biologischen Evolution« lässt sich streiten. Evolution nur mit dem Zufall zu erklären erscheint mir fragwürdig. Die Evolution beginnt schon beim Urknall. Entstehen Eigenschaften, Gesetze, Ordnungen bis hin zu Systemen aus einem »Potpourri von Zufällen«? Könnte es nicht sein, dass dies alles als »Möglichkeit«, als Potential schon in jenem Urplasma angelegt war? Bedeutet »Evolution« nicht »Entwicklung« dieses Potentials? Und ist aus der kosmologischen Entwicklung nicht auch eine klare Richtung vom scheinbar Einfachen zum Vielfachen, Komplexen herauszulesen? Urplasma > Galaxien > Elemente > Verbindungen > Leben > Biosphäre > Einzeller > Vielzeller > Bewusstsein > Noosphäre mit zunehmender Differenzierung und Komplexität…? Sicher war und ist Zufall immer mit im Spiel, durch zufällige neue Konstellationen oder Mutationen. Durch Zufall allein entsteht jedoch kein solches Kunstwerk wie z.B. eine Orchidee. Das entsteht aus einer für uns unerklärlichen ästhetischen Lust der Natur oder des Universums, egal was oder wer auch immer »dahintersteckt«. Es macht keinen Sinn, aus Angst vor einer möglichen schöpferischen Kraft oder Macht, z.B. »Gott« genannt, den Zufall zum Herrscher des Universums zu küren.
Auch wenn das Ganze sich »nur« auf einem winzigen Planeten am Rande einer Galaxie abspielt – Quantität des Ereignisses ist nicht alles. Das Geschehen auf unserem Planeten erscheint mir wesentlich faszinierender als das, was sich in den dumpf eruptierenden Sternen und den Staubwolken der Galaxien abspielt.
Und dann der von Ihnen heftig bekämpfte »Materie-Geist-Dualismus«. Dass Geist und Bewusstsein nur auf der materiellen Grundlage des Gehirns funktionieren und dass das Bewusstsein nicht »frei schwebt«, keine Frage. Geist und Materie als getrennt zu betrachten ist absurd. Aber dieses zusammenhängende Funktionieren besagt noch nicht, dass Geist gleich Materie ist. Ist Ihr Manifest »Materie«?
Wie wäre es, Materie und Geist als zwei Pole einer »Polarität«, nicht eines »Dualismus« zu betrachten? Materie, der Stoff, das Material – Geist, die formende, »organisierende«, nicht personalisierte(!) Kraft, bereits wirksam von Anfang an? Nicht nur in der Welt der Gedanken, gerade auch in der Welt der Ästhetik mit ihrer unerschöpflichen Kreativität – sollten wir da nicht dieser neugierigen, experimentierfreudigen Dimension Geist ein besonderes, nicht gesondertes Existenzrecht zugestehen? Polares contra monistisches Weltbild – mit Ihren »Ismen«, »Prinzipien« und dem zugrunde liegenden monistischen Denkansatz werde ich mich noch öfters auseinandersetzen müssen. Ich halte ihn für die philosophische Schwachstelle in Ihren Argumentationen.
»Brot für die Welt – die Wurst aber bleibt hier!« (S. 17 ff.)
»›Leben‹ lässt sich definieren als ein auf dem ›Prinzip Eigennutz‹ basierender Prozess der Selbstorganisation.« Da haben wir solch ein »monistisches Grundprinzip«, die einfache Erklärung, mit der Sie unterschiedliche, manchmal auch widersprüchliche Phänomene in das Korsett eines Prinzips oder Primats zwängen. Um neben dem Eigennutz soziale Instinkte wie Empathie, Kooperation und uneigennütziges Verhalten zu retten, müssen Sie später den schmerzhaften Spagat »eigennützig-altruistisch« vollbringen. Ich erinnere an das wahrhaft uneigennützige Brutverhalten, einprogrammiert nicht zum Erhalt des Individuums, sondern der Art. Ich erinnere an den Mann, der in einen Fluss springt, um ein Kind zu retten, an die zahllosen freiwilligen Helfer, Feuerwehrmänner, Ärzte, an die Spendenbereitschaft, an die uneigennützige Fähigkeit »mit zu leiden«.
Wie wäre es, wenn Sie die gegensätzlichen Pole – eigennützige Selbsterhaltung und uneigennützige Arterhaltung –, die gerade auch in der von Ihnen gern zitierten Tierwelt gelten, zwar nicht total getrennt – das System der »sauberen Trennungen« funktioniert nie – aber doch in ihrem Antagonismus und zugleich ihrer Komplementarität als gleichwertige Pole anerkennen würden? Ansonsten können Sie Ihre späteren ethischen Bemühungen, »Leid zu mindern«, ad acta legen. Ein hartgesottenes, auf seinem Eigennutz beharrendes Individuum wird Ihr 10. (An-)Gebot: »Stelle dein Leben in den Dienst einer größeren Sache…« nur müde belächeln und es wird auch nicht das geringste Unrechtsgefühl haben, seinen Eigennutz skrupellos durchzusetzen. Erinnert sei an den ungebremsten Eigennutz der kriminellen Unterwelt. Dort wird für den Eigennutz bekanntlich »über Leichen gegangen«.
Sinn und Sinnlichkeit (S. 24 ff.)
»Homo sapiens… als unbeabsichtigtes, kosmologisch unbedeutendes und vorübergehendes Randphänomen eines sinnleeren Universums.« Ihre Bescheidenheit ehrt Sie. Aber man kann die Bescheidenheit auch übertreiben. Die Frage, ob Universum und Mensch »beabsichtigt« sind, erscheint mir spekulativ. Auf solche Fragen verzichtet der Agnostiker wohlweislich. Dass aber die Evolution zumindest auf unserem Planeten in Richtung des komplexen Wesens Homo sapiens hinarbeitete, lässt sich kaum bestreiten. Wir sind und wir sind von der Evolution »gewollt«, ansonsten gäbe es uns nicht.
Die Bedeutung eines Wesens wie Homo sapiens bemisst sich nicht unbedingt an seiner Quantität, seiner Kleinheit im Vergleich zu den gigantischen Dimensionen des Universums, sondern an seiner Qualität. Und da bin ich geneigt, diesen Homo sapiens trotz all seiner Fragwürdigkeit zu bewundern. Was er im Lauf der kulturellen Evolution geleistet hat und was sich hier auf Erden abspielt, ist grandios. Dagegen erscheint mir das Geschehen innerhalb der Galaxien geradezu langweilig! Dass alles kreative Können des Menschen auch seine dunkle, destruktive Kehrseite hat, verwundert ein polar geschultes Bewusstsein nicht. Wer Polarität verinnerlicht hat, verzichtet auf pauschale Lobeshymnen oder Verdammungsurteile über Homo sapiens.
»Sinnleeres Universum«? Eine ziemlich gewagte Behauptung. Passt das, was sich im Universum dank dessen Gesetze, Ordnungen, Systeme abspielt, nicht zusammen und ergibt somit Sinnbezüge, einen Sinn? Auch der von Ihnen gern benutzte Begriff der »Selbstorganisation« spricht für ein sinnvolles, zielgerichtetes Geschehen. Wer etwas »organisiert«, hat ein Ziel im Auge. Ich spreche hier nicht von einem Sinn, der sich durch den Bezug auf eine »andere Welt« ergibt, sondern von einem innerweltlichen Sinn.