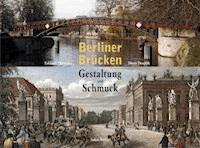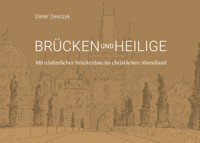
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum stehen auf alten europäischen Brücken oftmals ein oder mehrere Heiligenstatuen? Dieses reich bebilderte Buch schildert die mythischen und religiösen Bedeutungen des antiken Brückenbaus und deren Übergang in das "Christliche Abendland". Dabei wird auch der geistige, wirtschaftliche und politische Einfluss der Kirche in jenen Zeiten auf den Brückenbau behandelt. Diese Aspekte spielen im modernen und eher unchristlichen Europa zwar keine Rolle mehr, aber sie sind Teil unserer historischen Entwicklung und erklären viele auch heute noch existierende Verhältnisse und Traditionen. Auch die schon lange in Vergessenheit geratenen Lebensgeschichten und Legenden der Heiligen hatten seinerzeit eine Wirklichkeit und Wirkung. An dreißig Brücken aus ganz Europa werden diese Einflüsse auf ihre Baugeschichte beispielhaft beschrieben - ein geschichtliches, reich illustriertes Lesebuch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die mittelalterliche Steinbrücke „Ponte Romano“ über das tiefe Malezza-Tal bei Intragna im Centovalli, Tessin.
Ich bitte um Verständnis, dass ich in den Texten aus Gründen der Lesefreundlichkeit das generische Maskulinum verwendet habe, damit sind natürlich alle Personen unabhängig vom Geschlecht gemeint.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Einleitung
TEIL 1 ALLGEMEINE ASPEKTE
01. Brücke und Mythos
Die Brücke in Mythen und Märchen des Altertums
Die Brücke in Mythos und Aberglauben des christlichen Abendlandes
02. Brücken in der mittelalterlichen Gesellschaft
Die Brücke als Bau und Konstruktion
Politik und Wirtschaft beeinflussen den Brückenbau
Finanzierung von Bau und Erhalt der Brücken
Die Brücke und die Stadt
Die Brücke vor der Stadt – Regensburg
Die Brücke in der Stadt – Erfurt
03. Die Kirche der Heiligen und die Brücken
TEIL 2 EINZELDARSTELLUNGEN
Italien
Deutschland / Schweiz
Tschechien / Slowenien
Frankreich
Spanien / Portugal
England
Nachwort
Brückenregister
Ortsregister
Personenregister
Literaturverzeichnis
Kirchenglossar
Brückenglossar
Die Europabrücke der Brenner-Autobahn südlich von Innsbruck über das Silltal mit der rechts hinten auf dem Hügel am westlichen Widerlager sichtbaren Kapelle der Reise- und Brückenheiligen Christophorus und Johannes Nepomuk.
VORWORT
Auf Reisen – wie im Centovalli – findet man auf älteren Brücken mitunter eine oder mehrere Heiligenstatuen oder gar eine kleine Kapelle, eher selten bei modernen Konstruktionen wie bei der Brennerautobahn oder in Basel. Als Brückenbauingenieur hatte ich meist zuerst ein berufsmäßiges Auge auf die Werke der Kollegen, speziell der aus früheren Zeiten, denen noch keine wissenschaftliche Statik zur Verfügung stand und die ihr „Ingenium“ nur mit viel Erfahrung und einer Portion Wagemut paaren konnten.
In der Provence haben mich dann die Reste der Benezetbrücke in Avignon mit ihrer doppelstöckigen St. Niclas-Kapelle, die benachbarte Großbrücke von Pont St. Esprit und der unweit gelegene Pont St. Nicola auf das Thema Brückenbrüder und die Stellung des Brückenbaus in der mittelalterlichen Gesellschaft gebracht. Auch die ebenfalls dem Hl. Nikolaus geweihte Kapelle auf der kleinen Brücke in Calw und die besonders in Süddeutschland zahlreichen alten Brückchen mit Nepomukbezug lenkten mein Interesse auf die besondere Rolle der Heiligen für die Brücken dieser Zeit. Die verschiedenen Publikationen hinsichtlich Brücken im Mittelalter behandeln diesen Aspekt – außer den des kirchlichen Bauherren (20, 39) – nicht oder nur marginal. Dies Buch soll nun keine wissenschaftlich vollständige Erfassung des Themas sein, aber vielleicht dazu anregen. Es wendet sich an den interessierten Laien mit einem Gespür für das reiche Erbe einer Vergangenheit, in der – so ganz anders als heute – einheitlicher Glaube, Wirtschaft, Politik und Lebensgefühl zu einem europaweit gültigen System sich gegenseitig beeinflussender Größen gehörten.
Nachreformatorisch modern hat man heute – wenn überhaupt – eine distanziertere Haltung zu Heiligen und deren Legenden.
Dennoch ist die Kenntnis davon und von ihrer seinerzeitigen subjektiven Realität und Wirkung für das Verständnis des Mittelalters und der Kunstgeschichte ähnlich interessant wie z. B. das Wissen um die damalige Entwicklung der Agrar- oder Waffentechnik. Bei der Beschäftigung mit dem Thema zeigten sich mir neben den hierzulande bekannten Patronaten eine Fülle anderer regionaler und gesamteuropäischer Bezüge. Die Schilderungen der wenigen hier ausgewählten Brücken mögen dem Leser einen Eindruck von den Konstruktionen und der speziellen Bedeutung in ihrem jeweiligen baulichen und geschichtlichem Umfeld geben und ihn mitunter – wie mich – zu entsprechenden Abstechern beim Reisen und in die Geschichte verführen. Vielleicht fühlt man dann auch Dankbarkeit für das Leben in unserer Zeit, in der das Benutzen einer Brücke zumindest im Gebiet des alten Abendlandes alles andre als unsicher ist.
Neben der Möglichkeiten zum Studium der umfangreichen Literatur in der Staatsbibliothek bin ich dankbar für die hilfreichen zusätzlichen Informationen von Herrn Dr. P. Pfister vom Erzbistum München-Freising und von Frau E. Kucerova aus Pisek und allen, die mich freundlich bei den Recherchen unterstützt haben. Wegen der großen Unterschiede in Qualität und Charakter des verfügbaren Bildmaterials sind die Illustrationen skizzenhaft als Federzeichnungen wiedergegeben. In dieser damit homogenen Gestaltung will ich durch das damit mögliche Weglassen von Überflüssigem und das Ergänzen von Nötigem die wesentlichen Bildinhalte hervorheben und verdeutlichen.
Ein besonderer Dank gilt meinem Sohn, der als Diplom-Designer die Zeichnungen bearbeitet und dem ganzen Buch ein Layout gegeben hat.
Dieter Desczyk im August 2020
EINLEITUNG
„Erzähle mir die Vergangenheit und ich werde die Zukunft erkennen.“
Sprüche des Konfuzius
Eine Brücke!? Was ist das schon!? Davon gibt es im modernen Europa hunderttausende, in allen Größen und für jede Gelegenheit! Man tritt sie mit Füßen (weniger), meistens werden sie aber achtlos und schnell im Auto überrollt als Teil der Straße, „pons pars viae“ wie schon die alten römischen Verwaltungsfachleute sagten. Nur bei sehr großen Brücken über weite Täler oder Meerengen kann der eilige Benutzer in unseren Tagen noch einen Hauch von Außerordentlichem und Abenteuer verspüren, sollte ihm die freie Sicht und damit das Brückenbewusstsein nicht durch Lärmschutzwände oder sogenannte „Selbstmordverhinderungseinrichtungen“ genommen sein; deshalb sind Seiten- und Untersichten der Bauten meist nicht nur für den Fachmann und Fotografen viel interessanter.
Abseits der großen Straßen kann der aufmerksame Reisende aber auch noch manche ehrwürdige Brücke finden, die in bescheidenen und dafür meist schönen Proportionen den vielfältigen Erneuerungsdrücken widerstanden und somit den Lauf der Zeit überstanden hat. Oftmals geschmückt mit einer Statue oder gar einer kleinen Kapelle kündigt sie von einer Epoche, in der das singuläre Vorhandensein eines Flussüberganges im Bewusstsein der Menschen wohl etwas mehr bedeutet hat als heute, nicht nur in unseren Breiten.
Dieses Buch will von diesem Bewusstsein erzählen, von jener Zeit des Mittelalters im Gebiet des ehemaligen „Christlichen Abendlandes“ und von der Bedeutung der Brücken und der Stellung und Motivation ihrer oft geistlichen Erbauer in der Gesellschaft. Neben der Darlegung des Bezugs der jeweiligen Schutzheiligen und ihrer Einbindung in Ort, Weg und Zeit gibt das Buch auch eine Einführung in mittelalterliche Bautechniken. An Hand einer Auswahl von Brückenstandorten und ihrer Geschichte wird die seinerzeit selbstverständliche Zugehörigkeit des Brückenbaus zum europaweit gültigen Topos „christlich“ oder kirchlich gezeigt. Diese Blickrichtung führt auch weiter zurück zu den Mythen der Vorzeit und des Altertums, die auch noch im Mittelalter ein Momentum des populären Brückenverständnisses waren.
Im ersten Teil werden die mythologische Vorgeschichte und das Thema in seinen geschichtlichen und allgemeinen Aspekten behandelt, im zweiten Teil werden verschiedene Brücken im christlichen Abendland von Portugal bis Slowenien und von England bis Italien mit ihrer Baugeschichte und ihren Heiligen und deren Bezug geschildert. Dabei wird der Topos „Heiliger“ so gebraucht, wie es im Mittelalter üblich war. Die Gruppe der besprochenen Brückenheiligen zeigt dabei nicht nur viele hier und heute unbekannte Gestalten, sondern auch die oft der Kirche zugehörigen nicht kanonisierten Bauherren des Mittelalters, deren Andenken – ihres segensreichen Wirkens wegen – in ihren Heimatländern auch gegenwärtig oft noch lebendig ist. Wegen der in jener Zeit viel stärkeren Verbindung von Politik und Kirche gerät die Schilderung eines Brückenbaues oft zu einem unerwarteten Exkurs in europäische Geschichte.
Der zeitliche Rahmen Mittelalter ist in diesem Zusammenhang auf das 11. bis 14. Jh. fokussiert. Mit der Westreise des Columbus wurde der Begriff Abendland geografisch unzutreffend und auch das „christlich“ schrumpft zusehens. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis lädt schließlich zu vertiefendem Nachschlagen ein, die hochgestellten Klammerzahlen im Text nennen die Fundstelle.
Eine solche Reise zu den oft verschütteten Fundamenten und Wurzeln unserer Kultur kann vielleicht das Bewusstsein des heutigen Brückenbenutzers Betrachters dahingehend erweitern, dass er oder sie doch prüfe, ob nicht auch in einem modernen Flussübergang ein gewisser Zauber liege. Darüber hinaus könnte der Leser auch in der Kenntnis der damaligen Verhältnisse dankbar sein für die Fülle und Standfestigkeit der heute vorhandenen Brücken, die keine großen Umwege mehr wie für die Menschen des Mittelalters erfordern; die Leute haben damals Gott und den Heiligen gedankt, dass sie endlich gesund die Brücke erreicht hatten und dann auch noch heil mit Sack und Pack über dieselbe gekommen waren.
TEIL 1 ALLGEMEINE ASPEKTE
01. Brücke und Mythos
02. Brücken in der mittelalterlichen Gesellschaft
03. Die Kirche der Heiligen und die Brücken
Die Brücke in Mythen und Märchen des Altertums
Die Brücke in Mythos und Aberglauben des christlichen Abendlandes
Der Fluss als göttliche Urerfahrung von Grenze und Naturgewalt
Auch ein moderner Mensch kann sich vielleicht vorstellen, in einer weglosen Gegend (ohne Karte und Satellitennavigation) zu wandern. Dann wird sein Weiterkommen plötzlich durch einen Fluss oder großen See unterbrochen, und weit und breit ist keine Brücke oder Furt in Sicht. Dies vermittelt dann wohl eine leise Ahnung eines Gefühls von absoluter Grenze und Ohnmacht, das der Mensch der Steinzeit in dieser Situation empfunden haben muss.
Das Wasser war ein Hindernis, unüberwindbar und natur(gott)gegeben, auf dem anderen Ufer das Jenseits. Der Fluss gehörte nicht zum Diesseits, war „Niemands“land, heilig (122). Die Scheu davor kannte auch noch das klassische Altertum, wie das berühmte Zaudern Caesars vor der Überschreitung des Rubikons (alea jacta est) oder die Umkehr des Drusus vor dem Flussgott der Elbe zeigen (122). Den Heerführer Crassus hatte der Kaiser entlassen, weil er die Flussgottheit des Euphrat durch sein vom Orakel verbotenes Überschreiten verletzt hatte (110).
Wasser ist ja das Lebenselixier schlechthin (67) und damit seit jeher mythenumwoben (98): in babylonischer Zeit waren alle vier Elemente heilig, der Gott der Flüsse fungierte gleichzeitig als der Gott der Heilkunst, Gesundung und Schöpfung (68). Quellgeister, Reinigungsrituale und Regenzauber gehören weltweit zu den ältesten Ursprungsschichten von Märchen und Riten. Der Fluss zeichnet sich besonders dadurch aus, dass in ihm das eigentlich nicht fassbare Element Wasser gefasst ist (152).
Das große Wasser Fluss ist aber nicht nur gut und lebensspendend sondern kann auch zerstörend über die Ufer treten – in unregulierten Zeiten oft der Fall – und seine gewalttätige und Opfer fordernden Seite zeigt sich auch im Töten durch Ertränken. Ertrunkene hatten deshalb in vielen Kulturen einen besonderen Status im Vergleich zu anderen Toten; im alten Ägypten haben sie nur besondere Priester bestattet, denn sie waren durch den göttlichen Nil heilig geworden (68). Diese Heiligkeit war allen frühen Kulturen bewusst und entsprechend stellten zum Beispiel die Germanen an den Ufern des Flusses Lichter auf (67) oder aber man wollte ihm wie im alten China Bräute angetrauen, indem die Priester sie ertränkten (152, 68). Diese grausame Sitte war nicht auf China beschränkt, auch in Indien opferte man(n) auf gleiche Weise dem Ganges und in Ägypten dem Nil auf extra dafür am Ufer errichteten Altären. Auch im vorantiken Rom haben die Priester dem Tiber Bräute zugeführt (68). Die Griechen begnügten sich mit dem Ertränken lebender Pferde (152), die Trojer opferten auf diese Weise Stiere im Fluss, später auch auf Altären am Ufer nach ägyptischen Vorbild. Die Indianer dagegen brachten dem Mississippi sippenschonend gefangene Feinde dar, und auch der Niagara bekam jedes Jahr ein Mädchenopfer (68).
Der Brückenbau verletzt die Flussgottheit
Den heiligen Fluss durften die Menschen natürlich nicht verunreinigen oder sonst wie stören oder beleidigen. So berichtet Homer, dass der furchtbare Achill den Fluss Skamander so mit Leichen der erschlagenen Trojer gefüllt hatte, dass der gestörte Flussgott seinen Bruder Simois gegen den schrecklichen Griechen zu Hilfe rief. Nur durch die Hilfe seiner göttlichen Gönnerin Athene entging der Held dem Tod durch Ertrinken (eine Todesart, die auch nicht zu einem Heroen wie ihm und in die Ilias gepasst hätte).
Der erste Mann, der – um nicht immer hindurchwaten zu müssen – über den Bach vor seiner Höhle einen Baumstamm legte, wird wohl kein allzu schlechtes Gewissen dabei gehabt haben; er hatte ja damit den Bachgeist nicht wesentlich beschädigt oder verletzt, wenn er ihm auch durch sein Nichtertrinken ein mögliches (hier eher unwahrscheinliches) Opfer vorenthalten hatte, das beim unvorsichtigen Durchwaten der Furt hätte anfallen können.
Der Mensch auf einem ersten Floß oder einer aufgeblasenen Kuhhaut wird beim Übersetzen über einen großen Fluss schon eher um das Wohlwollen des Flussgottes bemüht gewesen sein und ihm vielleicht entsprechend geopfert haben. Der Fährmann hatte seit alters her (babyl.: Arad-Ea , griech.: Charon) (78) immer den Geruch eines Zauberers oder zumindest um Geheimnisse Wissenden, von seiner Funktion als Grenzüberwinder ganz zu schweigen.
Das assyrische Heer überquert einen Fluss, die Krieger schwimmen, teilweise mittels aufgeblasener Tierhäute, die zerlegten Kampfwagen werden im Boot überführt. Derweil versuchen der König Assurnasirpal II und ein Priester den verletzten Flussgott durch Gebete und Beschwörungen zu besänftigen.
Nach einem assyrischen Kalksteinrelief, 9. Jh. v. Ch.
Ein besonders dramatisches Ereignis schildert Herodot in seinem Werk über die Perserkriege vom Hellespontübergang des Xerxes: Ein Sturm hatte die fertige Schiffsbrücke für das Heer zerstört, der wütende Xerxes ließ den Hellespont auspeitschen (!) und die zuständigen Pioniere köpfen, um am nächsten Tag auf einer neu gebauten Brücke die Meerenge zu überschreiten. Vorher hatten die Priester den nun doppelt (durch Schläge und Schiffsbrücke) beleidigten Wassergott mit vielen Opfern zu besänftigen.
Die Bauweise der alten Brücke über den Arachtos bei Arta in Griechenland verrät die römischen Vorbilder. Beim Neubau auf den alten Fundamenten gab es erhebliche Probleme bei der Standsicherheit des großen Bogens, daraufhin soll der türkische Baumeister seine Frau in den Pfeiler hat einmauern lassen, bis heute erfolgreich.
Wenn der übers Wasser gelegte Baumstamm in der Länge nicht ausreichte, musste der Brückenbauer im Fluss ein Zwischenauflager, einen Pfeiler bauen. Das war nun ein Unternehmen von ganz anderer Dimension: es war technisch sehr viel schwieriger und erforderte besondere Gründungskenntnisse; es war oft extrem gefährlich und stellte auch sichtbar und physisch einen massiven Eingriff in die Sphäre des Flussgottes dar, der sich in der Regel auch kräftig mit Strudeln und Eisgang dagegen wehrte. Noch heute lässt der Anblick einer Dampframme in einem unberührten Flussbett eine leise Ahnung von einer Verletzung der Schöpfung aufkommen. Für diese Tätigkeit brauchte es imAltertum Männer mit geheimen technischem und magischem Wissen: Priester, die dem Fluss die ihm zustehenden Besänftigungsopfer darbringen konnten (90). Dazu war es zuvörderst nötig, den gefährdeten Pfeiler durch ein damit verbundenes Opfer dem beleidigten Wassergeist erträglich zu machen. Diese uralte Sitte hat sich bis heute in vielen Märchen und Sagen von in Brückenpfeilern eingemauerten Jungfrauen oder Kindern erhalten, sogar noch in Kinderspielen wie von der “London Bridge is broken down” oder der Goldenen Brücke (90):
„Ziehet durch, ziehet durch,
durch die Goldne Brücke!
Sie ist entzwei, sie ist entzwei,
wir woll’n sie wieder flicken
Mit Steinerlein, mit Beinerlein,
der Letzte muss gefangen sein.“
In China und Tibet glaubte man in manchen Gegenden, dass der Fluss seine opferlose Störung mit einer Pockenplage rächen würde, noch 1890 wird von abgeschnittenen Köpfen Fremder berichtet, die man für die Fundierung der Brückenpfeiler benötige, in Indien waren für den gleichen Zweck Kinderschädel erwünscht. In Griechenland konnte es auch der heimlich ausgemessene Schatten eines Mannes tun, daran hatte der ahnungslose Beraubte dann allerdings innerhalb eines Jahres zu sterben (90).
Nicht nur der Pfeiler störte den Flussgott, sondern auch die dadurch mögliche sichere Passage über die Brücke – entgingen ihm ja dadurch erhebliche Mengen von sonst in der Furt oder beim Schwimmen Ertrunkener. Das machte einen regelmäßig (jährlich) zu erbringenden Ausgleich durch entsprechende Opfer nötig, in alter Zeit waren das Lebende, die man dann mit fortschreitender Zivilisation mitunter durch Strohpuppen o. ä. ersetzte.
Der griechische Gott Hermes bezahlt als Seelenbegleiter den Fährmann Charon mit einer Münze für den Transport einer Verstorbenen über den Acheron in den Hades.
Nach einem nachantiken Terrakotta-Fragment.
Schon der Staatskultus des alten Rom kannte eine solche menschenfreundliche Substitution des uralten Ritus, wenn an den Iden des Mai der Hohe Priester des Staates und später auch der Kaiser, der Pontifex Maximus, als „größter Brückenbauer“ mit der Obervestalin in einer feierlichen Prozession zur sagenumwobenen ersten Tiberbrücke, dem pons Sublicius, zog. Thomas B. Macauly schildert in seinem „Horatius“, dass diese Brücke als Symbol für die physische Verbindung zwischen Sicherheit und Untergang angesehen wurde und im Falle einer Bedrohung durch die feindlichen Etrusker abzubrechen war (23).
Das Wort pontifex kann auch vom alten umbrischen „puntes“ stammen, das die Riten bei Opferungen meint (16), speziell auch zur Besänftigung des gestörten Flussgottes (23), der um diese Wortgenese geführte Etymologenstreit ist akademisch.
Auf der Brücke warfen dann die Vestalinnen unter seiner Oberaufsicht 24 Strohpuppen in den Fluss. Ovid dazu in seiner Beschreibung der Feste:
„Männer aus uralter Zeit, gebildet als Puppen aus Binsen, wirft von der Brücke aus Holz heute die Jungfrau herab.“
Dabei trug die Vestalin ein Gewand wie zu einer Beerdigung und die Puppen stellten alte Männer dar, an Händen und Füßen gefesselt (90). Ein böses Gerücht behauptet, dass sich der römische Staat in alter Zeit auf diese Weise von den für den Wehrdienst untauglichen 60-jährigen getrennt habe (sexagenarios de ponte). Ähnliche Praktiken sind auch anderswo üblich gewesen, etwa in China. Der geschilderte Staatsritus war auf Rom und den
Die germanischen Helden gehen auf der Jenseitsbrücke nach Walhall.
Nach einem Wikinger-Bildstein mit Runenschrift aus Gotland, um 1000.
Tiber beschränkt, der römische Soldat in den Provinzen des Weltreiches warf beim Überschreiten einer größeren Brücke seine ganz persönliche kleine Münze als Dankesopfer in das Wasser des ihm meist unbekannten Stromgottes, auch wenn dort keine Altäre für Neptun und Oceanus standen wie auf dem römischen pons Aelius (109). Anhand solcher Münzfunde konnten z. B. die Lagen der Römerbrücken in London und Koblenz bestimmt werden (66) (118).
Die Brücke als Grenzüberwinder und Jenseitsbrücke
Wie schon dargelegt ist der Fluss im Bewusstsein der Menschen auch immer eine Grenzerfahrung, eine Grenze zum Fremden, zum Anderssein, zum Unbekannten. Das erzeugt meistens Furcht und daraus entsteht wieder Antipathie, ein Grauen vor der Fremde, die Missachtung des Gegenüber: fremd gleich Feind (110).
Die Scheu der damaligen Menschen vor dem Betreten einer Brücke mag neben den geschilderten mythologischen und psychologischen Gründen auch ganz konkret an der in den meisten Fällen eher dürftigen Konstruktion und Standfestigkeit der meist hölzernen Bauwerke gelegen haben. Das gesunde Überqueren war dann schon ein Dankgebet oder kleines Opfer am sicheren Drüben wert.
Jacobs Traum in Bethel von der Himmelsleiter.
Nach einer Miniatur aus der Bilderbibel des Königs Sanchos VII von Navarra, Pamlona 1197.
Die beschriebenen Urerfahrungen von Grenze machen es nicht verwunderlich, dass in den meisten alten Epen der Menschheit auch die Grenze vom Leben zum anderen, unbekannten und unheimlichen Totsein als ein Fluss (Acheron, Styx, Gjöll) geschildert wird (152, 114, 122). Das Berühren dieses mit besonderen magischen Eigenschaften ausgestatteten Grenzwassers ist sehr gefährlich und ebenso das Hinübergelangen. Dazu bedarf es eines magischen und recht unheimliches Fährmannes (78) oder einer Brücke (114). Die ganz alten Mythen wie das Gilgamesch-Epos kennen nur einen Fährmann, da Brückenbau erst ab ca. 700 v. Ch. in Babylon existiert (90). In der persischen Sage des 4. Jhs. n. Ch. führt dann eine „Cinvat-Brücke“ ins Jenseits, für die Guten breit und für die Bösen messerschneidenschmal. Die letztere Brückenart findet sich wieder im mohammedanischen Seelenbrückenschwert „as-sirat“, bei dem Engel den Frommen helfen (durch Vierteldrehung des Schwertes geht der Gute über die breite Klinge) und die Sünder, die die Schneide benutzen müssen, zusätzlich schubsen. Eine Ausnahme bei den Jenseitsbrücken bildet die nordgermanische Gjallar-Brücke, breit, golden und ohne Ansehen der Person für alle Toten begehbar (109, 90). Bei den hiesigen Südgermanen war es die Helwegbrücke ins Totenreich Hel (= verborgen, Hehler) (110). Die Indianerseelen führte ein Baumstamm über einen tiefen Abgrund in die ewigen Jagdgründe, die Passage hat jedoch ein bissiger Wachhund so empfindlich gestört, dass ein Teil der Ärmsten in die Schlucht fiel (90).
Nicht auf eine Brücke angewiesen waren die Götter der Edda, die auf dem Weg zwischen Himmel und Erde den Regenbogen (Bifröst) benutzten, der auch schon im Alten Testament seit Noah als Bundeszeichen zwischen Gott und den Menschen installiert war, die Engel benutzten die Jakobsleiter. Im japanischen Mythos stiegen die Götter zwecks Schöpfung auf einer himmlischen Schwebebrücke ins Irdische hinab (14).
TEIL 1 ALLGEMEINE ASPEKTE
01. Brücke und Mythos
02. Brücken in der mittelalterlichen Gesellschaft
03. Die Kirche der Heiligen und die Brücken
Die Brücke in Mythen und Märchen des Altertums
Die Brücke in Mythos und Aberglauben des christlichen Abendlandes
Die Verwandlung der alten Götter
Bis zum legendären Sieg des großen Con-stantin im Zeichen des Christogramms an der Milvischen Brücke (A.D. 312) hatte das junge Christentum im römischen Weltreich einige Wellen heftigster Verfolgungen zu erdulden. Die Christen waren an Zahl wenige, aber in der Regel vom Glauben tief überzeugte Menschen. Nach Constantin war das Christsein nicht nur gefahrlos geworden sondern mitunter auch im Diesseits förderlich, und in der Völkerwanderungszeit bis Karl dem Großen wurde Europa von irischen Wandermönchen und christlichen Herrschern fast flächendekkend der Kirche zugeführt.
Es ist anzunehmen, dass bei der (Zwangs) taufe nicht immer der Heilige Geist sofort alle frisch Getauften voll durchdrungen hat, besonders wenn man sie als Alternative mit einem Schwert bedroht hatte. So blieb viel von den alten Göttern und Mythen erhalten, im Laufe der Generationen wanderten diese aber quasi in eine tiefere mythologische Schicht mit meist negativen Vorzeichen. So wurden aus den ambivalent janusgesichtigen und meist bärtigen Flussgöttern, denen man regelmäßig geopfert hatte, ähnlich aussehende Wassergeister wie der Nix, nun aber mit fast nur noch unangenehmen Eigenschaften. Sie konnten vielfältig gereizt und verärgert werden, dazu gehörten schon das Baden oder auch das Steinewerfen und gar nur das Vermessen der Flusstiefe (103). Ihre grausame Hauptrache war natürlich das Ertränken der Übeltäter (04). Als der Oberaufseher über alle Flussgeister waltete jetzt der Teufel mit dem Neptun-Dreizack, dem auch die ungetauften – weil verheimlichten – unehelichen Säuglinge gehörten. Das recht kommode Germanen-Jenseits Hel verwandelte sich in die schreckliche christliche Hölle, nur im schönen Reich der Frau Holle finden wir heute noch einen märchenhaften Rest vom einstigen germanischen Paradies (110).
Frauen werfen ihre unehelichen und zur Verhinderung der „Schande“ ungetauften Säuglinge in den „höllischen“ Fluss.
Nach einer zeitgenössischen französischen Zeichnung.
Ein Engel verschließt das Tor zur Hölle, die als Maul eines riesigen Wasserungeheuers dargestellt wird. Nach einer Zeichnung aus dem Psalter des Heinrich von Blois, 12. Jh.
Sich bei den bösen Geistern rückzuversichern konnte aber nicht schaden, im frommen Erfurt musste noch 1351 ein Gesetz erlassen werden, dass das (nur) Eintauchen von Leuten in der Gera verbot (90); da war man im – nicht so frommen – Basel bis ins 17. Jh. nicht so zimperlich, wo auch Selbstmörder (weil schuldbeladen) in den unheiligen Strom entsorgt wurden wie auch anderswo ungetaufte Säuglinge. Befremdlich erscheint auch der noch heute getätigte Brauch, bei der auf Booten durchgeführten Fronleichnamsprozession bei Oberndorf gesegnete (aber unkonsekrierte) Hostien in die Salzach zu werfen (2, 11).
Die Brücke wird heilig und Heil-bringend.
So wie früher die Brücke eine Störung und ein Tort gegenüber einem Flussgott gewesen war, so ist sie nun für die Christen die Überwindung – oder besser Überbrückung – des Reiches übler Geister, gewissermaßen eine „constructa triumphans“, so wie die heilige Kirche eine „ecclesia triumphans“ über den alten „Un“-glauben war.
Heiligkeit geht selbst als Person über Wasser (6) wie Christus, nach ganz frühen Legenden auch besonders heilige Männer wie der Hl. Petrus und der Hl. Nikolaus (109), die auch deshalb als die ersten Brückenheiligen gelten. Auch der Islam übernimmt die Heiligkeit der Brücke, wonach in einer alten Hodscha-Erzählung der Teufel die Schluchten und Täler gemacht hat:
„Die gefährliche Brücke“.
Nach einer Illustration zu einem französischen Gedicht von 1320, in dem die Welt mit einer Brücke verglichen wird, von der die Verblendeten in den höllemäßigen Fluss stürzen.
Christus als Weltenrichter thront auf der Regenbogenbrücke, auf der die flankierenden Heiligen knien, mit der Welt zu seinen Füßen.
Nach einer Darstellung im „Jüngsten Gericht“ von Hans Memling um 1470.
„Da breiteten die Engel ihre Flügel aus und die Leute begannen, über diese Flügel hinwegzugehen. So lernten die Menschen von den Engeln Gottes, wie man Brücken baut … und es ist die größte Sünde, Hand an sie zu legen …“ (1).
Die christliche Kirche stellt den Brückenbau gewissermaßen unter ihren Schutzmantel, die Brücke ist ein befriedeter Ort, oft mit einer Kapelle geheiligt. Wenn keine Kapelle, so war doch meist ein Kreuz – Kruzifixus oder Kalvariengruppe – auf der Brücke, oft praktischerweise über der schiffbarsten Öffnung als säkular praktischer Hinweis für den ortsunkundigen Kahnfahrer oder Flößer (141). Die Hierarchie der Kirche bildet sich allmählich heraus, und seit Leo dem Großen (+461) trägt der Papst den alten Beinamen des römischen Oberpriesters „Pontifex Maximus“, den auch die römischen Kaiser von Augustus an bis zum christlichen Gratian (+383) getragen hatten.
Die Päpste sowie viele Bischöfe förderten den Bau von Brücken und, besonders wichtig, auch ihre Erhaltung. Das geschah durch eigene Mittel und die Unterstützung frommer Bruderschaften, die sich diesem Zweck und meist auch dem Hospizdienst verpflichtet hatten, im Mittelalter auch durch Ablassversprechen für die Spender.
Trotz dieser heilbringenden Unterstützung des Brückenbaus durch die Amtskirche lebten gerüchteweise und unterschwellig vereinzelt noch die alten kultischen Praktiken speziell bei der sehr gefährdeten Gründungsarbeit fort: beim Bau der berühmten London Bridge habe man die Pfeilersteine mit dem Blut kleiner Kinder bespritzt, für die Werrabrücke in Vacha soll 1324 ein Kind lebendig eingemauert worden sein (130) und noch Jakob Grimm schreibt (50):
„Bei dem neuen brückenbau zu Halle, der im jahre 1843 (!) vollführt wurde, wähnte noch das volk, daß man eines kindes zum einmauern in den grund bedürfe.“
Sogar die Reliquie einer wenn auch legendären Hl. Quiteria sollen die Erbauer im Pfeiler der mittelalterlichen Brücke „puente de la rabia“ am Jakobsweg über den Rio Argo in Zubiri eingemauert haben, der Pfeiler helfe jetzt gegen Tollwut, wird berichtet (57). Auch in England war das Andenken an solche Bräuche noch virulent.
Des ungeachtet galt der Brückenbau im Mittelalter als eine wahrhaft christliche und verdienstvolle Tätigkeit und dem Kathedralbau gleichgestellt, wie aus einer kleinen Eloge hevorgeht, die Hastings (98) aus der englischen Ausgabe der Legenda Aurea (150), dem europäischen Standardkompendium der Heiligenlegenden des Mittelalters zitiert:
Die 1345 gebaute Werrabrücke bei Vacha von Unterstrom.
„Gottes Segen dem Meister, der Brücken baut Über die wilden Flüsse und Schluchten, unpassierbar vorher für die Füße der Menschen.
Gottes Segen auch für die Erbauer der Kathedralen,
deren dicke Mauern Brücken sind, geschlagen über
den dunklen und schrecklichen Abgrund des Todes.
Aus gutem Grund gibt man den Namen Pontifex
dem Haupt der Kirche als dem Baumeister und Architekten der unsichtbaren Brücke,
die uns von Erd ` zum Himmel führt.“
Die Brückenheiligen
Blick von der mit Heiligenstatuen gesäumten Karlsbrücke auf die Prager Altstadt.
Die Brücke ist die Mittlerin zwischen dem Hüben und Drüben, die Überwinderin des unheimlichen Niemandslandes, sie beschützt die Menschen, sie gibt ihnen im besten Sinne des Wortes Halt. So ist auch Christus in seiner Doppelnatur der Mittler zwischen Mensch und Gott und so können die Heiligen in seiner Nachfolge und ihrer Übernatürlichkeit gesehen werden. Sie sind Brückengestalten im Mythos und dann auch im Realen.
Das Reisen in den Zeiten des Mittelalters war ein Abenteuer der schrecklicheren Art, vor einer längeren Abwesenheit machte man klugerweise sein Testament. Der Mensch hatte ständig und mit Recht Furcht und das nicht nur vor den Räubern und Wegelagerern als solchen sondern auch und besonders vor dem sogenannten „plötzlichen Tod “. Der bedeutete das Sterben ohne die Sakramente der Kirche, und so ohne Vergebung der ewigen Verdammnis anheim zu fallen. In dieser Not brauchte es mächtige Fürsprecher, und da waren speziell natürlich die „geborene“ Mittlerin zwischen hüben und drüben, die Gottesmutter Maria, der erste Pontifex Petrus, der große Universalheilige des Mittelalters Nikolaus und der ähnlich mit Legenden überhäufte Fährmann und „Christusträger“ Christophorus gefragt (21) .
Die Bedeutung dieser Heiligen ist im Laufe der Zeit zurückgegangen, viele Kapellen und Standbilder fielen Umbauten und Vernichtung anheim. Darüber hinaus wurden im 17. Jh. viele alte Brücken-Patronate durch den Hl. Johannes Nepomuk ersetzt, dessen Ende als Märtyrer auf der Prager Karlsbrücke ihn zu einem Hauptheiligen der gegenreformatorischen Jesuiten machte und ihn so in manchen Gebieten im südlichen Deutschland und Österreich hat flächendeckend präsent werden lassen.
Der Pont Diable (oder Pont vieux) im Vordergrund von 1330 über das tiefe Tarntal bei Ceret mit einer Spannweite von 45 m zählt zu den kühnsten Steinbogen seiner Zeit.
Diese Überfülle des „Nepomukken“ (Goethe) war Anlass, im Rahmen dieses Buches auch der Märtyrer mit einem ähnlichem brükkenbezogenen Schicksal zu gedenken und deren (wegen fehlender „promotion“) Nichtbeachtung als Brückenheilige.