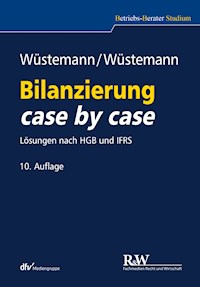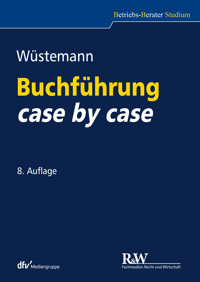
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Betriebs-Berater Studium - BWL case by case
- Sprache: Deutsch
In dem gut eingeführten Buch wird am Beispiel wesentlicher Geschäftsvorfälle zunächst problemorientiert das System der doppelten Buchführung dargestellt. Ein zweites Kapitel entwickelt für typische Buchungsvorfälle jeweils die zentralen Bilanzierungsgrundlagen; anschließend wird die Technik ihrer buchhalterischen Erfassung erläutert und veranschaulicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buchführung
case by case
von
Dr. Jens Wüstemann
o. Professor an der Universität Mannheim
Unter Mitarbeit von
Professor Dr. Anne Najderek Professor Dr. Christopher Sessar
8., aktualisierte Auflage 2024
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
1. Aufl. 2005 N ISBN 978-3-8252-2717-0 2. Aufl. 2007 N ISBN 978-3-8252-2717-3 3. Aufl. 2009 N ISBN 978-3-8005-5017-3 4. Aufl. 2011 N ISBN 978-3-8005-5025-8 5. Aufl. 2013 N ISBN 978-3-8005-5034-0 6. Aufl. 2015 N ISBN 978-3-8005-5040-1 7. Aufl. 2017 N ISBN 978-3-8005-5047-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-8005-1943-9
© 2024 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main www.ruw.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druckvorstufe: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, 69502 Hemsbach
Druck und Verarbeitung: Beltz Grafische Betriebe GmbH, 99947 Bad Langensalza
Vorwort
1. Die Buchführung bildet die Grundlage jedes betrieblichen Rechnungswesens. Seit der Franziskanermönch Luca Pacioli die Technik der doppelten Buchführung in dem 1494 erschienenen Buch Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita erstmals niederschrieb, muss eigentlich jeder mit der Doppik vertraut sein, der fundiert über die finanziellen Konsequenzen unternehmerischen Wirtschaftens urteilen möchte. Trotz oder wegen ihres zentralen propädeutischen Charakters fristet die Buchführung im Studium der Betriebswirtschaftslehre aber häufig ein Schattendasein in der Wahrnehmung Lernender. Dies ist im Grunde verständlich, wird doch durch die Lehrenden die rein technische Seite des Faches gelegentlich überbetont, ihre inhaltliche Bedeutung aber unbotmäßig zurückgedrängt. Dies mag viele Ursachen haben.
2. Dieses Lehrbuch will beides vermitteln: sowohl die erste Kenntnis einschlägiger Buchführungsgrundsätze als auch eine sichere Buchungstechnik. Denn die Beherrschung der Buchungstechnik und die Verinnerlichung ihrer Logik sind in der Tat wichtige Vorstufen für das Verständnis der Grundsätze ordnungsgemäßer Rechnungslegung; andererseits wird man ohne die Kenntnis der Buchführungsgrundsätze und ihres Sinn und Zwecks die Buchungstechnik weder verstehen noch erlernen können: Beides erhellt sich wechselseitig. Anhand wesentlicher Geschäftsvorfälle wird im vorliegenden Buch zunächst problemorientiert das System der doppelten Buchführung dargestellt. Ein zweites Kapitel entwickelt für typische Buchungsvorfälle jeweils die zentralen Bilanzierungsgrundlagen; anschließend wird die Technik ihrer buchhalterischen Erfassung erläutert und veranschaulicht. Hinweise auf weiterführende nationale und internationale Literatur, die auch den Zusammenhang mit der Bilanzierung nach handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung und International Financial Reporting Standards herstellen, runden die Fälle ab. Das Buch eignet sich derart für Studienanfänger, aber ebenso für fortgeschrittene Studenten und Praktiker, die ihre Buchführungskenntnisse auffrischen und vertiefen wollen. Angesichts der hektischen Betriebsamkeit in der nationalen wie internationalen Rechnungslegung wird man die Universalität und Eleganz der doppelten Buchführung hierbei als Ruhepol schätzen lernen; mancher mag zudem – der Altmeister der Bilanzlehre Adolf Moxter könnte dem zustimmen – den weltweiten so genannten Standard Settern der Rechnungslegung gelegentlich auch klösterliche Ruhe und kontemplative Abgeschiedenheit wünschen.
3. Die vorliegende achte Auflage bringt das Buch auf den aktuellen Stand der Literatur und Rechtsprechung. Erneut gaben dabei die Mannheimer Studierenden mit ihrer Kombination aus Einforderung des didaktischen und inhaltlichen Anspruchsniveaus einerseits und Leistungsbereitschaft andererseits hilfreiche und berücksichtigungswerte Hinweise zur Verbesserung.
4. Frau Leonie Baumann, M.Sc., hat sich dieser Neuauflage in einer völlig unzeitgemäßen Perfektion angenommen, wofür ich mich sehr herzlich bedanken möchte; unterstützt wurde sie in vorzüglicher Weise von Frau Pia Visel, B.Sc. Meinem Lehrstuhlteam danke ich – nicht nur in dieser Sache – für den Beleg dafür, dass ein Lehrstuhlbetrieb im klassischen Sinne zumindest dann möglich ist, wenn sich Freude an der Wissenschaft und esprit d’équipe vereinigen; dieser Dank schließt die Ehemaligen, in diesem Fall Frau Professor Dr. Anne Najderek und Herrn Professor Dr. Christopher Sessar, immer ein. Frau Nadine Grüttner, M.A., vom Deutschen Fachverlag – Fachmedien Recht und Wirtschaft – danke ich für die hervorragende verlegerische Betreuung.
Mannheim, Sommer 2024
Jens Wüstemann
Bearbeiterverzeichnis
Fall 1:
Prof. Dr. Anne Najderek, Hochschule Offenburg, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 2:
Prof. Dr. Anne Najderek, Hochschule Offenburg, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 3:
Prof. Dr. Christopher Sessar, SAP SE, Walldorf, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 4:
Prof. Dr. Anne Najderek, Hochschule Offenburg, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 5:
Prof. Dr. Anne Najderek, Hochschule Offenburg, Prof. Dr. Christopher Sessar, SAP SE, Walldorf, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 6:
Prof. Dr. Anne Najderek, Hochschule Offenburg, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 7:
Prof. Dr. Christopher Sessar, SAP SE, Walldorf, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 8:
Prof. Dr. Christopher Sessar, SAP SE, Walldorf, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 9:
Prof. Dr. Christopher Sessar, SAP SE, Walldorf, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 10:
Prof. Dr. Anne Najderek, Hochschule Offenburg, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 11:
Prof. Dr. Christopher Sessar, SAP SE, Walldorf, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 12:
Prof. Dr. Anne Najderek, Hochschule Offenburg, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 13:
Prof. Dr. Anne Najderek, Hochschule Offenburg, Prof. Dr. Christopher Sessar, SAP SE, Walldorf, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Fall 14:
Prof. Dr. Christopher Sessar, SAP SE, Walldorf, und Prof. Dr. Jens Wüstemann, Universität Mannheim
Inhaltsverzeichnis
Deckblatt
Titelseite
Impressum
Vorwort
Bearbeiterverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Kapitel: Grundlagen der Buchführung
Fall 1: Inventar und Bilanz
Fall 2: Erfolgsneutrale Geschäftsvorfälle: Bestandsbuchungen
Fall 3: Erfolgswirksame Geschäftsvorfälle: Geschäftsjahresgewinnermittlung
2. Kapitel Buchführungsgrundsätze und Buchungstechnik
Fall 4: Warenverkehr
Fall 5: Umsatzsteuer
Fall 6: Anschaffungskosten
Fall 7: Umsatzerlöse und Zahlungsverkehr
Fall 8: Personalaufwand
Fall 9: Abschreibungen auf das Anlagevermögen
Fall 10: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
Fall 11: Rechnungsabgrenzungsposten
Fall 12: Rückstellungen
Fall 13: Herstellungskosten und Ergebnisrechnung
Fall 14: Hauptabschlussübersicht
Sachregister
Autorenprofil
Abkürzungsverzeichnis
AB
Anfangsbestand
ABl.
Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.
Absatz
Abt.
Abteilung
a.F.
alte Fassung
AfA
Absetzung für Abnutzung
AG
Aktiengesellschaft
AN
Arbeitnehmer
ANK
Anschaffungsnebenkosten
AO
Abgabenordnung, zuletzt geändert am 27.3.2024
aRAP
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Aufl.
Auflage
Aug.
August
AV
Anlagevermögen
BB
Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BilMoG
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
Bd.
Band
BFH
Bundesfinanzhof
BGA
Büro- und Geschäftsausstattung
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch, zuletzt geändert am 16.7.2024
BGH
Bundesgerichtshof
BMF
Bundesministerium der Finanzen
BR-Drucks.
Bundesrats-Drucksache
bspw.
beispielsweise
BStBl.
Bundessteuerblatt
BT-Drucks.
Bundestags-Drucksache
Buchst.
Buchstabe
bzw.
beziehungsweise
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
DC
District of Columbia
Dez.
Dezember
d.h.
das heißt
Dipl.-Kfm.
Diplom-Kaufmann
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Diplom-Wirtschafts-Ingenieur
Dr.
Doktor
EB
Endbestand
EG
Europäische Gemeinschaft
EK
Eigenkapital
EStDV
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, zuletzt geändert am 27.3.2024
EStG
Einkommensteuergesetz, zuletzt geändert am 27.3.2024
EStR
Einkommensteuer-Richtlinie 2008 (EStR 2008)
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FE
Fertigerzeugnisse
Febr.
Februar
f.
folgende
ff.
(und) folgende Seiten
Fifo
First in – first out
FK
Fremdkapital
FR
Finanz-Rundschau (Zeitschrift)
FS
Festschrift
GE
Geldeinheit(en)
ggf.
gegebenenfalls
ggü.
gegenüber
GJ
Geschäftsjahr
GKR
Gemeinschaftskontenrahmen der Industrie
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GrS
Großer Senat
GS
Gedächtnisschrift
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
H
Haben
HGB
Handelsgesetzbuch, zuletzt geändert am 11.4.2024
Hifo
Highest in – first out
Hrsg.
Herausgeber
i.d.F.
in der Fassung
i.d.R.
in der Regel
i.H. (v.)
in Höhe (von)
i.S.d.
im Sinne der, des
i.S. (v.)
im Sinne von
i.V. (m.)
in Verbindung (mit)
IAS
International Accounting Standards
IFRS
International Financial Reporting Standards
inkl.
inklusive
insbes.
insbesondere
Jan.
Januar
Jg.
Jahrgang
Kfz
Kraftfahrzeug
Kifo
Konzern in – first out
Kilo
Konzern in – last out
Lifo
Last in – first out
Lofo
Lowest in – first out
LSt
Lohnsteuer
LStR
Lohnsteuer-Richtlinie
lt.
laut
LuL
Lieferung und Leistung
ME
Mengeneinheiten
NJ
New Jersey
Nov.
November
Nr.
Nummer
o.Ä.
oder Ähnliches, oder Ähnliche
o.g.
oben genannte
OHG
Offene Handelsgesellschaft
Okt.
Oktober
pRAP
passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Prof.
Professor
PwC
PricewaterhouseCoopers
R
Richtlinie
RFH
Reichsfinanzhof
Rn.
Randnummer
RStBl.
Reichssteuerblatt
s.
siehe
S
Soll
S.
Satz, Seite(n)
SBK
Schlussbilanzkonto
SEC
United States Securities and Exchange Commission
Sept.
September
SGB
Sozialgesetzbuch
sog.
so genannt
SolZG
Solidaritätszuschlaggesetz, zuletzt geändert am 8.12.2022
Sp.
Spalte
Teilbd.
Teilband
TEuro
Tausend Euro
u.
und
u.a.
und andere, unter anderem, unter anderen
UE
Unfertige Erzeugnisse
u.U.
unter Umständen
US-GAAP
United States General Accepted Accounting Standards
USt
Umsatzsteuer
UStG
Umsatzsteuergesetz, zuletzt geändert am 27.3.2024
UStR
Umsatzsteuer-Richtlinien 2008 (UStR 2008)
usw.
und so weiter
UV
Umlaufvermögen
v.
vom, von
vgl.
vergleiche
VL
Vermögenswirksame Leistungen
Vol.
Volume
WG
Wechselgesetz, zuletzt geändert am 31.8.2015
WPg
Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift)
WiSt
Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zeitschrift)
z.B.
zum Beispiel
zfbf
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung
ZGR
Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
1. Kapitel: Grundlagen der Buchführung
Fall 1: Inventar und Bilanz
Sachverhalt:
Unternehmer M der M-OHG hat zu Beginn seines Handelsgewerbes folgenden Bestand an Vermögensgegenständen und Schulden ermittelt:
Grundstück und Gebäude, Mannheimer Straße 3
350 000
Euro
1 Kleintransporter, Typ X
15 000
Euro
Kassenbestand laut Aufnahme
7 500
Euro
2 Schreibtische der Firma X zu je 1 000 Euro
2 000
Euro
Grundstück unbebaut, Mannheimer Straße 1
50 000
Euro
20 Waren A zu je 50 Euro
1 000
Euro
50 Waren B zu je 10 Euro
500
Euro
10 Waren C zu je 100 Euro
1 000
Euro
Kredit Y-Bank, Mannheim
250 000
Euro
2 PC, Marke X zu je 1 500 Euro
3 000
Euro
Kredit Z-Bank, Mannheim
145 000
Euro
Verbindlichkeit gegenüber X-AG
5 000
Euro
Bankguthaben Y-Bank, Mannheim
20 000
Euro
Aufgabenstellung:
Welche buchführungstechnischen Konsequenzen ergeben sich für die M-OHG?
I.Problemstellung
Ein Kaufmann ist handels- und steuerrechtlich grundsätzlich zur Buchführung verpflichtet. Der Buchführung kommt die Aufgabe zu, alle wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge (Geschäftsvorfälle) in einem Unternehmen zu dokumentieren.1 Der Sinn und Zweck dieser Verpflichtung begründet sich zunächst im Gläubigerschutzerfordernis i.S. einer Konkursvorsorge.2 Aus der Verantwortlichkeit, die Vermögenslage ersichtlich zu machen, ergibt sich auch die Notwendigkeit, zu Beginn des Handelsgewerbes sowie zum Ende jedes Geschäftsjahres ein art-, mengen- und wertmäßiges Verzeichnis von Vermögensgegenständen und Schulden (Inventar) zu erstellen. Dieses dient als Ausgangspunkt für die Bilanz und ist somit auch Grundlage für die doppelte Buchführung. Im vorliegenden Fall sollen daher zunächst die rechtlichen Bestimmungen zur Buchführung sowie allgemeine Anforderungen an eine ordnungsmäßige Buchführung erarbeitet werden, um im nächsten Schritt Inventar und Bilanz als Buchführungsgrundlagen vorzustellen.
II.Buchführungsgrundsätze
1.Buchführungspflicht
a)Gesetzliche Vorschriften zur Buchführungspflicht
§ 238 Abs. 1 S. 1 HGB bestimmt, dass jeder Kaufmann verpflichtet ist, „Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen“. Kaufmann ist hierbei, „wer ein Handelsgewerbe betreibt“ (§ 1 Abs. 1 HGB), so dass die Buchführungspflicht ab Beginn des Handelsgewerbes besteht.3 Dieses ist in das Handelsregister4 einzutragen. Freiwillig in das Handelsregister eingetragene gewerbliche Unternehmen gelten gemäß § 2 HGB gleichermaßen als Handelsbetriebe. Ferner finden die Vorschriften für Kaufleute nach § 6 HGB auch auf Handelsgesellschaften kraft Rechtsform Anwendung, so dass diese zur Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften zur Buchführung und Bilanzierung verpflichtet sind.5 Die Buchführungspflicht beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Handelsgewerbes; sie endet mit dem Ende der Kaufmannseigenschaft.6
Auch steuerrechtlich besteht eine Buchführungspflicht, die sich aus der Abgabenordnung (AO) ergibt: § 140 AO bestimmt, dass jeder, der „nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen zu führen hat [...], die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen“ hat (sog. derivative Buchführungspflicht). § 141 AO erweitert „den Kreis der Buchführungspflichtigen unabhängig von der Kaufmannseigenschaft aus Gründen der Gerechtigkeit [...] der Besteuerung“7 ab einer Umsatzhöhe von 800 000 Euro, einem Wirtschaftswert8 von 25 000 Euro oder einem Gewinn von 80 000 Euro, sofern nicht bereits nach § 140 AO Buchführungspflicht besteht (sog. originäre, also unmittelbar nach Steuerrecht bestehende Buchführungspflicht).
§ 241a HGB sieht für nichtkapitalmarktorientierte Einzelkaufleute eine Befreiung von der Buchführungspflicht und der Pflicht zur Erstellung eines Inventars vor, wenn an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren die Umsatzerlöse 500000 Euro und der Jahresüberschuss 50000 Euro nicht übersteigen. Diese größenabhängige Befreiung von der Anwendung der §§ 238–241 HGB dient der Angleichung an die steuerrechtlichen Schwellenwerte des § 141 AO.9 Ebenso werden mit § 242 Abs. 4 HGB solche Kaufleute von der Aufstellungspflicht eines Jahresabschlusses gemäß § 242 HGB befreit. Die „bestehende Verknüpfung zwischen der Kaufmannseigenschaft und der daran anknüpfenden Verpflichtung zur handelsrechtlichen Buchführungspflicht“ wird dadurch teilweise aufgehoben.10
b)Sinn und Zweck der Buchführungspflicht
aa)Begriff der Buchführung
Die Buchführung verzeichnet als laufende, systematische und in Geldgrößen vorgenommene Dokumentation chronologisch, lückenlos und ordnungsmäßig alle Geschäftsvorfälle in einem Unternehmen.11 Geschäftsvorfälle sind hierbei „Ereignisse, die eine Veränderung des kaufmännischen Bruttovermögens in Höhe und/oder Struktur bewirken“.12
bb)Sinn und Zweck der kaufmännischen Buchführungspflicht
Die kaufmännische Buchführung ist ein Instrument zur Sicherung des Einblicks in die Handelsgeschäfte und in die Vermögenslage eines Kaufmanns.13 Sie bezweckt eine klare, übersichtliche und nachprüfbare Dokumentation des Vermögens und der Vermögensentwicklung des zur Buchführung Verpflichteten.14 Die Buchführungspflicht begründet sich im Gläubigerschutzerfordernis i.S. einer Konkursvorsorgefunktion:15 Durch eine ordnungsmäßige Buchführung soll über den Stand von Schulden und Vermögen informiert, die Haftungsmasse gegen die Entziehung von Vermögensgegenständen gesichert sowie eine Beweiskraft durch Bücher erreicht werden.16
2.Art der Bücherführung
a)Gesetzliche Vorschriften
Die Buchführung hat „nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung“ (§ 238 Abs. 1 S. 1 HGB) zu erfolgen. Eine ordnungsmäßige Buchführung bedeutet zunächst, dass diese so beschaffen sein muss, „dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann“ (§ 238 Abs. 1 S. 2 HGB). Dies führt dazu, dass sich die „Geschäftsvorfälle [...] in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen“ (§ 238 Abs. 1 S. 3 HGB) müssen.
Neben den in § 238 HGB geregelten Vorschriften über die Buchführung enthält § 239 HGB Bestimmungen zur Führung der Handelsbücher: Hierbei „hat sich der Kaufmann einer lebenden Sprache zu bedienen“; eine Verwendung von „Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbole[n]“ ist zulässig, sofern „deren Bedeutung eindeutig“ festliegt (§ 239 Abs. 1 HGB). Des Weiteren müssen die Eintragungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen „vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden“ (§ 239 Abs. 2 HGB). Eine formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung setzt auch voraus, dass Buchungen oder Aufzeichnungen „nicht in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist“ bzw. Veränderungen zu einer Ungewissheit darüber führen, „ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind“ (§ 239 Abs. 3 HGB). Grundsätzlich dürfen Handelsbücher und Aufzeichnungen auch „in der geordneten Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden“. Werden Datenträger verwendet, muss sichergestellt sein, dass „die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können“ (§ 239 Abs. 4 HGB).
b)Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
Neben den Einzelvorschriften zu den formalen Anforderungen der Bücherführung gilt die Generalvorschrift, dass für die Ersichtlichmachung der Vermögenslage und der Handelsgeschäfte die „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ (GoB) angewendet werden müssen. Da die „(äußerst vielfältigen) Eigenschaften einer ordnungsgemäßen Buchführung (und Bilanzierung)“ nicht detailliert im Gesetz beschrieben werden können,17 greift das Gesetz auf den unbestimmten Rechtsbegriff der GoB zurück. Diese sind „ein System von sich wechselseitig ergänzenden und beschränkenden Prinzipien und Einzelnormen zur Rechnungslegung“18, die bestimmte Regeln über die Art und Weise der gesamten Rechnungslegung darstellen,19 die kodifiziert oder auch nicht kodifiziert sein können. Neben den Grundsätzen zur Führung der Handelsbücher impliziert der Begriff der GoB somit auch die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur und Bilanzierung.20
Zu den GoB gehören z.B. der Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit gemäß § 243 Abs. 2 HGB, die vollständige Erfassung aller „Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge“ nach § 246 Abs. 1 HGB sowie auch allgemeine Bewertungsgrundsätze nach § 252 HGB. Als übergeordneter Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung ist das sog. Vorsichtsprinzip nach § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB hervorzuheben, wonach die Bilanzierung einer vorsichtigen Bewertung unterliegt.
Die GoB, die für alle Kaufleute gelten und zur Erreichung der Schutzzwecke der Rechnungslegung dienen, sind Konkretisierungen des Gläubigerschutzprinzips.21 Sie werden durch die Gesetzgebung und die Rechtsprechung – insbes. des Bundesfinanzhofs – entwickelt,22 der „sich dabei primär an dem System kodifizierter Buchführungs- und Bilanzierungsnormen und dessen Sinn und Zweck“23 orientiert.
3.Buchführungsorganisation
a)Systeme der Buchführung
Die gesetzlichen Buchführungsbestimmungen schreiben kein bestimmtes Buchführungssystem zwingend vor, so dass die Praxis drei Buchführungssysteme kennt:
(1) Die kameralistische Buchführung24 „basiert auf einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung“25 und wird „in Form der Verwaltungs- und Betriebskameralistik [...] von öffentlichen Haushalten und Betrieben angewandt“26.
(2) Die einfache Buchführung beschränkt sich auf Bestandskonten, die ohne Gegenbuchungen geführt werden. Die Erfolgsermittlung erfolgt nicht nach den Quellen des Erfolgs, sondern als schlichter Vergleich von Anfangs- und Endvermögen einer Periode.27 Das Betriebsvermögen kann hierbei nur durch eine Inventur festgestellt werden; eine Gewinn- und Verlustrechnung wird nicht immer erstellt. Deshalb ist die Anwendung i.d.R. auf Kleinbetriebe (Handwerkerbuchhaltung) oder Ausnahmefälle (z.B. in der Gründungsphase eines Unternehmens) begrenzt.28
(3) Infolge der Verpflichtung zur Aufstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung nach § 242 Abs. 2 HGB ist das System der doppelten Buchführung das in der Praxis am häufigsten angewendete Buchführungssystem: Es beruht auf der Tatsache, dass sämtliche Geschäftsvorfälle einen Werteübergang im Sinne eines „Tauschakts“ darstellen, d.h. jede Leistung eine Gegenleistung impliziert. Diese zweiseitigen Wertbewegungen werden auf Bestands- und Erfolgskonten29 im Grundbuch zeitlich und im Hauptbuch nach Sachkonten getrennt erfasst. Das Hauptbuch stellt somit „systematisch alle betrieblichen Vorgänge nach ihrer Vermögens- und Erfolgswirkung dar“30 und wird am Ende der Abrechnungsperiode zur Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung verdichtet, so dass ein geschlossenes System entsteht, in dem der Erfolg auf zweifache Weise, durch Vermögensvergleich und durch eine Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag, ermittelt wird.31
b)Organisation der Buchführung
aa)Belegorganisation
Für die Einrichtung einer ordnungsmäßigen Buchführung ist die Festlegung organisatorischer Regelungen für ein nachvollziehbares und beweiskräftiges System notwendig, über das die Anforderungen an die Buchführung erfüllt werden. Hierfür ist sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle durch Belege erfasst und in Büchern aufgezeichnet werden.32 „Eine Buchführung ist nicht ordnungsmäßig, wenn die Belege fehlen“33. Gemäß dem Belegprinzip darf dementsprechend keine Buchung ohne Beleg erfolgen.34 Ein Beleg ist hierbei ein Schriftstück, das geeignet ist, „die Richtigkeit von Angaben über geschäftliche Vorgänge zu beweisen“35 (Belegfunktion). Maßgeblich ist hierbei der Inhalt und nicht die Form der Datenaufbewahrung, so dass grundsätzlich alle Medien als Beleg denkbar sind.36 Bei Belegen wird zwischen Eigen- und Fremdbeleg unterschieden: Fremdbelege entstehen aus dem Geschäftsverkehr des Unternehmens mit Dritten. Hierzu gehören bspw. Eingangsrechnungen, Kontoauszüge und Ausgangsrechnungen. Wenn es zu einer Buchung keinen Beleg von Außenstehenden gibt, muss ein Eigenbeleg erstellt werden, der als Nachweis dienen kann (z.B. Materialentnahmescheine, Lohn- und Gehaltslisten, Abschlussbelege).37 Da die Belegablage geordnet zu erfolgen hat und die Zusammengehörigkeit von Buchung und Beleg jederzeit überprüfbar sowie nachvollziehbar sein muss, wird die Belegordnung nach Sachkriterien (z.B. Kunde, Lieferant, Bank) unter fortlaufender Nummerierung vorgenommen. Die Aufbewahrung der Belege hat so zu erfolgen, dass sie jederzeit und lückenlos auffindbar sind.38 In der Buchführungspraxis werden Belege mithilfe eines Buchungsstempels vorkontiert, der den Beleginhalt um die Kontennummern der anzusprechenden Konten, den Buchungstext, das Buchungsdatum, die Belegnummer und den Betrag ergänzt.39
bb)Organisation der Bücher
Das Gesetz fordert vom Kaufmann eine Dokumentation der Geschäftsvorfälle in Handelsbüchern. Diese haben die Geschäftsvorfälle vollständig, klar und nachprüfbar zu erfassen.40 Wenngleich keine gesetzlichen Vorgaben darüber bestehen, welche Bücher zu führen sind, haben sich in der kaufmännischen Praxis Grund-, Haupt- und Nebenbücher als Erfassungsinstrument für Geschäftsvorfälle durchgesetzt.41
(1) In den Grundbüchern erfolgt die chronologische Dokumentation der Geschäftsvorfälle. Als Grundbücher kommen Kassenbücher, Bankbücher, Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbücher usw. in Betracht. In der Regel sind zu einem Geschäftsvorfall Angaben zum Datum, Vorgang, Beleghinweis, Konto, Gegenkonto und Betrag zu machen.42 Die Anzahl und Form der Grundbücher bestimmt sich dabei nach der Zweckmäßigkeit.
(2) Das Hauptbuch dient der systematischen Erfassung der Geschäftsvorfälle nach sachlichen Ordnungskriterien, so dass das Hauptbuch alle Bestands- und Erfolgskonten als Sachkonten enthält. Den Sachkonten liegt ein nach den betrieblichen Verhältnissen ausgestalteter Kontenplan43 zugrunde. Kontenpläne werden regelmäßig aus Kontenrahmen hergeleitet, die einen nach einheitlichen Prinzipien gestalteten Organisationsplan der Konten darstellen.44 Grundlage für die Buchungen im Hauptbuch sind die Eintragungen im Grundbuch, die in bestimmten Abständen übertragen werden. Das Hauptbuch ermöglicht die systematische Erfassung des Bestands und der Veränderung an Vermögen, Kapital und Schulden sowie der Aufwendungen und der Erträge, eine eindeutige Erfassung und Trennung einzelner Geschäftsvorfälle und eine umfassende Gliederung der Bestands- und Erfolgskonten sowie eine weitgehende Vermeidung gemischter Konten.45
(3) Da in Grund- und Hauptbuch lediglich eine knappe Darstellung der Buchungsinhalte erfolgt, haben Neben- und auch Hilfsbücher die Aufgabe, „die Aussagefähigkeit der Hauptbücher in Bezug auf bestimmte Einzelinformationen zu erweitern“46. Wichtige Nebenbücher sind z.B. das Kontokorrent- oder Geschäftsfreundebuch, Lohn- und Gehaltsbuch sowie die Anlagen- und Materialnebenbuchführung.47
c)Aufbewahrungspflicht
Gemäß § 257 HGB hat der Kaufmann bestimmte Unterlagen „geordnet aufzubewahren“. Die Aufbewahrungsfrist beträgt grundsätzlich zehn Jahre, Handelsbriefe sind sechs Jahre aufzubewahren. Den Aufbewahrungsvorschriften kommt insbes. eine Dokumentations- und Beweissicherungsfunktion zu,48 da „das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen die Vorlegung der Handelsbücher einer Partei anordnen“ (§ 258 Abs. 1 HGB) kann. Nach § 257 Abs. 5 HGB beginnt die Aufbewahrungsfrist „mit dem Schluss des Kalenderjahrs“, in dem der Sachverhalt, der zur Aufbewahrungspflicht führt, verwirklicht wird. Grundsätzlich kann die Aufbewahrung der Unterlagen mit „Ausnahme der Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse“ auch „auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern“ erfolgen, „wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht“ (§ 257 Abs. 3 HGB).
4.Anwendung auf den Fall: Prüfung der Buchführungspflicht der M-OHG
Die M-OHG als offene Handelsgesellschaft49 ist eine Personengesellschaft, deren „Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes [...] gerichtet ist“ (§ 105 HGB). „Eine OHG ist [...] immer Kaufmann“50 i.S.d. Handelsrechts: Die M-OHG unterliegt damit der Buchführungspflicht nach § 238 HGB. Gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften hat die M-OHG die Handelsgeschäfte sowie die Vermögenslage nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen, zu dokumentieren und die Unterlagen aufzubewahren. Es wird angenommen, dass die M-OHG die Aufzeichnungen nach dem System der doppelten Buchführung vornimmt, um den handelsrechtlichen Anforderungen nachzukommen.
1
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 90.
2
Vgl.
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 5f.
3
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.); Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 70.
4
Vgl. zum Handelsregister §§ 8–16 HGB.
5
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 27.
6
Vgl.
Adler/Düring/Schmaltz
, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen (1998), § 238 HGB, Rn. 23.
7
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 25.
8
Der Wirtschaftswert bezieht sich auf selbstbewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Flächen. Die Bewertung erfolgt nach § 46 Bewertungsgesetz.
9
Vgl. BR-Drucks. 344/08, S. 72.
10
Vgl. BR-Drucks. 344/08, S. 99. Vgl. auch
Ernst
, Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts, ZGR 2008, S. 631 (S. 658f.).
11
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 15.
12
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HBG, Rn. 95.
13
Vgl.
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 5.
14
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 90.
15
Vgl.
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 6.
16
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 111.
17
Vgl. hierzu sowie zur Entwicklung der GoB
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 7 (auch Zitat).
18
Moxter
, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, in: Ballwieser/Coenenberg/v. Wysocki (Hrsg.), Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung (2002), Sp. 1041 (Sp. 1041).
19
Vgl.
Knobbe-Keuk
, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht (1993), S. 41.
20
Vgl.
Justenhoven/Usinger
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 243 HGB, Rn. 1.
21
Vgl.
Beisse
, Wandlungen der Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung, in: Schön (Hrsg.), GS Knobbe-Keuk (1997), S. 385 (S. 408).
22
Vgl.
Moxter
, Grundsätze ordnungsgemäßer Rechnungslegung (2003), S. 9–13.
23
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 8.
24
Zur kameralistischen Rechnungslogik vgl.
Oettle
, Kameralistik, in: Chmielewicz/Schweitzer (Hrsg.), Handwörterbuch des Rechnungswesens (1993), Sp. 1048.
25
Buchner
, Buchführung und Jahresabschluss (2005), S. 415.
26
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 127.
27
Vgl.
Buchner
, Buchführung und Jahresabschluss (2005), S. 416.
28
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 125.
29
Vgl. zu Bestands- und Erfolgskonten unten, Fall 2 (Erfolgsneutrale Geschäftsvorfälle: Bestandsbuchungen) sowie unten, Fall 3 (Erfolgswirksame Geschäftsvorfälle: Geschäftsjahresgewinnermittlung).
30
Buchner
, Buchführung und Jahresabschluss (2005), S. 417.
31
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 123.
32
Vgl.
Adler/Düring/Schmaltz
, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen (1998), § 238 HGB, Rn. 33a.
33
BFH, Urteil v. 30.5.1962 – I 199/60, DB 1962, S. 1029 (S. 1029).
34
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 132.
35
Buchner
, Buchführung und Jahresabschluss (2005), S. 418.
36
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 132.
37
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 690.
38
Vgl.
Buchner
, Buchführung und Jahresabschluss (2005), S. 418.
39
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 690.
40
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 114.
41
Vgl.
Böcking/Gros/Wirth
, in: Wiedmann u.a. (Hrsg.), Bilanzrecht (2019), § 238 HGB, Rn. 13.
42
Vgl.
Böcking/Gros/Wirth
, in: Wiedmann u.a. (Hrsg.), Bilanzrecht (2019), § 238 HGB, Rn. 14.
43
Im vorliegenden Buch soll unabhängig von einem Kontenplan vorgegangen werden.
44
Je nach Wirtschaftszweig existieren unterschiedliche Kontenrahmen. Es lassen sich grundsätzlich die Kontenrahmen des Einzelhandels, des Großhandels und der Industrie unterscheiden. Da das betriebliche Rechnungswesen einerseits die Finanzbuchführung und andererseits die Kosten- und Leistungsrechnung (Betriebsbuchführung) erfasst, kann sich der Sachumfang der Kontenrahmen entweder nur auf die Finanzbuchführung erstrecken oder auch die Konten der Betriebsbuchführung umfassen. Vgl. zu den Ausführungen sowie zu denkbaren Gliederungsformen
Buchner
, Buchführung und Jahresabschluss (2005), S. 96–98.
45
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 117.
46
Vgl.
Böcking/Gros/Wirth
, in: Wiedmann u.a. (Hrsg.), Bilanzrecht (2019), § 238 HGB, Rn. 16.
47
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanzkommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 118.
48
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanzkommentar (2022), § 238 HGB, Rn. 1.
49
Vgl. §§ 105–160 HGB sowie ergänzend §§ 705–740 BGB.
50
Jacobs
, Unternehmensbesteuerung und Rechtsform (2015), S. 20.
51
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 46.
52
Vgl.
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 10.
53
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 46.
54
Vgl.
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 10.
55
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 240 HGB, Rn. 18. Diese Grundsätze können aber durch den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit eingeschränkt werden.
56
Vgl.
Böcking/Gros
, in: Wiedmann u.a. (Hrsg.), Bilanzrecht (2019), § 240 HGB, Rn. 6.
57
Vgl. hier und im Folgenden
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 240 HGB, Rn. 23 (auch folgende Zitate).
58
Vgl.
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 9. Zur Fest- und Gruppenbewertung vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 240 HGB, Rn. 76–145, ferner unten, Fall 4 (Warenverkehr).
59
Vgl.
Böcking/Gros
, in: Wiedmann u.a. (Hrsg.), Bilanzrecht (2019), § 240 HGB, Rn. 9.
60
Vgl.
Kunz
, Inventur, in: Ballwieser/Coenenberg/v. Wysocki (Hrsg.), Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung (2002), Sp. 1238 (Sp. 1240).
61
Die Systematik der Begrifflichkeiten ist in der Literatur unterschiedlich. Oftmals findet sich als Oberbegriff nur der Begriff der Inventurverfahren. Die Kombination aus Inventursystem und Inventurverfahren bezeichnet
Eisele/Knobloch
als Inventurform. Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 49f.
62
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 50.
63
Vgl.
Böcking/Gros
, in: Wiedmann u.a. (Hrsg.), Bilanzrecht (2019), § 240 HGB, Rn. 15.
64
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 240 HGB, Rn. 41.
65
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 50.
66
Vgl.
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 240 HGB, Rn. 44.
67
Vgl.
Böcking/Gros
, in: Wiedmann u.a. (Hrsg.), Bilanzrecht (2019), § 240 HGB, Rn. 19.
68
Als weitere Inventurvereinfachungsverfahren nach § 241 Abs. 2 HGB werden die Einlagerungsinventur, die systemgestützte Werkstattinventur sowie die warenwirtschaftssystemgestützte Inventur im Handel betrachtet. Vgl.
Heiden
, in: Küting/Pfitzer/Weber (Hrsg.), Handbuch der Rechnungslegung, Einzelabschluss, § 241 HGB, Rn. 49–63 (Stand: Sep. 2023).
69
Vgl.
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 13.
70
Vgl.
Heiden
, in: Küting/Pfitzer/Weber (Hrsg.), Handbuch der Rechnungslegung, Einzelabschluss, § 241 HGB, Rn. 46 (Stand: Sep. 2023).
71
Vgl.
Böcking/Gros
, in: Wiedmann u.a. (Hrsg.), Bilanzrecht (2019), § 241 HGB, Rn. 13.
72
Vgl.
Böcking/Gros
, in: Wiedmann u.a. (Hrsg.), Bilanzrecht (2019), § 241 HGB, Rn. 17 (auch Zitat).
73
Vgl.
Adler/Düring/Schmaltz
, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen (1998), § 241 HGB, Rn. 37.
74
Vgl.
Moxter
, Bilanzlehre, Bd. II (1986), S. 13.
75
Layer
, Inventur, in: Chmielewicz/Schweitzer (Hrsg.), Handwörterbuch des Rechnungswesens (1993), Sp. 955 (Sp. 958).
76
Vgl.
Adler/Düring/Schmaltz
, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen (1998), § 240 HGB, Rn. 63f.
77
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 73–75.
78
Vgl.
Buchner
, Buchführung und Jahresabschluss (2005), S. 98.
79
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 75f.
80
Störk/Lewe
, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2022), § 240 HGB, Rn. 53.
81
Häufig bedarf es einer Überleitungsrechnung vom Inventar auf die Bilanzposten nach Maßgabe der handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, was in einem gesonderten Bearbeitungsgang, dem sog. Anhängeverfahren, erfolgt. Vgl.
Adler/Düring/Schmaltz
, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen (1998), § 240 HGB, Rn. 66.
82
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 78 (auch beide Zitate).
83
Vgl.
Eisele/Knobloch
, Technik des betrieblichen Rechnungswesens (2019), S. 81.