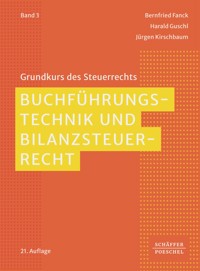
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Grundkurs des Steuerrechts
- Sprache: Deutsch
Doppelte Buchführung umfassend erklärt: vom Gewinnbegriff über die einzelnen Posten der Bilanz bis hin zur Vorbereitung des Jahresabschlusses. Mit weiterführenden Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen, besonderen Bilanzierungsfragen sowie zur Hauptabschlussübersicht und Bilanzberichtigung. Ausführungen zur Umsetzung in Buchhaltungsprogrammen runden den Band ab. Viele Beispiele, Fälle und Übungen sowie Buchungssätze ermöglichen einen schnellen und praxisnahen Einstieg in die Grundlagen. Die 21. Auflage von »Buchführungstechnik und Bilanzsteuerrecht« wurde aktualisiert und überarbeitet. Enthalten sind Gesetzesänderungen, insbesondere das Wachstumschancengesetz, sowie neue Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen. Rechtsstand: 1. August 2024 Die Lehrbuchreihe »Grundkurs des Steuerrechts« bietet kompaktes Grundlagenwissen und praktische Arbeitshilfen allen, die einen methodischen Einstieg in die unterschiedlichen Bereiche des Steuerrechts suchen. Im Vordergrund steht deshalb die Darstellung der allgemeinen Grundlagen und der systematischen Zusammenhänge, ergänzt durch die aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und die Verwaltungsmeinung. Alle Bände enthalten zahlreiche praxisnahe Beispiele und Übungsfälle. Der »Grundkurs« ist ideal für Studierende und Auszubildende aller Steuerberufe, insbesondere für die Beamt:innen der Steuerverwaltung, die sich am Anfang ihrer Ausbildung befinden. Er empfiehlt sich außerdem zur Vorbereitung auf die Prüfungen zum:r Steuerfachangestellten, Bilanzbuchhalter:in oder Steuerfachwirt:in sowie die Steuerberaterprüfung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort zur 21. AuflageAbkürzungsverzeichnisTeil A Einführung1 Bedeutung der Buchführung2 Der Gewinnbegriff des § 4 Abs. 1 EStG2.1 Der Betriebsvermögensvergleich2.2 Begriff des Betriebsvermögens2.3 Private Einflüsse2.4 Wirtschaftsjahr2.5 Übungsaufgaben zum Betriebsvermögensvergleich und zur Entwicklung des Betriebsvermögens3 Inventur – Inventar – Bilanz3.1 Inventur3.2 Inventar3.2.1 Gliederung des Inventars3.2.2 Ordnungsmäßigkeit des Inventars3.3 Bilanz3.3.1 Form und Inhalt der Bilanz3.3.2 Gliederung der Bilanz3.3.3 Bilanzenzusammenhang4 Änderung von Bilanzposten durch Geschäftsvorfälle4.1 Betriebsvermögensumschichtungen4.1.1 Der Aktiv-Tausch4.1.2 Der Passiv-Tausch4.1.3 Der Aktiv-Passiv-Tausch4.2 Betriebsvermögensveränderungen4.2.1 Betriebsvermögensveränderungen aus betrieblichem Anlass4.2.1.1 Betriebsvermögenserhöhungen durch Ertrag4.2.1.2 Betriebsvermögensminderungen durch Aufwand4.2.2 Betriebsvermögensveränderungen aus privatem Anlass4.2.2.1 Betriebsvermögenserhöhungen durch Einlagen4.2.2.2 Betriebsvermögensminderungen durch Entnahmen4.3 Sonderfälle4.4 ZusammenfassungTeil B Die Funktion der doppelten Buchführung1 Das Konto1.1 »Zerlegung« der Bilanz in Konten1.2 Kontenarten1.2.1 Sachkonten1.2.2 Personenkonten1.3 Die Seiten des Kontos (Soll und Haben)1.4 Buchungsregeln2 Der Buchungssatz2.1 Der einfache Buchungssatz2.2 Der zusammengesetzte Buchungssatz2.3 Deuten von Buchungssätzen3 Das Kapitalkonto und seine Unterkonten3.1 Erfolgskonten3.2 Das Gewinn-und-Verlust-Konto3.3 Privatkonten3.3.1 Einheitliches Privatkonto3.3.2 Getrennte Privatkonten3.4 Übersicht zu den Unterkonten des Kapitalkontos4 Kontenabschluss4.1 Abschluss der Bestandskonten4.2 Abschluss der Erfolgskonten4.3 Abschluss des Gewinn-und-Verlust-Kontos4.4 Abschluss des Privatkontos4.5 Beispiel für ein abgeschlossenes Konto4.6 Übersicht zu den Sachkonten und deren Abschluss4.7 Übersicht zu den Abschlussbuchungen5 Bilanzkonten5.1 Schlussbilanzkonto5.2 Eröffnungsbilanzkonto6 Gemischte Konten6.1 Begriff des gemischten Kontos6.2 Besonderheiten bei Konten des abnutzbaren Anlagevermögens6.3 Gemischtes Warenkonto6.3.1 Inhalt des Warenkontos6.3.2 Kontenmäßige Darstellung6.3.3 Abschluss des Warenkontos7 Kennzahlen für das Warengeschäft7.1 Wareneinsatz7.2 Sollumsatz7.3 Rohgewinn7.4 Rohgewinnsatz7.5 Rohgewinnaufschlagsatz7.6 Reingewinn und Reingewinnsatz8 Die getrennten Warenkonten8.1 Wareneinkaufskonto8.2 Warenverkaufskonto8.3 Abschluss der getrennten Warenkonten8.3.1 Nettoabschluss8.3.2 Bruttoabschluss8.4 Warenbestandskonto9 Kontenrahmen, Kontenplan9.1 Planmäßige Buchführung9.2 Kontenklassen9.3 Kontennummer10 JournalTeil C Weiterführende Buchungen1 Buchung der Umsatzsteuer1.1 Das Umsatzsteuerkonto1.1.1 Nettobuchung der Umsatzsteuer1.1.2 Bruttobuchung der Umsatzsteuer1.2 Das Vorsteuerkonto1.3 Abschluss der Umsatzsteuerkonten1.4 Besonderheiten beim Abschluss der Umsatzsteuerkonten2 Buchung von Lohnaufwand3 Verkauf von Anlagegütern4 Buchung von Erwerbsnebenkosten und Preisnachlässen4.1 Erwerbsnebenkosten4.2 Rabatte und Skonti4.2.1 Funktionsrabatte4.2.2 Mengenrabatte (Boni)4.2.3 Skonti4.2.3.1 Schematische Darstellung der Buchung von Liefererskonti4.2.3.2 Schematische Darstellung der Buchung von Kundenskonti4.2.3.3 Bruttobuchung4.2.4 Abschluss der Boni- und Skontikonten4.2.5 Boni und Skonti bei den Kennzahlen4.3 Andere Preisnachlässe4.3.1 Warenrücksendungen an Lieferer4.3.2 Gutschriften durch Lieferer4.3.3 Warenrücksendungen durch Kunden4.3.4 Gutschriften an Kunden4.3.5 Naturalrabatte5 Warenentnahmen5.1 Gewinnauswirkung von Warenentnahmen5.2 Bewertung der Warenentnahmen5.3 Buchung von Warenentnahmen5.3.1 Buchung über das Wareneinkaufskonto5.3.2 Buchung über das Warenverkaufskonto5.3.3 Buchung über das Konto »Warenentnahmen«5.3.4 Vergleich der Buchungsmethoden5.4 Umsatzsteuer bei Warenentnahmen6 Storno- und Berichtigungsbuchungen6.1 Stornobuchung6.2 BerichtigungsbuchungenTeil D Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze1 Die Steuerbilanz als Grundlage der Gewinnermittlung1.1 Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 und § 5 EStG1.2 Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG2 Das Betriebsvermögen (BV)2.1 Notwendiges Betriebsvermögen2.2 Notwendiges Privatvermögen (PV)2.3 Gewillkürtes Betriebsvermögen2.4 Verbindlichkeiten als Betriebs- oder Privatschulden2.5 Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter2.6 Grundstücke und Grundstücksteile2.6.1 Notwendiges Betriebsvermögen2.6.2 Gewillkürtes Betriebsvermögen2.6.3 Notwendiges Privatvermögen3 Die Bewertung des Betriebsvermögens3.1 Bewertungsmaßstäbe3.1.1 Die Anschaffungskosten3.1.1.1 Anschaffungsnebenkosten3.1.1.2 Umsatzsteuer, Vorsteuer3.1.1.3 Nachträgliche Änderung der Anschaffungskosten3.1.1.4 Anschaffungskosten beim Tausch3.1.2 Die Herstellungskosten3.1.3 Der Teilwert3.1.3.1 Grenzwerte3.1.3.2 Teilwertvermutungen3.2 Bewertungsgrundsätze des § 6 EStG3.3 Die einzelnen Bewertungsregeln des § 6 EStG3.3.1 Abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG)3.3.1.1 Buchmäßige Behandlung der Teilwertabschreibung3.3.2 Nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG)3.3.2.1 Nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens3.3.2.2 Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens3.3.2.3 Buchmäßige Behandlung der Teilwertabschreibung3.3.3 Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG)3.3.3.1 Verbindlichkeiten des Anlagevermögens3.3.3.2 Verbindlichkeiten des Umlaufvermögens3.3.3.3 Bewertung langfristiger unverzinslicher Schulden3.4 Maßgeblichkeit handelsrechtlicher GoB3.4.1 Steuerbilanz und Handelsbilanz3.4.2 Handelsrechtliche Bewertungsvorschriften3.4.3 Der Maßgeblichkeitsgrundsatz (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG)3.4.3.1 Maßgeblichkeitsgrundsatz bei der Bilanzierung3.4.3.2 Maßgeblichkeitsgrundsatz bei der Bewertung3.4.4 Zusammenfassende Darstellung3.5 Wertaufholung3.6 Absetzung für Abnutzung nach § 7 EStG3.6.1 Allgemeines3.6.2 Die lineare AfA (§ 7 Abs. 1 Satz 1 EStG)3.6.3 Die Leistungs-AfA (§ 7 Abs. 1 Satz 6 EStG)3.6.4 Die degressive AfA (§ 7 Abs. 2 EStG)3.6.5 AfA bei Gebäuden (§ 7 Abs. 4 und 5 EStG)3.6.5.1 Das Gebäude als selbständiges abnutzbares Wirtschaftsgut3.6.5.2 AfA für Wirtschaftsgebäude (§ 7 Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 5 Nr. 1 EStG)3.6.5.3 AfA für sonstige Gebäude (§ 7 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 5 Nr. 2 und 3 EStG)3.6.5.4 Erhöhte, degressive Gebäude-AfA für neue Wohngebäude (§ 7 Abs. 5 a EStG)3.6.5.5 AfA bei selbständigen Gebäudeteilen (§ 7 Abs. 5b EStG)3.6.6 Beginn und Ende der AfA3.6.7 Buchung der AfA3.6.8 Erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen3.6.8.1 Allgemeines3.6.8.2 Sonderabschreibungen nach § 7 g EStG3.6.8.3 Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) gem. § 7 g EStG3.6.8.3.1 Inanspruchnahme eines IAB in nach dem 31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren3.6.8.3.2 Inanspruchnahme eines IAB in vor dem 01.01.2020 endenden Wirtschaftsjahren3.6.8.3.3 Sonderabschreibung für Elektronutzfahrzeuge und elektrisch betriebene Lastenfahrräder nach § 7c EStG3.6.8.4 Sonderabschreibung nach § 7b EStG3.6.8.4.1 Voraussetzungen3.6.8.4.2 Höhe der Sonderabschreibung3.6.8.4.3 Schädliche Verwendung und Rückgängigmachung der Sonderabschreibung3.6.8.4.4 Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2022 und das Wachstumschancengesetz3.7 Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern/Sammelposten3.7.1 Wahlrechtsausübung3.7.1.1 Keine Anwendung der §§ 6 Abs. 2 und Abs. 2 a EStG3.7.1.2 Anwendung des § 6 Abs. 2 EStG3.7.1.3 Anwendung des § 6 Abs. 2 a EStG3.7.2 Buchmäßige Behandlung3.7.3 Rechtslage bis 2017Teil E Einzelne Bilanzierungs- und Buchungsfragen1 Forderungen1.1 Begriff1.2 Zeitpunkt der Buchung bzw. Bilanzierung von Kundenforderungen1.3 Bewertung von Kundenforderungen1.3.1 Anschaffungs- oder Herstellungskosten1.3.2 Teilwert1.3.2.1 Vollwertige Kundenforderungen1.3.2.2 Zweifelhafte (dubiose) Kundenforderungen1.3.2.3 Uneinbringliche Kundenforderungen1.3.3 Wertaufhellung1.3.4 Bewertungsverfahren1.3.5 Buchtechnische Durchführung der Bewertung1.3.5.1 Einzelbewertung uneinbringlicher Forderungen1.3.5.2 Pauschalbewertung von Forderungen unter ihrem Nennwert1.3.5.3 Einzelbewertung von zweifelhaften Forderungen1.3.5.4 Buchtechnische Fortführung des im Vorjahr gebildeten Delkredere1.3.5.5 Aktivische Absetzung der Wertberichtigung1.3.6 Unverzinsliche Darlehensforderungen1.4 Anzahlungen2 Rechnungsabgrenzung2.1 Begriff und Zweck2.2 Periodengerechte Erfolgsabgrenzung2.3 Abgrenzung und buchtechnische Durchführung transitorischer Vorgänge2.3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (§ 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG)2.3.2 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (§ 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG)2.3.3 Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten beim Jahresabschluss2.3.4 Wahlrecht zur Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens nach § 5 Abs. 5 Satz EStG2.4 Abgrenzung und buchtechnische Durchführung antizipativer Vorgänge3 Rückstellungen3.1 Allgemeines3.2 Voraussetzung der Rückstellungsbildung3.3 Bewertung von Rückstellungen3.4 Buchmäßige Behandlung von Rückstellungen3.5 Rückstellungsarten3.5.1 Abschlusskostenrückstellung3.5.2 Garantierückstellung3.5.3 Ansammlungsrückstellung3.5.4 Gewerbesteuerrückstellung3.5.5 Drohverlust-Rückstellung4 Steuerfreie Rücklagen4.1 Allgemeines4.2 Rücklage gem. § 6 b EStG4.2.1 Erster Hauptfall: Veräußerung von Grundstücken4.2.2 Zweiter Hauptfall: Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften4.2.2.1 Allgemeines4.3 Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR)4.3.1 Allgemeines4.3.2 Die einzelnen Tatbestandsmerkmale4.3.3 Die Übertragungsfristen4.3.4 Entschädigung bei Beschädigung4.3.5 Verhältnis R 6.6 EStR zu § 6 b EStGTeil F Entnahmen und Einlagen1 Bedeutung2 Entnahmen2.1 Aufwandsentnahme2.2 Entnahmehandlung2.3 Entnahme und Umsatzsteuer2.4 Bewertung der Entnahmen2.5 Buchmäßige Behandlung von Entnahmen2.6 Private Nutzung betrieblicher PKW2.6.1 Ertragssteuerrechtliche Beurteilung2.6.1.1 Vereinfachungsregelung2.6.1.2 Beschränkung der 1 %-Regelung auf Fahrzeuge des notwendigen BV2.6.2 Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung2.6.2.1 Privatnutzung und 1 %-Methode2.6.3 Entnahme eines auch privat genutzten PKW3 Einlagen4 Exkurs: Nicht abziehbare Betriebsausgaben4.1 Allgemeines4.2 Beschränkter Schuldzinsenabzug gem. § 4 Abs. 4 a EStGTeil G Hauptabschlussübersicht1 Vorbemerkungen2 Die Hauptabschlussübersicht im Einzelnen2.1 Summenbilanz2.2 Saldenbilanz2.3 Umbuchungen2.4 Saldenbilanz II2.5 Vermögensbilanz und Erfolgsbilanz3 Besonderheiten4 Beispiel zur Hauptabschlussübersicht (vgl. Lösung zu Fall 41)Teil H Bilanzberichtigung1 Voraussetzungen der Bilanzberichtigung2 Technik der Bilanzberichtigung2.1 Gewinnauswirkung nach Betriebsvermögensvergleich2.2 Gewinnauswirkung nach Gewinn-und-Verlust-RechnungTeil I EDV-Buchführung1 Einführung2 Der Buchungssatz2.1 Allgemeines2.2 Die Kontonummer2.3 Buchungskreise2.4 Forderungen und Verbindlichkeiten2.5 Zusammengesetzte Buchungssätze2.6 Verrechnungskonten2.7 Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten2.8 Skonti3 Datenerfassung und Datenverarbeitung3.1 Datenerfassung3.2 Datenverarbeitung4 Beispiele zur EDV-Buchführung4.1 Zugrunde liegende Sachverhalte4.2 Auszug aus dem Kontenplan4.3 Primanota (Erfassungsprotokoll)4.4 Journal4.5 Sach- und Personenkonten4.6 Summen- und Saldenliste5 Stornobuchungen6 Aufheben der AutomatikTeil J Lösungshinweise zu den FällenTeil K Komplexe Übungsfälle1 Übungsfall 11.1 Sachverhalt1.1.1 Allgemeines1.1.2 Einzelfeststellungen1.1.2.1 Lagerhalle1.1.2.2 Wertpapiere1.1.2.3 Waren- und Kassenbestand1.1.2.4 Fuhrpark1.2 Aufgabe2 Übungsfall 22.1 Sachverhalt2.1.1 Allgemeines2.1.2 Einzelfeststellungen2.1.2.1 Betriebsgrundstück2.1.2.2 Sonstiges Anlagevermögen2.1.2.3 Warenvorräte2.1.2.4 Devisenforderung/Devisenschuld2.1.2.5 Steuerrückstellung2.1.2.6 Prozessrückstellung2.1.2.7 Wertpapiere2.2 AufgabeTeil L Lösungshinweise zu den komplexen Übungsfällen1 Lösung zu Übungsfall 11.1 Lagerhalle1.2 Wertpapiere1.3 Waren- und Kassenbestand1.4 Fuhrpark2 Lösung zu Übungsfall 22.1 Betriebsgrundstück2.2 Sonstiges Anlagevermögen2.3 Warenvorräte2.4 Devisenforderung/Devisenverbindlichkeit2.5 Steuerrückstellung2.6 Prozessrückstellung2.7 WertpapiereStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bearbeiterübersicht:Fanck: Teile A, B, C, JGuschl: Teile D, G, I, JKirschbaum: Teile E, F, H, J, K, L
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6469-7
Bestell-Nr. 20203-0006
ePub:
ISBN 978-3-7910-6470-3
Bestell-Nr. 20203-0102
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6471-0
Bestell-Nr. 20203-0155
Bernfried Fanck/Harald Guschl/Jürgen Kirschbaum
Buchführungstechnik und Bilanzsteuerrecht
21. aktualisierte und überarbeitete Auflage, September 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Umschlag: Stoffers Grafik-Design, Leipzig
Produktmanagement: Ruth Kuonath
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort zur 21. Auflage
Mit dem vorliegenden Buch stellen die Verfasser – allesamt seit vielen Jahren Dozenten an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg – die Technik der Buchführung und die Grundsätze des Bilanzsteuerrechts dar. Es ist als Lehrbuch für das Grundstudium I an den Fachhochschulen und anderen Ausbildungseinrichtungen der Beamten des gehobenen Dienstes in der Steuerverwaltung konzipiert. Das Werk eignet sich jedoch auch bestens als Einstieg in die Materie der Buchführung und des Bilanzsteuerrechts für alle anderen Auszubildenden und Studierenden mit steuerlicher Fachrichtung.
In dieser Neuauflage wurden die seit dem Erscheinen der Vorauflage ergangenen Gesetzesänderungen (insbesondere des Wachstumschancengesetzes), neuen Verwaltungsanweisungen und BFH-Entscheidungen zum Bilanzsteuerrecht berücksichtigt.
Ludwigsburg, im Juni 2024
Bernfried Fanck
Harald Guschl
Jürgen Kirschbaum
Abkürzungsverzeichnis
A
Abschnitt
AB
Anfangsbestand
a. F.
alte Fassung
AfA
Absetzung für Abnutzung
AG
Aktiengesellschaft
AK
Anschaffungskosten
AktG
Aktiengesetz
AO
Abgabenordnung 1977
a. o.
außerordentliche/r
BFH
Bundesfinanzhof
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BilMoG
Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts
BGBl I
Bundesgesetzblatt Teil I
BStBl II
Bundessteuerblatt Teil II
BV
Betriebsvermögen
BVV
Betriebsvermögensvergleich
bzw.
beziehungsweise
d. h.
das heißt
EBK
Eröffnungsbilanzkonto
EmoG
Elektromobilitätsgesetz
ESt
Einkommensteuer
EStDV
Einkommensteuerdurchführungsverordnung
EStG
Einkommensteuergesetz
EStR
Einkommensteuerrichtlinien
EuGH
Europäischer Gerichtshof
f.
folgende
ff.
fortfolgende
gem.
gemäß
GewSt
Gewerbesteuer
ggb.
gegenüber
ggf.
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GuV
Gewinn und Verlust
GWG
Geringwertige Wirtschaftsgüter
HAÜ
Hauptabschlussübersicht
HGB
Handelsgesetzbuch
HK
Herstellungskosten
JStG
Jahressteuergesetz
i. d. F.
in der Fassung
i. d. R.
in der Regel
i. H. d.
in Höhe des/der
i. H. v.
in Höhe von
i. R. d.
im Rahmen des
i. S. d.
im Sinne der/des
i. Ü.
im Übrigen
i. V. m.
in Verbindung mit
lt.
laut
m. E.
meines Erachtens
ND
Nutzungsdauer
n. F.
neue Fassung
o. g.
oben genannt
PV
Privatvermögen
RAP
Rechnungsabgrenzungsposten
rd.
rund
Rspr.
Rechtsprechung
Rz.
Randziffer
S.
Seite
s.
siehe
SB
Schlussbestand
SBK
Schlussbilanzkonto
s. a.
siehe auch
s. o.
siehe oben
s. u.
siehe unten
SGB VI
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch
u. a.
unter anderem
u. U.
unter Umständen
UntStRefG
Unternehmensteuerreformgesetz
UR
Umsatzsteuer-Rundschau
USt
Umsatzsteuer
UStAE
Umsatzsteueranwendungserlass
UStDV
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG
Umsatzsteuergesetz
UStR
Umsatzsteuerrichtlinien
usw.
und so weiter
vgl.
vergleiche
WEK
Wareneinkaufskonto
WG
Wirtschaftsgut
Wj.
Wirtschaftsjahr
WVK
Warenverkaufskonto
z. B.
zum Beispiel
z. T.
zum Teil
Die Jahreszahlen 01, 02 usw. bedeuten nicht 2001, 2002 usw., sondern das erste, zweite bzw. weitere Jahr im jeweiligen Beispiel (Fall).
Teil A Einführung
1 Bedeutung der Buchführung
Jeder, der eine berufliche Tätigkeit ausübt, möchte selbstverständlich wissen, was er dabei verdient. Das gilt insbesondere auch für den Unternehmer. Auskunft über seine Ertrags- und Vermögenslage gibt ihm dabei die Buchführung seines Betriebs. Außerdem kann er daraus wichtige Daten für seine Kalkulation, für die Überwachung seiner Forderungen und Schulden und vieles andere mehr entnehmen. Die Buchführung ist somit eine wichtige Informationsquelle für den Unternehmer.
Buchführung ist aber nicht nur Privatsache. Auch aus Gründen des Gläubigerschutzes (z. B. Sicherung von Krediten) ist eine ordnungsmäßige Buchführung unbedingt erforderlich. Nicht zuletzt ist auch der Staat an den Ergebnissen der Buchführung interessiert, denn sie führen zu einer Reihe wichtiger Besteuerungsgrundlagen (z. B. Gewinn für die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, Verkaufserlöse = vereinbarte Entgelte für die Umsatzsteuer).
Aus diesen Gründen hat der Gesetzgeber für bestimmte Unternehmer die Buchführung zur Pflicht gemacht. So enthält § 238 HGB die Buchführungspflicht für alle Kaufleute (vgl. § 1 ff. HGB). Zur Befreiung von der Buchführungspflicht für kleine Einzelkaufleute siehe § 241 a HGB. § 141 AO verpflichtet alle Gewerbetreibenden sowie Land- und Forstwirte, deren Umsatz oder Gewinn eine bestimmte Grenze übersteigt, Bücher zu führen (vgl. auch D 1.1).
Eine bestimmte Form der Buchführung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Jedoch müssen zum Betriebsbeginn und zum Schluss jedes Geschäftsjahrs (Wirtschaftsjahrs) ein Inventar (Bestandsverzeichnis) und eine Bilanz erstellt werden, außerdem zum Schluss jedes Geschäftsjahrs eine Gewinn- und Verlustrechnung (§ 240 Abs. 1 und 2 sowie § 242 Abs. 1 und 2 HGB). Die einzelnen Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. Insgesamt muss die Buchführung so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten, z. B. dem Kreditsachbearbeiter der Bank oder dem Betriebsprüfer des Finanzamts, innerhalb angemessener Zeit einen sicheren Überblick über die Geschäftsvorfälle sowie über die Ertrags- und Vermögenslage des Unternehmens vermitteln kann (vgl. § 238 Abs. 1 Sätze 2 und 3 HGB sowie § 145 Abs. 1 AO). Eine Buchführung, die diesen Anforderungen entspricht, ist ordnungsmäßig.
2 Der Gewinnbegriff des § 4 Abs. 1 EStG
2.1 Der Betriebsvermögensvergleich
Die wohl wichtigste Besteuerungsgrundlage, die der Buchführung zu entnehmen ist, ist der Gewinn des Betriebs. Die steuerliche Definition des Gewinns ist im § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG enthalten. Aus dieser Vorschrift lässt sich folgende Darstellung ableiten:
Betriebsvermögen am Ende des Wirtschaftsjahrs (Wj.)
./.
Betriebsvermögen am Ende des vorangegangenen Wj.
Unterschiedsbetrag (Betriebsvermögenszunahme oder -abnahme)
+
EntnahmeEntnahmen
./.
EinlageEinlagen
Gewinn
Diese Berechnung bezeichnet man üblicherweise als Betriebsvermögensvergleich.
2.2 Begriff des Betriebsvermögens
Betriebsvermögen ist einerseits die Menge aller positiven und negativen Vermögenswerte (Wirtschaftsgüter), die dem Betrieb dienen, also der betrieblichen Besitzposten und Schulden, s. D 2.
Andererseits stellt das Betriebsvermögen auch den wertmäßigen Unterschied zwischen Besitzposten und Schulden des Betriebs dar, also das Eigenkapital. Dieses wertmäßige Betriebsvermögen liegt der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich zugrunde.
Zum Betriebsvermögen zählen nur Besitzposten, die dem Kaufmann gehören, also regelmäßig nur solche, die sich in seinem zivilrechtlichen Eigentum befinden. Ausnahmsweise können aber auch Besitzposten im zivilrechtlichen Eigentum eines Dritten dem Betriebsvermögen des Kaufmanns als wirtschaftliches Eigentum zugerechnet werden, vgl. § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO und § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB.
2.3 Private Einflüsse
Das Betriebsvermögen wird nicht nur durch betriebliche Einnahmen und Ausgaben verändert, sondern oft auch durch private Ausgaben (Entnahmen) oder Einlagen. Damit wird das Ergebnis des Betriebsvermögensvergleichs verfälscht. Zur Korrektur müssen deshalb die Entnahmen zugerechnet und die Einlagen abgesetzt werden. Damit ist sichergestellt, dass der Gewinn nur den betrieblichen Bereich erfasst.
Was unter Entnahmen und Einlagen im Einzelnen zu verstehen ist, ergibt sich aus § 4 Abs. 1 Sätze 2 und 8 EStG. Vgl. auch § 12 EStG und Teil F.
2.4 Wirtschaftsjahr
Die meisten Gewerbetreibenden haben als Wirtschaftsjahr (auch: Geschäftsjahr) das Kalenderjahr gewählt, jedoch sind vom Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahre unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls möglich. Für Land- und Forstwirte ist ein abweichendes Wirtschaftsjahr (01.07. bis 30.06.) gesetzlich vorgeschrieben, vgl. § 4 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG.
2.5 Übungsaufgaben zum Betriebsvermögensvergleich und zur Entwicklung des Betriebsvermögens
Fälle 1 – 3
Fall 1
Es bedeuten:
BV = Betriebsvermögen
BV 01 = Betriebsvermögen am Ende des ersten Wirtschaftsjahres
BV 02 = Betriebsvermögen am Ende des zweiten Wirtschaftsjahres
a)
b)
c)
d)
BV 02
50 000 €
20 000 €
./. 5 000 €
60 000 €
BV 01
10 000 €
30 000 €
15 000 €
./. 4 000 €
BV-Zunahme
40 000 €
…………………
…………………
…………………
BV-Abnahme
–
…………………
…………………
…………………
Eine Betriebsvermögens-Zunahme oder -Abnahme sagt für sich allein noch nichts über den endgültigen Gewinn oder Verlust aus. Das Betriebsvermögen am Ende des Wirtschaftsjahrs kann durch außerbetriebliche, also private Vorgänge beeinflusst sein; Privatentnahmen minderten das Vermögen, Privateinlagen wirkten sich erhöhend aus.
Fall 2
e)
f)
g)
h)
BV 02
25 000 €
./. 8 000 €
30 000 €
10 000 €
BV 01
35 000 €
12 000 €
10 000 €
./. 4 000 €
BV-Zunahme
–
…………………
…………………
…………………
BV-Abnahme
10 000 €
…………………
…………………
…………………
+ Entnahmen
36 000 €
14 000 €
24 000 €
30 000 €
./. Einlagen
6 000 €
5 000 €
50 000 €
2 000 €
Gewinn
20 000 €
…………………
…………………
…………………
Verlust
–
…………………
…………………
…………………
Fall 3
Die Bestandteile des Betriebsvermögensvergleichs werden oft in anderer Reihenfolge gegliedert, um die Entwicklung des Betriebsvermögens dazustellen.
i)
k)
l)
m)
BV 01
40 000 €
./. 5 000 €
12 000 €
30 000 €
./. Entnahmen
22 000 €
19 000 €
20 000 €
18 000 €
18 000 €
…………………
…………………
…………………
+ Einlagen
4 000 €
14 000 €
0 €
8 000 €
22 000 €
…………………
…………………
…………………
+ Gewinn
15 000 €
30 000 €
20 000 €
–
./. Verlust
–
–
–
25 000 €
BV 02
37 000 €
…………………
…………………
…………………
3 Inventur – Inventar – Bilanz
Nach den gesetzlichen Vorschriften über die Buchführung (§ 240 Abs. 1 und 2, § 242 Abs. 1 HGB, § 141 Abs. 1 Satz 2 AO) muss der Unternehmer zum Betriebsbeginn und zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahrs ein Inventar und eine Bilanz erstellen (vgl. 1). Ohne diese Unterlagen ist ein Betriebsvermögensvergleich nicht möglich, denn durch sie wird die Höhe des BV ja erst festgestellt.
3.1 Inventur
Die Inventur ist die körperliche Bestandsaufnahme, körperlicheBestandsaufnahme, buchmäßigeBestandsaufnahme des gesamten BV durch Zählen, Messen und Wiegen.
Das Schwergewicht liegt bei der Aufnahme der Warenbestände. Für das Anlagevermögen ist unter bestimmten Voraussetzungen (R 5.4 Abs. 4 EStR) eine buchmäßige Bestandsaufnahme zulässig. Bei Forderungen und Schulden können die Bestände ohnehin nur buchmäßig festgestellt werden.
3.2 Inventar
Das Inventar ist das auf Grund der Inventur erstellte BestandsverzeichnisBestandsverzeichnis, in dem die Besitzposten und Schulden des Unternehmens nach Art, Menge und Wert im Einzelnen aufgeführt sind.
Durch Gegenüberstellen von Besitzposten und Schulden ergibt sich das BV (Eigenkapital). Das Inventar muss vollständig und wahrheitsgemäß sein. Ein fehlerhaftes Inventar führt zu einem falschen Betriebsvermögen und damit auch zu einem falschen Gewinn.
3.2.1 Gliederung des Inventars
Zu einem ordnungsmäßigen Inventar gehört auch eine übersichtliche Gliederung. Besitzposten und Schulden werden getrennt aufgeführt. Beim Besitz wird zwischen Anlage-und Umlaufvermögen unterschieden. Anlagevermögen (§ 247 Abs. 2 HGB, R 6.1 Abs. 1 EStR) dient dem Betrieb auf längere Sicht (z. B. Einrichtung, Fuhrpark), UmlaufvermögenUmlaufvermögen gehört i. d. R. nur kurzfristig zum BV (z. B. Waren, Geldmittel, Forderungen); vgl. R 6.1 Abs. 2 EStR.
Beispiel
InventarInventar
der Firma Kurt M., Getränkehandlung, Bachstadt auf 31.12.01
A. Besitz
AnlagevermögenAnlagevermögen
1.
Einrichtung
20
Regale zu je 200 €
4 000 €
1
Ladentheke
500 €
1
Registrierkasse
600 €
2
Schreibtische zu je 150 €
300 €
2
Stühle zu je 80 €
160 €
5 560 €
2.
Fuhrpark
1 Lieferwagen
9 400 €
Summe Anlagevermögen
14 960 €
Umlaufvermögen
1.
Warenvorräte
20
Kisten Sprudel à 3 €
60 €
25
Kisten Limo à 4 €
100 €
30
Kisten Export-Bier à 8 €
240 €
10
Kisten Pils à 10 €
100 €
500 €
2.
Außenstände lt. besonderer Liste
200 €
3.
Guthaben bei Sparkasse B
8 160 €
4.
Kassenbestand
240 €
Summe Umlaufvermögen
9 100 €
9 100 €
Summe Besitz
24 060 €
B. Schulden
1.
Darlehen Brauerei Unterstadt
6 000 €
2.
Verbindlichkeiten an Lieferer
Brauerei Unterstadt
150 €
Mineralquelle Baden KG
80 €
230 €
3.
rückständige Ladenmiete
320 €
4.
Summe Schulden
6 550 €
C. Gegenüberstellung
Summe Besitz
24 060 €
Summe Schulden
6 550 €
Eigenkapital (Betriebsvermögen)
17 510 €
3.2.2 Ordnungsmäßigkeit des Inventars
Das Inventar gehört zu den wichtigsten Bestandteilen einer ordnungsmäßigen Buchführung. Es muss deshalb selbst ordnungsmäßig sein. Neben der Vollständigkeit ist darauf zu achten, dass alle Eintragungen lesbar sind, nichts radiert oder sonst wie unkenntlich gemacht ist, keine unbeschriebenen Zwischenräume verbleiben (Gefahr nachträglicher Eintragungen!) und Änderungen kenntlich gemacht sind. Selbstverständlich muss die Schrift dauerhaft sein; Bleistiftschrift ist nicht zulässig.
3.3 Bilanz
Ein ordnungsmäßiges Inventar kann je nach Art und Umfang des Betriebs einen beträchtlichen Umfang haben. Für einen raschen Überblick über die Vermögenslage des Unternehmens ist es daher in der Regel nicht geeignet. Dazu dient, unter Beschränkung auf das Wesentliche, die Bilanz.
Die Bilanz ist eine gedrängte Gegenüberstellung der Besitzposten einerseits und der Schulden und des Eigenkapitals (Betriebsvermögens) andererseits.
Sie wird jeweils zum Bilanzstichtag (Abschlussstichtag, Ende des Wirtschaftsjahrs) auf Grund des Inventars erstellt.
3.3.1 Form und Inhalt der Bilanz
Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Besitz und Schulden, meistens in T-Form. Dabei werden die Besitzposten auf der linken Seite (= Aktiv-Seite) ausgewiesen, während die Schuldposten auf der rechten Seite (= Passiv-Seite) stehen. Den Besitz nennt man deshalb oft auch AktivaAktiva, die Schulden PassivaPassiva.
Da Besitz und Schulden wertmäßig praktisch nie genau übereinstimmen, ergibt sich stets ein Unterschiedsbetrag, der als Eigenkapital (kurz: Kapital) bezeichnet wird. Dieser Unterschiedsbetrag stellt das BetriebsvermögenBetriebsvermögen i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG dar (s. 2.1 und 2.2).
Das Eigenkapital wird in der Regel auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Dadurch gleichen sich die Bilanzsummen in Aktiva und in Passiva aus. Man bezeichnet diesen Umstand als BilanzgleichungBilanzgleichung (Aktiva = Passiva).
Diese Bilanzgleichung ist für das Verständnis der doppelten Buchführung sehr wichtig. Sie muss jederzeit sichergestellt sein.
Am anschaulichsten ist es, wenn man die Bilanz mit einer Waage vergleicht. (Das entspricht auch ihrem Namen: il bilancia = die Waage.) Dann ergibt sich folgendes Bild:
Dieses Bild zeigt auch, dass bei einer ÜberschuldungÜberschuldung des Betriebs das Eigenkapital auf der Aktivseite stehen muss, denn nur dadurch lässt sich der Ausgleich beider Seiten erreichen.
Man kann den Inhalt der Bilanz auch so deuten, dass man dem Ausweis des Vermögens auf der Aktivseite die Finanzierung des Vermögens durch Eigenkapital und Fremdkapital auf der Passivseite gegenüberstellt.
Gelegentlich ist die Bilanz auch in der Form anzutreffen, dass Aktiva und Passiva nicht nebeneinander, sondern untereinander stehen. Am Grundsatz der Bilanzgleichung (Aktiva = Passiva) ändert sich dadurch jedoch nichts. Für Kapitalgesellschaften ist nach § 266 Abs. 1 Satz 1 HGB die Kontoform vorgeschrieben.
3.3.2 Gliederung der Bilanz
Der Klarheit der Bilanz dient eine übersichtliche Gliederung der Bilanzposten (§ 247 Abs. 1 HGB). Dabei ist es üblich, bei den Besitzposten zuerst das Anlagevermögen und dann das Umlaufvermögen (vgl. 3.2.1), jeweils geordnet nach der Verfügbarkeit, auszuweisen. Auf der Passivseite steht an der ersten Stelle das EigenkapitalEigenkapital, dann die langfristigen und schließlich die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Schulden).
Beispiel
Die Bilanz der Firma Kurt M. (s. 3.2.1) könnte so aussehen:
Aktiva
Schlussbilanz
der Firma Kurt M., Getränkehandlung, Bachstadt, auf den 31. Dezember 01
Passiva
A.
Anlagevermögen
A.
Eigenkapital
17 510 €
Einrichtung
5 560 €
B.
Schulden
Fuhrpark
9 400 €
Darlehen
6 000 €
B.
Umlaufvermögen
Verbindlichkeiten für Waren
230 €
Warenvorräte
500 €
sonstige Verbindlichkeiten
320 €
Forderungen
200 €
Bankguthaben
8 160 €
Kasse
240 €
24 060 €
24 060 €
Eine ausführliche Gliederungsvorschrift enthält § 266 HGB, allerdings nur für Kapitalgesellschaften, bestimmte Personengesellschaften (§ 264 a HGB) und Genossenschaften verbindlich, für andere Unternehmen aber eine gute Orientierungshilfe.
Fall 4
Durch die Inventur auf den 31.12.01 wurden folgende Bestände ermittelt: Bankguthaben 21 700 €, Einrichtung 8 600 €, Grundstücke 60 000 €, Hypothekenschuld 40 000 €, Kassenbestand 5 400 €, LKW 14 200 €, Verbindlichkeiten an Lieferer 16 300 €, sonstige Verbindlichkeiten 7 800 €, Warenforderungen 17 900 €, Warenvorräte 32 500 €, Eigenkapital?
Ermitteln Sie das Eigenkapital (Betriebsvermögen) und stellen Sie die Bilanz auf.
3.3.3 Bilanzenzusammenhang
Beim Betriebsvermögensvergleich nach § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG ist das auf Grund der Bilanz ermittelte Betriebsvermögen (Eigenkapital) gleich zweimal von Bedeutung, zuerst als Endvermögen für die Gewinnermittlung des abgelaufenen Wirtschaftsjahrs und sodann als Vorjahresvermögen für die Gewinnermittlung des folgenden Jahres. Es ist deshalb nicht üblich, für jedes Jahr eine besondere Eröffnungsbilanz aufzustellen. § 242 Abs. 1 HGB sieht eine Eröffnungsbilanz nur für den Beginn des Geschäftsbetriebs vor. Die Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres stellt praktisch die Eröffnungsbilanz für das folgende Jahr dar (Bilanzenzusammenhang), vgl. § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB.
4 Änderung von Bilanzposten durch Geschäftsvorfälle
Nahezu jeder betriebliche Vorgang wirkt sich auf die Bilanzposten aus. Es ist möglich, dass sich die Veränderungen gegenseitig ausgleichen, sodass das Eigenkapital unberührt bleibt. Dann handelt es sich um Betriebsvermögensumschichtungen. Oft wird jedoch durch einen Geschäftsvorfall das Eigenkapital erhöht oder vermindert. Dann spricht man von Betriebsvermögensveränderungen. Diese können nicht nur betriebliche, sondern auch außerbetriebliche, d. h. private Anlässe haben. Von der Auswirkung auf das Eigenkapital hängt es weitgehend ab, ob ein Geschäftsvorfall eine Auswirkung auf den Gewinn hat. Deshalb ist es wichtig, die einzelnen Arten dieser Vorfälle näher zu betrachten.
4.1 Betriebsvermögensumschichtungen
Bei Betriebsvermögensumschichtungen ändert sich das Eigenkapital nur in seiner Zusammensetzung, nicht jedoch in seiner Höhe. Damit ergibt sich bei ihnen auch keine Auswirkung auf den Gewinn. Sie sind also erfolgsneutral. Dabei unterscheidet man drei Arten von Betriebsvermögensumschichtungen: den Aktiv-Tausch, den Passiv-Tausch und den Aktiv-Passiv-Tausch.
4.1.1 Der Aktiv-Tausch
Ein Aktiv-Tausch liegt vor, wenn der Abnahme eines Besitzpostens die Zunahme eines anderen Besitzpostens gegenübersteht. Die Bilanzsumme ändert sich nicht.
Beispiele
Anschaffung einer Maschine gegen Bankscheck.
Aus der Kasse wird Geld auf das betriebliche Bankkonto eingezahlt.
Ein Kunde zahlt eine bisher als Forderung ausgewiesene Rechnung durch Überweisung.
4.1.2 Der Passiv-Tausch
Beim Passiv-Tausch wird die Minderung einer Schuld durch die Erhöhung eines anderen Schuldpostens ausgeglichen. Die Bilanzsumme ändert sich ebenfalls nicht.
Beispiele
Eine Warenschuld wird in eine Darlehensschuld umgewandelt.
Eine betriebliche Steuerschuld wird durch Aufnahme eines Bankkredits getilgt.
4.1.3 Der Aktiv-Passiv-Tausch
Von einem Aktiv-Passiv-Tausch spricht man, wenn sich Besitz und Schulden (Aktiva und Passiva) in gleichem Umfang erhöhen oder vermindern.
Beispiele
Es werden Waren auf Rechnung (Kredit) gekauft.
Eine Lieferantenschuld wird durch Banküberweisung gezahlt.
Durch einen Aktiv-Passiv-Tausch ändert sich zwar nicht das Eigenkapital (Betriebsvermögen), die Bilanzsumme wird aber höher oder niedriger. Die Bilanzgleichung bleibt jedoch stets gewahrt.
4.2 Betriebsvermögensveränderungen
Zahlreiche Geschäftsvorfälle führen jedoch zu einer Erhöhung oder Verminderung des Eigenkapitals (Betriebsvermögens). Der Anlass dazu kann betrieblich oder auch außerbetrieblich, d. h. privat sein. Es ist einleuchtend, dass betrieblich veranlasste Vermögensveränderungen i. R. d. BVV Einfluss auf den Gewinn haben. Privat veranlasste Vermögensveränderungen dürfen dagegen den betrieblichen Gewinn nicht beeinflussen. Aus diesem Grunde erfolgt die Korrektur beim BVV, nämlich die Zurechnung der Entnahmen und die Kürzung um die Einlagen.
Demnach sind die Betriebsvermögensveränderungen in zwei Gruppen einzuteilen, in die BV-Veränderungen aus betrieblichem Anlass und die BV-Veränderungen aus privatem Anlass.
4.2.1 Betriebsvermögensveränderungen aus betrieblichem Anlass
4.2.1.1 Betriebsvermögenserhöhungen durch Ertrag
Erhält ein Unternehmer einen Vermögenszufluss, ohne dass er dafür gleichzeitig entsprechende Ausgaben hat, so erhöht sich sein Eigenkapital und damit auch der Gewinn. Man spricht hier von ErtragErträgen.
Beispiele
Dem Unternehmer werden auf seinem betrieblichen Bankkonto Bankzinsen gutgeschrieben.
Für aus betrieblichem Anlass vermietete Räume wird Miete bar bezahlt.
Einem Handelsvertreter wird Provision überwiesen.
4.2.1.2 Betriebsvermögensminderungen durch Aufwand
Hat ein Unternehmer betrieblich veranlasste Ausgaben, für die er unmittelbar keinen Gegenwert (= mehr Aktiva oder weniger Passiva) erhält, so vermindert sich sein Eigenkapital und damit auch der Gewinn. Es liegt ein AufwandAufwand vor.
Beispiele
Die Stromrechnung für den Betrieb wird bar bezahlt.
Die Kraftfahrzeugsteuer für das Betriebsfahrzeug wird an die Bundeskasse überwiesen.
Die Arbeitnehmer des Betriebs erhalten ihre Löhne und Gehälter ausbezahlt.
4.2.2 Betriebsvermögensveränderungen aus privatem Anlass
4.2.2.1 Betriebsvermögenserhöhungen durch Einlagen
Private EinlageEinlagen in Geld oder Geldeswert erhöhen das Betriebsvermögen. Beim Betriebsvermögensvergleich ist deshalb die Vermögenszunahme entsprechend höher. Dies wird aber ausgeglichen durch die Kürzung um die Einlagen (vgl. 2.1). Einlagen sind deshalb erfolgsneutral; sie wirken sich nicht auf den Gewinn aus.
Beispiel
Auf das betriebliche Bankkonto wird Geld aus einer Erbschaft oder einem Lottogewinn überwiesen.
4.2.2.2 Betriebsvermögensminderungen durch Entnahmen
Private Entnahmen in Geld oder Geldeswert vermindern das BV. Dies wirkt sich beim Betriebsvermögensvergleich negativ aus, wird aber ebenfalls ausgeglichen, und zwar durch die Zurechnung der Entnahmen (vgl. 2.1).
Entnahmen sind deshalb i. d. R. ebenfalls erfolgsneutral; sie wirken sich meist nicht auf den Gewinn aus.
Beispiele
Aus der Kasse wird Geld für private Zwecke entnommen.
Der Unternehmer entnimmt Ware zum Eigenverbrauch.
Eine andere Auswirkung ergibt sich, wenn ein Gegenstand in der Buchführung (Bilanz) mit einem niedrigeren Wert geführt wird, als es dem wirklichen Wert entspricht, wenn also sogenannte stille Reserven vorliegen. Diese stillen Reserven sind übrigens regelmäßig legal entstanden; bestimmte gesetzliche Bewertungsvorschriften führen oft zwangsläufig zu solchen niedrigeren Werten.
Dabei wird der in den Büchern ausgewiesene Wert als BuchwertBuchwert bezeichnet. Unter »wirklicher Wert« ist nach dem Steuerrecht der sogenannte Teilwert zu verstehen. Zum Begriff Teilwert vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG und bei D 3. 1. 3.
In diesen Fällen weicht die Vermögensverminderung durch Abgang des Gegenstandes zum Buchwert von der Zurechnung der Entnahmen mit dem Teilwert ab (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG). Es kann sich dadurch eine Gewinnerhöhung (Ertrag) oder eine Gewinnminderung (Aufwand) ergeben. Solche Entnahmen sind teilweise erfolgswirksam.
Beispiel
Ein bisher zum BV zählendes Fahrzeug mit einem Buchwert von 2 000 € soll künftig nur noch privat genutzt werden. Es wird entnommen. Der Teilwert beträgt bei der Entnahme
5 000 €,
1 500 €.
Lösung:
Es entsteht ein Ertrag von 3 000 €.
Es entsteht ein Aufwand von 500 €.
4.3 Sonderfälle
Nicht alle Geschäftsvorfälle sind Betriebsvermögensumschichtungen oder -veränderungen. In Ausnahmefällen, also nur selten, berührt ein Geschäftsvorfall keinen Besitz- oder Schuldposten, z. B. wenn betrieblicher Aufwand mit privaten Geldmitteln bestritten wird. Eine Gewinnauswirkung ergibt sich dabei nur, wenn Privatentnahmen oder Privateinlagen vorliegen.
Beispiele
Das Benzin für eine Geschäftsfahrt wird mit Privatgeld bezahlt.
Lösung: Es liegt einerseits eine Einlage, andererseits betrieblicher Aufwand vor. Der Gewinn mindert sich entsprechend.
Die Gemeinde verrechnet überzahlte Gewerbesteuer mit Grundsteuer für das private Grundstück.
Lösung: Die Erstattung der Gewerbesteuer ist ein Ertrag (bzw. eine Aufwandsminderung), die Tilgung der privaten Grundsteuerschuld (weil aus betrieblichen Mitteln bestritten) eine Entnahme. Hier erhöht sich der Gewinn.
Hinweis
Gewerbesteuerzahlungen für Kalenderjahre ab 2008 sind aber gem. § 4 Abs. 5 b EStG steuerlich nicht mehr als Betriebsausgaben abzugsfähig; entsprechend sind Gewerbesteuererstattungen nicht mehr als Betriebseinnahmen zu versteuern. Dennoch liegen diesbezüglich handelsrechtlich weiterhin betriebliche Ausgaben bzw. Einnahmen vor, die auch als solche erfolgswirksam zu verbuchen sind. Zur Ermittlung des steuerlichen Gewinns als Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer sind allerdings Gewerbesteuerzahlungen dem handelsrechtlichen Gewinn außerhalb der Änderung von BilanzpostenBilanz hinzuzurechnen. Gewerbesteuererstattungen sind entsprechend abzuziehen.
4.4 Zusammenfassung
Die folgenden Geschäftsvorfälle haben die folgende Gewinnauswirkung:
Art des
Geschäftsvorfalls
Gewinnauswirkung
1
Betriebsvermögensumschichtungen
erfolgsneutral
1.1
Aktiv-Tausch
1.2
Passiv-Tausch
1.3
Aktiv-Passiv-Tausch
2.
Betriebsvermögensveränderungen
2.1
aus betrieblichem Anlass
2.1.1
BV-Erhöhung durch Ertrag
gewinnerhöhend
2.1.2
BV-Minderung durch Aufwand
gewinnmindernd
2.2
aus privatem Anlass
2.2.1
BV-Erhöhung durch Einlagen
erfolgsneutral
2.2.2
BV-Minderung durch Entnahmen
2.2.2.1
Buchwert gleich Teilwert
erfolgsneutral
2.2.2.2
Buchwert unter Teilwert
gewinnerhöhend
2.2.2.3
Buchwert über Teilwert
gewinnmindernd
3.
Sonderfälle
3.1
betrieblicher Aufwand mit privaten Mitteln gezahlt
gewinnmindernd
3.2
betrieblicher Ertrag für private Zwecke verwendet
gewinnerhöhend
Fall 5
Bitte vermerken Sie in Spalte
ob es sich um eine BV-Umschichtung (U), eine BV-Erhöhung (E) oder eine BV-Minderung (M) handelt;
ob ein betrieblicher (B) oder ein privater (P) Anlass vorliegt;
welche Auswirkung auf den Gewinn gegeben ist: erfolgsneutral (=), gewinnerhöhend (+) oder gewinnmindernd (./.).
Nr.
Geschäftsvorfall
a)
b)
c)
1
Der Unternehmer (U) kauft einen Lagerplatz für 10 000 € gegen Barzahlung.
2
U zahlt aus der Kasse 4 000 € auf das betriebliche Bankkonto ein.
3
U bezahlt eine Warenschuld durch Banküberweisung über 2 500 €.
4
Bankgutschrift über 20 000 € infolge Gewährung eines betrieblichen Darlehens durch die Bank.
5
Banklastschrift für hierfür angefallene Darlehenszinsen: 500 €.
6
Zahlung von Einkommensteuer durch Überweisung an das Finanzamt: 1 200 € (vgl. § 12 Nr. 3 EStG).
7
Mieter von betrieblich vermieteten Ladenräumen überweist an U 400 € Miete.
8
100 € Zinsgutschrift für Bankguthaben auf dem Geschäftskonto des U.
9
U entnimmt der Geschäftskasse 500 € für Urlaubsreise.
10
U zahlt aus Erbschaft 2 000 € bar auf betriebliches Bankkonto ein.
11
U entnimmt das Betriebs-Kfz, Buchwert 2 000 €, Teilwert 5 000 €.
12
U bezahlt Porto für Geschäftsbriefe mit 24 € aus privaten Mitteln.
Hinweis
Gehen Sie hier – und in allen späteren Aufgaben – davon aus, dass Zahlungsvorgänge grundsätzlich über die Geschäftskasse bzw. das betriebliche Bankkonto laufen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt ist.
Teil B Die Funktion der doppelten Buchführung
1 Das Konto
Wie der vorstehende Fall 5 zeigt, werden Besitzposten und Schulden sowie das Eigenkapital ständig durch Geschäftsvorfälle verändert. Aufgabe der Buchführung ist es nun, diese Veränderungen zu erfassen und übersichtlich darzustellen. Mittel dazu sind die Konten der Buchführung.
Typisch für ein Konto ist, dass es wie die Bilanz zwei Seiten hat. Der Aktivseite der Bilanz entspricht die Soll-Seite des Kontos, der Passivseite der Bilanz die Haben-Seite des Kontos.
Die äußere Form des Kontos kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Das Konto in T-Form zeigt folgendes Bild:
Soll
… -Konto
Haben
Datum
Text
Betrag
Datum
Text
Betrag
Das in der Praxis meist vorkommende Konto in Reihen-Form zeigt dagegen dieses Bild:
… -Konto
Soll
Haben
Datum
Text
Betrag
Betrag
Diese Form haben in der Regel auch die durch elektronische Datenverarbeitung (EDV) erstellten Konten.
Unabhängig von der äußerlichen Form besteht die entscheidende Übereinstimmung darin, dass es bei beiden Kontenformen eine Soll-Seite und eine Haben-Seite gibt. Wegen der Bezeichnung Soll und Haben bzw. Lastschrift und Gutschrift vgl. 1. 3.
1.1 »Zerlegung« der Bilanz in Konten
Die Bilanz ist zwar ein äußerst wichtiger Bestandteil der ordnungsmäßigen Buchführung, für das Aufzeichnen der laufenden Veränderungen bei den Besitzposten und Schuldposten ist sie jedoch völlig ungeeignet. Sie wird deshalb in Konten aufgelöst, gewissermaßen »zerlegt«. Für jeden Posten der Bilanz wird ein eigenes Konto eingerichtet. Dabei werden die Bestände aus der EröffnungsbilanzEröffnungsbilanz bzw. ‒ was dasselbe ist – aus der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres auf die Konten übernommen.
Wichtig ist, dass bei Eröffnung der Konten die Seiten der Bestände beibehalten werden; Aktivposten kommen auf die Soll-Seite, Passivposten auf die Haben-Seite der Konten.
Aktiva
Eröffnungsbilanz
Passiva
Einrichtung
12 000 €
Eigenkapital
20 500 €
Waren
18 000 €
Warenschulden
16 000 €
Bankguthaben
5 000 €
Kasse
1 500 €
36 500 €
36 500 €
Konten
S
Einrichtung
H
S
Waren
H
Bestand
12 000
Bestand
18 000
S
Bank
H
S
Kasse
H
Bestand
5 000
Bestand
1 500
S
Eigenkapital
H
S
Warenschulden
H
Bestand
20 500
Bestand
16 000
Fall 6
Richten Sie die Konten für die Firma Kurt M. auf Grund der unter A 3.3.2 dargestellten Schlussbilanz (= Eröffnungsbilanz auf 01.01.02) ein.
1.2 Kontenarten
Zu den Aufgaben einer ordnungsmäßigen Buchführung gehört es, die Geschäftsvorfälle sachlich richtig aufzuzeichnen, damit sie einen sicheren Überblick über diese geben kann (s. § 238 Abs. 1 Sätze 2 und 3 HGB und § 145 Abs. 1 AO). Diesem Zweck dienen die Sachkonten. Sie gehören zum Zahlenwerk der doppelten Buchführung.
Daneben gibt es auch noch die PersonenkontoPersonenkonten, auf denen – zusätzlich zur Buchung auf den Sachkonten – die Kunden oder Lieferer betreffenden Vorgänge aufgezeichnet werden, also alle Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen und die entsprechenden Zahlungen.
1.2.1 Sachkonten
Zu den Sachkonten gehören insbesondere die Bestandskonten; das sind die Konten, welche die Aktiv- und Passivposten der Bilanz aufnehmen. Vgl. Beispiel in 1. 1. Es sind zu unterscheiden
aktive Bestandskonten (AktivkontenAktivkonten):
In ihnen werden die Besitzposten ausgewiesen, z. B. Einrichtung, Waren, Kasse.
passive Bestandskonten (PassivkontoPassivkonten):
Sie dienen der Verbuchung der Schuldposten und des Eigenkapitals.
Fall 7
Auf welcher Seite der aktiven und passiven Bestandskonten stehen die Anfangsbestände?
Als weitere Sachkonten werden später noch die Erfolgskonten behandelt, vgl. 3. 1.
1.2.2 Personenkonten
Neben den Sachkonten sind Personenkonten (auch KontokorrentkontoKontokorrentkonten genannt) einzurichten, und zwar für alle Geschäftsfreunde, mit denen Geschäfte auf Ziel abgeschlossen werden. Ziel oder – besser – Zahlungsziel nennt man die Frist, die dem Leistungsempfänger zur Zahlung des Rechnungsbetrags eingeräumt ist. (Der Ausdruck »auf Ziel« als Gegensatz zum Bargeschäft wird in späteren Beispielen und Aufgaben noch oft verwendet werden.)
Es gibt Personenkonten für Kunden und für Lieferer. Die Buchungsregeln unterscheiden sich nicht von denen für die Bestandskonten. Die Summe der Bestände auf den Kundenkonten muss dem Bestand auf dem Sachkonto »Forderungen aus Lieferungen und Leistungen«, auch »(Waren-)Forderungen«, »Außenstände« oder »Debitoren« genannt, entsprechen. Bei den Liefererkonten heißt das entsprechende Sachkonto »Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen«, »(Waren-)Verbindlichkeiten«, »Warenschulden« oder »Kreditoren«. Auch die Summe der Bestände auf den Liefererkonten muss mit dem Bestand auf dem entsprechenden Sachkonto übereinstimmen.
1.3 Die Seiten des Kontos (Soll und Haben)
Die Bezeichnung der Kontenseiten mit Soll und Haben bereitet dem Anfänger oft Schwierigkeiten. Er sucht einen tieferen Sinn, der ihm für die Lösung der Aufgaben helfen könnte. Er wird ihn vergeblich suchen. Man könnte genauso gut die Seiten mit links und rechts oder vorne und hinten bezeichnen, oder mit Aktivseite und Passivseite.
Natürlich ist die Benennung nicht grundlos erfolgt. Eine Erklärung findet man am einfachsten bei den Personenkonten. Der Kunde soll zahlen, also Buchung im Soll; der Unternehmer hat zu zahlen, also Buchung im Haben. Bisweilen werden in der Doppelte BuchführungBuchführung auch die Bezeichnungen Lastschrift (statt Soll) und Gutschrift (statt Haben) verwendet. Daraus abgeleitet ergibt sich für Buchungen im Soll die Bezeichnung »belasten« und für Buchungen im Haben die Bezeichnung »gutschreiben«.
Die Bezeichnungen »LastschriftLastschrift« und »GutschriftGutschrift« werden insbesondere auf den Kontoauszügen der Banken verwendet. Eine Lastschrift auf dem Kontoauszug (= Sollbuchung) bedeutet aus der Sicht der Bank eine Verminderung des Kundenguthabens (= Verbindlichkeit der Bank) oder eine Erhöhung der Bankschuld des Kunden (= Forderung der Bank). Beim Unternehmer als Bankkunde erfolgt jedoch auf dem Bankkonto seiner Buchführung insoweit eine Habenbuchung.
1.4 Buchungsregeln
Beim Buchen sind folgende Regeln zu beachten:
Der Anfangsbestand steht auf derselben Seite wie der Bilanzposten in der Bilanz.
Die Zugänge stehen auf derselben Seite wie die Anfangsbestände (als Bestandszunahmen).
Die Abgänge stehen auf der den Anfangsbeständen und Zugängen entgegengesetzten Seite (als Bestandsabnahmen).
Der Endbestand steht als Saldo grundsätzlich ebenfalls auf der dem Anfangsbestand entgegengesetzten Seite.
Eine Ausnahme gilt nur, wenn durch diverse Zu- und Abgänge aus einem Besitzposten ein Schuldposten geworden ist oder umgekehrt (z. B. aus einem Bankguthaben wird durch Überziehung eine Bankschuld). Am Ende zeigt sich also auch beim Konto die Bilanzgleichung, allerdings in der Form »Soll = Haben«.
Jeder Sollbuchung entspricht eine Habenbuchung!
Schaubild zu den Buchungsregeln
S
Aktivkonto
H
S
Passivkonto
H
Anfangsbestand
Abgang
Abgang
Anfangsbestand
Zugang
Endbestand
Endbestand
Zugang
Merksatz
Buchungen auf Aktivkonten und Buchungen auf Passivkonten verhalten sich spiegelbildlich!
Beispiele
a)
1.
Kauf von Waren auf Ziel, 850 €
Zunahme des Warenbestands = Warenkonto Soll
Zunahme der Verbindlichkeiten = Verbindlichkeitskonto Haben
2.
Banküberweisung an Lieferer, 850 €
Abnahme der Verbindlichkeiten = Verbindlichkeitenkonto im Soll
Abnahme des Bankguthabens = Bankkonto Haben
b)
1.
Verkauf von Waren auf Ziel, 1 500 €
Zunahme der Forderungen = Forderungskonto Soll
Abnahme des Warenbestands = Warenkonto Haben
2.
Banküberweisung durch Kunden, 1 500 €
Zunahme des Bankguthabens = Bankkonto Soll
Abnahme der Forderungen = Forderungskonto Haben
S
Waren
H
S
Verbindlichkeiten
H
a) 1.
850
b) 1.
1 500
a) 2.
850
a) 1.
850
S
Forderungen
H
S
Bank
H
b) 1.
1 500
b) 2.
1 500
b) 2.
1 500
a) 2.
850
Zur richtigen Buchung gehört die Angabe des Datums (in Klausuren der laufenden Nr. der Aufgabe), des Gegenkontos und des Betrags.
Fälle 8 – 10
Fall 8
Geben Sie Konto und Kontoseite für die Geschäftsvorfälle Nr. 1 bis 10 des Falls 5 an.
Fall 9
Die Firma Karz hat bei Betriebsbeginn folgende Bestände: Einrichtung 4 000 €, Waren 9 000 €, Forderungen 6 300 €, Bankguthaben 7 100 €, Kasse 2 200 €, Darlehensschuld 10 000 €, Verbindlichkeiten 5 500 €, (Eigen-)Kapital?
Erstellen Sie eine Eröffnungsbilanz.
Richten Sie die Bestandskonten ein.
Buchen Sie auf diesen Konten folgende Geschäftsvorfälle unter Angabe der Fall-Nr. und des Gegenkontos.
1. Überweisung an Lieferer
3 000 €
1. Bankgutschrift für Zahlung eines Kunden
3 800 €
1. Barzahlung einer Rechnung durch einen Kunden
1 000 €
1. Bareinzahlung auf Bankkonto (vgl. hierzu Hinweis zu Fall 5)
1 500 €
1. Banküberweisung zur Darlehenstilgung
2 000 €
1. Kauf von Waren auf Ziel
2 800 €
1. Verkauf von Waren auf Ziel
3 600 €
1. Verkauf von Waren, bar
1 700 €
1. Kauf eines Aktenschrankes, bar
1 100 €
1. Überweisung einer Rechnung durch einen Kunden
2 300 €
Stellen Sie die neuen Bestände fest (Saldo!)
Hinweis: Bei Barzahlung oder Überweisung durch Kunden bzw. an Lieferer ist stets davon auszugehen, dass die der Zahlung zugrunde liegende Lieferung (oder sonstige Leistung) bereits gebucht ist, soweit der Sachverhalt nicht ausdrücklich etwas anderes aussagt (z. B. im Sachverhalt Nr. 8). Dies gilt auch für alle folgenden Beispiele und Aufgaben.
Fall 10
Erstellen Sie nach den Salden des Falls 9 eine Eröffnungsbilanz und richten Sie die Konten ein.
Buchen Sie auf den Konten folgende Geschäftsvorfälle und geben Sie dabei die Fall-Nr. und das Gegenkonto an.
1. Banküberweisung durch Kunden
1 200 €
1. Bareinzahlung auf das Bankkonto
2 000 €
1. Überweisung an Lieferer
3 700 €
1. Barverkauf von Waren
2 600 €
1. Kauf von Waren auf Ziel
4 500 €
1. Verkauf von Waren auf Ziel
3 900 €
1. Bareinzahlung auf das Bankkonto
1 800 €
1. Überweisung für Darlehenstilgung
3 000 €
Ermitteln Sie den Saldo der Konten.
2 Der Buchungssatz
Wie die bisherigen Beispiele gezeigt haben, betrifft jeder Geschäftsvorfall mehrere Sachkonten. Die Angaben über Art und Weise der Buchungen sind entsprechend umfangreich. Der Vorgang 1 aus Fall 9 ist z. B. zu buchen: Im Konto Verbindlichkeiten auf der Soll-Seite 3 000 € und im Konto Bank auf der Haben-Seite 3 000 €.
Für den Alltag des Kaufmanns, z. B. als Buchungsanweisung auf dem Beleg, sind diese Angaben zu umständlich. Sie schrumpfen im Buchungssatz auf das unbedingt Notwendige zusammen. Notwendig ist der Name des Kontos, die Kontenseite und der Betrag. Die namentliche Angabe der Kontenseite erübrigt sich, wenn man als feste Regel voraussetzt, dass das Sollkonto zuerst, das Habenkonto zuletzt genannt wird. Es ist üblich, Sollkonto und Habenkonto durch das Wort »an« zu trennen. Der Buchungssatz wird dadurch übersichtlicher. Der Buchungssatz für das obige Beispiel lautet nun: Verbindlichkeiten an Bank 3 000 €.
Wie Sie sehen, eine kurze und klare Anweisung und Aussage. Wie geht man nun bei der Bildung eines Buchungssatzes zweckmäßigerweise vor?
Stellen Sie zuerst fest, welche Konten von dem Geschäftsvorfall betroffen sind. Prüfen Sie dann anhand der Buchungsregeln, auf welchem Konto im Soll zu buchen ist. (Sie wissen ja, im Soll stehen Besitzzunahme und Schuldabnahme.) Schließlich ist zu prüfen, auf welchem Konto im Haben zu buchen ist. (Im Haben: Besitzabnahme und Schuldzunahme.)
Nun heißt es nur noch: Sollkonto an Habenkonto. Dazu der Betrag, und fertig ist der Buchungssatz!
Haben Sie vielleicht nur Sollkonten oder nur Habenkonten? Das wäre der Beweis, dass Sie die Buchungsregeln nicht richtig angewandt haben. Prüfen Sie nochmals! Übrigens, Sie sehen hier schon zum ersten Mal eine Kontrollfunktion der Buchführung, doppeltedoppelten Buchführung, die auf diese Weise schonungslos Fehler aufdeckt.
Wichtig: Geben Sie dem Wörtchen »an« keinen anderen Sinn, als lediglich Trennung zwischen Sollkonto und Habenkonto zu sein. Sie könnten sonst aus dem Buchungssatz »Bank an Kasse« gerade den falschen Vorgang herauslesen (vgl. Fall 5 Nr. 2).
2.1 Der einfache Buchungssatz
Was Sie bisher kennengelernt haben, wird als einfacher Buchungssatz bezeichnet. In ihm gibt es immer nur zwei Konten: ein Sollkonto und ein Habenkonto.
Beispiel
Ein Kunde überweist zum Ausgleich einer Warenforderung 1 600 €.
Lösung: Buchungssatz:
Bank
1 600 €
an
Forderungen
1 600 €.
Dieser Buchungssatz ist übrigens einzeilig.
Man kann ihn auch zweizeilig darstellen, nämlich:
Bank 1600 €
an Forderungen 1600 €
Diese Form ist zweckmäßig und üblich, wenn der Buchungssatz in einem Journal (Tagebuch, in dem alle Geschäftsvorfälle zeitlich geordnet einzutragen sind) mit Soll- und Haben-Spalte aufgezeichnet wird. Dieses Journal gehört zu einer ordnungsmäßigen Buchführung. Vgl. auch 10.
Fall 11
Bilden Sie die Buchungssätze zu den Geschäftsvorfällen der Fälle 9 und 10.
2.2 Der zusammengesetzte Buchungssatz
Nicht selten sind an einem Geschäftsvorfall mehr als zwei Konten beteiligt. Zum Beispiel wird bei einem Wareneinkauf in Höhe von 4 500 € nur ein Teilbetrag von 1 000 € bar bezahlt, für den Rest ist ein Zahlungsziel eingeräumt.
Hier sind drei Konten betroffen: Waren, Kasse und Verbindlichkeiten. Zugang bei Waren (Aktivkonto) und Verbindlichkeiten (Passivkonto), Abgang bei Kasse (Aktivkonto).
Daraus ergibt sich folgender – zusammengesetzter ‒ Buchungssatz, DeutungBuchungssatz:
Waren
4 500 €
an
Kasse
1 000 €
Verbindlichkeiten
3 500 €
Wichtig: Auch beim zusammengesetzten Buchungssatz muss im Soll und im Haben der gleiche Betrag stehen. (Sollsumme = Habensumme!)
Fall 12
Bilden Sie die Buchungssätze für folgende Geschäftsvorfälle:
Ein Kunde überweist zum Ausgleich einer Forderung in Höhe von 4 000 € auf das Bankkonto 3 000 € und auf das Postbankkonto 1 000 €.
Anschaffung eines PKW (Konto: Fuhrpark) für 45 000 € gegen Barzahlung von 10 000 €, Scheck über 30 000 €, Rest zahlbar in einem Monat.
Verkauf von Waren gegen Anzahlung von 2 000 € bar, Rest mit 3 000 € auf Ziel.
Einkauf von Waren gegen Barzahlung von 1 500 € und mit einem Monat Ziel 4 500 €.
Zusammengesetzte Buchungssätze treten vor allem im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer auf. Hierauf wird unter C 1 später noch näher eingegangen.
2.3 Deuten von Buchungssätzen
Buchungssätze können nicht nur als Buchungsanweisung verwendet werden. Sie lassen auch Schlüsse auf den ihnen zugrunde liegenden Geschäftsvorfall zu. Sie sind gewissermaßen eine »Kurzfassung« des betrieblichen Vorgangs. Sie lassen sich bei Kenntnis der Buchungsregeln ohne Weiteres deuten.
Dabei geht man zweckmäßigerweise folgenden Weg:
Welches Konto steht vorne, ist also im Soll bebucht?
Ist das Konto ein Aktiv- oder ein Passiv-Konto?
Folge: Zugang oder Abgang?
Welches Konto steht hinten, ist also im Haben bebucht?
Ist das Konto ein Aktiv- oder ein Passiv-Konto?
Folge: Zugang oder Abgang?
Beispiel
Buchungssatz:
Waren
800 €
an
Verbindlichkeiten
800 €
Lösung: Das im Soll bebuchte Konto »Waren« ist ein Aktiv-Konto, also Zugang 800 €. Das im Haben bebuchte Konto »Verbindlichkeiten« ist ein Passiv-Konto, also ebenfalls Zugang 800 €.
Demnach handelte es sich um Kauf von Waren auf Ziel.
Fall 13
Deuten Sie folgende Buchungssätze:
1.
Bank
an
Kasse
2 000 €
2.
Forderungen1
an
Waren
1 200 €
3.
Verbindlichkeiten2
an
Bank
2 300 €
4.
Postbank
an
Forderungen
900 €
5.
Kasse
an
Bank
1 700 €
6.
Waren
an
Verbindlichkeiten
4 300 €
7.
Einrichtung
an
Kasse
1 400 €
8.
Darlehensschuld
an
Bank
5 000 €
9.
Darlehensforderung
an
Kasse
1 000 €
10.
Waren
3 300 €
an
Kasse
300 €
Verbindlichkeiten
3 000 €
11.
Kasse
500 €
Forderungen
5 000 €
an
Waren
5 500 €
12.
Verbindlichkeiten
an
Forderungen
800 €
13.
Bank
an
Darlehensschuld
15 000 €
14.
Postbank
an
Bank
2 000 €
15.
Verbindlichkeiten
an
Waren
3 800 €
16.
Kasse
an
(Eigen-)Kapital
4 000 €
17.
Einrichtung w
an
Bank
1 300 €
18.
Einrichtung
an
(sonstige) Verbindlichkeiten
1 850 €
1 Auch andere Bezeichnungen, z. B. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Außenstände, Debitoren, Warenforderungen.
2 Andere Bezeichnungen, z. B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Warenschulden, Kreditoren.
3 Das Kapitalkonto und seine Unterkonten
Wie Sie sicher festgestellt haben, waren die bisher besprochenen Geschäftsvorfälle fast ausschließlich Betriebsvermögensumschichtungen, d. h., sie wirkten sich auf das Betriebsvermögen (Eigenkapital, Kapital) nicht aus. Zudem sind Vermögensumschichtungen stets erfolgsneutral.
Nun gibt es aber im Alltag des Unternehmers zahlreiche Geschäfte, die nicht erfolgsneutral sind, sondern Erträge oder Aufwendungen bringen. Durch sie wird das Kapital ständig verändert. Wie sind solche Vorfälle zu buchen?
Zuerst ist festzustellen, dass das Kapitalkonto immer ein Passivkonto ist. Das gilt für die Anwendung der Buchungsregeln selbst dann, wenn ausnahmsweise wegen Überschuldung das Kapital auf der Aktivseite der Bilanz erscheint!
Erträge erhöhen das Kapital, sie sind Kapitalzugang. Im Passivkonto steht der Zugang auf der Habenseite. Erträge stehen also auf der Habenseite.
Aufwendungen mindern das Kapital, sie sind Kapitalabgänge. Abgänge stehen im Passivkonto wie bekannt auf der Sollseite. Aufwendungen stehen daher immer auf der Sollseite.
Die Bezahlung der Stromrechnung könnte man also buchen: Kapital an Bank. Und für die Zinsgutschrift auf dem Bankkonto bietet sich der Buchungssatz Bank an Kapital an.
Aber: Wie würde bei solchen Buchungen das Kapitalkonto am Ende des Wirtschaftsjahrs aussehen? Wäre es als übersichtlich geführt zu bezeichnen? Wohl kaum!
Die unmittelbare Buchung von Aufwendungen und Erträgen auf dem Kapitalkonto würde in der Praxis vor allem gegen den Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit verstoßen (vgl. § 243 Abs. 2 HGB). Wichtige Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Erträgen und Aufwendungen gingen verloren. Dies ist der Grund, warum auf dem KapitalkontoKapitalkonto selbst, außer bei Eröffnung und beim Abschluss, nicht gebucht wird, sondern besondere UnterkontoUnterkonten eingerichtet werden. Das Kapitalkonto wird dadurch zum »ruhenden« Konto.
3.1 Erfolgskonten
Die wichtigsten Unterkonten des Kapitalkontos sind die Erfolgskonten. Auf ihnen werden alle betrieblichen Vermögensveränderungen gebucht, also die Aufwendungen und die Erträge. Man unterscheidet dabei zwischen AufwandskontenAufwandskonten und ErtragskontoErtragskonten. Wie viel und welche Erfolgskonten eingerichtet werden, richtet sich nach den Bedürfnissen des Betriebs, wobei Betriebsumfang, -struktur und -größe eine wichtige Rolle spielen.
Die Buchungen auf den Erfolgskonten stehen auf der gleichen Seite, auf der sie sonst im Kapitalkonto stehen würden. Auch für die Erfolgskonten gilt also:
Erträge stehen immer auf der Habenseite.
Aufwendungen stehen immer auf der Sollseite.
Der realistische Buchungssatz für die Zahlung der Stromrechnung lautet demnach:
Raumkosten an Bank.
Und die Zinsgutschrift würde man buchen:
Bank an Zinserträge.
Durch die Einrichtung der Erfolgskonten bleibt die Buchführung, doppelteBuchführung übersichtlich. Die Aufwendungen und die Erträge werden nach sachlichen Gesichtspunkten getrennt gebucht. Dadurch wird die Aussagekraft der Buchführung wesentlich verstärkt.
Schema für die Erfolgskonten
S
Aufwandskonto
H
S
Ertragskonto
H
Aufwand
Aufwandsminderung
Ertragsminderung
Ertrag
Saldo
Saldo
Fälle 14 – 15
Fall 14
Bilden Sie die Buchungssätze für folgende Geschäftsvorfälle:
1. Barzahlung für Löhne
2 100 €
7. Überweisung für zu zahlende Ladenmiete
850 €
7. Bankgutschrift für erhaltene Provision
500 €
7. Überweisung an Lieferer (Wareneinkauf bereits verbucht)
3 300 €
7. Bank belastet für Zinsen
250 €
7. Barkauf eines Aktenschrankes
1 340 €
7. Postbanküberweisung für Strom
610 €
7. Bankgutschrift für Zinsen
380 €
7. Barzahlung für Fachzeitschrift
40 €
7. Wareneinkauf auf Ziel
1 970 €
7. Warenverkauf auf Ziel
2 480 €
7. Banküberweisung für Gewerbesteuer
750 €
7. Bankgutschrift für Mietrückzahlung
100 €
7. Kunde zahlt durch Postbanküberweisung
1 370 €
7. Warenverkauf gegen bar
490 €
Folgende Erfolgskonten sind vorhanden: Personalkosten, Raumkosten, Betriebssteuern, Zinsertrag, Zinsaufwand, allgemeine Verwaltungskosten, Provisionsertrag, Waren (vgl. 6.3).
Fall 15
Deuten Sie folgende Buchungssätze:
1. Bank
an
Mieterträge
800 €
7. Kasse
an
Mieterträge
200 €
7. Personalkosten
an
Bank
1 200 €
7. Provisionsaufwand
an
Postbank
800 €
7. Allgemeine Verwaltungskosten
an
Kasse
50 €
7. Raumkosten
an
Bank
660 €
7. Postbank
an
Forderungen
1 470 €
7. Bank
an
Betriebssteuern
390 €
7. Verbindlichkeiten
an
Postbank
2 130 €
7. Zinsaufwand
an
Bank
170 €
Die Erfolgskonten haben mit Ablauf des Wirtschaftsjahrs ihre Aufgabe erfüllt, die betrieblichen Kapitalveränderungen (Aufwendungen und Erträge) aufzunehmen. Sie sind abzuschließen. Die jeweiligen Summen oder Salden zeigen, welcher Aufwand oder Ertrag im Wirtschaftsjahr insgesamt angefallen ist.
Beispiel
Auf dem Konto Raumkosten stehen beim Abschluss im Soll insgesamt 4 660 €, im Haben 260 €.
Lösung: Der Saldo von 4 400 € zeigt den Aufwand für die Geschäftsräume im abgelaufenen Wirtschaftsjahr.
Bei den im Haben gebuchten Beträgen handelt es sich um Aufwandsminderungen, z. B. durch Mietrückzahlung.
3.2 Das Gewinn-und-Verlust-Konto
Die Salden der Erfolgskonten zeigen nun, sachlich gegliedert, die jeweiligen Betriebsvermögenserhöhungen und -minderungen an. Diese werden jedoch nicht unmittelbar auf das Kapitalkonto übertragen, sondern zunächst auf dem Gewinn-und-Verlust-Konto (GuV-Konto) gesammelt. Es wird gelegentlich auch als Verlust-und-Gewinn-Konto bezeichnet.
Auch das GuV-Konto ist ein Unterkonto des Kapitalkontos. Es gelten die schon bekannten Buchungsregeln: Aufwendungen im Soll, Erträge im Haben. Das GuV-Konto nimmt aber keine laufenden Geschäftsvorfälle auf, sondern nur die Salden der Erfolgskonten. Man braucht es also nur zum Abschluss am Ende des Wirtschaftsjahrs.
Da sich Erträge und Aufwendungen eines Betriebs so gut wie niemals genau ausgleichen, ergibt sich auch auf dem GuV-Konto ein Saldo, und zwar im Soll, wenn die Erträge höher sind als die Aufwendungen. Ein Saldo im Soll weist demnach einen Gewinn aus. Steht der Saldo im Haben, so sind die Aufwendungen größer als die Erträge, die Firma hat also einen Verlust erlitten.
Im GuV-Konto bedeutet folglich:
Saldo im Soll = Gewinn,
Saldo im Haben = Verlust.
Neben der Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich auf Grund der Bilanzen bietet demnach die doppelte Buchführung auch noch die GewinnermittlungGewinnermittlung durch Vergleich von Aufwand und Ertrag. Beide Gewinne müssen übereinstimmen. Andernfalls liegt ein Buchungs- oder Übertragungsfehler vor. Sie sehen damit eine weitere Kontrollfunktion der Buchführung, doppeltedoppelten Buchführung.
Schema für das GuV-Konto
S
Gewinn-und-Verlust-Konto
H
Aufwendungen
Erträge
Saldo = Gewinn
Saldo = Verlust
Fall 16
Die Erfolgskonten weisen folgende Summen aus: Personalkosten S 18 300 €, Raumkosten S 5 420 €, Betriebssteuern S 2 450 €, Zinsaufwand S 750 €, allgemeine Verwaltungskosten S 3 190 €. Erträge aus Leistungen H 42 580 €, Mieterträge H 2 460 €.
Erstellen Sie das Gewinn-und-Verlust-Konto. Wie hoch ist der Gewinn (oder Verlust)?
Zum Abschluss eines Betriebs gehört neben der Schlussbilanz auch die Gewinn-und-Verlust-Rechnung (§ 242 Abs. 3 HGB). Diese Gewinn-und-Verlust-Rechnung ist praktisch eine »Reinschrift« des Gewinn-und-Verlust-Kontos. Für Kapitalgesellschaften ist dabei nach § 275 HGB nicht die Kontoform, sondern eine Staffelform vorgeschrieben. Bei anderen Unternehmen sind beide Formen zulässig. Als Beispiel für eine Gewinn-und-Verlust-Rechnung in Staffelform vgl. Lösung zu Fall 55.
3.3 Privatkonten
Sie kennen nun die Sachkonten für Betriebsvermögensumschichtungen und betriebliche Vermögensveränderungen. Es bleiben also noch die außerbetrieblichen, die privaten Betriebsvermögensveränderungen zu behandeln.
Erinnern Sie sich: Private Entnahmen mindern das Kapital, private Einlagen erhöhen es. Trotzdem soll auch hier das Kapitalkonto nicht angesprochen werden; es soll ein Konto, ruhendesruhendes Konto bleiben. Das bedeutet: es wird ein neues Unterkonto benötigt, das Privatkonto.
3.3.1 Einheitliches Privatkonto
Auf dem Privatkonto werden alle nicht betrieblichen, also privaten Vermögensveränderungen gebucht. Dabei gelten die Buchungsregeln für das Kapitalkonto. Das bedeutet:
EntnahmeEntnahmen sind als Kapitalabnahme im Soll,
EinlageEinlagen sind als Kapitalzugang im Haben
zu buchen.
Die Entnahme von Bargeld aus der Geschäftskasse ist demnach »Privat an Kasse« zu buchen, die Einzahlung auf das betriebliche Bankkonto aus privaten Mitteln »Bank an Privat«.
Fall 17
Bilden Sie Buchungssätze für folgende Vorfälle:
Überweisung für Privatversicherung
Bareinlage aus Lottogewinn
Einlage eines Grundstücks, bisher im Privatvermögen
Entnahme von Waren
Postbanküberweisung der Einkommensteuer (vgl. § 12 Nr. 3 EStG)
Bankgutschrift für erstattete Arztkosten
Entnahme eines Kraftfahrzeugs (Buchwert = Teilwert)
Barzahlung für Urlaubsreise
Der Saldo des Privatkontos zeigt einen Überschuss der Entnahmen über die Einlagen – also insgesamt eine Verminderung des Kapitals – an, wenn er im Haben steht; steht er im Soll, so überwiegen die Einlagen, das Kapital hat sich insgesamt erhöht.
Schema für das Privatkonto, getrenntesPrivatkonto
S
Privat
H
Entnahmen
Einlagen
Saldo
(Einlagenüberschuss)
Saldo
(Entnahmeüberschuss)
3.3.2 Getrennte Privatkonten
In der Praxis ist die Aufteilung des Privatkontos in ein Konto (Privat-)Entnahmen und ein Konto (Privat-)Einlagen üblich. Auch eine weitere Unterteilung ist möglich (z. B. private Steuern, private Versicherungen).
Festzuhalten ist, dass sich durch eine andere Gliederung der Privatkonten an den Buchungsregeln nichts ändert. Soll bleibt die Entnahmeseite, Haben die Einlagenseite.
3.4 Übersicht zu den Unterkonten des Kapitalkontos
4 Kontenabschluss
Mit Ablauf des Geschäftsjahrs werden die Bestandskonten und die Erfolgskonten geschlossen. Für das folgende Geschäftsjahr werden die Konten wieder neu eingerichtet.
Für den Kontenabschluss wird zunächst der Saldo festgestellt. Er steht auf der Habenseite, wenn die Buchungen im Soll überwiegen, und im Soll, wenn die im Haben gebuchten Beträge höher sind. Nach Eintragung des Saldos sind beide Seiten des Kontos ausgeglichen.
Auch die Eintragung des Saldos ist letztlich eine Buchung. Sie wissen, zu jeder Buchung gehört eine Gegenbuchung. Wo die Gegenbuchung erfolgt, welches Gegenkonto also in Betracht kommt, hängt von der Art des Kontos ab, das abzuschließen ist.
4.1 Abschluss der Bestandskonten
Gewinn-und-Verlust-KontoGegenkonto für den Abschluss der Bestandskonten ist das Schlussbilanzkonto (SBK). Es nimmt die Schlussbestände dieser Konten, also die Salden auf. Inhaltlich entspricht es der Schlussbilanz.
Beispiel
Im Konto »Kasse« beträgt die Soll-Summe 84 670 € (Anfangsbestand + Zugänge), die Haben-Summe 79 910 € (Abgänge = Barausgaben). Der Saldo von 4 760 € steht somit auf der Haben-Seite. Damit ist das Kasse-Konto ausgeglichen.
Im Schlussbilanzkonto erscheint der Kassen-Saldo im Soll (auf der Aktivseite).
Damit lautet der Abschluss-Buchungssatz:
Schlussbilanzkonto an Kasse 4 760 €.
Dieser Buchungssatz lässt sich verallgemeinern für sämtliche Aktivkonten.
Abschlussbuchung für Aktivkonten (Besitzkonten):
Schlussbilanzkonto an Aktivkonto
Damit ist das aktive Bestandskonto ausgeglichen und der Saldo auf das Schlussbilanzkonto übertragen.
Nach den Buchungsregeln verhalten sich die Passivkonten zu den Aktivkonten spiegelbildlich. Das gilt auch für die Abschlussbuchung. Daraus ergibt sich die typische Abschlussbuchung für Passivkonten (Schuldkonten):
Passivkonto an Schlussbilanzkonto
Fall 18
Kontenstände am Ende des Geschäftsjahrs
Konto
Soll
Haben
Bank
64 730 €
58 470 €
Forderungen
72 610 €
61 880 €
Postbank
29 580 €
23 960 €
Darlehensschuld
10 000 €
80 000 €
Verbindlichkeiten
43 730 €
61 290 €
sonstige Verbindlichkeiten
8 300 €
10 760 €
Kontenabschluss, Gewinn-und-Verlust-KontoErmitteln Sie die Salden und bilden Sie die Abschluss-Buchungssätze.
4.2 Abschluss der Erfolgskonten
Die Salden der Erfolgskonten werden, wie bereits unter 3.2 behandelt, auf dem GuV-Konto gesammelt. Auch diese »Sammlung« geschieht durch Buchung und Gegenbuchung: Buchung des Saldos im Erfolgskonto und Gegenbuchung im GuV-Konto.
Damit ergeben sich für die Erfolgskonten folgende typische Abschlussbuchungssätze:
GuV-Konto an Aufwandskonto,
Ertragskonto an GuV-Konto.
Mit diesen Abschlussbuchungen sind auch die Erfolgskonten ausgeglichen und alle Aufwendungen und Erträge auf das GuV-Konto übertragen.
4.3 Abschluss des Gewinn-und-Verlust-Kontos
Buchführung, doppelteNach Übernahme der Aufwendungen und Erträge wird sich auch im GuV-Konto ein Saldo ergeben. Wie bereits in 3.2 festgestellt wurde, bedeutet ein Saldo im Soll (Überschuss der Erträge über die Aufwendungen) einen Gewinn, ein Saldo im Haben (Überschuss der Aufwendungen über die Erträge) einen Verlust. Nachdem nun der betriebliche Gewinn oder Verlust bekannt ist, kann auch das Kapitalkonto weitergeführt werden. Sie erinnern sich: Für das Kapitalkonto gelten die Buchungsregeln des Passivkontos. Gewinn erhöht das Eigenkapital und muss demnach auf der Habenseite des Kapitalkontos gebucht werden. Für Verlust als Minderung des Eigenkapitals kommt folglich die Sollseite des Kapitalkontos in Betracht.
Damit ergeben sich für das Gewinn-und-Verlust-Konto folgende Abschlussbuchungen
bei Gewinn: GuV-Konto an Kapital,
bei Verlust: Kapital an GuV-Konto.
4.4 Abschluss des Privatkontos
Auch nach dem Abschluss des GuV-Kontos hat das Kapitalkonto seinen endgültigen Stand noch nicht erreicht. Es fehlen nämlich noch die privaten Betriebsvermögensveränderungen, die auf dem Privatkonto gebucht wurden.
Als nächster Schritt ist deshalb das Privatkonto abzuschließen. Ein Saldo im Haben bedeutet, dass die Entnahmen überwiegen. Ein Entnahmeüberschuss führt zu einer Kapitalminderung und muss daher im Konto »Kapital« im Soll gebucht werden.
Hat dagegen der Unternehmer mehr eingelegt als entnommen, so steht die größere Summe im Haben. Der Saldo gehört also zum Ausgleich ins Soll. Und weil ein Einlagenüberschuss kapitalerhöhend wirkt, muss er im Kapitalkonto im Haben gebucht werden.
Der Abschluss des Privatkontos geht demnach über folgende Buchungen:
Kapital an Privat, bei Entnahmeüberschuss;
Privat an Kapital, bei Einlagenüberschuss.
Fall 19
Wie lauten die Abschlussbuchungssätze, wenn statt des Kontos »Privat« die Konten Entnahmen und Einlagen geführt werden?
Nach dem Übertrag der privaten Vermögensveränderungen hat das Eigenkapital seinen Endstand erreicht und ist – als Bestandskonto – mit dem Buchungssatz
Kapital an Schlussbilanzkonto
abzuschließen (bei Überschuldung: Schlussbilanzkonto an Kapital). Im Schlussbilanzkonto muss jetzt Aktiva = Passiva sein. (Andernfalls wurde etwas falsch gemacht.) Damit ist die gesamte Buchführung abgeschlossen.
Gelegentlich wird zwischen »Abschlussbuchungen« und »vorbereitenden Abschlussbuchungen« unterschieden. Dies hat zwar keine große praktische Bedeutung, aber damit keine Missverständnisse aufkommen: Abschlussbuchungen berühren das Schlussbilanzkonto oder das GuV-Konto, vorbereitende Abschlussbuchungen dagegen nicht. So gehört z. B. der Abschluss des Privatkontos zu den vorbereitenden Abschlussbuchungen.
4.5 Beispiel für ein abgeschlossenes Konto
S
Bank
H
1. Anfangsbestand
23 700 €
2. Verbindlichkeiten
8 600 €
3. Forderungen
6 320 €
4. Provisionsaufwand
2 510 €
6. Kasse
5 000 €
5. Mietaufwand
1 200 €
7. Verbindlichkeiten
5 490 €
8. SBK
17 220 €
35 020 €
35 020 €
4.6 Übersicht zu den Sachkonten und deren Abschluss
Neben den Sachkonten bestehen noch Personenkonten (Kundenkonten und Liefererkonten bzw. Debitoren- und Kreditorenkonten), die zusätzlich geführt werden, vgl. 1. 2. 2.
4.7 Übersicht zu den Abschlussbuchungen
Schlussbilanzkonto an Aktivkonto (für jedes Aktivkonto)
Passivkonto an Schlussbilanzkonto (für jedes Passivkonto)
Gewinn-und-Verlust-Konto an Aufwandskonto (für jedes Aufwandskonto)
Ertragskonto an Gewinn-und-Verlust-Konto (für jedes Ertragskonto)
Kapitalkonto an Konto Privatentnahmen
Konto Privateinlagen an Kapitalkonto
Gewinn-und-Verlust-Konto an Kapitalkonto (bei Gewinn)
7a. Kapitalkonto an Gewinn-und-Verlust-Konto (bei Verlust)
Kapitalkonto an Schlussbilanzkonto





























