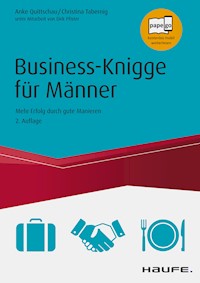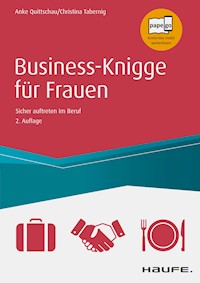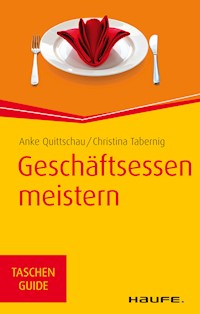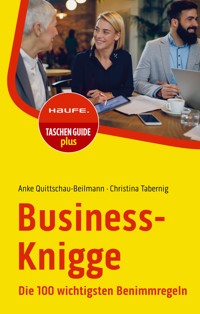
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe TaschenGuide
- Sprache: Deutsch
Zum souveränen Auftritt gehören Stilsicherheit und Gewandtheit im persönlichen Umgang. Wer die Benimmregeln beherrscht, profitiert im Geschäftsleben enorm. Hier erhalten Sie alle Spielregeln für die stilsichere Bewältigung Ihres Berufsalltags an die Hand - vom richtigen Business-Outfit über tadellose Tischmanieren bis zur stilvollen Korrespondenz. Inhalte: - Der erste Eindruck: Begrüßung und Anrede - So verhalten Sie sich korrekt und souverän in allen beruflichen Situationen - Lernen Sie kompakt und schnell alle Benimmregeln und wichtigen Umgangsformen kennen - Mit zahlreichen Beispielen, darunter Ess-Anleitungen für schwierige Speisen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Business-Knigge
Anke Quittschau-BeilmannChristina Tabernig
7. Auflage
Inhalt
Der erste Eindruck: Begrüßung und Anrede
■Der erste Eindruck zählt
■Angemessen begrüßen
■Sich und andere vorstellen
■Die richtige Anrede
Business-Dresscode
■Von Düften und Farben
■Kleidung zwischen Trend und Stil
■Flecken und andere Missgeschicke
Umgangsformen im Geschäftsleben
■Wie der Körper spricht
■Das richtige Verhalten bei Begegnungen
■Ungeschriebene Gesetze am Arbeitsplatz
■Im Job unterwegs
Kommunikation mit Geschäftspartnern
■Small Talk – wichtiger als viele glauben
■Am Telefon höflich und souverän
■Schriftliche Korrespondenz – stilvoll und zeitgemäß
■Online – auch hier ist Stil gefragt
Das Business-Parkett
■Meetings
■Souverän auftreten im Homeoffice
■Auf Messen
Geschäftskontakte zu festlichen Anlässen einladen
■Die Einladung
■Das Geschäftsessen vorbereiten
■Der Ablauf eines Restaurantbesuchs
Esskultur und Tischsitten
■Gedeck, Besteck & Co.
■Die Speisen
■Richtiges Verhalten bei Tisch
■Glossar
■Stichwortverzeichnis
Vorwort
Warum »Knigge« im digitalen Zeitalter? Ist das noch zeitgemäß? Die Arbeitswelt hat sich verändert, insbesondere bedingt durch die Digitalisierung und die veränderten Bedürfnisse der Generationen Y und Z. Doch nach wie vor sind soziale Fähigkeiten wichtig für ein gutes betriebliches Zusammenleben.
Mit diesem TaschenGuide möchten wir Sie in Ihrer Persönlichkeits- und Wertefindung unterstützen: Denn mit »Benehmen« ist nicht eine Anweisung für den Gebrauch der Hummerzange gemeint, sondern vor allem der tägliche Umgang miteinander. Dass schon Kleinigkeiten wie Grüßen, Türen aufzuhalten oder »bitte« und »danke« zu sagen den Alltag freundlicher gestalten, wissen wir alle. Wir geben Ihnen alle Spielregeln für die stilsichere Bewältigung Ihres Berufsalltags an die Hand – von der richtigen Anrede über das Verhalten in Gesprächen und Meetings bis hin zum Geschäftsessen. Das größte Geheimnis bei all unseren Tipps heißt Respekt, denn respektvoller Umgang mit Menschen ist die erste Voraussetzung guten Stils.
Wer die Benimmregeln beherrscht, profitiert im Geschäftsleben enorm. Er oder sie bewegt sich kompetent und sicher auf dem Business-Parkett. Mit Höflichkeit und Respekt meistern Sie selbst heikle Situationen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Anke Quittschau-Beilmann und Christina Tabernig
Der erste Eindruck: Begrüßung und Anrede
Wer kennt ihn nicht, den Spruch: »Es gibt keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck«. Tatsächlich kann der erste Eindruck ausschlaggebend für weitere Verhandlungen sein. In diesem Kapitel lesen Sie
■welche Signale den berühmten ersten Eindruck prägen und
■wie Sie durch richtiges Verhalten bei Begrüßung, Vorstellung und Anrede punkten.
Der erste Eindruck zählt
Beispiel
Ein Bekannter von uns, Inhaber eines erfolgreichen Handwerksbetriebes, betrat in seiner Arbeitskleidung ein exklusives Autohaus. Er wurde von der Informationsmitarbeiterin kritisch gemustert und der Kollege vom Verkauf war auch nicht viel freundlicher. Schade nur, dass nicht auf seiner Stirn stand, wie vermögend und kaufbereit der Kunde war. Er suchte sich nach der schlechten Betreuung ein anderes Geschäft aus, um seinen Traumwagen zu kaufen. Der erste Eindruck ist eben zum Großteil visuell geprägt.
Es gibt zahlreiche Studien zum Thema »erster Eindruck«, in denen Faktoren und deren Dauer gemessen wurden. Eine bekannte Studie des Max-Planck-Instituts für Wirtschaft hat herausgefunden, dass bereits 150 Millisekunden ausreichen, um unterbewusst einen fixen Eindruck von jemandem zu haben. Spätestens nach 90 Sekunden ist der Prozess abgeschlossen.
Der Mensch hat fünf Sinne. Er kann sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, und trotzdem nimmt er fast 80 Prozent seiner Umgebung allein über die Augen wahr – Grund genug, sich über die Bedeutung des ersten Eindrucks Gedanken zu machen. Diese Vorgänge werden durch das limbische System gesteuert, unser sogenanntes Reptilienhirn. Schon die Urmenschen mussten schnell einschätzen, ob derjenige, der ihnen entgegenkam, Freund oder Feind war. Damals wie heute gilt die Regel: Je ähnlicher uns jemand ist, desto weniger Unsicherheiten empfinden wir dieser Person gegenüber. Passen wir uns also unserem Gegenüber an, erhöht sich die Chance, dass wir schneller als Freund erkannt werden. Ob dieser erste Eindruck dann tatsächlich stimmt, erweist sich natürlich erst im nächsten Schritt.
Die Signale des ersten Eindrucks unterscheiden sich in zwei Kategorien: die bewussten und die unbewussten Signale. Und da fängt gleich die erste Schwierigkeit an. Die bewussten Signale kann nämlich nur der verändern, der seine eigenen Defizite kennt. Leider erhalten wir bei den Themen Umgangsformen und erster Eindruck nur selten ein ehrliches Feedback. Vielleicht geben uns Partner, Geschwister oder Eltern ab und zu einen Hinweis, aber im normalen Berufsleben kommt dies selten vor.
Die bewussten Signale
Zu den sogenannten bewussten veränderbaren Signalen zählt Ihre äußere Erscheinung. Hierzu gehören Kleidung, Frisur, Farben und Accessoires. Des Weiteren ist Ihr ganzes Wesen ein Signal, das Sie natürlich auch beeinflussen können. Damit sind vor allem Ihre Gestik, Ihre Gesichtszüge aber auch Ihre Körperhaltung gemeint. Sind Sie ein fröhlicher Mensch oder eher zurückhaltend? Sollten Sie vielleicht mehr aus sich herausgehen oder sich lieber mal zurückhalten? All dies können Sie bewusst trainieren. Ein weiteres veränderbares Element des ersten Eindrucks ist die Sprache. Ihrem Gegenüber fällt die Art und Weise auf, wie Sie ihn grüßen und Ihren Namen nennen. Vorhandene Akzente oder Dialekte klingen an und man nimmt wahr, ob Sie eine laute oder leise, schnelle oder langsame Aussprache haben. Sprache und Stimme sind veränderbar und trainierbar, beispielsweise durch Rhetorikkurse oder Stimmbildungstrainings.
Dr. Albert Mehrabian, Professor an der UCLA (University of California, in Los Angeles), hat in einer Studie folgende Verteilung der Bestandteile des ersten Eindrucks zusammengefasst:
Die äußere Erscheinung spielt bei den bewussten Signalen eine extrem wichtige Rolle, sie ist nicht zu unterschätzen. Die Wortwahl und Melodie sind das Nächste, das beim ersten Eindruck ins Gewicht fällt. Und am wenigsten beachten wir das, was jemand in den ersten Sekunden sagt.
Natürlich erscheint das im ersten Moment etwas oberflächlich, denn wir alle möchten schließlich für unsere inneren Werte, Kompetenzen und Fähigkeiten geschätzt werden. Respektieren Sie dennoch dieses Naturgesetz. Arbeiten Sie nicht dagegen, sondern nutzen Sie die Kenntnis davon.
Die unbewussten Signale
Neben Kleidung, Körpersprache und Stimme spielt auch der Duft eine unbewusste Rolle für den ersten Eindruck. »Den kann ich nicht riechen« – diese Redewendung hat einen wahren Kern. Hat unser Gegenüber zu viel und zu starkes Parfum aufgetragen oder verströmt er bzw. sie einen unangenehmen Körpergeruch, so sind das negative Einrücke, die sich bei uns festsetzen. Die chemische Reaktion auf Parfums ist bei jedem Menschen unterschiedlich – egal, ob er größere oder geringere Mengen Duftwasser verwendet. Und am Ende des Tages kommt der körpereigene Geruch meist wieder zum Vorschein. Deshalb gehört der Duft zu den unbewussten Kriterien des ersten Eindrucks. Ihm haben wir uns im Kapitel Business Dresscode ausführlich gewidmet.
Das letzte Element, das den ersten Eindruck prägt, ist die Haut. Wenn Sie vor Aufregung feuchte oder kalte Hände bekommen, ist das nur schwer beeinflussbar. Dieser Vorgang spielt sich unbewusst ab und ist kaum zu kontrollieren. Dennoch müssen Sie sich Ihrem Gegenüber nicht so ausliefern. Feuchte Hände können Sie vor dem Handschlag am Hosenbein trocknen und kalte Hände warm reiben. Oder bleiben diese Phänomene bei Ihnen aus? Umso besser! Dann können Sie Ihr Gegenüber unbefangen begrüßen.
Regel Nr. 1:
Bedenken Sie: Ihre gesamte Erscheinung prägt den ersten Eindruck, den Sie auf Ihr Gegenüber machen. Dazu zählen Kleidung, Körpersprache, Stimme, Duft und sogar die Beschaffenheit Ihrer Haut.
Angemessen begrüßen
Jeder Kontakt beginnt mit einer Begrüßung. Dies mag als leichte Übung erscheinen. Doch gerade im Geschäftsleben lauern dabei einige Tücken. Hat man sich begrüßt und vorgestellt, folgt die Frage nach der korrekten Anrede.
Ein Beispiel: Herr Professor Schönberg hat sich mit »Guten Tag, ich bin Michael Schönberg!« vorgestellt, aber Sie sind sicher, dass er einen Adelstitel hat. Was passiert jetzt mit seinen akademischen Graden? Und wen stelle ich wem vor, wenn meine Vorgesetzte dazukommt?
Die Kenntnis einfacher Regeln gibt Ihnen die nötige Gelassenheit. Die Begrüßung besteht aus zwei Phasen: dem gesprochenen Gruß und dem gefühlten ersten Eindruck, dem Händedruck. Für beide Phasen gelten unterschiedliche Regeln, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen.
Wer grüßt zuerst?
Soll ich unbekannte Menschen auf der Straße grüßen? In Großstädten kommen Sie eher selten in diese Verlegenheit. In kleineren Gemeinden oder beim Spaziergang im Wald, ist dies durchaus angebracht und üblich. Der Gruß ist eine freundliche Geste der anderen Person gegenüber.
Der Rangniedere grüßt den Ranghöheren zuerst. Besteht keine Hierarchie, sollte derjenige grüßen, der die andere Person zuerst gesehen hat. Ein »Mahlzeit« gehört übrigens nicht in diese Kategorie des Grüßens und sollte möglichst gar nicht erst über Ihre Lippen kommen. Betreten Sie einen Raum, grüßen Sie zuerst die dort Anwesenden. Hierbei ist nicht nur der Besprechungsraum oder das Büro gemeint. Auch wenn Sie privat unterwegs sind, grüßen Sie beim Eintreten die Anwesenden im Fahrstuhl, beim Bäcker, in der Sauna oder im Wartezimmer der Arztpraxis. Antworten Sie auf einen Gruß möglichst mit den gleichen Worten und spielen Sie nicht den Besserwisser, indem Sie um 12.00 Uhr auf ein »Guten Morgen« mit einem »Guten Tag« kontern. So ein Verhalten gleicht einer Zurechtweisung und macht nicht gerade sympathisch.
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Doch auch wenn agile Arbeitsmethoden gefördert werden – oder gerade deshalb – und wir in gleichberechtigten Teams arbeiten, benötigen wir Spielregeln für unsere Zusammenarbeit. Es gibt weiterhin Hierarchien, die zu berücksichtigen sind, um den Projekterfolg sicherzustellen. Wichtig ist, dass es eine akzeptierte Teamhierarchie gibt. Die Kriterien können Kompetenz, Dienstalter, Lebensalter oder eine informelle Hierarchie sein.
Regel Nr. 2:
Wer einen Raum betritt, grüßt zuerst – unabhängig von Rang oder Position. Begegnet man ranghöheren Personen auf dem Flur, grüßt grundsätzlich die rangniedere Person die ranghöhere zuerst.
Der Händedruck
Wer reicht wem die Hand?
Beispiel
Sie sind zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und werden in das Büro Ihrer zukünftigen Vorgesetzten geführt. Freundlich wie Sie sind, strecken Sie zur Begrüßung der dort Wartenden Ihre Hand entgegen. Ist das korrekt?
Nein, der Händedruck geht stets von der ranghöheren Person aus. Seien Sie also nicht zu freundlich, indem Sie Ihrer (zukünftigen) Vorgesetzten beim Betreten ihres Büros Ihre Hand reichen. Warten Sie ab, wie die ranghöhere oder gastgebende Person entscheidet. Stellen Sie sich vor, Sie erwarten zuhause Besuch. Es klingelt an der Tür, Sie öffnen und eine Hand wird Ihnen entgegengestreckt. Sie würden sich unangenehm überrumpelt fühlen. Haben Sie aber Ihre Hand schon zum Gruß ausgestreckt, nehmen Sie sie nicht mehr zurück. Eine gereichte Hand sollte immer erwidert werden. Alles andere wäre unhöflich.
Beispiel
Zwei männliche Kollegen treffen am Samstag in entspannter Shoppinglaune beim Einkaufen aufeinander. Beide sind in weiblicher, dem anderen noch unbekannter Begleitung. Der eine Kollege streckt dem anderen freudig seine Hand entgegen, doch der andere sagt: »Nee, nee, Ladies first!« Er erwidert den Händedruck nicht, sondern streckt seine Hand der ihm unbekannten Frau hin.
Dieser Mann mag es gut gemeint haben, doch sind ihm bei einer Begegnung gleich drei Fauxpas »gelungen«:
■Er hat die ihm gereichte Hand ausgeschlagen.
■Er hat seinen Kollegen vor anderen Personen gemaßregelt.
■Er begrüßt eine Person, die er gar nicht kennt.
Stattdessen sollte er zuerst den begrüßen, den er kennt. Anschließend sollte er sich vorstellen lassen oder er kann sich selbst vorstellen.
Regel Nr. 3:
Begrüßen Sie die Person zuerst, die Sie kennen, und lassen Sie sich dann vorstellen oder stellen Sie sich selbst vor.
Gibt man noch die Hand?
Der Händedruck hat ein Imageproblem. Während der Coronapandemie haben wir wegen der Ansteckungsgefahr auf den Händedruck verzichtet. Doch kaum war das Schlimmste überstanden, sind viele wieder zum alten Verhalten zurückgekehrt. Verständlich, denn dieser unmittelbare Kontakt zu Menschen wurde schmerzlich vermisst. Händedruck oder nicht? Entscheiden Sie selbst, wie es Ihnen lieber ist. Kommentieren Sie Ihre Entscheidung aber, damit sich die anderen nicht wundern.
Der Händedruck sagt eine Menge über den Menschen aus, und er kann Formen annehmen, die andere als unsympathisch oder sogar dominant empfinden.
■Die Machtdemonstration: Der Händedruck wird mit zwei Händen erwidert oder der oder die Begrüßte tätschelt mit der zweiten Hand den Oberarm des Gegenübers.
■Der Kniefall: Die Hand des Gegenübers wird so fest gedrückt, dass die Person beinahe in die Knie geht.
■Der Waschlappen: Dem Händedruck fehlt ein gewisser Druck, so dass er sich anfühlt wie ein feuchter Waschlappen, der einem in die Hand gelegt wurde.
■Der Gleichgültige: Eine Person gibt jemandem die Hand, spricht aber mit einer dritten Person weiter.
Der korrekte Händedruck ist von einem angenehmen Druck und dauert ca. ein bis drei Sekunden. Hände werden gereicht und nicht geschüttelt. Schauen Sie Ihrem Gegenüber dabei in die Augen und nehmen Sie im Sommer die Sonnenbrille ab, solange es keine sich verdunkelnde Lesebrille ist. Was tun, wenn Ihr Gegenüber Ihre Hand beim Händereichen nicht mehr loslässt? Entspannen Sie einfach Ihren Druck, damit signalisieren Sie, dass Sie Ihre Hand gerne zurückhätten. Wenn Ihr Gegenüber nicht ganz emotionslos ist, wird es die schlaffe Hand spüren und sie freigeben.
Regel Nr. 4:
Achten Sie auf Ihren Händedruck: Er sollte nicht zu fest, aber auch nicht zu locker sein und maximal ein bis drei Sekunden dauern. Schauen Sie Ihrem Gegenüber immer freundlich in die Augen.
Zur Begrüßung aufstehen
Beispiel
Sie sitzen mit Ihren Kunden und Kollegen an einem Besprechungstisch, und ein Mitarbeiter betritt den Raum, um, wie abgesprochen, eine Produktpräsentation zu halten. Als er an den Tisch herantritt, um die Gäste zu begrüßen, stehen nur die Herren auf, die anwesenden Kolleginnen und die Kundin bleiben sitzen. Macht man das so?
Sobald Ihnen eine Person entgegentritt und Sie begrüßen möchte, sollten Sie aufstehen. Dies gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Sie bringen damit zum Ausdruck, dass Sie Ihrem Gegenüber den nötigen Respekt entgegenbringen. Im Geschäftsleben ist es für Frauen sehr viel angenehmer, auch körperlich auf Augenhöhe zu kommunizieren und nicht angestrengt den Kopf in den Nacken zu legen und nach oben schauend sprechen zu müssen. Sollten Sie am Schreibtisch sitzen, stehen Sie auf und gehen um diesen herum. Damit bauen Sie Barrieren ab, die sichtbar zwischen Ihnen stehen. Bieten Sie Ihren Gästen danach einen Platz an. Im Privatleben dürfen Frauen sitzen bleiben, solange keine ältere Dame auf sie zukommt. Wer nun jünger ist oder nicht, mag nicht immer ganz einfach einzuschätzen sein. Für jemanden aufzustehen, ist immer ein Zeichen von Respekt.
Regel Nr. 5:
Im Berufsleben stehen alle zur Begrüßung auf.
Sich und andere vorstellen
Wie stellen Sie sich sympathisch vor und wie machen Sie eine adäquate Gegenvorstellung? Was sollten Sie beachten, wenn Sie Personen miteinander bekannt machen? In unseren Trainings werden die meisten Teilnehmenden bei diesem Thema nervös. Viele machen sich hier die größten Gedanken, doch oft sind solche Situationen sehr entspannt und alles läuft von selbst.
Wie stelle ich mich sich selbst vor?
Beispiel
Zwei fremde Personen begegnen sich zum ersten Mal auf einer Veranstaltung. Sie nähern sich zaghaft an, reichen sich die Hände und stellen sich vor: »Guten Tag, Meier mein Name!«, »Freut mich, ich bin Frau Müller.«
Solche Vorstellungen hört man häufig. Es geht aber schöner. Eine positive Selbstvorstellung lautet: »Guten Tag, ich bin Vorname Nachname.« Nennen Sie eventuell noch Ihre Position im Unternehmen bzw. die Aufgabe, die Sie erfüllen. Damit geben Sie oft ein Thema für den ersten Small Talk vor. Die Gegenvorstellung im obigen Beispiel ist auch nicht mehr zeitgemäß.
Die Vorstellung sowie die Gegenvorstellung umfassen nur Vor- und Nachname. Stellen Sie sich bitte nie mit Ihren Titeln oder akademischen Graden vor. Auch Inhaber von Doktortiteln sprechen sich nicht mit den Titeln an. Natürlich wird es dadurch nicht gerade einfacher herauszufinden, wie die korrekte Anrede der Person ist, die man gerade kennengelernt hat.
Auch in einem »Duz-Umfeld« ist es hilfreich, wenn man sich mit Vorname PLUS Nachname vorstellt. Vielleicht heißen mehrere im Projektteam Thomas, dann kann der Nachname zur Unterscheidung wichtig sein.
Gemäßigt im Ton und ohne Floskeln
Kennen Sie die Menschen, die sich vor Sie hinstellen, die Hand ausstrecken und mit scharfem Ton nur ihren Nachnamen nennen? Besonders sympathisch ist das nicht. Es ist weitaus angenehmer, wenn man bereits bei der Vorstellung die Stimme seines Gegenübers mitbekommt. Immerhin prägt die Stimme 38 Prozent des ersten Eindrucks. Geben Sie Ihrem Gegenüber also auch die Chance, sie zu hören.
Dann gibt es noch die Menschen, die meinen sehr höflich zu sein, wenn sie fragen: »Gestatten, dass ich mich vorstelle?« oder »Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist…«. Nun, das ist in der Tat sehr nett gemeint, aber heutzutage nicht mehr üblich, sondern gilt als übertriebene Beflissenheit. Wir müssen uns nichts erlauben oder gestatten lassen, was die Vorstellung betrifft. Diese alten Zöpfe können wir getrost abschneiden.
Verhalten einer Gruppe gegenüber
Wenn Sie auf eine Gruppe zukommen, sollten Sie Ihren Namen ab und an bei der Begrüßungsrunde wiederholen. So gehen Sie sicher, dass auch der letzte in der Runde Ihren Namen zumindest einmal gehört hat.
Noch ein wichtiger Aspekt: Stoßen Sie auf eine Gruppe, bei der Sie nur eine Person kennen, begrüßen Sie diese zuerst. Stellt sie Sie dann nicht der Gruppe vor, nehmen Sie das selbst in die Hand. Beginnen Sie bei der ranghöchsten Person und gehen von dieser der Reihe nach die Vorstellungsrunde durch. Kennen Sie die Rangordnung nicht, starten Sie bei einer Dame der Gruppe. Kommen Sie aber nicht auf die Idee, zuerst alle Damen und dann die Herren zu begrüßen. Dieser Zick-Zack-Parcours könnte verwirrend und umständlich wirken. Leiten Sie ruhig Ihre Begrüßung mit den Worten ein: »Ich fange der Einfachheit halber bei Ihnen an …« Und gehen dann der Reihenfolge nach die Personen ab.
Die korrekte Gegenvorstellung
Viele reagieren auf eine Vorstellung mit den Floskeln »angenehm« oder »sehr erfreut«. Freundlicher ist da schon ein »Freut mich, Sie kennenzulernen.« Eine sympathische und moderne Gegenvorstellung klingt allerdings genauso wie eine Vorstellung: »Guten Tag, (und) ich bin Vorname Nachname.« Der Nachsatz: »Wie schön, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen« ist die modernere Variante von »angenehm«.
Regel Nr. 6:
Sowohl die Selbstals auch die Gegenvorstellung sollte folgendermaßen formuliert werden: »Guten Tag, mein Name ist/ich bin/ich heiße Vor- und Nachname.« Alte Floskeln wie »Erlauben Sie, dass …« oder »angenehm« gehören nicht mehr dazu.
Wie stelle ich andere vor?
Sie befinden sich in einem größeren Kreis, als jemand dazukommt, der nur Ihnen bekannt ist. Begrüßen Sie die Person und stellen Sie sie der Gruppe vor. Hier gilt als erste Regel: Ankommende werden Anwesenden vorgestellt. Stellen Sie dabei die Personen mit all ihren Titeln und akademischen Graden vor. Nur dann können die anderen die fremde Person korrekt ansprechen. Die zweite Regel besagt: Die wichtigere Person erhält zuerst die Information, wer vor ihr steht.
Beispiel
Sie stehen mit dem neuen Praktikanten am Kopierer und die Vorgesetzte kommt den Gang entlang. Sie grüßen zuerst und machen folgende Vorstellung: »Liebe Frau Thöres, ich möchte Ihnen unseren neuen Praktikanten, Tobias Matter, vorstellen. Herr Matter, dies ist unsere Geschäftsführerin, Julia Thöres.«
Situationen, die in den privaten Bereich hineinreichen, sind dagegen nicht immer ganz eindeutig. Treffen Sie Vorgesetzte am Samstag in der Stadt, stellen Sie Ihre Begleitung vor. Etwas unangenehmer könnte es werden, wenn man seine Begleitung vorgestellt hat, der oder die Vorgesetzte aber vergisst, seine bzw. ihre Begleitung vorzustellen. Die Frage, wer die Person ist, sollten Sie sich verkneifen. Die bessere Lösung ist die Flucht nach vorne. Zum Beispiel mit den Worten: »Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ich bin Vorname Nachname und arbeite ihm Team von …« Meist wird auf Ihre Selbstvorstellung auch eine Gegenvorstellung kommen und Sie wissen dann, mit wem Sie es zu tun haben. Werden Sie also in solchen Situationen aktiv und rätseln Sie nicht lange herum.
Regel Nr. 7:
Ankommende werden Anwesenden vorgestellt. Die wichtigste Person erfährt zuerst, wer vor ihr steht.
Die richtige Anrede
In den meisten Fällen lautet die korrekte Anrede: Gruß, Herr/ Frau Nachname. Tückisch wird die Sache erst, wenn Adelstitel oder akademische Grade hinzukommen, diese sollten auf jeden Fall genannt werden. Der Adelstitel ist zudem Bestandteil des Namens.
Den anderen beim Namen nennen
Wir alle hören gerne unseren eigenen Namen, aber nur, wenn er auch korrekt ausgesprochen wird. Den Namen wiederholt falsch auszusprechen oder ihn zu verwechseln, wirkt sehr unhöflich. Doch ist es nicht immer leicht, sich die Namen seiner Geschäftspartner:innen auf Anhieb zu merken. Das Nachfragen beim Erstkontakt ist kein Verbrechen. Fragen Sie aber bitte nicht drei Mal nach. Auch das wäre unhöflich. Nennen Sie Ihre Gesprächspartner:innen im Laufe Ihrer Unterhaltung ab und zu beim Namen oder verabschieden Sie sich mit der Nennung des Namens. Übertreiben Sie dabei aber nicht.
Anrede bei Titeln und Adelstiteln
Beispiel
Haben Sie mit österreichischen Geschäftsleuten zu tun, sollten Sie wissen, dass die Österreicher stolz auf Ihre Titel sind und diese auch gerne hören. Die Titel unterscheiden sich jedoch erheblich von denen in Deutschland. Es gibt beispielsweise »Berufstitel« wie Hofrat, Medizinalrat oder Kammersänger, die vom Bundespräsidenten für besondere berufliche Leistungen verliehen werden. Auch der Herr Diplomkaufmann oder die Frau Magistra möchten genau so angesprochen werden. Sie merken schon: Der Titel kann wichtiger sein als der Name, der häufig entfällt. Erkundigen Sie sich deshalb im Vorfeld eines Geschäftskontaktes gezielt nach Titeln.
Bei Adelstiteln
Mit Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung am 14. August 1919 wurden die Vorrechte und Titel des Adels abgeschafft. Juristisch gibt es seitdem keinen deutschen Adelsstand mehr – die früheren Adligen und ihre Nachkommen sind bürgerliche Menschen wie alle anderen auch. Ein Privileg ließ man ihnen allerdings: Die Mitglieder der Adelsfamilien durften den alten Titel als Bestandteil des bürgerlichen Namens und auch das »von« behalten.
Treffen Sie auf einen Gesprächspartner, der einen Adelstitel hat, wird dieser in der Anrede mitgenannt. Die einfachste Variante ist, wenn es sich um das bloße »von« handelt. Dann heißt es »Guten Abend, Herr von Münchhausen«. Wissen Sie, dass Ihr Gegenüber Baron bzw. Freiherr ist oder einen Grafentitel trägt, sprechen Sie ihn mit: »Guten Abend, Graf Schönberg« an. Das kleine Wörtchen »von« fällt bei dieser Anrede weg. Sobald ein Graf oder Baron vor Ihnen steht, entfällt die Anrede mit Herr/Frau. Herr Graf oder Frau Gräfin sagten früher nur die Angestellten und drückten damit ihre Untertänigkeit aus. Bei einem Geschäftskontakt gibt es diese Differenzierung nicht, sondern man steht auf der gleichen Stufe. Einen Adelstitel allerdings dürfen Sie bei der Anrede erst weglassen, wenn er Ihnen vom Träger erlassen wird. Gleiches gilt auch für akademische Grade. Wenn eine dritte Person Ihren adeligen Geschäftskollegen ohne Titel anspricht, kommen Sie also nicht auf die Idee, es auch zu tun. Sie wissen nicht, wie sich die beiden bezüglich der Ansprache geeinigt haben.
Regel Nr. 8:
Adelstitel gehören zum Namen und sollten bei der Anrede mit genannt werden. Graf von Petershausen, wird mit »Guten Tag, Graf Petershausen« angesprochen – also ohne »Herr« und ohne »von«. Das einfache »von« (ohne Adelstitel) hingegen wird in der Anrede nicht weggelassen.
Bei akademischen Graden
Bei akademischen Graden wird in der Anrede immer nur der höchste Titel genannt. Wird Ihnen ein Professor Dr. Huber vorgestellt, sprechen Sie ihn mit »Guten Tag, Herr Professor Huber« an. In der weiblichen Variante heißt es »Guten Tag, Frau Professorin Huber«. Auf der Adresse eines Briefumschlages sollten Sie aber alle Titel hinschreiben. Haben Sie einen Gesprächspartner, der Dr. Dr. h.c. Caesar heißt, sprechen Sie ihn bei der Anrede nur mit einem Doktortitel an. Verwirrung kann aufkommen, wenn jemand sowohl akademische als auch adelige Titel hat. Beide Titel werden bei der Anrede genannt. Dabei gilt folgende Reihenfolge: akademischer Grad, Adelstitel, Nachname (z. B. Guten Tag, Dr. Graf Edelmann). Sollten Sie auf die Nennung Ihres akademischen Grades Wert legen, können Sie es wie ein ehemaliger Kollege von uns halten, der mit ironischem Unterton und einem Grinsen im Gesicht sagte: »Dr. Berger bitte, so viel Zeit muss sein.« Solche Bemerkungen sollte man sich aber lieber in einem Vier-Augen-Gespräch erlauben, wenn man den Gesprächspartner besser kennt. Titel wie Bachelor und Master werden in Deutschland ebenso wenig wie der Diplom-Ingenieur oder die Diplom-Betriebswirtin bei der Begrüßung oder Anrede mit genannt.
Regel Nr. 9:
In Deutschland werden bei der Anrede nur akademische Titel wie Doktor oder Professor genannt. Nennen Sie nur den höchsten Titel.
Doppelnamen
Beispiel
Ihre Kollegin hat geheiratet und Sie haben erfahren, dass Sie sich für einen Doppelnamen entschieden hat. Trotzdem meldet sie sich immer noch ausschließlich mit Ihrem Geburtsnamen am Telefon. Wie sollen Sie sie denn nun ansprechen?
Sprechen Sie Ihre Kollegin ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie wissen, dass sie einen Doppelnamen hat, mit diesem an. Hier gilt dieselbe Regel wie bei den Titeln: Sollte Ihre Kollegin Ihnen ihren neuen Zweitnamen erlassen, dürfen Sie sie wieder mit dem »alten« Namen ansprechen.
Regel Nr. 10:
Titel, Doppelnamen oder akademische Grade können Sie erst weglassen, nachdem sie Ihnen erlassen werden.
Du oder Sie?
Das Siezen ist historisch betrachtet ein eher junger Brauch. Im Frühmittelalter (um 500 n. Chr.) war das Du die gängige Anredeform. Erst vier Jahrhunderte später wurde das Ihr für hochrangige Personen eingeführt. Unser heutiges Sie hat sich erst im 19. Jahrhundert entwickelt und damit sind auch unsere heutigen Anreden im alltäglichen Leben entstanden.
Beispiel
Eine Bekannte von uns war auf einem Fest ihrer Freundin eingeladen. Die Anwesenden waren alle zwischen 30 und 40 Jahre alt und Freunde der Gastgeberin. In einer Runde traf sie auf einen guten Freund, er stand bei einer Frau, die sie schon vor Jahren einmal kennengelernt hatte. Sie begrüßte den Freund und stellte sich dann der Frau mit ihrem Vornamen vor. Diese allerdings erwiderte die Gegenvorstellung mit: »Ich bin Frau von Döring.« Wieso ließ sich jemand in dieser Runde siezen, zumal man sich schon vor Jahren in kleinerer Runde getroffen hatte? Es blieb bei der Vorstellungsrunde und unsere Bekannte suchte danach das Weite. Über die steife Begrüßung war sie sichtlich schockiert.
Gerade bei gleichaltrigen Personen oder Freunden von Freunden rechnet man nicht damit, sich siezen zu müssen, geschweige denn mit Adelstiteln anzusprechen.
Das Du anbieten
Wer darf im Berufsleben das Du anbieten? Hier gilt wieder die Regel: Die ranghöhere Person darf entscheiden, wem sie wann das »Du« anbieten möchte. Dies ist unabhängig von Geschlecht und Alter. Für ein »Du« reicht ein Handschlag oder die Übereinkunft, sich ab jetzt zu duzen, indem man seinen Vornamen nennt.
Es ist nicht immer ganz einfach festzustellen, wie ernst das Duz-Angebot gemeint ist. Gerade auf Weihnachtsfeiern oder bei anderen Firmenveranstaltungen werden solche Angebote gerne zur fortgeschrittenen Stunde ausgesprochen. Im Zweifelsfall kehren Sie am nächsten Tag einfach zum üblichen Sie zurück.
Beispiel
Auf einer Weihnachtsfeier sitzen Sie zu fortgeschrittener Stunde mit Ihrer Vorgesetzten am Tisch. Wie es der Zufall und die Stimmung so wollen, bietet Ihre Chefin Ihnen mit nicht mehr ganz klarer Stimme das Du an. Eine nicht ganz einfache Situation: Für den jetzigen Zeitpunkt nicht so schlimm, aber was machen Sie damit am nächsten Morgen? Leider haben Sie den Eindruck, dass Ihre Vorgesetzte nicht mehr ganz nüchtern war, als sie Ihnen das Du anbot. Am nächsten Morgen treffen Sie sie auf dem Flur und wissen nicht mehr, ob sie sich noch daran erinnert, was sie gestern gesagt oder getan hat. Sie begrüßen sie mit einem freundlichen »Guten Morgen, Frau Drexler.« Ihre Chefin schaut Sie verwundert an und sagt: »Guten Morgen, Monika. Wir hatten uns doch gestern auf das Du geeinigt, oder?«
Wie dieses Beispiel zeigt, sind Sie immer auf der sicheren Seite, nach einem feucht-fröhlichen Abend beim Sie zu bleiben. Die ranghöhere Person wird Ihnen schon ein Zeichen geben, dass sie das Du ernst gemeint hat. Hüten Sie sich davor, auf Firmenveranstaltungen über den Durst zu trinken. Ihre möglichen Fehltritte sind schneller, als Ihnen lieb ist, in der ganzen Firma bekannt.