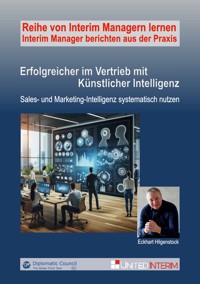Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch gilt als Standardwerk zum Thema Business Transformation. Es gibt keine anderen Führungskräfte als Interim Manager, die im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen kennenlernen und dabei verschiedene unternehmerische Herausforderungen bewältigen. In der Buchreihe "Von Interim Managern lernen" wird dieses geballte Know-how gebündelt und einer breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Diplomatic Council (DC), ein globaler Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen (UNO), und United Interim (UI), das führende Netzwerk qualifizierter Interim Manager im deutschsprachigen Raum, haben sich hierzu zusammengetan. Die beiden Herausgeber der Buchreihe, Dr. Harald Schönfeld und Jürgen Becker, sind zugleich die Gründer und Geschäftsführer von United Interim; sie kennen daher dieses Marktsegment besser als irgendjemand anderes. Dieses Wissen gepaart mit einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu praktisch allen qualifizierten Interim Managern von Relevanz im deutschsprachigen Raum gewährleistet, dass in der Buchreihe "Von Interim Managern lernen" tatsächlich nur die Besten der Besten zu Wort kommen. Daher wird dieser Band "Business Transformation" mit viel Anerkennung und Begeisterung aufgenommen. Die Presse nennt das Buch "das neue Standardwerk für das Thema Business Transformation". Fünfzehn Autoren stellen ihr in der Praxis erarbeitetes Know-how auf 512 Seiten zur Verfügung. Von Interim Managern lernen (Dr. Harald Schönfeld, Jürgen Becker) Business Transformation ist der einzige Schritt in die Zukunft (Eckhart Hilgenstock) So werden Menschen und Unternehmen resilient (Dr. Bodo Antonic) Transformation von HR-Funktion und Belegschaft (Udo Fichtner) Herausforderungen der Transformation in der Serienproduktion (Rudi Grebner) Internationales Wachstum )Michael Gutowski) Die Renaissance im Supply Chain Management (Stefan Löffler) Transformation Strategischer Einkauf und Schnittstellen (Manfred Richter) Business Transformation: Post Merger Integration (Marcus Schuss) Business Transformation in Operations & Process Management (Dr. Detlef Weber) Die ewige Transformation (Falk Janotta) Zwei Praxisbeispiele für gelungene Business Transformation (Rainer Simko) Unternehmenskrisen: Meistens hausgemacht (Lothar Hiese) Business Transformation: Best Practice, Tools und Tipps (Susanne Möcks-Carone)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autoren
Dr. Harald Schönfeld
Jürgen Becker
Eckhart Hilgenstock
Dr. Bodo Antonić
Udo Fichtner
Rudi Grebner
Michael Gutowski
Stefan Löffler
Manfred Richter
Rolf Marcus Schuss
Dr. Detlef Weber
Falk Janotta
Rainer Simko
Lothar Hiese
Susanne Möcks-Carone
Inhalt
Vorwort
Von Interim Managern lernen
Interim Manager: Was ist das und worum geht es?
Interim Manager: Spezialisierte Experten für die Umsetzung
Einsatzfelder/Besonderheiten beim Einsatz von Interim Managern
Buchreihe mit praxisorientierten Umsetzungsexperten
Business Transformation ist der einzige Schritt in die Zukunft
Unternehmerisches Denken erforderlich
Was verändert sich für Unternehmen?
Megatrends als Transformationstreiber
Disruptionen können jeden treffen
Die Macht der Plattformen
Innovative Geschäftsmodelle
Daten: Das Öl des 21. Jahrhunderts
Transformation im Automobilsektor
Neue cross-industrielle Geschäftsmodelle
Ökosystem Partner: Der Schlüssel zum Erfolg
Die Werkzeuge der Transformation
Der Entstehungsprozess neuer Geschäftsmodelle
Eine Transformationsarchitektur entwickeln
Selbstorganisierte Teams
Der Weg zur Selbstorganisation
Resümee: Transformieren Sie sich in die Zukunft!
So werden Menschen und Unternehmen resilient
Einführung
Krisen sind das neue Normal
Was auf die Wirtschaft zukommt
Wie Unternehmen reagieren – und warum das nicht reicht
Neues Paradigma: Resilienz statt Krisenmanagement
Vordenker der systemischen Resilienz
Was also ist in Sachen Resilienz zu tun?
Was Managerinnen und Manager tun müssen
Fallbeispiele aus meiner Interimpraxis
Führungskräfte brauchen „Störkraft“
Bürokratie gilt es einzudämmen
Weg mit der rosaroten Brille im Management
Das Gymnastikprogramm für das resiliente Unternehmen
Fazit
Der Resilienz-Check
Transformation von HR-Funktion und Belegschaft
Transformation der HR-Funktion
Transformation der Belegschaft
Resümee
Herausforderungen der Transformation in der Serienproduktion
Abstrakt
Aktuelle Ausgangslage
Selbstorganisierte Teams sind Voraussetzung
Die „eingefrorene und unbewegliche“ Produktion
Wer ist gerade besonders erfolgreich?
Für jedes Problem das richtige Werkzeug
Auftauen des verhärteten Status Quo
Mentale Vorbereitung auf weitere Schwierigkeiten
Ab heute nur noch agil?
Gründe für das „Ausklammern“ der eigenen Serienproduktion
Fähigkeiten zur agilen Projektumsetzung in der Serienproduktion
Nachwuchs für das Team
Was geschieht, wenn wir uns auf unseren Erfolgen ausruhen?
Beispiel: Wann ist ein Change-Prozess erfolgreich?
Resümee
Internationales Wachstum
Zusammenfassung
Einleitung
Internationalisierung im Transformations-Kontext
Warum internationalisieren?
Unbeabsichtigte Folgen der Internationalisierung
Vision und Auftrag
Führungsqualitäten
Umgang mit Vielfalt
Vertriebs- und Marketingstrategie
Geschäftstätigkeit
Finanz- und Rechnungswesen
Personal / Recht
Ist es das wert?
Persönliche Erfahrungen / Glossar der Begriffe
Die Renaissance im Supply Chain Management
Kommunikation, Information und Informationsfluss
Beschaffungsstrategie mit Umsetzungsplanung
Dispositive Materialflussoptimierung
Strategische Transformation in die Vertriebsdistribution
Resümee
Transformation Strategischer Einkauf und Schnittstellen
Einleitung
Rahmenbedingungen für einen strategischen Einkauf
Beispiel Eins: Transformation Einkauf und Schnittstellen
Ergebnisse der Transformation: Beispiel Eins
Beispiel Zwei: Aufbau eines Gruppeneinkaufs
Ergebnisse der Transformation: Beispiel Zwei
Beispiel Drei: Transformation im laufenden Projekt
Ergebnisse der „agilen“ Transformation: Beispiel Drei
Fazit aus den drei Transformationsbeispielen
Business Transformation: Post Merger Integration
Abstract
Ausgangslage
Umsatzplanung
Umsatzrealisation nach dem Handelsgesetzbuch (HGB)
Buchhalterische Mechanik bei Revenue Recognition
ASC 606 und Purchase Accounting
Notwendigkeit einer Kostenrechnung
Fertigungsplanung
Unternehmenskulturen – Grundsätzliche Anmerkungen
Personelle Verstärkung
Resümee
Business Transformation in Operations & Process Management
Abstract
Einführung
Strategisches Management als Basis
Skill-Management und Training in der Transformation
Risikomanagement
Prozess-Management in der „Business Transformation“
IT-Transformation als Teil der „Business Transformation“
Case Studies aus meiner Praxis
Case-Study einer Restrukturierung
Fazit, Lessons Learned aus diesem Beitrag
Die ewige Transformation
Abstract
Der Begriff der Transformation
Was treibt ein Unternehmen zu einer Transformation?
Die Rolle der IT in einer Business Transformation
Die IT heute, morgen und übermorgen
Die Rolle des Interim Manager
Resümee
Zwei Praxisbeispiele für gelungene Business Transformation
Einführung
Allgemeine Begriffsfindung
Teil I: Chirurgie-Instrumente-Hersteller
Erkenntnisse aus der dreitägigen Analyse
Schlüsselpunkte und Ansätze der Verbesserungen
Umgesetzte Problemlösungen und deren Ergebnisse
Resümee beim Chirurgie-Instrumente-Hersteller
Teil II: Premium Tiefkühl-Pizza-Hersteller
Erkenntnisse aus der 3-Tage-Analyse
Mögliche Stellschrauben für eine Effizienzsteigerung:
Umgesetzte Problemlösungen
Resümee
Schlusswort
Unternehmenskrisen: Meistens hausgemacht
Einführung
Woher kommen Verluste, woher Gewinnbeiträge?
Führender Ladenbauer Food mit Expansionsdrang
Größere Offset- und Digitaldruckerei mit sinkenden Umsätzen
Modemarke mit Expansionsdrang
Europaweit führender, PE-finanzierter Großhändler
Cash is King: Ach ja, da war doch noch was
Krisenvermeidung und Krisenmanagement
Zusammenfassung
Business Transformation: Best Practice, Tools und Tipps
Abstract
Was ist eine Business Transformation?
Key Field: Reframing
Key Field: Revitalizing
Key Field: Restructuring
Key Field: Renewing
Resümee
Autorenverzeichnis
Dr. Harald Schönfeld
Jürgen Becker
Eckhart Hilgenstock
Dr. Bodo Antonić
Udo Fichtner
Rudi Grebner
Michael Gutowski
Stefan Löffler
Manfred Richter
Rolf Marcus Schuss
Dr. Detlef Weber
Falk Janotta
Rainer Simko
Lothar Hiese
Susanne Möcks-Carone
Bücher im DC Verlag
Besondere Empfehlung für alle Interim Manager
Fachbücher „Von Interim Managern lernen“
Sachbücher
Über Diplomatic Council
Über United Interim
Vorwort
Es gibt keine anderen Führungskräfte als Interim Manager, die im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und so viele verschiedene unternehmerische Herausforderungen kennenlernen. Daher wurde es höchste Zeit, eine eigene Buchreihe „Von Interim Managern lernen“ aufzulegen, um dieses geballte Know-how zu bündeln und einer breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen.
Das Diplomatic Council (DC), ein globaler Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen (UNO), hat sich hierzu United Interim (UI), das führende Netzwerk qualifizierter Interim Manager im deutschsprachigen Raum, zum Partner gewählt. Die beiden Herausgeber der Buchreihe, Dr. Harald Schönfeld und Jürgen Becker, sind zugleich die Gründer und Geschäftsführer von United Interim; sie kennen daher dieses Marktsegment besser als irgendjemand anderes. Dieses Wissen gepaart mit einem langjährig entwickelten, vertrauensvollen und persönlichen Verhältnis zu praktisch allen qualifizierten Interim Managern von Relevanz im deutschsprachigen Raum gewährleistet, dass in der Buchreihe „Von Interim Managern lernen“ tatsächlich nur die Besten der Besten zu Wort kommen.
Dieses geballte Know-how stellen wir einmal mehr im Band „Interim Manager berichten aus der Praxis: Business Transformation“ zur Verfügung. Das ist kein Zufall – es gibt wohl keine Branche von Bedeutung, die nicht von massiven Umstellungen betroffen ist. In den meisten Fällen geht es dabei nicht um alltägliche Anpassungen, wie sie mit jeder Geschäftstätigkeit verbunden sind, sondern um fundamentale Umwälzungen, die es zu bewältigen gilt. Die dazu notwendige Business Transformation ist häufig schon schwer zu erkennen; sie erfolgreich umzusetzen, ist in der Regel noch um ein Vielfaches schwieriger.
Vor diesem Hintergrund erscheint das vorliegende Buch genau zum richtigen Zeitpunkt, um den Entscheidungsträgern in der Branche mit klugem und vor allem praxiserprobtem Rat zur Seite zu stehen. Noch besser: Wer über den Rat hinaus tatkräftige Unterstützung bei Strategie und/oder Umsetzung benötigt, kann die in diesem Buch vorgestellten Interim Manager direkt ansprechen. Die Profile inklusive Kontaktdaten befinden sich in der Sektion „Über die Autoren“ am Ende des Werkes. Denn alle, die in diesem Buch zu Wort kommen, sind nicht in erster Linie Autoren, sondern es sind vor allem Interim Manager, die eben nicht nur mit Rat, sondern insbesondere auch mit Tat zur Seite stehen.
In diesem Sinne wünsche ich dem neuen Band einen guten Start, mögen die geneigten Leserinnen und Leser ein Maximum an Nutzen aus der Lektüre ziehen. Mein Dank gilt den Interim Managern, die sich die Zeit genommen haben und bereit sind, ihr profundes Know-how in diesem Werk darzustellen, und natürlich den beiden Herausgebern, die sich um die hohe Qualität aller Beiträge verdient gemacht haben.
Hang Nguyen
Generalsekretärin Diplomatic Council
Von Interim Managern lernen
Einführung von Jürgen Becker und Dr. Harald Schönfeld, beide Gründer und Geschäftsführer der UnitedInterim GmbH
„Es ist eine Kunst, wie professionelle Interim Manager Menschen und Organisationen in dynamischen Märkten durch Prozesse der Veränderung führen, sie dabei stärken und ihnen konkret in ihrem Praxisalltag an der Seite stehen, bis sie ihre definierten Ziele erreicht haben. Dann geht es weiter zum nächsten Mandanten.“
Interim Manager: Was ist das und worum geht es?
Zeiten voller Krisen und kaum vorhersehbarer „Schwarzer Schwäne“ wie Corona-Pandemie, Ukrainekrieg oder Energiepreisentwicklung sind voller Herausforderungen. Natürlich ist es dabei wichtig, Themen wie Liquidität und Kosten im Blick zu haben. Doch gerade in Zeiten, in denen eine „VUCA-Welt“ immer sichtbarer wird, sind Unternehmen in einzigartiger Weise gefordert, sich ständig zu wandeln und Antworten auf neue Zukunftsfragen zu finden. In dynamischen, sich immer schneller verändernden Märkten wird die zügige und sichere Umsetzung von Veränderungen zu einem erfolgskritischen Faktor.
Angesichts all der Veränderungen ist die Fähigkeit eines Unternehmens, sich selbst zielgerichtet anzupassen – sich zu „transformieren“ – notwendig. Das ist jedoch etwas, das auf der Managementseite andere oder zusätzliche Arbeitskapazitäten und Kompetenzen erfordert, als bewährte und in der Vergangenheit erfolgreiche Prozesse und Routinen in immer weiter optimierender Weise auszuführen: manchmal auch nur für eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Phase oder einen definierten Zeitraum.
Der erste Engpass liegt – vor allem im Mittelstand – häufig bei den Kapazitäten: Bewährten Führungskräften im Hause können nur selten neben ihrem Tagesgeschäft noch weitere Projekte auf die Schultern gelegt werden. Die Managementkapazitäten sind zumeist „auch schon so“ komplett ausgereizt. Der zweite Engpass betrifft das Wissen: Gerade bei neuen Themen sind aktuelles Know-how oder eine Spezialkompetenz notwendig. Beides muss zügig im Unternehmen verankert werden, denn der Markt wartet selten. Aufwändige und zeitintensive Weiterbildungen oder die Rekrutierung spezialisierter Experten am Arbeitsmarkt sind nicht immer die Lösungen der Wahl, wenn die Zeit drängt.
An dieser Stelle kommen Interim Manager ins Spiel: als Experten für die Gestaltung und Umsetzung von Transformationen. Das Besondere an ihnen sind nicht nur der zeitliche Faktor, also eine Tätigkeit „ad interim“, und die kurzfristige Verfügbarkeit mit einem Projektstart innerhalb weniger Tage. Hinzu kommt ihre in vielen Berufsjahren und vielen Projekten erworbene Erfahrung,
was in der Praxis – und nicht nur in Hochglanzbroschüren oder auf den bunten Charts von Consultants – wirklich funktioniert, und
wie die betreffenden Menschen und Organisationen dorthin gelangen, und zwar möglichst sicher (Quality), möglichst zügig (Time), bei vertretbarem Aufwand (Costs) – und möglichst nachhaltig in der Wirkung.
Es gibt wohl kaum eine Berufsgruppe, die mehr über die betriebliche Praxis weiß als Interim Manager. Weil sie im Laufe ihres Berufslebens viele verschiedene Unternehmen sowie unterschiedliche Situation und Herausforderungen kennen lernen, stellte ihre Erfahrungen und ihr Know-how einen wahren Schatz dar. Bei Transformationen, bei denen im Alltag durchaus Emotionen, „innere Welten“ und Unternehmenspolitik eine Rolle spielen, profitieren ihre Auftraggeber vor allem von
ihrer neutralen und nur der Aufgabe verpflichteten Sichtweise,
ihrer Nicht-Eingebundenheit in politische Konstellationen, „Seilschaften“ oder gar „Königreiche“,
den fehlenden Karriereinteressen in eigener Sache,
einer besonderen, projektorientierten Arbeitsmethodik in Veränderungsprozessen, und
einem vertrauensbildenden Track Record, ähnliche Aufgaben an anderer Stelle bereits mehrfach erfolgreich bewältigt zu haben.
Wird all dies kombiniert mit
aktuellem Wissen rund um das Fachthema (erworben unter anderem durch kontinuierliche Weiterbildung), und
einer Sensibilität für die vorliegende Unternehmenskultur mit der Fähigkeit, in den Worten die passende Ansprache und im Handeln das notwendige Vorbild sein zu können,
dann prädestiniert es sie geradezu, ein wichtiger oder gar federführender Teil der Erfolgsstory von Transformationsprozessen zu sein.
Es soll dazu noch ergänzt werden, dass Interim Manager, die Transformationsprozesse erfolgreich für andere umsetzen, auch für sich selbst die Kompetenzen bzw. persönliche Reife entwickelt haben müssen, die Spannungen, Konflikte, Diskussionen und Unsicherheiten auszuhalten, die Veränderungen mit sich bringen. Meist stehen persönliche Erlebnisse hinter den Kompetenzen. („Habe ich selbst auch schon erlebt – Ich kann nachfühlen, wie es Ihnen jetzt geht“.) Das kann im Hinblick auf eine Vorbild- bzw. Führungsfunktion – insbesondere für Mitarbeitende, die in unsicheren Zeiten durchaus Empathie und Orientierung schätzen – zusätzliche Sicherheit und Vertrauen geben, einen neuen Weg zu beschreiten.
Interim Manager unterstützen Unternehmen indes nicht nur bei der Umsetzung „normaler“ Transformationen rund um definierte Themen oder Ziele. Sie können ebenfalls – quasi projektbegleitend und als Zusatznutzen – für nachhaltige Resilienz sorgen. Dazu gehört das bewusste Einbauen von Redundanzen und Sicherheitsnetzen in die Prozesse. Oder sie fördern die Entwicklung von Antifragilität: Das betrifft die Fähigkeit von Unternehmen, als Ergebnis von Schocks, Volatilität, Fehlern, Störungen, Angriffen oder Ausfällen zu wachsen und zu gedeihen. Dazu gehört der Mut, bisherige Wege zu verlassen, zu lernen und sich auf Neues in all seiner Unsicherheit einzulassen.
In den meisten Fällen kann ein Interim Manager sein Wissen zudem an das Team weitergeben und dafür sorgen, dass der interne Kompetenzaufbau zügig und praxisbezogen klappt. Gutes Interim Management beinhaltet damit noch einen ganz pragmatischen Know-how-Transfer on the job. Das betrifft nicht nur neues fachliches Wissen. Mitarbeitende und Kollegen in der Unternehmensführung, die einen Transformationsprozess zusammen mit einem Profi durchlebt haben, lernen rund um vier Fragenkomplexe:
(1) Einstellung: Wie verhalten wir uns, wenn wir nicht mehr zielführende Gegebenheiten im Unternehmen feststellen? Wie gehen wir dabei mit liebgewordenen Routinen und Denkhaltungen um, die in der Vergangenheit durchaus erfolgreich waren, nun aber nicht mehr richtig weiterhelfen?
(2) Emotion: Wie können wir uns kontinuierlich emotional darin stärken, uns auf Neues (durchaus nicht ungeprüft) einzulassen? Wie erarbeiten wir uns dabei ein notwendiges Maß an innerer Sicherheit und wie können wir dies spüren?
(3) Methodik: Wie erweitern wir unseren Werkzeugkasten im Management um Methoden, die Anforderungen einer zunehmend sichtbar werdenden VUCA-Welt systematisch in unserem Unternehmen zu verankern, auch wenn das gegebenenfalls im ersten Schritt zusätzliche Arbeit und Investitionen betrifft?
(4) Zukunftssicherung und Erwartung weiterer Veränderungen über die heute zu lösende Situation hinaus (Prävention): Wie sorge ich für nachhaltige Resilienz und Antifragilität im Unternehmen – auch wenn das in einem Quartal Geld kostet? Was kann ich vielleicht mit kleinem Aufwand schon heute gleich mitmachen?
Interim Manager: Spezialisierte Experten für die Umsetzung
Den Begriff „Interim Manager“ gibt es im deutschen Sprachraum seit mehr als 40 Jahren. In dieser Zeit haben sich die Aufgabenstellungen und Rollen natürlich verändert, für die Interim Manager engagiert werden – ebenso wie die Kompetenzen und Qualifikationen, die notwendig sind, um Mehrwert zu erzielen und langfristig erfolgreich zu sein. Standen am Anfang in erster Linie die Restrukturierung und Sanierung sowie Projekte auf oberster Unternehmensebene im Vordergrund, die hauptsächlich von Männern kurz vor oder nach der Pensionierungsgrenze durchgeführt wurden, so ist es heute eine vielfältige, bunte Mischung an Themen geworden. Interim Manager sind zudem in ihrer Gesamtheit weiblicher und jünger geworden. Die vielen Projekte im Personalbereich – eine statistisch überwiegend weibliche Domäne – stehen als Beispiel für zunehmend mehr Frauen, die sehr erfolgreich als Interim Manager tätig sind.
Die Online-Ausgabe des Gabler Wirtschaftslexikons gibt folgende Definition (Interim Management, 2018):
Beim Interim Management arbeiten selbstständig tätige Interim Manager für einen definierten Zeitraum (üblicherweise 3-18 Monate) i.d.R. in unternehmerischer Verantwortung in einem Unternehmen in einer Führungsposition der ersten und zweiten Ebene. Interim Manager werden in unterschiedlichen Situationen und Aufgabengebieten eingesetzt, z.B. zur Überbrückung bei unvorhersehbaren Vakanzen beim Ausfall einer Führungskraft, zur Restrukturierung und Sanierung, im Projektmanagement, zur Einführung neuer Programme oder bei der Gründung, Übernahme oder Veräusserung von Unternehmen.
In der Unternehmenspraxis werden Interim Manager zunehmend als Teil der gesamtwirtschaftlich immer bedeutsamer werdenden und stark wachsenden Gruppe der Freelancer und dabei als Teil des Marktes für „Freelance Management Dienstleistungen“ betrachtet. In die gleiche Richtung zielt die DDIM (Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V.) als führender Wirtschafts- und Berufsverband für Interim Management in Deutschland. Interim Management wird dort als eigenes Angebotssegment im Markt der Management Dienstleistungen bezeichnet, welches sich von der Nachbarbranche der Unternehmensberatung in der Art des Service unterscheidet (DDIM, Branchenprofil, 2020):
„Während Unternehmensberatungen einen externen, unabhängigen Service bieten, bei dem die Entscheidungsbefugnis und -verantwortung beim Auftraggeber verbleiben, arbeiten Interim Manager in der Regel in unternehmerischer Verantwortung im Mandanten-Unternehmen. Für einen definierten Zeitraum werden sie zum integralen Bestandteil des internen Teams. Interim Manager arbeiten freiberuflich und auf eigenes Risiko. Sie werden in Führungspositionen der ersten und zweiten Ebene eingesetzt.“
Eine andere Begriffsdefinition rückt den „Markenkern des Interim Managers“ in den Blickpunkt. Sie wurde am 1. Juli 2022 von den Verbänden der deutsch sprechenden Länder (DDIM, DSIM, DÖIM, VRIM, AIMP) auf dem „6. Gipfeltreffen der Interim Management Branche“ in Luzern gefunden und sogar in der aktuell viel verwendeten „gender-gerechten“ Sprache und Grammatik formuliert (Schädler, 2022):
Interim Manager:innen sind führungserfahrene und umsetzungsstarke Problemlöser:innen. Sie stehen einem Unternehmen zeitnah für spezifische Aufgaben und auf begrenzte Zeit zur Verfügung. Sie schaffen unternehmerischen Mehrwert.
Einsatzfelder/Besonderheiten beim Einsatz von Interim Managern
Ihren Kundennutzen bringen Interim Manager in allen Phasen des Lebenszyklus von Unternehmen ein. So gibt es Interim Manager, die vor allem bei der Unterstützung von jungen Unternehmen tätig sind, Interim Manager, die sich auf Wachstumsthemen und Transformationen spezialisiert haben, und Interim Manager, die sich geradezu auf „Krisen“ oder gar die „Beerdigung“ von Unternehmen spezialisiert haben. In allen Phasen jedoch sind viele Interim Manager in der Überbrückung von Vakanzen tätig. Gerade weil in der Praxis die beiden mittleren Phasen in der Regel die längste Zeit des Lebens eines Unternehmens ausmachen, sind diese Phasen besonders „arbeitsreich“ für Interim Manager.
Abbildung: Einsatzfelder von Interim Managern in unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklus von Unternehmen. Quelle: Becker / Schönfeld / Singer (2022).
Aus Sicht der Praxis des Interim Managements formuliert ein erfahrener und in der Branche mehrfach ausgezeichneter Interim Manager, Ulvi I. Aydin, die folgenden Unterschiede in der Tätigkeit zum „normalen“ Management (Handelsblatt vom 7.8. 2022):
„Interim Manager haben schon unzählige Unternehmen von innen gesehen und erkennen sehr schnell Muster und Pain Points – in Prozessen, Bilanzen, der Organisation, der Kultur, etc. Ihre Einarbeitungszeit ist damit sehr gering, und sie können in kürzester Zeit Mehrwert für das Unternehmen schaffen. Auch bringen Interim Manager keinen Ballast aus der Vergangenheit mit. Sie sind nicht in unternehmenspolitische Machenschaften verstrickt und haben auch nicht vor, im Unternehmen aufzusteigen und Konkurrenten auszustechen. Sie haben eine klare Mission. Ist diese erfüllt, sind sie wieder weg. Sie stellen also kein Risiko für interne Manager da. Als Macher sind Interim Manager immer im „Hands-On“-Modus. Sie suchen keine Entschuldigungen oder Schuldigen, sondern praktikable Lösungen und Ansätze. Sie entwickeln Konzepte in wenigen Wochen, nicht wie in den meisten Unternehmen üblich, erst nach Monaten. Sobald ein Konzept freigegeben ist, machen sich Interim Manager mit den bereitgestellten Ressourcen an die Umsetzung.»
Interim Manager können als Freelancer im Management bezeichnet werden. In der Praxis haben sie vor allem mit Beratern einige Überschneidungen. Der wesentliche Unterschied wird darin gesehen, dass Interim Manager ihren Fokus auf die operative Umsetzung oder Durchsetzung von meist unternehmerisch bedeutsamen Maßnahmen legen. Diese können durchaus auf Empfehlungen aufsetzen, die vorher von einem Berater gegeben wurden – oder von dem Interim Manager selbst, der vorher eine Analyse gemacht hat. Es ist auch nicht mehr nur die erste oder zweite Ebene, auf der Interim Manager tätig werden. Einsätze in Projekten, zum Beispiel zu Change- oder Transformationsthemen, für die eine hochwertige Expertise notwendig ist, umfassen inzwischen ein gutes Drittel der Gesamtumsätze im Interim Management-Bereich (AIMP, 2022). Tendenz steigend!
Buchreihe mit praxisorientierten Umsetzungsexperten
Mit der Buchreihe „Von Interim Managern lernen“ wird das Know-how von praxisorientierten Umsetzungsexperten erstmals gebündelt. Nach „Automotive“ und „Maschinen- und Anlagenbau“ ist dieser Band zu „Business Transformation“ bereits der dritte in dieser überaus erfolgreichen Reihe.
Die sorgfältige Auswahl der Autoren durch die Herausgeber stellt sicher, dass in dieser Reihe nur die „Besten der Besten“ mit Themen zu Wort kommen, die aktuell rund um „Business Transformation“ brennen; aus jedem Fachgebiet und aus jeder fachlichen Perspektive immer nur einer. Alle Interim Manager vereint jedoch das Streben nach operativer Exzellenz für ihre Kunden: Es geht um eine Steigerung der Performance, die Verbesserung der Wertschöpfung des Unternehmens, eine erhöhte Rentabilität und damit um eine nachhaltige Zukunftssicherung des Unternehmen! All das sind Anliegen von Unternehmen, für die Interim Manager engagiert werden.
„Es ist es so, als ob ich für mich selbst einen Personal Trainer engagiere: Die Sicherheit steigt, die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Ich muss dabei natürlich auch Themen anpacken, bei denen ich mir selbst im Weg stehe. Aber meist entdecke ich dabei auch noch Potentiale, an die ich bisher noch nie gedacht hatte.“
Freuen wir uns damit auf die einzelnen Beiträge dieses Sammelbandes. Sie bilden ein breites Spektrum unterschiedlicher Herausforderungen, Aufgaben, Erfahrungen und Impulse professioneller Interim Manager in der Praxis betrieblicher Transformationen. Auch wenn wir, die Herausgeber, mit allen Autoren schon seit Jahren persönlich-professionell bekannt sind und ihre berufliche Entwicklung als Interim Manager verfolgen konnten, haben wir bei der Durchsicht der Fachbeiträge und den Diskussionen dazu viel gelernt! Dafür danken wir – und wünschen es auch dem Leserkreis.
Dem Diplomatic Council (DC) sind wir seit einigen Jahren freundschaftlich und aktiv verbunden. Wir engagieren uns gerne in dieser Organisation, die einen globalen Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen, ein weltweites Business Network und eine gemeinnützige Charity Foundation vereint. Auf diese Weise können gemeinsam mit allen nationalen und internationalen Mitgliedern Synergien gehoben werden, wie es sonst kaum möglich wäre!
Die Herausgeber
Jürgen Becker und Dr. Harald Schönfeld
Im Oktober 2022
Quellen:
AIMP (2022). AIMP-Arbeitskreis Interim Management Provider. AIMP-Providerumfrage 2022: https://www.aimp.de/aimp-umfragen/aktuelle-aimp-umfragen
Aydin, Ulvi, I. (19.04.2022). "Wer mich holt, erhält einen Klartexter." – Interim-Manager Ulvi I. Aydin zeigt Kante. Webseite Handelsblatt https://www.handelsblatt.com/adv/firmen/ulvi-i-aydin.html
Becker, J. / Schönfeld, H. / Singer, G. (2022): Karriere-Handbuch für Interim Manager. Erfolg als Freelancer im Management. Zweite aktualisierte und ergänzte Auflage
DDIM (2020). Branchenprofil. Webseite Dachgesellschaft Deutsches Interim Management https://www.ddim.de/interim-management/fuer-unternehmen/branchenprofil/
Interim Management (2018). Gabler Wirtschaftslexikon - Online Lexikon: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/interim-management-52714/version-275829
Schädler, K. (21.07.2022). 6. Gipfeltreffen und 1. Schweizer Forum für Interim Management. https://rheintal-interim.org/6-gipfeltreffen-und-1-schweizer-forum-fuer-interim-management/
Business Transformation ist der einzige Schritt in die Zukunft
Eckhart Hilgenstock, Interim Executive (EBS), Interim Manager des Jahres 2012 (AIMP), Top Interim Manager im Manager Magazin 10/2021 und in Capital 01/2022
Hadern Sie noch oder transformieren Sie schon?
Warum Business Transformationen der einzige Schritt in die Zukunft sind
Seit Jahren wird über Transformation geredet. Ein Blick auf deutsche Unternehmen offenbart aber: Getan wird verhältnismäßig wenig. Dabei ist eine zielgerichtete Business Transformation der einzige Schritt, um in Zukunft marktfähig zu bleiben. Was sollten Unternehmen heute tun?
Kopf aus dem Sand
Der Trendforscher Franz Kühmeyer schrieb in der Trendstudie Hands-on Digital (2018): „Es ist immer das Gleiche: Während in vollmundigen Reden die disruptiven Geschäftsmodelle der digitalen Ökonomie bewundert werden, reicht der Mut in der eigenen Organisation für einen Durchbruch nicht aus.“ 1Transformationsvorhaben gehen oftmals nicht über die Digitalisierung analoger Prozesse hinaus – zu wenig, um in Zukunft noch oben mitzuspielen. Zaghafte digitale Gehversuche waren vor zehn Jahren vielleicht noch angebracht. Diese Phase des Herantastens muss aber spätestens seit der Coronakrise vorbei sein. Verantwortliche müssen ihren Kopf aus dem Sand ziehen und mehr Unternehmergeist aufbringen!
Ich frage Sie als Unternehmer:in ganz direkt: War die Pandemie auch für Ihr Unternehmen ein Katalysator? Welchen Turbo hat er gezündet? Mehr als Home-Office und von analog auf digital? Glauben Sie, dass Ihr Geschäftsmodell auch in fünf Jahren noch funktioniert? Woran machen Sie das fest? In meiner Arbeit als Interim Manager für digitale Struktur- und Organisationsentwicklung sehe ich immer wieder: Viele Unternehmen hierzulande unterschätzen den Veränderungsdruck. Oftmals stecken sie noch in den digitalen Kinderschuhen. Dabei sollten sie schon viel weiter sein – denn die Dynamik in der Welt nimmt nicht ab. Entwicklungen und Trends gehen weiter. Geht Ihr Unternehmen mit?
Unternehmerisches Denken erforderlich
Die wirtschaftlichen Herausforderungen kennen Sie: Lieferengpässe, geopolitische Krisen, zunehmende Ressourcenknappheit, Fachkräftemangel, Klimawandel, Digitalisierung. Mit diesen Veränderungen einher gehen ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft sowie neue Kunden- und Mitarbeiteranforderungen an Unternehmen – B2C wie B2B. Immer häufiger stellen Kunden, Partner und junge Mitarbeiter:innen die Sinnfrage: Wofür das alles? Und die Antwort lautet nicht „Geld und Einkommen“. Das Finanzielle ist nur noch ein Parameter unter vielen. Eine gesunde Umwelt und eine nachhaltige Infrastruktur, sauberes Wasser und reine Luft gehören ebenfalls dazu. Die Prinzipien der Gemeinwohlökonomie rücken zunehmend in den Vordergrund – und tragen maßgeblich zur Kaufentscheidung bei.2 Wirtschaftet ein Unternehmen nachhaltig? Weiß ein Unternehmen, unter welchen Bedingungen seine Güter hergestellt werden?
Die Sharing Economy (Ökonomie des Teilens) ist weiter auf dem Vormarsch. Vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit verlieren Besitz und Eigentum in vielen Bereichen ihre Relevanz. Mehr zu besitzen bedeutet nicht, ein besseres Leben zu haben. Wichtig ist das Wissen, dass wir Zugang zu bestimmten Produkten oder Services haben, sobald wir sie benötigen. Ein niedliches Beispiel hierzu stellt die Nachbarschaftsplattform FragNebenan.de dar, wo sich Nachbarn gegenseitig Werkzeug und ähnliches leihen. Ein prominentes Beispiel ist Carsharing, E-Scooter und Fahrräder: Nicht jeder Mensch benötigt ein eigenes Fortbewegungsmittel – warum teilen wir nicht die Nutzung? Der Gedanke der Sharing Economy geht Hand in Hand mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das World Economic Forum hat im Jahr 2020 das erste Mal nur Umweltthemen unter die Top 5 größten Risiken für die Menschheit eingestuft.3 Alle Ressourcen, die unser Planet im Jahr 2020 reproduzieren konnte, waren bereits im Juli desselben Jahres aufgebraucht. 2022 hat Deutschland diesen Punkt bereits im Mai erreicht! Zero-CO2-Ausstoß und die Wiederherstellung von Ressourcen werden zum unumgehbaren ökonomischen Kriterium. Das macht sich auch im Kundenverhalten bemerkbar: Immer mehr Menschen kaufen nur noch von Unternehmen, die ein klares Nachhaltigkeitskonzept haben. Nachhaltigkeit ist somit zu einem gewinnrelevanten Wirtschaftsfaktor geworden.
Was verändert sich für Unternehmen?
Sinn, teilen, Natur: Das sind wichtige Entwicklungstendenzen, die Unternehmen in ihren zukünftigen Geschäftsmodellen berücksichtigen müssen. Was tragen Sie für die Gesellschaft bei? Worin liegt der höhere Sinn Ihres Unternehmens? Können Sie Produkte, Lösungen und Services zum Zeitpunkt der Nutzung bereitstellen? Wie bringen Sie die Ressourcen, die Sie verbrauchen, zurück in die Natur? Oder noch besser: Wie schaffen Sie einen positiven Effekt für die Natur? Ein schönes Beispiel ist Viva con Aqua, das sich zum Ziel gesetzt hat, jedem Menschen sauberes Wasser zugänglich zu machen.
Für Unternehmen hat also in den letzten Jahren eine Verschiebung der Prioritäten stattgefunden – kunden- und umweltgetrieben:
Aus der Wertschätzung für Verträge wurde die Wertschätzung der Geschäftsbeziehungen, gerade auch der persönlichen Beziehungen. Geschäft basiert auf Vertrauen, daher werden die handelnden Personen immer wichtiger.
Aus dem
Management von
Kunden und Partnern wurde das
Engagement mit
Kunden und Partnern.
Der Fokus hat sich vom Unternehmen auf Partnerschaften und Ökosysteme gedreht.
Aus purem Wettbewerb ist
Coopetition
(Kooperation und Wettbewerb) geworden.
Aus der Lieferung
eines
Produktes wurden komplexe Lösungen.
Aus Top-Down-Hierarchien und Command-and-Control wurden lokale, flache Hierarchien und Selbstorganisation.
Megatrends als Transformationstreiber
All diese Veränderungen und Tendenzen spiegeln sich auch in den Megatrends wider, die das Zukunftsinstitut identifiziert hat, darunter:
Individualisierung von ego zu eco
Individualisierung ist schon lange ein großes Thema. Doch hat sich dieser Trend weiterentwickelt. Heute steht das Ego im Kontext von Gemeinschaften und Beziehungen. In Zukunft wird es noch mehr um die Wechselwirkung von Individuum und Umwelt, bzw. Umfeld gehen. Communities spielen eine wichtige Rolle. Geschäftsformen wie Goldeimer, Share oder Viva con Agua gelingt es besonders gut, Community und Solidarität mit Profit und Dienstleistung zu verbinden. Für Marken liegt genau in dieser Verknüpfung die große Chance der Zukunft.
Neo-Ökologie
Konsum erfolgt zunehmend unter ökologischen und sozial-ethischen Aspekten. Der rote Faden ist der Trend zu mehr Lebensqualität. Damit eng verbunden sind die Themen Verzicht und Minimalismus. Die nächste Business Generation rückt gesellschaftliche Probleme in den wirtschaftlichen Fokus, um sie mit wirtschaftlichen Mitteln zu lösen. Diese Idee trifft besonders bei nachwachsenden Generationen auf Resonanz.
Konnektivität
Der enorme Komplexitätsanstieg durch immer vielfältigere vernetzte Geräte erhöht das Bedürfnis nach sogenannter Simplexity: Einfache, intuitive Zugänge zu komplexen technologischen Anwendungen. Im Zentrum digitaler Geschäftsmodelle steht eine möglichst nahtlose, individuell ansprechende User Experience. Nur wenn die Nutzerfreundlichkeit von Interfaces hoch ist, hat ein digitales Produkt eine Chance auf Erfolg. Um blinde Flecken aufzuhellen, ist es elementar, Digitalisierung nicht mit Technologie gleichzusetzen, sondern umfassender zu verstehen als technologisch vernetzte Kommunikation.
Diese Megatrends sind weitere Transformationstreiber, üben zusätzlichen Veränderungsdruck auf Unternehmen aus – und bieten gleichzeitig große Chancen, durch Transformation marktfähig zu bleiben. Die Frage, was der ideale Zeitpunkt für eine Transformation ist, lässt sich nicht so leicht beantworten. Transformationen können aus Druck heraus entstehen oder aber aus eigenem Antrieb. Letzteres ist anzustreben. Dabei spielt der Lebenszyklus des Marktes bzw. der Industrie eine wesentliche Rolle: Laut Corporate Finance Institute besteht dieser aus den Phasen Entstehung, Wachstum, Konsolidierung, Sättigung und Niedergang.4 Wichtig ist es, frühzeitig in der Wachstumsphase darüber nachzudenken, was als nächstes kommt. Welche Transformation bringt das Unternehmen voran und sichert Arbeitsplätze?
Disruptionen können jeden treffen
Fest steht: Wer Veränderungen und Trends im Markt und anderen Branchen ignoriert und sein Business nicht daran ausrichtet, hat schon bald keine Chancen mehr in dieser unberechenbaren VUCA-Welt. VUCA steht für „Volatility“ (Volatilität), „Uncertainty“ (Unsicherheit), „Complexity“ (Komplexität) und „Ambiguity“ (Mehrdeutigkeit). Digitalisierung ist dabei nicht das Ziel, sondern das einzige Mittel zum Zweck. Und dieser besteht aus nachhaltigen, zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. Verschlafen Sie den Wandel nicht! Niemand möchte sein Unternehmen auf einer Liste mit den ganzen Kodaks, Nokias oder Digital Equipments sehen, die den an ihnen vorbeirasenden „Change-Express“ verpasst haben. Disruptionen können heute jeden treffen – und oftmals kommen sie von unsichtbaren Startups oder aus fremden Branchen.
Tesla hat die Automobilindustrie aufgemischt: Batterieentwicklung und Software waren zu Beginn innovativ und unerreichbar. Elon Musk hat mit den Tesla-Ladesäulen eine eigene Infrastruktur geschaffen. Mit all diesen Disruptionen ist das US-amerikanische Unternehmen zu einem global relevanten Player aufgestiegen – noch lange, bevor die EU entschieden hat, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft haben wird. Tesla hat die gesamte Automobilindustrie revolutioniert – und die großen deutschen Hersteller endlich aus dem Dornröschenschlaf geweckt.
Die Macht der Plattformen
Digitale Disruption entsteht vor allem durch Plattformen, die die Anbieter- und Interessentenseite zusammenbringen. Airbnb verbindet Unterkunftssuchende mit Unterkunftsanbietern, Amazon verbindet Konsumenten mit Händlern – um nur zwei Beispiele zu nennen. Zumindest im B2B-Plattformbereich haben deutsche Unternehmen noch gute Chancen, oben mitzuspielen. In den letzten Jahren ist die Startup-Welt auch in Deutschland stark gewachsen. Allerdings fehlt Investoren oftmals der Mut, in neue Plattformen zu investieren. Dabei sind Plattformen für die Shareholder ein lukratives Geschäftsmodell, sobald sie funktionieren. Anfangs muss ein großer Ressourcenaufwand betrieben werden, um Nutzer auf die Plattform zu locken, da ohne User auch die beste Plattform nutzlos ist. US-Investoren scheuen den initialen Ressourcenaufwand nicht, denn sie wissen: Mit Ressourcen, der Bereitschaft zu unternehmerischem Risiko und den passenden Ansätzen können sie mit Plattformen ein sehr profitables Geschäftsmodell aufziehen.
Wenn sich branchenfremde Anbieter mit einer B2B-Plattform zwischen Hersteller- und Abnehmerseite schieben, rutschen die Hersteller in der Wertschöpfungskette ab. Wohin das führen könnte, beschreibt die Deloitte-Studie „Maschinenbau 2030“ 5 für eben diesen Sektor anschaulich. Eines der vier Zukunftsszenarien mündet in den Sieg der US-amerikanischen und asiatischen Tech-Unternehmen am Markt: Die größte Wertschöpfung wird durch digitale Servicelösungen „beyond the product“ erzielt, die indes von den branchenfremden Softwareanbietern kommen. Der Maschinenbau wird zum Zulieferer ohne direkten Zugang zu Kunden- und Maschinendaten – und muss mit Anbietern aus Fernost in den Wettbewerb treten. Die digitalen Wachstumsmärkte bleiben ihm weitestgehend verschlossen.
Als Unternehmen haben Sie somit schon zwei triftige Argumente, warum Sie sich transformieren und innovative Businesslösungen entwickeln sollten: zum ersten die Lukrativität von Plattformen als digitales Geschäftsmodell, und zum zweiten die drohende Degradierung in der Wertschöpfung, wenn Sie dieses Potenzial branchenfremden Firmen überlassen. Eine Transformation gelingt natürlich nicht über Nacht. Sie ist ein langer Weg mit Hürden und Herausforderungen. Darum ist es hilfreich, starke Allianzen zu schmieden und ein Ökosystem interdisziplinärer Akteure aufzubauen, die gemeinsam an einem Zukunftsthema arbeiten. Wenn Sie beispielsweise Maschinenbauer sind und nicht über genug Knowhow oder Ressourcen verfügen, um im Alleingang eine Plattform auf die Beine zu stellen, könnten Sie sich Partner suchen und Kooperationen auf Augenhöhe eingehen.
Innovative Geschäftsmodelle
Digitalisierung ermöglicht Unternehmen die Entwicklung ganz neuer Angebote. Allen voran digitale Services. Das Industrial Internet of Things (IIoT) macht es beispielsweise möglich, im ersten Schritt ein Condition Monitoring als neuen Service zu implementieren, der den Zustand eines Produktes, einer Maschine oder eines ganzen Maschinenparks überwacht. Im nächsten Schritt könnte ein weiterer Service aus Predictive Maintenance bestehen: Sensoren in der Maschine, der Anlage oder im Gerät melden automatisch, wann eine Wartung notwendig ist, um hohe Reparaturkosten und lange Ausfallzeiten zu reduzieren.
Ebenso macht die Digitalisierung innovative Geschäftsmodelle möglich. Da heutzutage oftmals unbekannt ist, wie sich die Auftragslage entwickelt, scheuen Unternehmen hohe Kapitalausgaben (CapEx). Also bieten sich Geschäftsmodelle wie Payper-Use, Leasing/Subscription/Abo oder Outcome-based an, weil Unternehmen die Kosten flexibel gestalten können – und eher niedrige operative Fixkosten haben (OpEx). Ein B2C-Beispiel stellen Auto-Abos dar, die immer populärer werden.
Daten: Das Öl des 21. Jahrhunderts
Software und Datenerhebung spielen eine immer entscheidendere Rolle. Dabei sind wir erst am Anfang der Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Unternehmen sollten die heutigen technologischen Möglichkeiten nutzen, Daten über ihre Produkte erheben und analysieren zu können – um aus den gewonnenen Erkenntnissen digitale Servicelösungen für Kunden zu entwickeln. Wenn Sie es nicht tun, kommt im Worst-Case ein Tech-Unternehmen und stellt sich mit digitalen Servicelösungen zu Ihren Produkten zwischen Sie und Ihren Kunden. Darum kann ich nur raten: Entwickeln Sie eigene Plattformen – entweder allein oder im Ökosystem.
Transformation im Automobilsektor
Um herauszustellen, wie eine Business Transformation hin zur digitalen Plattform aussehen kann, wenden wir den Blick auf den Automobilsektor: Ein großes Trendthema dort ist das ACES-Auto. Das Kürzel steht für Autonomous, Connected, Electrical, Shared Car. Die Entwicklung hin zu elektrischen Fortbewegungsmitteln ist jedem in der Europäischen Union auch mit gesetzlichen Regelungen vor Augen geführt worden. Niemand in Deutschland zweifelt momentan daran, dass in Zukunft E-Autos auf den Straßen zu sehen sein werden. Selbst das Thema Wasserstoff als Fahrzeugantrieb ist noch nicht vom Tisch.
Weltweit arbeitet die Automobilindustrie an vernetzten Fahrzeugen, die untereinander und mit anderen Verkehrsteilnehmern (Fahrradfahrern, Fußgänger) über das Internet kommunizieren – also Daten austauschen können, etwa um Unfälle zu verhindern. Dafür reduzieren Hersteller und andere die Anzahl der Steuereinheiten in den Fahrzeugen – auch wenn bisher fast nur Tesla mit einer einzigen Steuereinheit auskommt. Nur integrierte Daten und Funktionen können die Verbindung von Fahrzeugen untereinander gewährleisten. Voraussetzung ist ein lückenloses, schnelles Netz, also mindestens 5G. Um die Zeitverzögerung bei der Übertragung, die sogenannte Latenz, zu verkürzen, wird unter anderem daran geforscht, Daten von einem Fahrzeug direkt zum anderen zu übertragen. Ein anderer Ansatz wäre Fog-Computing, also dezentrale Minirechenzentren – sozusagen die Cloud für den Nahbereich. Noch existiert keine Lösung für Echtzeit-Datenübertragung ohne Verzögerung über die Cloud – auch daran wird gearbeitet. 5G ist aktuell das Werkzeug dazu. Automotive-Unternehmen arbeiten an neuen Services, die Fahrer:innen abonnieren können, um komfortabler unterwegs zu sein. Dazu gehören zum Beispiel die Hotelsuche und -buchung in der Nähe und die temporäre Zuschaltung bestimmter Fahrzeugoptionen mit einer Abonnementfunktion. Auch hierbei stellt die sichere Datenübertragung mit minimaler Verzögerung eine große Herausforderung dar. Im Fahrzeug verbaute Sensoren müssen von Anfang an abgesichert sein. Eine nachträgliche Cybersicherung birgt das Risiko, dass bis dahin bereits ein erfolgreicher Hacker-Angriff stattgefunden haben könnte.
Die größte Herausforderung stellt das autonome Fahren dar. Sie kennen vielleicht das oftmals skizierte moralisch-ethische Dilemma: Ein autonom fahrendes Auto muss vor einem heranrasenden Lkw ausweichen. Doch links steht eine ältere Dame und rechts ein kleines Kind. Wofür entscheidet sich der „Roboter auf Rädern“? Die rechtlichen Implikationen, wenn ein Fahrzeug autonom fährt und etwas passiert, sind nahezu komplett bearbeitet. Es fehlt noch die letzte Gesetzesgrundlage, um autonomes Fahren in der Masse zu ermöglichen. Die ersten Fahrzeuge haben die Erlaubnis der „Stufe 3“ bis 120 Stundenkilometer erhalten: Dabei fährt das Fahrzeug hochautomatisiert und erlaubt es dem Fahrer, sich zeitweise abzuwenden. Mercedes hat als erster Hersteller die weltweite Zertifizierung erhalten, autonomes Fahren auf Level-3 anzubieten.
Level-5 erfordert ein flächendeckendes 5G-Mobilfunknetz. Auf dieser Stufe darf das Fahrzeug auch ohne Passagier und Fahrer fahren. Entsprechende Versuche laufen nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Deutschland. Künstliche Intelligenz und Machine Learning haben dabei neue Möglichkeiten geschaffen. Level-5 ist das höchste Level, das erreicht werden kann. Viele Hersteller gehen davon aus, dass autonomes Fahren auf diesem Level-5 in absehbarer Zeit möglich ist – und somit das ACES-Car Realität wird.
Neue cross-industrielle Geschäftsmodelle – ein Zukunftsszenario mit Aston Martin
Aus diesen Technologien (5G, Connected Cars, IIoT, ACES, etc.) können die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle entstehen. Sie ermöglichen einen nahezu grenzenlosen Blue Ocean innovativer Lösungen und öffnen die Tore zu völlig neuen Wachstumsmärkten. Ich möchte Sie nun auf eine Reise in die nahe Zukunft der Automobilindustrie mitnehmen – und ein kleines fiktives Szenario skizzieren:
ACES ist Realität und verändert unser Fahr- und Reiseverhalten im Auto. Viele Menschen möchten ihre Reisezeit im Auto effektiv nutzen – wie zuvor im Zug oder Flugzeug. Die Anbieter wollen ihren Kunden einen Mehrwert bieten und für eine entspannte Atmosphäre auf der autonomen Autofahrt sorgen. Der legendäre britische Sportwagenhersteller Aston Martin ist eine ikonische und luxuriöse Marke mit enormer Strahlkraft. Die Marke zeichnet hohe Qualität, herausragende Sportwagen und eine starke Gemeinschaft treuer Fahrer:innen aus. Die Community potenzieller User für eine digitale Plattform ist also schon vorhanden. Eine gute Ausgangslage!
Die Verantwortlichen von Aston Martin entscheiden sich, ACES als Geschäftschance zu nutzen, um die Plattform A-Time & Travel by Aston Martin aufzubauen. Die Plattform soll alle ACES-Stakeholder zusammenbringen, sozusagen das „Amazon von ACES“ werden. In der Phase, in der gute Gewinne mit reifen Produkten erwirtschaftet werden, investieren die Briten in die nächste Innovation – getreu dem McKinsey-Modell der drei Horizonte.6
Selbst mit der treuen Community liegt eine Herausforderung der Plattform darin, zu Beginn genügend Interessenten und Anbieter zusammen zu bringen, so dass alle Kundenwünsche erfüllt werden können und die Plattform beinahe von allein wächst. In dieser Situation darf sich Aston Martin nicht vom alten Businessmodell beeinflussen lassen oder darauf Rücksicht nehmen. Vielmehr gilt: Kannibalisieren Sie Ihr eigenes Geschäftsmodell, bevor es andere tun! Die digitale Transformation des Verlagshauses Axel Springer 7 oder des Stahlhändlers Klöckner8 machen deutlich, wie hilfreich die eigene Kannibalisierung sein kann.
Zurück zur Plattform von Aston Martin: Wie sieht diese in etwa aus? Interessenten geben Ihr Reiseziel an – und können ergänzen, was sie während der Fahrt gerne machen möchten: Einen Online-Kurs besuchen, Immobilienobjekte screenen, die nächste Urlaubsreise planen und buchen, Klamotten shoppen, eine Maniküre während der Fahrt und so weiter. Der Anbieter bietet diesen Service während der Fahrt an. Ab einem bestimmten Waren- oder Servicewert übernimmt er die kompletten Reisekosten. Die Plattform sorgt also dafür, dass sich Anbieter und Interessenten finden und einen Vertrag bzw. eine Verabredung mit geeigneter juristischer Absicherung schließen. Dabei können Treffen sowohl virtuell als auch persönlich stattfinden. Abhängig vom Umsatzvolumen erhält A-Time & Travel eine Kommission von ein bis fünf Prozent des erzielten Auftragseingangs. Bei geringen Auftragswerten wird eine zusätzliche Servicegebühr fällig. Denkbar ist auch eine ergänzende Finanzierung durch Werbung – lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!
Parallel zur Plattform gründet Aston Martin einen weiteren Geschäftsbereich: Die Bereitstellung der konfigurierbaren Hardware, also der Fahrzeuge, die den Plattform-Usern bereitgestellt werden. Die Fahrzeuge sind konfigurierbare, leicht veränderbare ACES-Autos, die mit wenig Aufwand dem gebuchten Service angepasst werden können.
Ökosystem Partner: Der Schlüssel zum Erfolg
In dem fiktiven Szenario kreiert ein Autohersteller eine Plattform. Allein kommt er damit aber nicht weit. Wichtig für eine funktionierende Plattform sind neben den Usern die Partner im Ökosystem, die den gemeinsamen Erfolg erst möglich machen, wie zum Beispiel:
ACES-Hersteller wie Aston Martin und andere,
Cloud Provider,
Servicepartner, die die Wagen vorbereiten oder die Software für die automatische Konfiguration erstellen und warten,
Fahrzeugservice und Support,
Plattformentwickler, die Prozesse, IT, Apps und Services bereitstellen,
und so weiter.
Es gibt zwar keine einheitliche wissenschaftliche Definition eines Business-Ökosystems, allerdings liegen ihm in der Regel folgende Charakteristiken zugrunde: Ein Ökosystem besteht aus einer Vielzahl an Geschäftspartnern aus unterschiedlichsten Branchen, deren Beziehung auf Kooperation statt auf einer Ownership liegt – und deren Zahl stetig wachsen kann9. In unserem fiktiven Beispiel wäre es also durchaus denkbar, dass einige der Ökosystempartner sich an den Aufbaukosten der Plattform beteiligen. Es gibt unterschiedliche Wege, Teil eines interessen- oder themenbasierten Ökosystems zu werden:
den Verkaufskanal anbieten,
Zugang zu Kunden / Märkten gewähren,
Produkte oder Services anbieten,
ein Teilangebot bereitstellen, wie zum Beispiel Zahlung,
der Treiber dessen sein, wie zum Beispiel Amazon.
Die Werkzeuge der Transformation
Sich verändernde Marktbedingungen verlangen einen Wandel der Business- und Operating-Modelle. Dafür gibt es Werkzeuge. Da wir in diesem Fall von Business Transformationen sprechen, sollten Sie vor allem Tools zu Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle nutzen – wobei sich jede Transformation auch auf die Strategie-, Prozess-, Technologie-, Personal- und Kulturebene bezieht. Sie haben vermutlich schon vom Business Canvas und vom Trend Canvas Model gehört? Das Business Model Canvas (BMC) ist fast schon zum Standard geworden, wenn es um die Planung eines Geschäftsmodells geht. Das BMC bildet die neun wichtigsten Bausteine eines Geschäftsmodells in einer Darstellung ab. Dazu gehören:
Kundensegmente,
Wertangebot / Leistung,
Kanäle,
Kundenbeziehungen,
Einkommensströme,
wichtigste Ressourcen,
wichtigste Aktivitäten,
wichtigste Partner,
Kostenstruktur.
Das darauf aufbauende Modell von Alexander Osterwalder und Patrick Stähler konzentriert sich noch stärker auf die wesentlichen Bestandteile eines Geschäftsmodells: die Geschäftsstruktur, die Value Proposition, das Ertragsmodell und den Unternehmergeist.
Abb. 1: Geschäftsmodell-Mapping nach Dr. Patrick Stähler.
Wer sich mit diesem Modell auseinandersetzt, erhält Klarheit und Struktur für das neue Geschäft – und eine Argumentationsgrundlage für Partner- und Investorengespräche. Bei Geschäftsmodellinnovation geht es darum, offen gegenüber neuen Ansätzen zu sein und von anderen Unternehmen und Branchen zu lernen. Oftmals basieren Geschäftsmodellinnovationen auf bereits existierenden Business Models – sie sind Adaptionen auf andere Branchen oder Märkte. Ein Beispiel für letzteres wäre die Personentransport-Plattform Cabify, das „spanische Uber“, das sich auf dem spanischen sowie einigen Lateinamerikanischen Märkten gegenüber dem US-Pendant Uber durchgesetzt hat – mit genau demselben Geschäftsmodell. Ein Beispiel in Deutschland wäre Zalando, das einfach das Business Model von Zappos aus den USA kopiert und an den europäischen Markt angepasst hat. Beispiele für dasselbe Geschäftsmodell in anderen Branchen sind die schon erwähnten Abo- oder Subscripton-Modelle, beispielsweise bei Netflix, LinkedIn, Spiegel Online oder dem Dollar Shave Club.
Innovationen können auch aufgrund technologischer Entwicklungen und neuer Marktperspektiven entstehen. Die Gründer der Online-Bank N26 beispielsweise kommen nicht aus dem klassischen Finanzsektor. Sie wollten eigentlich eine Taschengeld-App entwickeln, aus der dann die Idee entstand, ein neues Format „Bank“ zu entwickeln – ohne physische Filialen. N26 hat nicht das gesamte Bankensystem verändert – sondern mithilfe von Technologie-Anwendung den Zugang für Bankkunden zu ihren Finanzen erleichtert.
Der Entstehungsprozess neuer Geschäftsmodelle
Der Prozess hin zu neuen Geschäftsmodellen kann unterschiedlichste Züge haben. Was Verantwortliche bei Transformationen oftmals nicht verstehen, ist, dass eine Organisation altes Knowhow, Prozesse, Strukturen und Technologien auch wieder ent-lernen muss, um Platz für neue Ansätze, Denk- und Handlungsweisen zu schaffen. Dieses Ent-Lernen (englisch: organizational forgetting) sollte möglichst frühzeitig im Entstehungsprozess neuer Business Models stattfinden. Darum rate ich in der Regel, folgende Schritte zu gehen:
Abb. 2: Schritte eines Geschäftsmodell-Innovationsprozesses
Verstehen:
Zunächst sollten Verantwortliche mit Kunden sprechen und Erkenntnisse daraus ableiten. Nur wer den Markt versteht und die Megatrends auf dem Radar hat, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigen, kann Innovation schaffen. Ein Blick auf andere Märkte und deren Disruptionen ist dabei ebenfalls hilfreich, um Erkenntnisse für die eigene Organisation und Branche abzuleiten.
Ent-lernen:
Die Technologie entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit. Um hier auf dem neuesten Stand zu sein, müssen Unternehmen verstehen, wie sie mit obsoletem Wissen umgehen sollten. Es gilt, altes Wissen zu identifizieren und sich schrittweise davon zu lösen. So schaffen Organisationen Raum für neues Wissen. Wer sich nicht vom obsoleten Wissen und gar Strukturen löst, droht nach der Transformation noch Schattenorganisationen zu haben: Mitarbeitende, die weiter mit dem alten Wissen umgehen und in den alten Prozessen weiterarbeiten.
Ideenfindung:
Hierbei geht es darum, erste Geschäftsideen zu entwickeln und zu validieren. Nutzerversprechen, Wertschöpfungsarchitektur und Ertragsmodelle werden entworfen, diskutiert und verfeinert.
Design:
Im nächsten Schritt kommt das Business Model Canvas zum Einsatz. Neue Geschäftsmodelle werden designt – auch vor dem Hintergrund der Frage: Was würde ein Unternehmen tun, das uns vom Markt verdrängen möchte? Alle Beteiligten sollten die Abhängigkeiten innerhalb der neuen Geschäftsmodelle überprüfen, um mögliche Schwachstellen frühzeitig zu kennen oder zu beheben.
Auswahl & Prototyp:
Ist die Designphase abgeschlossen, werden die erfolgversprechendsten Geschäftsmodelle ausgewählt. Die Entwickler bauen und testen Prototypen als Minimum Viable Product – also ein Produkt mit ausreichenden Funktionen, um frühe Kunden anzulocken und eine Produktidee in einem frühen Stadium des Produktentwicklungszyklus zu testen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein physisches Produkt handelt oder um ein Online-Produkt wie zum Beispiel eine Plattform. Die User-Tests und der Businessplan werden dokumentiert.
Umsetzen & Lernen:
Im letzten Schritt kann das Unternehmen die Geschäftsmodelle implementieren, die sich im Early-Bird-Kundenmarkt bewährt haben. Wichtig ist, kontinuierlich Kundenfeedback einzuholen und das Produkt andauernd zu optimieren. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung erfolgt in kurzen Feedbackschleifen und in enger Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und weiteren Stakeholdern.
Eine Transformationsarchitektur entwickeln
Für eine erfolgreiche Transformation des Geschäftsmodells sollten Verantwortliche Antworten für die folgenden zwei Fragen parat haben:
1. Wie können wir in Zukunft flexibler auf Marktschwankungen reagieren?
2. Wie fördern wir unsere Mitarbeitenden in den von McKinsey und dem Stifterverband als „Future Skills“ definierten Kompetenzen, wie: Kreativität, Mut, Resilienz, Selbstverantwortung und digitales Knowhow? 10
Die Antworten auf diese Fragen münden in der Organisationsstruktur. Ein Unternehmen kann sich nur kulturell, organisational und prozessual neu ausrichten, wenn es die Strukturen zulassen. Peter Drucker hat gesagt: „Kultur isst Strategie zum Frühstück“. Brian Robertson, Erfinder der Holacracy, ergänzte passend: „Struktur isst Kultur zum Lunch“. Um eine wandlungsfähige Organisation zu erreichen, sollte die Transformationsarchitektur Ihres Unternehmens folgende Bausteine haben:
flache Hierarchien,
kurze Entscheidungswege,
schlanke und digitalisierte Prozesse,
selbstorganisiert und fachübergreifend arbeitende Mitarbeitende,
interdisziplinärer Wissenstransfer,
digitale Serviceleistungen und Kundenerlebnisse,
ein professionelles Datenmanagement,
agiles Controlling,
kontinuierliche Feinjustierung.
11
Der Wandel hin zu digitalen Geschäftsmodellen gelingt nur mit den Menschen. Angefangen beim Management, das veränderungsfähig und -willig sein muss – und sich kritisch selbst reflektiert: Wo sind unsere eigenen Ängste? Wo die eigenen Defizite? Was müssen wir loslassen können? Was müssen wir lernen? Welche unterstützenden Leitplanken setzen wir für unsere Mitarbeitenden ein? Die Mitarbeitenden tragen einen wesentlichen Teil zum Transformationserfolg bei. Gehen sie nicht mit, so scheitert das Veränderungsvorhaben. Darum sollten Verantwortliche sie fördern, fordern und befähigen, den Wandel mitzugestalten und mitzutragen. Wie kann so eine Mitarbeiterbefähigung aussehen?
Selbstorganisierte Teams
Agilität und Selbstorganisation sind zwei Schlagworte, die wir heute häufig hören. Bei der Frage, wie agil Unternehmen wirklich sind, klaffen Wahrnehmung und Wirklichkeit oftmals auseinander. Denn es ist ein großer Unterschied, ob ein Unternehmen agile Methoden nutzt („doing agile“) oder ob es flächendeckend eine agile Organisationsstruktur etabliert hat („being agile“). Laut der BearingPoint-Studie „Agile Impulse 2022“ stufen zwar bemerkenswerte 96 Prozent der befragten europäischen Unternehmen die Relevanz von Agilität als sehr hoch ein – und immerhin 75 Prozent nutzen agile Methoden. Allerdings werden die mit Agilität angestrebten Ziele noch nicht übergreifend erreicht, da Agilität nicht ganzheitlich etabliert sei.12 Einen Grund sehen die Autoren in der Fehlannahme vieler Führungskräfte, ihr gesamtes Unternehmen sei mit der Einführung agiler Methoden bereits agil.
Agilität, das agile Mindset, können Verantwortliche in den Köpfen der Mitarbeitenden indes verankern, ohne das Buzzword „Agile“ ständig zu nutzen. Wie? Indem sie den Teams, je nach Reifegrad, einfach mehr Selbstverantwortung übertragen. Die Führungskraft von heute delegiert nicht mehr oder gibt Arbeitsschritte vor. Sie definiert in Abstimmung mit dem Team Ziele und Termine zur Erreichung dieser Ziele. Sie steckt wenige Leitplanken ab, innerhalb derer sich das Team frei bewegen kann. Wie die Menschen zum Ziel gelangen, ist ihnen überlassen. Die Führungskraft hält ihren Teams den Rücken frei, räumt ihnen Steine aus dem Weg, so dass sie möglichst selbstorganisiert arbeiten können. Ob der Führungsstil nun „Democratic Leadership“, „Servant Leadership“, „Transformational Leadership“ oder „Agile Leadership“ heißt, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden sich selbst organisieren können und wollen.
Ein Pionier-Unternehmen, das mit selbstorganisierten Teams schon in den 1980er Jahren die eigene Performance verbessert hat, ist der französische Automobilzulieferer FAVI. Der damals frischgebackene CEO Jean-François Zobrist stellte seit 1983 die stark hierarchische Organisationsstruktur auf viele kleine selbstorganisierte Teams um. Sein Motto: Vertrauen statt Kontrolle. Die Mitarbeitenden waren dadurch viel motivierter, konnten sich noch stärker mit dem Unternehmen identifizieren und steigerten die Performance. Nach Zobrists Ausscheiden im Jahr 2004 ging diese Kultur des Vertrauens bedauerlicherweise wieder verloren.13
Dennoch: Wer die Intelligenz der gesamten Gruppe nutzt, erhält oftmals kreativere Lösungswege. Je vielfältiger ein Team zusammengesetzt ist, desto größer ist die Chance auf kreative Lösungen, denn: desto unterschiedlicher sind die Perspektiven, aus denen eine Herausforderung betrachtet wird. Ein sehr inspirierender Klassiker zum Thema Selbstorganisation ist das Werk „Reinventing Organizations“ von Frédéric Laloux (2014). Laloux schrieb über die drei Durchbrüche von evolutionären Organisationen:
Selbstführung:
„Evolutionäre Organisationen funktionieren vollständig ohne Hierarchie“14, für viele Führungskräfte zunächst beängstigend. „Sie haben den Schlüssel gefunden, um die Funktionsweisen von komplexen adaptiven Systemen, wie man sie in der Natur kennt, auf Organisationen zu übertragen.“15 Interessant ist, dass dies ebenfalls der Resilienz hilft.
Ganzheit:
Hier geht es darum, dass sich der gesamte Mensch einbringt, also nicht nur die Person in ihrer Rolle als Mitarbeitende, sondern eben auch als Privatmensch. Das ist besonders den jüngeren Mitarbeitenden wichtig. Für sie sind Nachhaltigkeit, soziales Engagement und Gemeinwohl immens wichtig. Oder anders ausgedrückt: Softskills sind die neuen Hardskills. Ganzheit führt schnell zur Sinnerfüllung.
Vertrauen:
Vertrauen ist wichtiger als Kontrolle. Das führt auch dazu, dass Mitarbeitende besonderes Engagement an den Tag legen, wenn es notwendig ist. Dafür dürfen sie sich auch bestimmte Freiheiten nehmen, wenn sie dies anschließend möchten. Produktivitätsgewinne sind nahezu die Regel auf dem Weg zur Selbstorganisation.
Selbstorganisation bedeutet nicht, „alle machen, was sie wollen“. Auch Agilität bedeutet nicht „Unstrukturiertheit und Anarchie“. Im Gegenteil: Selbstorganisation und agiles Arbeiten funktionieren nur, weil sie klaren Strukturen folgen. Laloux schrieb: „Selbstführung arbeitet genauso wie das herkömmliche Pyramidenmodell, das dadurch ersetzt wird, mit einem ineinandergreifenden System von Strukturen, Prozessen und Praktiken. Dieses System bestimmt, wie die Rollen definiert und verteilt werden, Entscheidungen getroffen, wie die Rollen definiert und verteilt werden, die Gehälter festgelegt, wie die Mitarbeiter eingestellt oder entlassen werden usw.“16
Der Weg zur Selbstorganisation
Der Weg hin zur Selbstorganisation ist lang. Es ist durchaus sinnvoll, zunächst mit der Einführung erster Methoden und Werkzeuge einer agilen Vorgehensweise zu beginnen. Die Einführung von Sprints, Daily Standups und Retrospektiven sind die ersten Schritte, gefolgt von einem Backlog. Das ermöglicht Ihren Teams schon mehr Flexibilität. Nur: Belassen Sie es nicht dabei. Wenn sich Ihre Teams die Automatismen agiler Methoden angeeignet haben, können Sie den nächsten Schritt gehen. Beispielsweise, indem Sie Skalierungsframeworks nutzen, um Agilität und selbstorganisierte Strukturen auch auf Programmebene oder höher einzuführen. So wird Ihr Unternehmen mittelfristig resilienter gegenüber unvorhersehbaren Krisen – und bleibt auch im Sturm auf Kurs.
Resümee: Transformieren Sie sich in die Zukunft!
Unsere Wirtschaftswelt dreht sich immer schneller. Neue Technologien, disruptive Geschäftsmodelle und unvorhersehbare Krisen sorgen für eine nie dagewesene Dynamik am Markt. Heute kann ein Team 20-jähriger Studierender aus einer Garage heraus über Nacht die Geschäftsmodelle ganzer Branchen obsolet machen. Halten Sie daher nicht an Ihren liebgewonnenen Strukturen und Prozessen fest! Verlassen Sie Ihre Komfortzone. „Kill your Darlings“, wie man im Theater so schön sagt. Eine Transformation schafft neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Nutzen Sie diese!
Transformation beginnt immer in den Köpfen. Angefangen in den obersten Managementetagen. Verantwortliche müssen die Rahmenbedingungen schaffen und Prioritäten setzen. Hat eine Transformation keine Priorität, wird sie nicht stattfinden. Die Führungsteams sollten als Unterstützer, Möglichmacher und Vorbilder auftreten – und die Mitarbeitenden mitnehmen. Hadern Sie nicht – sondern transformieren Sie Ihr Unternehmen in die Zukunft!
1 Vgl.: Kühmeyer, F. et. al. (2018): Hands-On Digital. Agenda für digitale Kompetenz. Zukunftsinstitut. Link:
https://onlineshop.zukunftsinstitut.de/shop/hands-on-digital/ (aufgerufen: 11. August 2022).
2 Vg.: https://web.ecogood.org/de/ (aufgerufen: 11. August 2022).
3 Vgl.: World Economic Forum (2020): The Global Risks Report 2020. Link: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf (aufgerufen: 11. August 2022).
4 Vgl: Corporate Finance Institute (2022): Industry Life Cycle. Link:
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/industry-life-cycle/ (aufgerufen: 11. August 2022).
5 Vgl.: Deloitte (2021): Wachstumsmotor Maschinenbau. Vier Szenarien für eine erfolgreiche Zukunft in 2030. Link:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/energy-resources/deloitte-ch-de-wachstumsmotor-maschinenbau.pdf (aufgerufen: 11. August 2022).
6 Vgl.: McKinsey (2009): Enduring Ideas: The three horizons of growth. Link: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-three-horizons-of-growth (Aufgerufen: 11. August 2022).
7 Vgl.: Burgelman, R., Müffelmann, J. (2016): Die digitale Transformation von Axel Springer. In: Heinemann, G. et. al. (Hrsg., 2016): Digitale Transformation oder digitale Disruption im Handel. Springer Gabler, Wiesbaden.
8 Vgl.: Etventure (2019): Klöckner vs. Stahlindustrie – Disruption ist überall. Download-Link: https://www.etventure.de/cases/kloeckner-co/ (aufgerufen: 11. August 2022)
9 Vgl. Reeves, M. et. al. (2019): How Ecosystems Raise (and often Fall). MIT Sloan Management Review, 60 (4). S. 1 ff., Link:
https://sloanreview.mit.edu/article/how-business-ecosystems-rise-and-often-fall/(aufgerufen: 10. August 2022)
10 Vgl.: Stiftervand & McKinsey (2021): Future Skills 2021 – 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel. Link: https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021 (aufgerufen: 10. August 2022).
11 Vgl.: Hilgenstock, E., Kuhle, P. (2021): Mit dieser Transformationsarchitektur gelingt der Wandel. Springer Professional. Link:
https://www.springerprofessional.de/change-management/transformation/mit-dieser-transformationarchitektur-gelingt-der-wandel/18970346 (aufgerufen: 10. August 2022).
12 Vgl.: BearingPoint (2022): Doing Agile vs. Being Agile – agile Impulse, die Agilitätsstudie. Link:
https://www.bearingpoint.com/files/BearingPoint_Studie_Agile_Pulse_2022.pdf?download=0&itemId=971714 (aufgerufen am 11. August 2022).
13 Vgl. : Zobrist, J.-F. (2018): La belle histoire de FAVI. L’enterprise qui croit que l’homme est bon. Editions Humanisme & Organisations, Paris.
14 Laloux, F. (2014): Reinventing Organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Editions Diateino, Paris.
15 Ebd.
16 Ebd.
So werden Menschen und Unternehmen resilient
Dr. Bodo Antonić, Interim Manager, Krisen-Spezialist
Einführung
Als Interim Manager bin ich zumeist auch Krisenmanager. Werde ich geholt, ist die Lage häufig aus dem Ruder gelaufen: Menschen agieren plan- und kopflos, Prozesse stocken, Kunden wenden sich ab, Lieferketten brechen, Liquidität versiegt. In allen diesen Fällen gilt es entschlossen gegenzusteuern. Doch in einer Welt, in der Krisen immer häufiger, immer heftiger und immer schneller aufeinander folgen, reicht Krisenmanagement alleine nicht aus. Es braucht Mittel und Wege, um Menschen und Organisationen generell widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen.
Für mich als Interim Manager, der in der Regel geholt wird, wenn irgendwo im Unternehmen der Karren im Dreck steckt und dort wieder herausbewegt werden muss, ist die Krise so etwas wie mein ständiger Begleiter. Ich habe in gut 20 Jahren Managementeinsätzen auf Zeit gelernt, mit Krisen umzugehen, sie als alltäglich hinzunehmen, und sogar einen Wert in ihnen zu erkennen. Dennoch verblüfft selbst mich, wie sich Krisen immer stärker in unseren Alltag und in unser Bewusstsein schieben. Die beiden letzten Jahrzehnte erscheinen im Rückblick als Aneinanderreihung von Krisen, die in Ausmaß und Frequenz im ausgehenden 20. Jahrhundert im Grunde nicht vorstellbar waren.
Krisen sind das neue Normal
Da gab es 2001 „Nine-Eleven“, den islamistischen Anschlag auf die Twin Towers in New York. Er läutete eine Ära von Angst und Schrecken in westlichen Gesellschaften ein, die immer häufiger von Terror heimgesucht wurden. Im Jahr 2008 brach die Lehman-Bank ein und sorgte für eine weltweite Finanzkrise, die nicht nur die Realwirtschaft, sondern sogar ganze Staaten, in den Abgrund zu ziehen drohte.
2015, durchaus unter dem Einfluss beider Krisen, kam es zur sogenannten Flüchtlingskrise. Tausende Migranten aus den Kriegs- und Hungergebieten der Südhalbkugel machten sich auf den Weg nach Europa. Ohne Plan und unabgestimmt reagierten die Staaten in einer Mischung aus Willkommenskultur und Abschottung, Integration und Push-Back. Die tiefliegenden Ursachen dieser Migration und die damit einhergehenden Herausforderungen sind alles andere als bewältigt, sie schwelen weiter und können jederzeit neue Krisen hervorrufen.