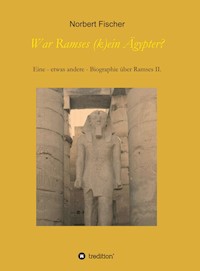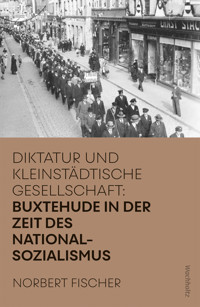
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wachholtz Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende, reich bebilderte Werk stellt erstmals die Geschichte des Nationalsozialismus in Buxtehude dar. Auf Basis archivalischer Quellen analysiert Norbert Fischer Gesellschaft, Alltag, Ereignisse und Biografien. Besonderes Augenmerk gilt den Opfern der Diktatur. Der Zweite Weltkrieg brachte neuerliches Leid, tausende Hamburger Bombenflüchtlinge und eine wachsende Zahl von Zwangsarbeiter:innen in die Stadt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NORBERT FISCHER
DIKTATUR UND KLEINSTÄDTISCHE GESELLSCHAFT: BUXTEHUDE IN DER ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS
MIT EINEM EXKURS VONWOLFGANG SCHILLING
HERAUSGEGEBEN VON DERHANSESTADT BUXTEHUDE
INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT
EINLEITUNG
ÜBER DIKTATUR UND KLEINSTÄDTISCHE GESELLSCHAFT
KAPITEL 1
BUXTEHUDE UND ALTKLOSTER IN DER ZEIT VOR DEM NATIONALSOZIALISMUS
Stadt, Wirtschaft und Sozialtopografie zur Zeit der Weimarer Republik
Das politische Spektrum und Buxtehuder Honoratiorenschaften
Drei Frauen, Hitler und der Obersalzberg
KAPITEL 2
AUFSTIEG UND MACHTANSPRÜCHE DER NSDAP
„In Uniformen über die Dörfer …“
Das „Braune Haus“: Politische Auseinandersetzungen und einseitige Justiz
Auf dem Weg zur Buxtehuder Ortsgruppe der NSDAP
KAPITEL 3
RATHAUSBESETZUNG, SCHIKANEN UND TRAGÖDIEN: DIE ANFÄNGE DER DIKTATUR
Wüsthoff gegen Schlikker: Der Streit in der Presse zwischen Deutschnationalen und Nationalsozialisten
SA-Mann Glüer und die Besetzung des Buxtehuder Rathauses
Persönliche Tragödien: Bürgermeister Krancke – Stadtoberinspektor Bach – Gaswerksdirektor Schulz
KAPITEL 4
WIDERSTAND UND VERFOLGUNG
Sozialdemokraten und Kommunisten als Opfer: Die ersten „Schutzhaft“-Internierungen und die Rolle von SA und SS
Von der „Schutzhaft“ ins Konzentrationslager
Beispiele individueller Verweigerung
Die Rolle der Gestapo
Die KPD in der Illegalität und der Hochverratsprozess 1935
KAPITEL 5
GESELLSCHAFT UND ALLTAG UNTER DER DIKTATUR
Hakenkreuz, Hitlergruß und der fehlgeschlagene Boykott eines „jüdischen“ Geschäfts
Muttertag und Hitlereichen
Das Winterhilfswerk und der Eintopfsonntag
Ritualisierung der nationalsozialistischen Herrschaft
KAPITEL 6
DER NEUE BÜRGERMEISTER EDUARD GROSSHEIM UND SEINE ROLLE IN VERWALTUNG UND POLITIK
Kommunale Verwaltung und Nationalsozialismus
Großheims umstrittener Amtsantritt: Der Konflikt zwischen Gauleiter Telschow und Regierungspräsident Leister
Vom Rathaus in die Heil- und Pflegeanstalt: Die kurze Karriere des ersten nationalsozialistischen Bürgermeisters und SA-Mannes Werner Glüer
KAPITEL 7
PASTOR THIELBÖRGER, DIE BUXTEHUDER ST.-PETRI-KIRCHENGEMEINDE UND DER NATIONALSOZIALISMUS
Thielbörgers konfliktreicher Weg zum Superintendenten
Jugend- und Wohlfahrtsarbeit: Konkurrenz zwischen Kirche und Nationalsozialismus
Der Konflikt um die Herberge zur Heimat: Von kirchlicher Fürsorge zur Zwangsarbeiter-Unterkunft
KAPITEL 8
NS-„VOLKSGEMEINSCHAFT“ GEGEN „VOLKSSCHÄDLINGE“: DISKRIMINIERUNG – AUSGRENZUNG – VERFOLGUNG
Ausgrenzung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung
„Zigeuner wurden bei der Razzia nicht angetroffen“
Von der Wanderfürsorge zur „Asozialität“
Das Buxtehuder „Säuferbuch“ und die Stigmatisierung von Alkoholkranken
KAPITEL 9
TOD IN PFAFFERODE: NATIONALSOZIALISTISCHE „EUTHANASIE“-PRAKTIKEN UND ZWANGSSTERILISATIONEN
Der Leidensweg der Dorothea Schultz
Von der Familienpflege in die Tötungsanstalt
Weitere „Euthanasie“-Fälle und das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“
KAPITEL 10
SCHULE, BILDUNG UND KULTUR IN DEN 1930ER-JAHREN
Rektor Konopka und das Reformreal-Gymnasium: ein Deutschnationaler unter der Diktatur
„Buxtehuder Heimatbücher“ 1936: Wilhelm Marquardt, Heimatforschung und NS-Ideologie
KAPITEL 11
SPORTVEREINE UND SCHÜTZENGILDE
„Führerprinzip“ bei Sportvereinen: Die Zwangszusammenlegung 1935, Hermann Grotz und Johannes Langelüddeke
Schützenverein Altkloster und Schützengilde Buxtehude: Eine ungewollte Ehe
KAPITEL 12
STADTGESELLSCHAFT, WIRTSCHAFT UND NATIONALSOZIALISMUS: DAS HITLERJUGEND-HEIM ALS SYMBOL
Bürgermeister Großheims Prestigeprojekt des Hitlerjugend-Heimes und die städtischen Stiftungen
Ein Konflikt unter Buxtehuder Architekten
KAPITEL 13
ASPEKTE VON WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR
Wasserbau, Schifffahrt und Handel: Die Vision vom Hansa-Kanal und die Versandung der Este
Nationalsozialistische Landwirtschaftspolitik: Das Reichserbhof-Gesetz – Anerbengericht – Kreis- und Ortsbauernführer
Buxtehude als Marinestandort
Verschobene Infrastruktur-Projekte: Umgehungsstraße – Eingemeindungen – Waldfriedhof
KAPITEL 14
1939–1945: KRIEGSALLTAG, KRIEGSTOD UND DIE BUTEN-HAMBORGER
Rationierungen – Verdunkelungsvorschriften – Metallablieferungen
Tod und Trauer in der Stadt
1943: „Operation Gomorrha“ und der Zustrom der Buten-Hamborger
KAPITEL 15
DAS ENDE VON WELTKRIEG UND DIKTATUR
Bürgermeister Großheim und die Umstände seines Wechsels nach Stade
Der Bombenangriff vom 18. April 1945
Die Briten in Buxtehude
Zur Notaufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen
AUSBLICK
EXKURS VON WOLFGANG SCHILLING:
FREMDES LEID GANZ NAH – KRIEGSGEFANGENE, ZIVILARBEITER UND ZIVILARBEITERINNEN IN BUXTEHUDE
KAPITEL 16
EINFÜHRUNG
KAPITEL 17
STRUKTUREN DES EINSATZES AUSLÄNDISCHER ARBEITSKRÄFTE BILDEN SICH AUS (1939–1942)
Eine oft vergessene Gruppe – Tschechische Arbeitskräfte
„Feind bleibt Feind“ – Polnische Kriegsgefangene und Zivilarbeitende
Die französischen Kriegsgefangenen – Gefangenschaft und kein Ende
Arbeit zwischen Freiwilligkeit und Zwang: Die dänischen, niederländischen und belgischen Arbeitskräfte
Rassenideologische Vernichtung contra effektive Ausbeutung
KAPITEL 18
DIE ZWEITE PHASE – ZWANGSARBEIT IM RAHMEN DER KRIEGSWIRTSCHAFT
Zunehmender Ausbau von Zwangsarbeit und Repression
Zwangsarbeit hält Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen
Der Ausbau des Lagersystems
Diskriminierung, Verfolgung, Tod
KAPITEL 19
ZWANGSARBEIT IN BUXTEHUDE – EIN KURZES FAZIT
ANMERKUNGEN
QUELLENVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS
ORTS-, GEBIETS- UND PERSONENREGISTER
DANKSAGUNG
ÜBER DIE AUTOREN
GELEITWORT
Die vorliegende Studie von Prof. Dr. Norbert Fischer gibt erstmals einen breiten Überblick über die Geschichte des Nationalsozialismus in der Hansestadt Buxtehude. Damit ist sie als immenser Gewinn für die hiesige Stadtgeschichtsschreibung anzusehen – nicht nur, weil sie nach mehr als 90 Jahren nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten längst überfällig ist, sondern auch, weil sie in Zeiten, in denen die Demokratie verstärkt infrage gestellt wird, dazu beitragen kann, Rückschlüsse und Lehren aus der Geschichte zu ziehen.
In der Untersuchung gelingt es Norbert Fischer, anschaulich darzustellen, wie sich die Kleinstadt und deren Gesellschaft unter dem Eindruck der menschenverachtenden Diktatur massiv veränderte. Die allgemeinen politischen Entwicklungen stets im Blick, stehen zunächst die vordiktatorischen Verhältnisse, gewaltsame politische Auseinandersetzungen und die Machtergreifung bzw. -sicherung der Nationalsozialisten im Fokus. In den folgenden Kapiteln blickt der Autor unter anderem auf die Verfolgung missliebiger Personengruppen, stellt die Gleichschaltung von Stadtverwaltung und Vereinen dar, verweist auf die ideologisch motivierte Etablierung neuer Traditionen („Eintopfsonntag“), zeichnet Konfliktlinien innerhalb der städtischen Elite nach und thematisiert großangelegte Infrastrukturprojekte wie die Etablierung Buxtehudes als Militärstandort. Direkte und indirekte Auswirkungen des Krieges auf die Hansestadt werden am Ende ebenso beleuchtet wie die Befreiung Buxtehudes durch das britische Militär.
Ergänzend zu den Untersuchungen Norbert Fischers liefert Wolfgang Schilling, Mitarbeiter des Buxtehuder Stadtarchivs, einen Exkurs zur prekären Situation der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitenden. Sein Beitrag ist ebenfalls verdienstvoll, da auch hier erstmals grundlegende Informationen zur Thematik zusammengetragen werden.
Die Studie beabsichtigt einerseits, Interesse bei einem breiten Publikum zu wecken, und andererseits, der regional- und zeithistorischen Forschung einen wertvollen Beitrag zu bieten. Möge ihr beides beschieden sein.
Ihre Katja Oldenburg-Schmidt
Bürgermeisterin
EINLEITUNG
ÜBER DIKTATUR UND KLEINSTÄDTISCHE GESELLSCHAFT1
Die Zeit des Nationalsozialismus ist seit vielen Jahren Thema der Geschichtsforschung. Dies gilt für die nationale Ebene, größere Städte und Regionen sowie für zahlreiche Einzelaspekte der nationalsozialistischen Diktatur, ihrer Täter und Opfer, nicht zuletzt im Bereich der Holocaust-Forschung. Jedoch gibt es nur wenige Mikrostudien zu Kleinstädten mit ihren spezifischen Milieus und Netzwerken – und Buxtehude war zur Zeit des Nationalsozialismus mit seiner Wohnbevölkerung von knapp 7.000 definitorisch eine Kleinstadt (Stand 16. Juni 1933: 6.915 Einwohner:innen).2 Als Pionierarbeit gilt in diesem Zusammenhang bis heute das 2023 in Neuauflage erschienene Werk des US-amerikanischen Historikers William Sheridan Allen über das südniedersächsische Northeim.3 Aus neuerer Zeit und wegen der guten Vergleichbarkeit sowohl des kleinstädtischen Milieus als auch der Lage der Stadt innerhalb des Hamburger Umlandes ist die 2021 erschienene Studie zum holsteinischen Bad Oldesloe von Sylvina Zander zu nennen.4 Fast zeitgleich kam das Buch von Dirk Stegmann für das allerdings deutlich größere Lüneburg heraus – in beiden Fällen auch die Zeit der Weimarer Republik mit umfassend.5
Für den Landkreis Stade, zu dem Buxtehude seit 1932 gehört, erschien bereits zu Beginn der 1990er-Jahre eine von Hartmut Lohmann verfasste Geschichte des Nationalsozialismus.6 Hartmut Lohmann und Heike Schlichting lieferten 2023 eine grundlegende Übersicht zum Nationalsozialismus im Elbe-Weser-Raum.7 Henning Müllers ebenfalls 2023 abgeschlossene, noch unveröffentlichte Dissertation über die Zeit der Weimarer Republik im Elbe-Weser-Raum erbrachte für Buxtehude wichtige Erkenntnisse zur Vorgeschichte des Nationalsozialismus. Sie flossen in eine gemeinsam mit Michael Ehrhardt verfasste Übersicht zum selben Thema ein.8
In Buxtehude hingegen waren mehrere Initiativen gescheitert, Forschungen zur Geschichte des Nationalsozialismus auf den Weg zu bringen. Zwar wurde bereits Anfang der 1990er-Jahre ein entsprechendes Projekt geplant – Hartmut Lohmann begründete mit diesem Hinweis, dass er der Stadt Buxtehude in seinem erwähnten Buch zur NS-Zeit im Landkreis Stade nicht den eigentlich notwendigen Raum widmete. Zu diesem Projekt ist es aber trotz weiterer Anläufe in den folgenden knapp 30 Jahren nicht gekommen, daher dauerte das Forschungsdefizit bis Anfang der 2020er-Jahre an.
In dieser Hinsicht ist besonders bemerkenswert, welch verschwindend geringe Rolle die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in der lokalen Buxtehuder Geschichtsschreibung und die der umliegenden, inzwischen eingemeindeten Kommunen spielt. Selbst in der als Standardwerk betrachteten, 1993 in völlig neu bearbeiteter und stark erweiterter Auflage erschienenen Stadtgeschichte wird die Zeit des Nationalsozialismus praktisch nicht behandelt.9 Möglicherweise hängt dies auch damit zusammen, dass Personen, die mit dem Nationalsozialismus politisch-ideologisch aufs Engste verbunden waren, nach 1945 – mit nur geringen Verzögerungen – in wichtigen Funktionen weiterwirken konnten. Dies erweist sich zumal dann als besonders problematisch, wenn diese Personen direkt mit Dokumentation und Aufarbeitung der lokalen Geschichte zu tun haben. Hier ist beispielhaft zu erwähnen der (Ober-) Studiendirektor, Wehrturnsportleiter und Anführer des „Volkssturmes“, Johannes Langelüddeke: Er war ab 1949 noch für viele Jahre als städtischer Archivpfleger in Buxtehude tätig. Vor allem aber ist der Lehrer, Heimatforscher und nationalsozialistische Kulturfunktionär Wilhelm Marquardt zu nennen. Er vertrat, wie später zu dokumentieren sein wird, in seinen Texten teilweise fanatisch nationalsozialistische Ideologie und konnte dennoch – nach politisch bedingter Internierung nach Kriegsende – zum Abschluss seiner Laufbahn noch als Schulleiter in Immenbeck sowie danach auf vielfältige Weise in Ehrenämtern (unter anderem Kreisarchivpfleger im Landkreis Harburg) sowie als Autor wirken. In seiner 1983 von der Stadt Buxtehude herausgegebenen, fast 500-seitigen Geschichte der Buxtehuder Geestdörfer kommt die Zeit des Nationalsozialismus praktisch nicht vor.10 Nach seinem Tod wurde in einer Publikation des Buxtehuder Heimatvereines ein ausführlicher Nachruf veröffentlicht, der zahlreiche Verdienste, Stellen und Ehrenämter aufzählt, aber Marquardts zentrales Wirken im Nationalsozialismus nur knapp mit dem Hinweis auf seine NSDAP-Mitgliedschaft und seine Zuständigkeit für „Volkstum und Heimat“ im Gau Osthannover abhandelt.11
So war es letztlich dem anhaltenden, nachdrücklichen Engagement der früheren Stadtarchivarin von Buxtehude, Eva Drechsler, zu verdanken, dass das Projekt einer Geschichte des Nationalsozialismus von der Stadt finanziert, Mitte 2021 auf den Weg gebracht und im Jahr 2023 abgeschlossen werden konnte.
Im Ergebnis will das hier nun vorliegende Werk die Zeit des Nationalsozialismus über Strukturen, Ereignisse und Fallstudien sowie das Handeln (oder Nicht-Handeln) einzelner Akteur:innen darstellen. Letztere bedienten sich des Nationalsozialismus für ihre Karrieren in Politik, Gesellschaft, Schulwesen oder Kirche. So verschaffte sich der 1934 nach Buxtehude gekommene Bürgermeister und NSDAP-Ortsgruppenführer Eduard Großheim in der Stadt eine starke Stellung, bevor er kurz vor Kriegsende wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung versetzt wurde. Der Erste Pastor an der St.-Petri-Kirchengemeinde, Karl Thielbörger, war frühes NSDAP-Mitglied, propagierte den Nationalsozialismus von der Kanzel und konnte sich das ersehnte Amt des Superintendenten im Kirchenkreis sichern.
Andere litten unter dem Nationalsozialismus und wurden zu seinen Opfern. Der vor allem kommunistisch getragene Widerstand gegen die Diktatur im Untergrund war in Buxtehude erstaunlich weit verbreitet und zäh, was aus der starken Verankerung der Arbeiterbewegung vornehmlich in Altkloster resultierte (das seit 1931 zu Buxtehude gehört). Sozialdemokraten und Kommunisten wurden ab März 1933 systematisch verfolgt und mehr oder weniger lange inhaftiert. Darunter litt beispielsweise der Sozialdemokrat Wilhelm Geerken, der nach 1945 Buxtehuder Bürgermeister wurde. Zum Höhepunkt der Verfolgung politisch Andersdenkender wurde der aufsehenerregende „Hochverratsprozess“ im März 1935 gegen eine von Rudolf Welskopf geleitete, im Untergrund wirkende KPD-Widerstandsgruppe.
Neben den politisch Verfolgten gilt besonderes Augenmerk den von den Nationalsozialisten sozial Stigmatisierten und Ausgegrenzten. Der Ein- oder Ausschluss in der selbstdefinierten, alles andere gesellschaftlich herabwürdigenden NS-„Volksgemeinschaft“ konnte für die Betroffenen fatale, nicht selten tödliche Folgen haben. Der völkische Rassismus und die antisemitische Propaganda der Nationalsozialisten waren auch in Buxtehude allgegenwärtig: Gleich zu Beginn der Diktatur wurde ein vermeintlich jüdisches Geschäft von Nationalsozialisten belagert. Das Leben des in Buxtehude gebürtigen, später in Lüneburg lebenden jüdischen Kaufmanns Adolf Aron Schickler endete – ebenso wie das seiner Frau Hulda – mit ihrer Deportation und ihrem Tod im Konzentrationslager Theresienstadt. Auch Roma und Sinti, Wanderarbeiter und Obdachlose erlitten Stigmatisierungen und Erniedrigungen, wurden als „Volksschädlinge“ diffamiert und Opfer von speziellen Razzien der Nationalsozialisten. Als weiteres, besonders bedrückendes Beispiel sei auf den tragischen Lebensweg des Buxtehuder „Euthanasie“-Opfers Dorothea Schultz in die Tötungsanstalt Pfafferode verwiesen – und sie war keineswegs das einzige Buxtehuder Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Praktiken.
Buxtehudes kleinstädtische Gesellschaft zeigte sich unter der Diktatur in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie produzierte sich immer wieder neu: Im Verlauf der Arbeit werden die netzwerkartigen Verflechtungen zwischen Strukturen, Ereignissen und einzelnen Persönlichkeiten in den Vordergrund treten. Viele Entwicklungen verweisen auf Wechselbeziehungen mit benachbarten Städten: Dies gilt für Hamburg – nicht zuletzt zu Kriegszeiten durch den Zustrom der Hamburger Bombenflüchtlinge im Sommer 1943 – und vor allem für die Kreisstadt Stade, die zugleich Sitz des Regierungsbezirkes, der NSDAP-Kreisleitung und weiterer Parteiinstanzen sowie von Gerichten und Gerichtsgefängnissen war.
Gelegentlich werden auch Verbindungen zu Personen und Ereignissen sichtbar, die weit über Buxtehude hinausweisen – Beispiele für vielfältige, manchmal eher zufällige Verflechtungen zwischen der norddeutschen Kleinstadt und der „großen“ Geschichte und Kultur. So gehörte Hitlers berüchtigter „Berghof“ auf dem Obersalzberg bis Anfang der 1930er-Jahre als „Haus Wachenfeld“ der bekannten Buxtehuder Unternehmerswitwe Margarete Winter (geborene Wachenfeld). Ein weiteres Beispiel: Das Kriegsende in Buxtehude und die Besetzung der Stadt durch britische Truppen ist mit jenem Geheimdienstoffizier Dunstan Curtis verbunden, der später das Vorbild für Ian Flemings „James-Bond“-Figur wurde. Und als Fußnote zur Weltliteratur: Einer der Männer, die von der Wehrmacht eingezogen wurden und von Buxtehude aus in den Krieg ziehen mussten, war der städtische Sparkassenangestellte Erich Schönemann. Er wurde während seines kriegsbedingten Aufenthaltes in Österreich 1942 Vater eines berühmten Schriftstellers: nämlich von Peter Handke (der ihn übrigens später gelegentlich in Buxtehude besuchte und mit ihm einen regelmäßigen Briefwechsel pflegte).
Ein wichtiges Thema aus der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in Buxtehude blieb bisher unerwähnt: Kriegsgefangene und Zivilarbeiter:innen. Dieses Thema wurde von dem Historiker Wolfgang Schilling in einer besonderen Untersuchung mit eindrucksvoller Gründlichkeit und Umsicht recherchiert und dargestellt. Wegen der Bedeutung des Themas und um die Eigenständigkeit des Beitrages zu unterstreichen, ist er als „Exkurs“ gekennzeichnet und nicht in die chronologische Gliederung eingeordnet worden.
Wie Wolfgang Schillings Exkurs, so behandelt die gesamte vorliegende Studie Buxtehude in der heutigen territorialen Gestalt. Das heißt: Auch die durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden vom 22. Juni 1972 eingemeindeten Ortschaften werden bei der Darstellung soweit als möglich berücksichtigt. Die auftragsgemäß vorgegebene zweijährige Laufzeit des Projektes brachte es mit sich, dass sich die Untersuchung an ausgewählten Fallstudien, exemplarischen Lebensläufen sowie vielfältigen Einzelaspekten und -problemen der Zeit des Nationalsozialismus in Buxtehude orientiert.
KAPITEL 1
BUXTEHUDE UND ALTKLOSTER IN DER ZEIT VOR DEM NATIONALSOZIALISMUS
Stadt, Wirtschaft und Sozialtopografie zur Zeit der Weimarer Republik
Ende der 1920er-Jahre gab der Heimatforscher Hans Peter Siemens eine Publikation unter dem Titel „Buxtehude und das Alte Land“ heraus.12 Darin wurde eine knappe Übersicht zum kleinstädtischen Leben Buxtehudes, das bis 1932 noch zum Kreis Jork gehörte, in der Spätzeit der Weimarer Republik vermittelt: „Das rege Geschäftsleben prägt der Stadt ihren Stempel auf. Die günstige geographische Lage hart am Rande der Geest und als Haupteingangstor zum Alten Lande schufen hierzu den Boden, dazu kommt, dass die Stadt im Ausstrahlungsgebiet von Groß-Hamburg liegt, was wiederum dazu beitrug, dass unsere Kaufleute bezüglich ihrer Ware in Qualität wie Auswahl mit der Großstadt zu konkurrieren sich mit Erfolg eingesetzt haben. … Nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in kultureller und geistiger Hinsicht bildet Buxtehude den Mittelpunkt eines weiten Umkreises.“ Dabei verwies Siemens auf das noch junge Reformrealgymnasium, die staatliche Baugewerkschule sowie die Malerfach- und Musikschule.13
In Buxtehude gab es während der Weimarer Republik eine rege Bautätigkeit. Zu Beginn der 1920er-Jahre entstand zwischen Altstadt und Bahnlinie die Brüningstraße mit ihrer Wohnbebauung. Um die Harburger Straße entwickelten sich weitere Wohnsiedlungen sowie auch Gewerbegebiete. In der hinter der Bahnstrecke Harburg-Stade-Cuxhaven südlich direkt angrenzenden Landgemeinde Altkloster – von der Einwohnerzahl her nur wenig kleiner als Buxtehude und 1931 in letzteres eingemeindet – wurde nach dem Ersten Weltkrieg im Gebiet der Sanderei sowie am Mühlenweg und im Ortskern gebaut. Zwischen Buxtehude und Altkloster lag an der erwähnten Bahnstrecke das Stationsgebäude. Vom benachbarten Kleinbahnhof nahm 1928 die Kleinbahn Richtung Harsefeld ihren fahrplanmäßigen Betrieb auf.14
Zwei neue Einrichtungen Buxtehudes wurden in der genannten Publikation mit jeweils einem eigenen Beitrag gewürdigt: das Reformrealgymnasium und das Krankenhaus. Verfasser dieser Beiträge waren bemerkenswerterweise jene beiden Persönlichkeiten, die nicht nur Leiter dieser Institutionen waren, sondern später in der Zeit des Nationalsozialismus bedeutende und zugleich kontroverse Rollen spielen sollten: der Studienrat Willy Konopka und der Arzt Hans Wüsthoff. Ersterer trat als Vertreter der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und des Stahlhelms/Bund der Frontsoldaten ab 1933 in Konkurrenz zu den Nationalsozialisten, letzterer zählte zu deren führenden Repräsentanten in Buxtehude und zugleich zu den umstrittensten Persönlichkeiten in der Stadt (von beiden wird später noch ausführlicher zu lesen sein).
1.1 Krankenhaus in der Bahnhofstrasse (auf dem Gelände befindet sich heute das Stadthaus), Aufnahme um 1939
Stadtarchiv Buxtehude, Fotosammlung. Foto: Bolde.
Bleiben wir zunächst noch bei den beiden Institutionen – zunächst zum Reformrealgymnasium: Konopka hob in seinem Beitrag die besondere pädagogische Stellung des 1929 eingerichteten und von ihm geleiteten neuen städtischen Gymnasiums hervor. Aus pädagogischer Sicht galt die in Buxtehude eingeführte Koedukation von Mädchen und Jungen als fortschrittlich.15 Wüsthoff beschreibt in seinem Text, wie Ende der 1920er-Jahre mit Unterstützung des Buxtehuder Senators Wilhelm Meyer ein an der Bahnhofstraße liegendes neues, fast 50 Betten umfassendes Krankenhaus entstanden war.16
Neben den Vorzügen von Buxtehude wurden in der genannten Publikation aber auch die Probleme nicht verschwiegen, die sich in der Spätphase der Weimarer Republik insbesondere aus dem Niedergang von wichtigen Industriebetrieben ergeben hatten.17 So musste Buxtehude 1922 den auf wirtschaftlichen Problemen beruhenden Eigentümerwechsel der von der ortsansässigen Honoratiorenfamilie Wachenfeld begründeten Lederfabrik erleben, die nun in die Hände wechselnder auswärtiger Unternehmen überging. Von weitreichenderer Bedeutung war die 1925 erfolgte Stilllegung des größten Industriebetriebes in der Gegend: der Winter’schen Papierfabrik in Altkloster. Darüber hinaus mussten in den 1920er-Jahren auch andere Betriebe in Altkloster aufgeben, zum Beispiel die Brauerei und die Spar- und Darlehnskasse.18 Dies führte insgesamt zu einem enormen Anstieg der Arbeitslosigkeit und zum Anstieg der Soziallasten in der Landgemeinde.19
1.2 Ansicht der Buxtehuder Lederfabrik, wohl 1930er Jahre
StadtA BUX, AS 21 Nr. 385
Auch in anderen Nachbargemeinden hatten sich soziale Probleme breitgemacht: In der Schulchronik von Neukloster wird unter dem Jahr 1932 vermerkt, dass die wirtschaftliche Notlage – damals waren 12 Familien in der Gemeinde arbeitslos – „parteipolitische Spannung“ in die Dorfgemeinschaft brachte.20
Diese und andere grundlegende Verunsicherungen in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht begünstigten vor Ort den später noch im Einzelnen darzustellenden Aufstieg der Nationalsozialisten ab der Zeit um 1930.
Zu deren häufig von brachialem Verhalten geprägten Durchsetzung gehörte ihr dominantes Auftreten im öffentlichen Raum von Stadt und Land, nicht zuletzt durch die „Sturmabteilung“ der Partei, also der SA, als paramilitärischer Kampftruppe.
Jedoch stießen die Nationalsozialisten in Buxtehude und Altkloster mit deren stark von der Arbeiterbewegung geprägten sozialen Strukturen auf größeren Widerstand, als in kleinstädtischen Verhältnissen sonst zu erwarten gewesen wäre.21 Durch die Industrialisierung im späten 19. Jahrhundert hatte sich die Sozialtopografie von Buxtehude und Altkloster verändert. Buxtehudes ursprünglich kaufmännisch-gewerblich-handwerklich geprägter Stadtkern war von Arbeiterwohnhäusern überformt worden. Zum größten Industriebetrieb des Raumes Buxtehude wurde die erwähnte Winter’sche Papierfabrik mit mehreren hundert Beschäftigten. Neue Wohnungen wurden vor allem in Altkloster, dem Standort der Papierfabrik, gebaut. Aber auch zuvor waren dort bereits Arbeiterunterkünfte entstanden, als man Beschäftigte für den Bau der Eisenbahnlinie Harburg-Cuxhaven benötigte. Zu den bekanntesten zählte der sogenannte „Lange Jammer“ – eine Mehrfamilienunterkunft in der Ferdinandstraße. Die wirtschaftliche Abhängigkeit Altklosters von der Papierfabrik zeigte sich nach deren Schließung 1925, als die Kommune wegen der daraus folgenden starken sozialen Belastungen finanziell nicht mehr existenzfähig war und 1931 nach Buxtehude eingemeindet wurde.22
Der Historiker Christoph Schleef hat in einer unveröffentlichten Ausarbeitung die Sozialtopografie von Buxtehude und Altkloster für die Zeit vor Beginn der nationalsozialistischen Diktatur erläutert.23 Demnach bestand der Doppelort aus mehreren, sozial unterschiedlich strukturierten Wohngebieten. Die Buxtehuder Altstadt repräsentierte vor allem das bürgerlichkonservative Milieu mit Kaufleuten, Beamten, Angestellten und Handwerkern, also einem starken Mittelstand. Hingegen bildete der ebenfalls in der Altstadt gelegene Stavenort ein altes, wenig attraktives Wohngebiet mit Armenwohnungen. Der Raum Halepaghenstraße stellte ein jüngeres Wohngebiet dar, in das bisherige Stavenort-Bewohner bevorzugt zogen. Beide Räume waren vor 1933 sozialdemokratisch bzw. kommunistisch geprägt – im Stavenort lebte zeitweilig mit Rudolf Welskopf ein führender KPD-Politiker.24
Altkloster – das übrigens wegen seiner landschaftlich reizvollen Lage am Waldrand und Geesthang auch Ausflugsstätten beherbergte – war gesellschaftlich in seinem Kern sozialdemokratisch orientiert, verzeichnete aber auch im Verhältnis zu seiner geringen Größe überdurchschnittlich viele KPD-Anhänger. Am Ottensener Weg/Mühlenweg in Altkloster war ein neueres Siedlungsgebiet mit sozialpolitischer Förderung entstanden. Gerade hier stieg um 1930 der Stimmenanteil der KPD an. Der Raum um den Mühlenweg wurde auch als „Klein-Moskau“ bezeichnet, wegen seiner vergleichbaren politischen Orientierung galt das Siedlungsgebiet Ellerbruch als „rotes Gebiet“. Schleef ergänzt, dass sich vom eigentlich „sozialdemokratischen“ Altkloster der Raum um Lutherallee/Stader Straße abhob, denn er war durch handwerklichen Mittelstand, gehobene Angestellte und Selbstständige bürgerlich geprägt.25
1.3 Hotel Waldburg, Stader Straße, um 1935
StadtA BUX, PKS Stadtarchiv, Inv. Nr. 1.17
Die hier skizzierten sozialräumlichen Verhältnisse werden später noch eine Rolle spielen, wenn es um die Durchsetzung der nationalsozialistischen Machtansprüche vor Ort gehen wird. Aufschlussreich für die räumliche Wahrnehmung ist nicht zuletzt das Mobilitätsverhalten. Hier sind Wahrnehmungen des Raumes um Buxtehude auf einer gänzlich anderen, der privaten Ebene dokumentiert: Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens haben sich nämlich aus dem Frühherbst 1932 private Briefe erhalten, die von den Liebesbeziehungen eines Landarbeiters mit mehreren Frauen Zeugnis ablegen. Von entscheidender Bedeutung für das Zustandekommen der Treffen war unter anderem, dass der Landarbeiter ein funktionstüchtiges Fahrrad zur Verfügung hatte. Auf diese Weise konnten Vertreter ärmerer Schichten an einem Tag gewisse Entfernungen im Umfeld von Buxtehude überwinden.26
Das politische Spektrum und Buxtehuder Honoratiorenschaften
Insgesamt bildete Buxtehude zusammen mit Altkloster in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Hinsicht einen Brennpunkt der historischen Entwicklung in der Zeit um 1930. Hier lag – bezogen auf den gesamten damaligen Regierungsbezirk Stade – einer der wenigen Schwerpunkte der Arbeiterbewegung. Buxtehude-Altkloster war Mitte der 1920er-Jahre der nach Stade zweitstärkste Ortsverein im sozialdemokratischen Parteibezirk Unterelbe. In Buxtehude war bereits Anfang 1867, also relativ früh im Vergleich für den Regierungsbezirk, ein Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins gegründet worden – einem der Vorläufer der Sozialdemokratie.27 Zur wichtigsten Persönlichkeit wurde der vor Ort aufgewachsene Zigarrenmacher Hermann Weber (1845–1934). Er war von 1919 bis 1924 als Senator Mitglied des Magistrats der Stadt.28
Die Landgemeinde Altkloster wurde vor dem Ende ihrer Selbstständigkeit sogar sozialdemokratisch regiert – und zwar von Gemeindevorsteher Franz Andreas, der dabei auf die Unterstützung der KPD zählen konnte. Die KPD hatte um 1930 in Buxtehude/Altkloster eine ihrer mitgliederstärksten Gruppierungen innerhalb des Elbe-Weser-Raumes.29 Von hier aus agitierte sie unter anderem erfolgreich im kleinen Ort Wiegersen, der Anfang der 1930er-Jahre – gleichsam inselartig im ländlichen Raum – eine KPD-Hochburg wurde. Im Hintergrund stand, dass Wiegersen ein Land- und Torfarbeiterdorf war und sich die radikale politische Linksorientierung aus den sozialen Ungerechtigkeiten vor Ort ergab.30
1.4 KPD-Aufmarsch im Mühlenweg, Anfang 1930er Jahre
StadtA BUX, AS 60 Nr. 514
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums wurden im Raum Buxtehude/Altkloster bereits in den 1920er-Jahren immer wieder deutschnationale bzw. rechtsextreme Umtriebe beobachtet. Anfang 1921 fand in Beckdorf eine Versammlung der militant republikfeindlichen und einflussreichen Organisation Eschrich („Orgesch“) statt.31 Ebenfalls 1921 entstand in Buxtehude eine Ortsgruppe des deutschnationalen Stahlhelms/Bund der Frontsoldaten.32 Der völkisch-antisemitische Jungdeutsche Orden wollte auf einer Veranstaltung Anfang Juli 1923 „alles Undeutsche ausmerzen“.331931 feierten fast 1.000 Menschen das 50-jährige Jubiläum des Kriegervereins Neukloster mit Fahnen und Kapellen. Lehrer Fitschen aus Neukloster hielt eine „markige“ Rede. Kurz darauf hörten rund 2.000 Menschen beim Feldgottesdienst durch Pastor Richard Poppe aus Neukloster eine kriegerische Ansprache von Major a. D. Holleuffer.34 Im Frühjahr 1932 gehörten fast sämtliche Jungen in Neukloster dem Jugendkorps Scharnhorst, der Jugendgruppe des „Stahlhelms“, an.35 Pastor Poppe stellte sich in den „Dienst der Hitlerbewegung“ und auch sonst bildete Neukloster – wie noch zu zeigen sein wird – immer wieder einen Schauplatz nationalsozialistischer Aktivitäten.36
Im deutschnationalen Kontext spielten auch Turnervereinigungen eine Rolle, wie die sich von 1923 bis 1933 in der „Adlerklaue“ – der späteren ersten Unterkunft der Hitlerjugend – treffenden Turnerjugend des MTV Buxtehude. Diese fuhr auch zu Jugendtreffen der von der antisemitischen Ideologie des späteren NS-Sportführers Edmund Neuendorff beeinflussten Deutschen Turnerschaft.37
Das deutschnationale Spektrum in Buxtehude wurde durch bedeutende Persönlichkeiten aus der bürgerlichen Honoratiorenschaft repräsentiert. Die Druckereibesitzerin, Zeitungsverlegerin und Politikerin Dolly Schlikker war Mitglied der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP), für die sie unter anderem für den Preußischen Landtag kandidierte. Sie war eine geborene Bussenius und verwitwete Vetterli – ihr erster Mann war der im Ersten Weltkrieg gefallene Buchdruckereibesitzer und Zeitungsverleger Rudolf Vetterli. 1919 hatte sie den Juristen Hermann Schlikker geheiratet und damit ihren Namen geändert. Dolly Schlikker zählte in den 1920er- und 1930er-Jahren als Verlegerin des „Buxtehuder Wochenblatts“ bzw. späteren (ab 1926) „Buxtehuder Tageblatts“ zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt.38 Ihre Schwester war übrigens erste Besitzerin des Ausflugslokals „Pilgerruh“ am Eingang zum Klosterforst in Neukloster gewesen.39Dolly Schlikker zählte zusammen mit Franziska von Oldershausen40 nach der Kommunalwahl vom 2. März 1919 zu den ersten Bürgervorsteherinnen in Buxtehude. Im Folgejahr wurde sie Vorsitzende des Hausfrauenvereins Buxtehude-Altkloster.41 Ihre Partei, also die DVP, stellte im Regierungsbezirk Stade einige prominente Politiker und Persönlichkeiten, wie den Regierungspräsident Hermann Rose und mehrere Landräte, unter anderem mit Karl Schwering auch im damaligen Kreis Jork (zu dem Buxtehude bis zur preußischen Kreisreform von 1932 gehörte, anschließend wurde Schwering Landrat im neugebildeten „Großkreis“ Stade).42 1933 stand Dolly Schlikker, die Druckerei und Verlag nach dem Tod ihres ersten Mannes übernommen hatte, im Zentrum eines Konfliktes im rechten politischen Lager, in dem die politisch wie persönlich motivierten Konkurrenzen innerhalb des rechten Lagers deutlich werden sollten (dazu später mehr).
Seit 1921 wirkte Arthur Vagts in Zeitungsverlag und Druckerei des Buxtehuder Tageblatts mit, er wurde Teilhaber und Geschäftsleiter. Vagts, dessen Bruder Erich übrigens nach Kriegsende kurzzeitig Regierender Bürgermeister in Bremen wurde, gehörte vor 1933 zur Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) – auch hier wurde also das politisch rechte Spektrum repräsentiert. Arthur Vagts trat 1937 der NSDAP bei und gehörte auch verschiedenen NS-Organisationen an.43
Eine bedeutende Buxtehuder Honoratiorenfamilie zählte ebenfalls politisch zur völkisch-demokratiefeindlichen DNVP: die Familie Winter. Ihr gehörte bis zu deren Schließung 1925 die Papierfabrik in Altkloster. Der letzte Fabrikbesitzer Herbert Winter führte den DNVP-Parteibezirk Unterelbe, auch seine Mutter Margarete Winter, geb. Wachenfeld, und seine Schwester Annalisa Winter waren zunächst in der DNVP aktiv (bevor sich Letztere, wie gleich noch zu lesen sein wird, der NSDAP zuwandte). In Buxtehude existierte auch eine Frauengruppe der DNVP, die von Herbert Winters Ehefrau Antonie gegründet worden war.44 Der der DNVP nahestehende und für diese Partei Saalschutz liefernde Wehrverband des Stahlhelm/Bund der Frontsoldaten hatte, wie erwähnt, ab 1921 eine Ortsgruppe in Buxtehude.
Mit den Winters familiär verbunden war die Familie Wachenfeld – ihr entstammten die Unternehmer der 1832 in Buxtehude gegründeten Lederfabrik, dem zeitweilig größten Betrieb der Stadt. 1878 heiratete Margarete Wachenfeld, die Tochter des Fabrikbesitzers Otto Ludwig Wachenfeld, den in Altkloster geborenen Otto Asmus Winter. Letzterer übernahm auch die Leitung der Wachenfeldschen Lederfabrik, starb aber 1920.45
Otto und Margarete Winters Sohn Herbert, ein promovierter Chemiker, war als Rittmeister zusammen mit dem Major a. D. Werner Glüer und anderen „Offizierskameraden“ nach dem Ersten Weltkrieg zurück nach Buxtehude gekommen. Herbert Winter hatte nach dem Tod seines Vaters wenig Interesse an der Unternehmensführung und stellte Werner Glüer – obwohl es diesem an entsprechenden Kompetenzen fehlte – an führender Position ein.46 Der wirtschaftliche Niedergang kam bald: Wie erwähnt, musste die Lederfabrik 1922 verkauft werden. Herbert Winter wohnte mit seiner Familie in der Buxtehuder Parkstraße, seine Ehefrau war Sängerin und starb 1924 vor Ort während eines Konzertes. Das Haus wurde später an den Krankenhaus-Direktor und Führer der NSDAP-Ratsfraktion in Buxtehude, Hans Wüsthoff, verkauft.47 Von Werner Glüer wird später noch ausführlich im Zusammenhang mit den Anfängen nationalsozialistischer Herrschaft in Buxtehude zu lesen sein – er war als SA-Führer maßgeblich an der Besetzung des Rathauses Ende März 1933 beteiligt und amtierte anschließend 1933/34 als kommissarischer Bürgermeister.
Drei Frauen, Hitler und der Obersalzberg
Die in der breiteren Öffentlichkeit bekannteste Persönlichkeit aus dem Familiennetzwerk Winter/Wachenfeld im frühen 20. Jahrhundert war zweifellos Margarete Winter. Sie erregte frühzeitig Aufsehen, als sie allein bzw. teilweise in Begleitung ihres Sohnes Herbert im Jahr 1905 mehrere tausend Kilometer mit dem Auto durch Europa fuhr. Dies war sowohl für die Frühzeit der Automobilgeschichte als auch für ihre gesellschaftliche Rolle als Frau – und erst recht in einer Kleinstadt – ein bemerkenswertes Ereignis.48
Ihr Mann, also Otto Asmus Winter, ließ für die Familie auf eigens dafür erworbenem Grund im Jahr 1917 die alpine Sommerfrische „Haus Wachenfeld“ errichten.49 Diese gelangte zu unrühmlicher Bedeutung: Sie stand auf dem Obersalzberg oberhalb von Berchtesgaden, wurde später von Hitler erworben und zu seinem festungsähnlich geschützten „Berghof“ umgebaut. In den ersten Jahren jedoch wurde sie noch von den Winters als Feriensitz genutzt, nach dem Tod von Otto Asmus Winter dann in den 1920er-Jahren immer häufiger vermietet.
In diesem Zusammenhang rückt die Beziehung der Winters zur Person Hitlers in den Fokus. Wieder wird dabei das milieuspezifische Netzwerk im deutschnational-völkischen Umfeld deutlich. Über die Verbindungen zwischen Hitler, den Winters und Buxtehude gibt es unterschiedliche Interpretationen. Befeuert wurde die Interpretation einer engeren Verknüpfung – als es sie tatsächlich gab – durch einen Artikel im „Buxtehuder Tageblatt“ aus dem Jahr 1933. Dort hieß es unter dem Titel „Adolf Hitler und Buxtehude“: „Nur wenige werden wissen, dass unseren Reichskanzler auch mittelbar Beziehungen mit unserer Heimatstadt Buxtehude oder vielmehr mit einer bekannten alten Familie derselben verbinden. … … [nämlich] daß Hitler auch persönliche Beziehungen zu der Familie Winter aufrecht erhält; so weilte er schon vor Jahren in Buxtehude, ohne dass jemand ahnte, welche Bedeutung dieser Mann später noch erlangen würde.“50 Jedoch kann von „persönlichen Beziehungen“ im Sinne von laufenden, engeren Kontakten keine Rede sein. Dokumentiert sind lediglich zwei geschäftliche Treffen von Hitler mit Margarete bzw. ihrer Tochter Annalisa Winter – eines auf dem Obersalzberg und ein weiteres Treffen in deren Villa in Buxtehude (1929).
1.5 Haus Wachenfeld, Aufnahme von 1932 oder 1933
Aus: Deutschland erwacht. Werden, Kampf und Sieg der NSDAP, hrsg. Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld, 1933, S. 134
Aber der Reihe nach: Hitler war 1923 zum ersten Mal in die von ihm anschließend bevorzugte Gegend bei Berchtesgaden gekommen und wohnte zunächst in verschiedenen Pensionen und Hotels. Zufällig erfuhr er – entweder Anfang 192751 oder, nach seinen eigenen Angaben, erst 192852 – dass das Haus Wachenfeld zu mieten sei. Dies geschah in einer Zeit, als die beiden Frauen – wie auch Herbert Winter – das Interesse an dem alpinen Feriensitz verloren und die Verwaltung einem einheimischen Bauern überlassen hatten.53 Umgekehrt zeigte Hitler ein immer größeres Interesse daran, sich auf dem Obersalzberg niederzulassen. Durch Vermittlung des örtlichen Verwalters lernte Hitler die beiden Frauen kennen, die froh waren, eine langfristige Nutzung für das Gebäude zu finden. Sie einigten sich mit Hitler auf Jahresmietverträge, wobei Hitler ein späteres Vorkaufsrecht wünschte.54 Gegenüber dem Finanzamt München gab Hitler aus steuerlichen Gründen an, dass seine Halbschwester Angela Raubal die Mieterin sei.55
Ein weiteres Treffen mit Hitler fand am 21. Juli 1929 bei den Winters in Buxtehude statt – Margarete und Annalisa Winter hatten noch immer Wohnrecht im Direktorenhaus der Lederfabrik in der Bleicherstraße. Hitler war am Vortag in Hamburg im Hotel „Phönix“ abgestiegen. Der Zeitpunkt des Besuches ist insofern bemerkenswert, als in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli 1929 ein aufsehenerregendes Großfeuer auf dem Gelände der Buxtehuder Lederfabrik ausbrach – was naturgemäß die Erinnerungen an den Besuch prägte. Interessanterweise vermerkt Sandners „Itinerar“ mit seinem Tag für Tag notierten Aufenthalten Hitlers zwar dessen Zugreise nach Hamburg, gibt aber als Grund der Reise „unbekannt“ an. Hitler fuhr anschließend am 21. Juli mit dem Zug nach München zurück.56
1.6 Annalisa Winter, Aufnahme wohl nach 1945
StadtA BUX, NL 1 Martin Jank, Fotos/Winter/Papierfabrik
Zu engeren Verhandlungen und eigentlichem Kauf durch Hitler kam es jedoch erst 1932/33 – wegen einer Erkrankung von Margarete Winter hatte diese ihrer Tochter die Vertretungsrechte übertragen.57 Annalisa Winter selbst äußerte sich noch kurz vor dem Eigentümerwechsel im April 1933 im Buxtehuder Tageblatt – in Ergänzung des oben erwähnten, vorangegangenen Artikels – zum Stand der Dinge wie folgt: „‚Haus Wachenfeld‘. Zu dem Artikel im ‚Buxtehuder Tageblatt‘: ‚Adolf Hitler und Buxtehude‘ möchte ich folgende Berichtigung geben. ‚Haus Wachenfeld‘ auf dem Obersalzberg wurde nach Angaben meiner Mutter gebaut auf einem Stück deutscher Erde, das ihr besonders ans Herz gewachsen war. Noch heute ist das Haus ihr persönliches Eigentum. – Erst seit dem Jahre 1928 wird ‚Haus Wachenfeld‘ von der [Halb-] Schwester Adolf Hitlers bewohnt, nicht ‚zwecks Aufnahme von Sommergästen‘, sondern lediglich um dem Bruder in der kurzen Zeit seiner Ausspannung ein ruhiges Heim zu ermöglichen.“58 Endgültig wechselte Haus Wachenfeld den Besitzer im weiteren Verlauf des Jahres 1933 zum Preis von 40.000 Goldmark. Im November 1933 reiste Annalisa Winter in Vertretung ihrer erkrankten Mutter zu einem notariellen Vorgang nach München.59 Anschließend ließ Hitler die frühere Sommerfrische der Winter-Wachenfelds zu seinem „Berghof“ um- und ausbauen.
Margarete Winter verstarb bald nach dem Verkauf ihres alpinen Feriensitzes im Alter von 77 Jahren am 7. März 1934. Die Traueransprache hielt der Erste Pastor der Buxtehuder Kirchengemeinde St. Petri und frühe Anhänger der NSDAP, Karl Thielbörger (dessen Aktivitäten später noch ausführlich dargestellt werden). Im selben Jahr wurde die Familienvilla in der Bleicherstraße abgerissen. Mit Margaretes Tod endete auch die Familiengeschichte der Wachenfelds in Buxtehude, da Versuche von Annalisa und Herbert scheiterten, ihren Nachnamen offiziell in „Winter-Wachenfeld“ – wie ihn Annalisa auch im alltäglichen Umgang verwendet hatte – ändern zu lassen.
Soweit zu den wenigen persönlichen Beziehungen von Margarete und Annalisa Winter zu Hitler. Aufschlussreich ist darüber hinaus die politische Teilhabe der beiden, aus dem deutschnationalen Umfeld stammenden Frauen an der Geschichte der Buxtehuder NSDAP. Bereits Ende 1925 konnten die Nationalsozialisten die Mitgliedschaft von Margarete Winter, deren Tochter Annalisa (die mit Nr. 665, Eintritt am 16. April 1925, zu den frühesten Parteimitgliedern zählte – zunächst in der Ortsgruppe Hamburg, wo sie beruflich tätig war) sowie von der Lehrerin Else Bütemeister verzeichnen, die mit der Familie Winter persönlich eng verbunden war.60
1.7 Notarielle Beurkundung des Verkaufs von „Haus Wachenfeld“, 1934
Kopie im StadtA BUX, Original Staatsarchiv München, VI 1933/1525
Wie Annalisa Winter in ihrem Entnazifizierungsverfahren berichtete, wurde sie Mitte der 1920er-Jahre durch Ortsansässige am Obersalzberg von Hitler und seiner Partei überzeugt. Beflügelt durch eigenes sozialfürsorgerisches Engagement hätte sie sich der Partei angenähert und sei ihr frühzeitig beigetreten. Nach eigener Darstellung blieb sie nurmehr nominelles Mitglied und lehnte nach 1933 weitgehend Aktivitäten für die Partei ab. Immerhin wurde Annalisa Winter NSDAP-intern im Februar 1928 als Repräsentantin für Buxtehude verzeichnet. Mindestens bis Anfang 1929 war sie auch für die Mitgliedsbeiträge im Raum Buxtehude zuständig, in die NS-Frauenschaft trat sie 1938 ein. Zu Kriegszeiten stand sie an der Spitze des Buxtehuder Roten Kreuzes und engagierte sich bei der Flüchtlingsbetreuung – dieses sozialfürsorgerische Engagement zeichnete sie über Jahrzehnte hinweg aus und hatte sich bereits während des Ersten Weltkriegs gezeigt. Später erklärte Annalisa Winter bei ihrem Entnazifizierungsverfahren, dass sie sich angesichts häufender Übergriffe der Partei gegenüber der Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes, dem sie sich in erster Linie verbunden fühlte, das Interesse an der Partei verlor. Wie der Historiker Henning Müller erläutert, beruhte die ihr zunächst von der Partei zugebilligte Vertrauens- bzw. Repräsentantenrolle unter Umständen auf einseitiger Zuschreibung durch die NSDAP.61
Wie die Geschichte der Winter-Wachenfelds, so ist auch die Biografie von Else Bütemeister im Zusammenhang mit der Buxtehuder NSDAP von Interesse. Sie lebte seit 1920 in Buxtehude, entstammte einer Familie mit langer bildungsbürgerlicher Tradition und hatte jüdische Vorfahren. Seit dem 1. Februar 1924 arbeitete sie als Lehrerin, zunächst an der von Franziska von Oldershausen geleiteten höheren Mädchenschule und nach deren Auflösung am Reformrealgymnasium. Else Bütemeister war am 19. April 1925 mit der Mitgliedsnummer 754 in Buxtehude der NSDAP beigetreten. Ihren eigenen, nachträglichen Erklärungen zufolge war dies – wie im Fall von Annalisa Winter – aus ihren sozialfürsorgerischen Überzeugungen heraus geschehen: Sie erhoffte sich demnach von den Nationalsozialisten unter anderem eine Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Als es durch Erlass vom 25. Juni 1930 preußischen Beamten verboten wurde, Mitglied der NSDAP oder KPD zu sein, gab sie ihre Mitgliedschaft im November 1930 vorübergehend bis zur Aufhebung des Verbots auf. 1934 folgte Else Bütemeister der Bitte des neuen Bürgermeisters Eduard Großheim, der bald auch NSDAP-Ortsgruppenleiter wurde, die Führung der Buxtehuder NS-Frauenschaft zu übernehmen. Diese hatte damals rund 100 Mitglieder. Bei der NSDAP wurde sie auch als Mitglied der Sektion Gauleitung geführt. Daneben übte sie städtische Beiratstätigkeiten in Sachen Kindergarten und Wohlfahrt aus.62
Else Bütemeister war bis weit in die 1930er-Jahre hinein fest im rechten Buxtehuder Honoratiorenkreis verankert. Sie wie auch Annalisa Winter wurden 1934 als „Alte Garde“ auf einem Ehrentag mit dem Goldenen Parteiabzeichen der NSDAP versehen.63 Auch als Lehrerin wurde sie von den Nationalsozialisten geschätzt: 1936 wurde Bütemeister von der Abteilung für höheres Schulwesen beim Oberpräsidenten in Hannover in einen vom 21. Juni bis 4. Juli in Syke stattfindenden Schülerlehrgang eingebunden, der „unbedingte nationalpolitische Zuverlässigkeit“ erforderte.64
Die politische Haltung von Else Bütemeister wandelte sich jedoch in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre. Zunächst heiratete sie Anfang 1937, nahm den Namen ihres Mannes Pfaehler an, schied zum 31. Januar 1937 aus dem Schuldienst aus und zog von Buxtehude nach Stuttgart. Sie zeigte zunehmende Zweifel an der Partei wegen der wachsenden Kirchenfeindlichkeit des Regimes einerseits, ihrer eigenen Religiosität und Zugehörigkeit zur Bekennenden Kirche andererseits. Hinzu kam, dass ihr Ehemann Hermann Pfaehler als Rechtsanwalt Verfolgte der NS-Diktatur juristisch unterstützte. Nach Ende der Diktatur wurde sie zunächst als Minderbelastete in Gruppe III, nach einem Berufungsverfahren als Mitläuferin in Gruppe IV eingestuft.65
KAPITEL 2
AUFSTIEG UND MACHTANSPRÜCHE DER NSDAP
„In Uniformen über die Dörfer …“
Nachdem bisher einzelne, der NSDAP verbundene Persönlichkeiten aus der Buxtehuder Honoratiorenschicht vorgestellt wurden, wird es im Folgenden um die Durchsetzung des nationalsozialistischen Machtanspruchs in Politik, Gesellschaft und Alltag gehen. Allgemein setzte um 1930 eine Radikalisierung der Wählerbewegungen in Richtung NSDAP ein. Die Partei konnte sowohl in Arbeiter- als auch in bürgerlich-konservativen Gebieten an Stimmen gewinnen. Die Zunahme der Nationalsozialisten lag allerdings im bürgerlichen Lager deutlich höher als in Arbeiterwohngebieten.66
Die NSDAP war laut Dirk Stegmann Nutznießer der „fundamentalen politischen Um- und Neuorientierung im bürgerlichen und bäuerlichen Sozialmilieu im Gefolge der Agrarkrise“ Ende der 1920er-Jahre.67 Für den Kreis Stade spricht der Historiker Hartmut Lohmann von einer die NSDAP begünstigenden schwierigen Lage der Landwirtschaft: Viele Höfe waren verschuldet und sahen keine Zukunftsperspektive mehr. Die Geestgebiete des Kreises mit ihren klein- und mittelbäuerlichen Betrieben waren Schwerpunkte des Nationalsozialismus, weil sich hier vor Ort die negativen Folgen der Wirtschaftskrise besonders hart auswirkten.68 Aber auch generell zählten Landwirte zu jener Berufsgruppe, die von den Nationalsozialisten umworben wurden und umgekehrt die Nationalsozialisten besonders stark unterstützten.69
Die aus Buxtehuder Sicht zusätzlich besonders problematische wirtschaftliche Situation in der noch bis 1931 selbstständigen Landgemeinde Altkloster wurde bereits erwähnt. Hier gab es einige Jahre nach Schließung der Papierfabrik und kurz nach der Eingliederung nach Buxtehude noch Hunderte von Arbeitslosen: Ende Januar 1933 lag die Zahl bei 410 – bei kaum mehr als 3.000 Einwohner:innen in Altkloster.70
Die NSDAP zielte mit ihrer antidemokratischen Agitation auf eine vermeintliche „Honoratiorenpolitik“ der konkurrierenden Parteien und auf deren angebliches politisches Versagen.71 Die Parteiveranstaltungen appellierten mit ihren Abläufen – zum Beispiel Kranzniederlegungen am Kriegerdenkmal und Aufmärschen der SA – an ein konservativ-nationalistisches Milieu mit autoritären Ordnungsvorstellungen, das zuvor vor allem von den bürgerlich-deutschnationalen Rechtsparteien, wie DNVP und DVP, repräsentiert worden war.72 Von nicht zu unterschätzender Bedeutung war, dass in vielen Orten Personen mit hohem lokalen Ansehen für die Nationalsozialisten Partei ergriffen.73 Dies galt, wie sich an Personen wie Krankenhausdirektor Wüsthoff und Pastor Thielbörger noch zeigen wird, auch für Buxtehude mit seinen kleinstädtischen Strukturen.
Dabei hatte die NSDAP im Raum Buxtehude/Altkloster – wie überhaupt im Gebiet des späteren Großkreises Stade (1932 gebildet aus Altkreis Stade, Kreis Kehdingen und Kreis Jork) – noch bis weit in die zweite Hälfte der 1920er-Jahre hinein eine eher geringe Rolle gespielt.74 Der Kreis Stade – der heutige Begriff „Landkreis“ kam erst 1939 auf – gehörte innerhalb der NSDAP-Parteistrukturen zum Gau Lüneburg-Stade (später umbenannt in Hannover-Ost). Gauleiter war hier ab 1925 Otto Telschow. Er wurde künftig zu einem wichtigen Akteur nationalsozialistischer Ideologie und Politik auf überregionaler Ebene und arbeitete unter anderem auf Führungsebene später mit dem in Immenbeck als Lehrer wirkenden Heimatforscher Wilhelm Marquardt zusammen.75
Für die fast alles andere niederwalzende Dynamik des Nationalsozialismus verantwortlich war nicht zuletzt, dass der Anteil junger, unverheirateter Männer an den Parteimitgliedern im Allgemeinen und ihrer paramilitärischen „Sturmabteilung“, der SA, im Besonderen sehr hoch war.76 Sie wandten viel Zeit und Energie auf, um den öffentlichen Raum zu besetzen und zu dominieren – unterstützt von der symbolischen Wirkung ihres militaristisch-uniformierten, massenhaften und bedrohlichen Auftretens. So gelang es der SA schon vor 1933, den Eindruck einer allgegenwärtigen Ordnungsmacht zu erwecken, der die linken Parteien und Organisationen immer weniger entgegenzusetzen hatten.77 Oder, wie ein Buxtehuder NSDAP-Politiker es ausdrückte: Die Nationalsozialisten zogen „in Uniformen über die Dörfer“.78
2.1 Werbung auf der Rückseite eines Programmzettels für eine SA-Veranstaltung 1931
StadtA BUX, KL SE 62, Nr. 9
Die Ergebnisse der Reichstagswahlen in der Zeit vor 1933 belegen auch empirisch den Aufstieg der NSDAP: Erzielte sie noch 1928 nur 0,7 % der Stimmen, so waren es 1930 bereits 17,7 % und am 31. Juli 1932 43,7 %. Bei den Reichstagswahlen am 6. November 1932 sank ihr Stimmenanteil wieder auf 37,1 %, bevor er bei der unfreien Wahl im März 1933 auf 47,5 % wuchs. Buxtehude (ab 1931 mit Altkloster) lag damit jedoch fast immer unter dem Stimmenanteil der NSDAP in den Landkreisen Jork bzw. Stade sowie in der Stadt Stade. Der Stimmenanteil der SPD blieb innerhalb einer Marge zwischen rund 23 % und 29 % relativ stabil, die KPD stieg 1932 auf 13,6 bzw. 17,7 %, um 1933 wieder auf 12,1 % zu fallen.79
Das „Braune Haus“: Politische Auseinandersetzungen und einseitige Justiz
Die teils brachiale Präsenz der Nationalsozialisten im öffentlichen Raum bot mehrfach Anlass für gewaltsame Auseinandersetzungen mit ihren Gegnern aus dem Milieu der Arbeiterparteien. Überregional bekannt und berüchtigt wurde eine Saalschlacht in Buxtehude im Oktober 1931, in deren direkter Folge sich Schlägereien bei Bliedersdorf ereigneten. Am 22. Oktober 1931 hatten sich anlässlich einer nationalsozialistischen Veranstaltung rund 500 Personen unterschiedlicher politischer Couleur im Bahnhofshotel versammelt, unter anderem vom „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ (dieser war ursprünglich im sozialliberal-bürgerlichen Spektrum von SPD, DDP und Zentrum 1924 zur Abwehr republikfeindlicher Kräfte gegründet worden und später stark sozialdemokratisch orientiert). Im Umfeld von Zwischenrufen kam es zur Eskalation: „Der Versammlungsleiter Stummeyer, [NSDAP-] Kreisleiter in Harburg, gab in diesem Moment den Befehl ‚SA drauf‘, woraufhin eine mit Biergläsern und Stuhlbeinen ausgetragene allgemeine Saalschlacht einsetzte … . Obwohl die Nazigegner personell eher in der Mehrheit waren, wurden sie von den Nationalsozialisten – durch Harburger SA-Trupps verstärkt – buchstäblich aus dem Saal hinausgeprügelt.“80 Die Saalschlacht endete erst durch den Einsatz eines Polizeikommandos.81
Eine Woche später wurden bei Bliedersdorf NSDAP-Anhänger auf dem Rückweg von einer Parteiveranstaltung angegriffen. Dabei waren – wie sich aus der späteren Anklage ergab – vor allem Sozialdemokraten bzw. Reichsbanner-Mitglieder und Kommunisten auch aus dem Buxtehuder Raum aktiv beteiligt. Der Überfall galt als Reaktion auf die Buxtehuder Saalschlacht. Während bei letzterer niemand aus dem rechten Spektrum angeklagt wurde, wurden im Bliedersdorfer Fall fast alle der 30 linken Angeklagten zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen verurteilt. Dies zeigte die ungleiche Behandlung von links und rechts durch die Justiz vor 1933. Einige der hier Angeklagten wurden nach Beginn der nationalsozialistischen Diktatur aus Rachsucht nochmals verhaftet.82
Ein weiteres Beispiel waren Auseinandersetzungen zwischen KPD- und NSDAP-Anhängern in der Nacht vom 10. auf den 11. November 1932.83 In Buxtehude war Tag des Martinimarkts und die Gaststätten waren gefüllt. Anhänger der KPD hatten sich in der Gastwirtschaft Wegener in der Abtstraße getroffen, Nationalsozialisten in der als Partei- und SA-Treffpunkt bekannten, nahe der St.-Petri-Kirche in der Altstadt gelegenen Gastwirtschaft Lasse („Braunes Haus“). Eine der Akte beigegebene Situations- bzw. Augenscheinskizze84 dokumentiert die Topografie. Kurz nach Mitternacht trafen die Gruppen auf der Straße aufeinander: Auf einen Wortwechsel folgten Schlägereien, einige Beteiligte erlitten Verletzungen. Als Beweismittel wurden unter anderem ein Messer und drei blutige Taschentücher überliefert. Durch das Eingreifen von Polizisten löste sich das Ganze auf, mehrere Personen wurden festgenommen. Wieder zeigte der spätere Prozess die politische Einseitigkeit der Stader Justiz.85 Darauf verweist auch Hartmut Lohmann, wenn er die auffällige Häufung von Freisprüchen bei Nationalsozialisten feststellt. Umgekehrt wurden Sozialdemokraten und vor allem Kommunisten oft zu hohen Strafen verurteilt. Im Hintergrund stand, dass ein Großteil der Juristen noch im Kaiserreich ausgebildet worden und entsprechend konservativ war. In diesen Kreisen gab es kaum Zugang und Verständnis für Arbeitermilieus.86
2.2 Situationsskizze zur Auseinandersetzung der Nationalsozialisten gegen Kommunisten 1932 in Buxtehude
NLA ST, Rep 171a Stade Nr. 131, Bl. 73a
2.3 Messer aus Asservatenkammer, 1932
NLA ST, Rep 171a Stade Nr. 131, Bl. 73a Foto: Norbert Fischer
2.4 Taschentuch aus Asservatenkammer, 1932
NLA ST, Rep 171a Stade Nr. 131, Bl. 73a Foto: Norbert Fischer
Auf dem Weg zur Buxtehuder Ortsgruppe der NSDAP
In Buxtehude hatte es schon punktuelles Engagement und einzelne Repräsentanten der NSDAP in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre gegeben, wie am Beispiel von Margarete und Annalisa Winter sowie Else Bütemeister gezeigt wurde. Allerdings kann für Buxtehude in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre noch nicht von einer festen organisatorischen Ortsgruppen-Struktur gesprochen werden.87 In Quellen und Literatur werden einzelne NSDAP-Mitglieder immerhin als Repräsentanten für Buxtehude genannt: Gauleiter Otto Telschow verzeichnete in einer Zusammenstellung vom 8. Juli 1927 den 1908 geborenen Sparkassenangestellten Heinrich Böttjer als Vertrauensmann für Buxtehude.88 Am 7. Februar 1928 wurde, wie erwähnt, Annalisa Winter genannt, aber schon am 17. Oktober desselben Jahres der junge, der Partei erst wenige Monate zuvor beigetretene Apensener Kaufmannsgehilfe Herbert Krücken.89
Eine offizielle Ortsgruppe der NSDAP im engeren organisatorischen Sinn wurde in Buxtehude im Januar 1930 gegründet.90 Ihre Leitung übernahm zunächst der Apotheker Wilhelm Leddin (er wurde 1933 stellvertretender Bürgermeister und war auch Erster Vorsitzender des Buxtehuder Heimatvereines, also ein klassischer städtischer Honoratior). Diese erste feststrukturierte Buxtehuder Ortsgruppe bediente zunächst auch einige umliegende Gemeinden sowie den damals noch existierenden Kreis Jork. Ab 1930 entfaltete die NSDAP dann vor Ort eine breitere Propaganda-Arbeit.91
Im Jahr 1931 löste Fritz Baasch bis auf Weiteres den bisherigen Ortsgruppenführer Leddin ab, wie aus parteiinternen Unterlagen hervorgeht.92 Der in Altkloster wohnhafte Maschinenbauer und spätere Buxtehuder Ratsherr war ein sogenannter „alter Kämpfer“ der NSDAP. Er war am 25. Juli 1925 in die Partei eingetreten93 und firmierte am 1. Juli 1930 als Ortsgruppenleiter in Altkloster.94Nachdem der neue Bürgermeister Großheim im Mai 1934 sein Amt in Buxtehude angetreten hatte, übernahm dieser auch die NSDAP-Ortsgruppe, Baasch wurde sein Stellvertreter95 und Führer des SA-Trupps Buxtehude.96 Kassenwart der NSDAP war 1932 der Kaufmann Otto Lühning.97 Er war auch Oberscharführer der SA und durfte 1934 „Ärmelstreifen für altgediente SA-Männer“ tragen.98Lühning nahm in Bremervörde an einer Kundgebung am 28. Oktober 1932 mit einer Rede von „Der Führer Adolf Hitler“ teil (der reservierte Sitzplatz kostete ihn drei Mark, wie seine Eintrittskarte dokumentiert).99
2.5 Bewerbung von Otto Lühning, Westfleth, als Brigade-Geldverwalter, 1934
StadtA BUX, KL SE 62 Nr. 5
2.6 Dienstrangabzeichen der NSDAP, um 1933
StadtA BUX, KL SE 62, Nr. 8
Auch in der näheren und weiteren Umgebung war die Entwicklung der NSDAP ab 1930 rasch vonstatten gegangen. Gab es im Raum des späteren Großkreises Stade noch Mitte 1930 nur drei Ortsgruppen (Buxtehude, Kutenholz und Stade) mit zusammen knapp über 100 Mitgliedern, so konnte die NSDAP Ende des Folgejahres bereits einen „straff ausgebauten Parteiapparat“ verzeichnen.100 Buxtehude zählte zu diesem Zeitpunkt, also Ende 1931, unter den Landstädten mit über 3.000 Einwohner:innen im Gau Ost-Hannover zu den Orten mit der höchsten Zahl von NSDAP-Ortsgruppenmitgliedern (nämlich 69). Selbst das wesentlich größere Stade hatte mit 77 NSDAP-Mitgliedern nur wenig mehr als Buxtehude.101 Anfang 1933 hatte die Partei innerhalb des neugebildeten Kreises Stade bereits in jeder größeren Gemeinde Ortsgruppen oder zumindest Stützpunkte.102 In ihrer regionalen Organisation lehnte sich die NSDAP an die vor der Kreisreform von 1932 bestehenden Altkreise Stade, Jork und Kehdingen mit den jeweiligen Kreisgruppen an. Die Kreisleiter waren für die einzelnen Ortsgruppen verantwortlich, letztere mussten mindestens 10 Mitglieder umfassen.103
KAPITEL 3
RATHAUSBESETZUNG, SCHIKANEN UND TRAGÖDIEN: DIE ANFÄNGE DER DIKTATUR
Wüsthoff gegen Schlikker: Der Streit in der Presse zwischen Deutschnationalen und Nationalsozialisten
Die Zeit vor und nach der Machtübergabe an Hitler und die NSDAP war also von einer sich rasch verstärkenden Präsenz der Partei, vor allem auch der SA, und von einer zunehmenden Gewaltbereitschaft der Nationalsozialisten im Kreis Stade geprägt. In Horneburg beispielsweise marschierten nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler durch Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 SA-Leute durch den Ort. Aber auch die Proteste gegen die Nationalsozialisten hielten an: In Buxtehude wurden bei einem führenden NSDAP-Vertreter Fensterscheiben beschädigt.104
Das „Buxtehuder Tageblatt“ begleitete bereits vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten die Aktivitäten der Partei wohlwollend. Während Anfang Januar noch Probleme der steigenden Arbeitslosenzahlen und der Arbeitsmarktpolitik das Themenspektrum in der Zeitung prägten, folgten Mitte Januar positive Berichte über eine öffentliche Versammlung der NSDAP im Buxtehuder Bahnhofshotel105 und über eine Veranstaltung zu „Fragen der Rassenlehre“ in Jork.106 Aufmerksamkeit fand auch eine öffentliche Versammlung der NSDAP-Ortsgruppe Elstorf Anfang Februar. Dem Bericht zufolge bestand ein Großteil der Anwesenden aus Jugendlichen, es gab offensichtlich zahlreiche Neuaufnahmen – der Artikel im „Buxtehuder Tageblatt“ endete mit „Heil Hitler“.107 Umgekehrt galten der Zeitung Sozialdemokraten und Kommunisten als „Staatsverräter“. Diese Tendenz, sich auf die nationalsozialistische Seite zu schlagen, sollte sich im Prinzip – mit einer noch zu beschreibenden Ausnahme – künftig verstärken. In der Folge wurde fast ausschließlich von NS-Veranstaltungen und dabei im nationalsozialistischen Sinn berichtet. Seinen vorläufigen Höhepunkt fand diese Tendenz Ende Februar/Anfang März 1933 nach dem Reichstagsbrand, dessen Umstände bis heute ungeklärt sind und der in ganz Deutschland zu einer Verfolgungs- und Verhaftungswelle bei linken Politikern führte. Dies galt auch für Buxtehuder KPD-Anhänger:innen. Es gab Durchsuchungen, bei denen aber nur ein im Wald unter Gebüsch verborgenes Druckgerät gefunden wurde.108
Im Wahlkampf vor den Gemeindewahlen im März 1933 kam es zu einer aufschlussreichen publizistischen Auseinandersetzung innerhalb des rechten Lagers zwischen der „Tageblatt“-Verlegerin und Politikerin Dolly Schlikker und den Nationalsozialisten. Anlass war ein offensichtlich hämischer Artikel im nationalsozialistischen „Hamburger Tageblatt“ gegen die Politik der „bürgerlich-national“ – so die Selbstbezeichnung – orientierten Gruppierung der Bürgerlichen Einheitsliste Buxtehude, die im Rat der Stadt unter anderem von Dolly Schlikker vertreten wurde. Die Nationalsozialisten um Wüsthoff, Leddin und Wilhelm Meyer warfen der Gruppierung „Systemwirtschaft“ vor und führten einige vermeintliche Beispiele aus der Stadtpolitik der vergangenen Jahre an. Im Einzelnen ging es in dem – anonym verfassten – Artikel um verschiedene Ausgabenposten, im Allgemeinen jedoch darum, die bisherige Stadtregierung und den parteilosen Bürgermeister Johannes Krancke zu diskreditieren. Aus nachträglicher Sicht lässt sich dieser mediale Rundumschlag nicht nur mit dem kommunalen Wahlkampf, sondern auch damit interpretieren, dass die Ende März folgende gewaltsame Besetzung des Buxtehuder Rathauses öffentlichkeitswirksam vorbereitet werden sollte.109
Im Gegenzug wurde in einer bald darauf folgenden, ausführlichen Replik im „Buxtehude Tageblatt“ unter dem Titel „Niedriger hängen!“ den NSDAP-Mitgliedern Meyer und Wüsthoff unlauterer Umgang mit Geld vorgeworfen. Die Replik wurde unterzeichnet mit: Die Beauftragten des Wahlvorschlages Nr. 29. Bürgerliche Einheitsliste Buxtehude.110 Sie begann mit den Worten „Wüste Hetze gegen Frau Schlikker, den Bürgermeister und das Buxtehuder Tageblatt im nationalsozialistischen Hamburger Tageblatt“. Unter anderem folgte eine ausführliche Argumentation, in der die bisherige Politik und namentlich Bürgermeister Krancke verteidigt sowie umgekehrt der NSDAP-Fraktionsführer Wüsthoff wegen seines hohen Gehalts und anderer – tatsächlicher oder vermeintlicher – Privilegien in seiner Stellung als Chefarzt des städtischen Krankenhauses angegriffen wurde. Dabei zeigten sich auch einzelne Details der Buxtehuder Stadtpolitik aus den vergangenen Jahren, nicht zuletzt persönliche Rivalitäten und Konfrontationen.111
3.1 Artikel „Niedriger hängen“ aus dem Buxtehuder Tageblatt vom 10. März 1933
Es folgte dann noch eine Gegendarstellung von Wüsthoff im „Tageblatt“ vom 11. März 1933: „Die im Buxtehuder Tageblatt gegen meine Person und meine Einkommensverhältnisse geführten Angriffe weise ich energisch zurück und bezeichne sie als das, was sie sein sollen, nämlich als Blitzableiter für Vorgänge, die anscheinend das Licht der Öffentlichkeit zu scheuen haben. Als Nationalsozialist und, durch das Vertrauen meiner Führer, Amtswalter der NSDAP, weiß ich genau, was ich meinen Volksgenossen schuldig bin.“112 Hier wird also schon deutlich auf die künftige Dominanz der Nationalsozialisten angespielt. Noch deutlicher wird diese Tendenz in einer bezahlten Anzeige im „Buxtehuder Tageblatt“, in der es hieß: „Der Schriftsatz ‚Niedriger hängen‘ im ‚Buxtehuder Tageblatt‘ ist die letzte Zuckung eines Systems, das wir endgültig ausrotten werden. Die Richtlinien dafür haben wohl auch die Buxtehuder am Radio aus dem Munde unseres Parteigenossen, Reichskommissars Goering gehört. – Die N.S.D.A.P., Ortsgruppe Buxtehude, steht restlos auf Seiten der Parteigenossen Senator a. D. Wilhelm Meyer und Dr. Wüsthoff. Wir werden den Gegnern auf den Fersen bleiben.“113
In dieser publizistischen Auseinandersetzung ging es also vor allem um persönliche Vorwürfe und Rivalitäten. Erstaunlich ist, mit welcher persönlichen Häme die Auseinandersetzungen im Kontext des kleinstädtischen Milieus von Buxtehude geführt wurden. Die Dynamik der politischen Machtverhältnisse wurde deutlich, weil Wüsthoff die zunehmende Dominanz der NSDAP offensichtlich nutzen wollte, um seinen persönlichen Machtspielraum zu erweitern. Während von späteren Angriffen auf das dann auch letztlich vollständig auf NSDAP-Kurs einschwenkende „Tageblatt“ oder auf Dolly Schlikker nichts mehr überliefert ist, sah sich Bürgermeister Johannes Krancke auch später den Anfeindungen und Unterstellungen Wüsthoffs ausgesetzt, bevor der – wie noch zu berichten sein wird – neue Bürgermeister Großheim diesem Treiben ein formalbürokratisches Ende setzte.
SA-Mann Glüer und die Besetzung des Buxtehuder Rathauses
Allgemein mussten im Kreis Stade und dort vor allem in den ländlichen Gemeinden die Nationalsozialisten bei der Durchsetzung ihres Machtanspruchs nur zum Teil Neubesetzungen bei den Gemeindevorstehern vornehmen. Hartmut Lohmann konstatiert im Vergleich von Anfang 1933 und Mitte 1934 eine gewisse Kontinuität in den Führungsämtern der Gemeinden. Teilweise sympathisierten dörfliche Eliten ohnehin mit den Nationalsozialisten. In vielen Fällen blieben Gemeindevorsteher auch ohne NSDAP-Parteibuch im Amt, weil sie zur alteingesessenen ländlichen Honoratiorenschaft gehörten.114
Das aber sah in Buxtehude ganz anders aus: Die Kommunalwahlen am 12. März brachten nicht den von den Nationalsozialisten erhofften Durchmarsch. Trotz aller Bedrängnisse wurden noch vier Sozialdemokraten in die Stadtvertretung gewählt: der Heizer Johannes Engel, der Lehrer Hugo Schimke, der Zimmerer Peter Meyer und – als prominentester – der Kaufmann Wilhelm Geerken. Unter beruflichem Druck nahm Schimke die Wahl nicht an, die Sozialdemokratin Lina Meyer rückte zunächst nach. Die gewählten Mandatsvertreter standen jedoch unter dem Verdikt des nationalsozialistischen Regimes, dass zunächst alle KPD- und später auch alle SPD-Leute von Sitzungen der Vertreterkörperschaften auszuschließen bzw. zu „beurlauben“ und zu ersetzen seien. Daher wurde am 27. März 1933 auch der sozialdemokratische Senator Ferdinand Geerken aus dem Buxtehuder Magistrat vertrieben.115
Das reichte aber den Nationalsozialisten in Buxtehude offensichtlich nicht, denn nur kurz darauf griffen sie zum Mittel der Gewalt: Am Vormittag des 31. März 1933 kam es zur Besetzung des Rathauses, um den Ausgang der Kommunalwahlen endgültig zu konterkarieren. Flankiert wurden die Aktionen von einer Verfügung des kommissarischen Stader Regierungspräsidenten, des Nationalsozialisten Albert Leister. Mit dessen Verfügung wurde im Vorwege die sofortige „Beurlaubung“ des Buxtehuder Bürgermeisters Johannes Krancke ebenso angeordnet wie die von Gaswerksdirektor Georg Schulz und Stadtoberinspektor Louis Bach. Der SA-Führer Werner Glüer sollte demnach zum kommissarischen Bürgermeister ernannt werden.116
Wie der Ablauf im Einzelnen war, erhellt aus der in den Quellen überlieferten Vollzugsmeldung von Regierungsinspektor Hasse ans Stader Regierungspräsidium: „In Ausführung des vorstehenden Auftrages habe ich mich unter Begleitung von 40 Hilfspolizeibeamten [d. h. SA] aus Stade unter Führung des Polizeioberleutnants Vespermann am 31. März 1933 morgens nach Buxtehude begeben. Am Ortseingang traten weitere 35 Hilfspolizisten [SA] aus Buxtehude unter Führung des Majors a. D. Glüer zu diesem Kommando. Um 8 Uhr wurde das Rathaus besetzt, alle Eingänge wurden gesperrt und die Sicherung der Straßen durchgeführt. … Ich gab dem Bürgermeister Krancke und dem Stadtoberinspektor Bach die eingangs bezeichnete Verfügung durch Vorlesen bekannt und ersuchte den Bürgermeister um Übergabe der Geschäfte an den komm.[issarischen] Bürgermeister, Major a. D. Glüer. Dies geschah alsbald. Für den beurlaubten Stadtoberinspektor Bach wurde im Laufe des Vormittags der hierzu bestellte Kreisausschussoberinspektor Lühring (Jork) vertretungsweise vom komm.[issarischen] Bürgermeister eingesetzt.“ Der nicht im Rathaus befindliche Schulz wurde später auch „beurlaubt“ – so der beschönigende Begriff, der faktisch eine Vertreibung aus dem Amt bedeutete.117
Das „Buxtehuder Tageblatt“ berichtete noch am selben Tag wie folgt: „Heute vormittag ½ 8 Uhr traf hier, unter Führung des Kommissars des Herrn Regierungspräsidenten Regierungsamtmann Hasse und des Polizeioberleutnants Vespermann eine Abteilung Schupo, Hilfspolizei, SA und Stahlhelm mit Gewehren ein. Die Abteilung wurde an der Waldburg von der Buxtehuder SA empfangen, mit der zusammen sie durch die Stadt nach dem Rathause marschierte. Dort wurde das Rathaus besetzt.“118 Das „Tageblatt“ berichtete zugleich über politisch motivierte Festnahmen der sozialdemokratischen Stadtvertreter Wilhelm Geerken (der Kaufmann zählte vor Ort seit Beginn der Weimarer Republik zu den führenden Köpfen der SPD), Hugo Schimke (Lehrer und Reichsbanner-Vorsitzender) sowie von Gewerbelehrer Ording, Elblotse Köpke und Gasarbeiter Holtz – vom weiteren Schicksal Schimkes und Geerkens werden wir später noch ausführlicher lesen.119 Das sozialdemokratische Magistratsmitglied, der Senator Ferdinand Geerken, war – wie berichtet – bereits am 27. März „beurlaubt“ worden.120 Das endgültige formelle Ende der gewählten sozialdemokratischen Kommunalvertreter kam durch eine Zwangsverfügung des Stader Landrats vom 5. Juli 1933, die ihnen die Ausübung ihrer Mandate endgültig untersagte. Bereits zuvor war die SPD reichsweit von den nationalsozialistischen Machthabern ebenso verboten worden wie das Reichsbanner und die freien Gewerkschaften.121
3.2 Eingang zum Buxtehuder Rathaus, um 1935
StadtA BUX, AS 60, Nr. 641
Buxtehude blieb mit der gewaltsamen Rathaus-Aktion der Nationalsozialisten innerhalb des Kreises Stade ein singulärer Fall. Möglicherweise war die hier relativ starke Sozialdemokratie ein Grund dafür sowie auch der Umstand, dass mit Fraktionsführer Wüsthoff und SA-Führer Glüer besonders rabiate Nationalsozialisten ihre Machtspiele trieben.
Nach dem Sturm auf das Rathaus und der Absetzung von Bürgermeister Krancke griffen die Nationalsozialisten personell nun weiter durch, um die Stadtregierung auf ihre Linie zu bringen. Glüer besetzte das Amt des Bürgervorsteher-Wortführers mit dem NSDAP-Mann Regierungsbaumeister Fischer, als Senatoren amtierten im Magistrat künftig der Apotheker und führende NSDAP-Funktionär Leddin, der Mechanikermeister Beiker (ebenfalls NSDAP) und der Schneidermeister Becker (Liste Altkloster).122 Lohmann stellt fest, dass somit „die Machtverhältnisse an der Verwaltungsspitze in Buxtehude schnell im Sinne der Nationalsozialisten geklärt“ wurden.123
Dies galt im Übrigen auch für Einrichtungen wie die städtische Sparkasse, wo Ende 1934 nur noch eine Person dem Gremium angehörte, die schon 1932 dort tätig war. Der Geschäftsbericht der Sparkasse für 1934 lobte ausdrücklich die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik. In den Buxtehuder Ratsprotokollen gab es in den Wochen nach dem 31. März keine Hinweise auf den gewaltsamen Machtwechsel – außer, dass der Name des neuen kommissarischen Bürgermeisters genannt wird und der Name von Stadtoberinspektor Louis Bach als Protokollführer zugunsten von Verwaltungsgehilfe Bode verschwand.124
Mit Durchsetzung der nationalsozialistischen Diktatur gingen die spezifischen, nicht nur vom Wohnen geprägten Sozialmilieus der Arbeiter verloren: „Auch in Buxtehude insgesamt kappt der Nationalsozialismus nach 1933 viele traditionelle politische Strukturen und macht hiesiger Arbeiterkultur (Sport- und Gesangvereine, Nachbarschaften mit gegenseitiger Hilfe beim Hausbau, Stammtische, Gewerkschaftsarbeit) weitgehend den Garaus.“125
Persönliche Tragödien: Bürgermeister Krancke – Stadtoberinspektor Bach – Gaswerksdirektor Schulz
Die offiziell vorgetragenen Gründe für die „Beurlaubungen“ von Bürgermeister Johannes Krancke sowie von Louis Bach und Georg Schulz waren ebenso unterschiedlich wie die Folgewirkungen. Bach und Krancke wurden die Verletzung städtischer Interessen zur Last gelegt. Bei Schulz spielte der Hinweis auf frühere sozialdemokratische Aktivitäten eine Rolle. Im Hintergrund stand aber persönliche Rachsucht der Nationalsozialisten.
Letzteres galt in erster Linie für Krancke.126 Hier entwickelte insbesondere Hans Wüsthoff erhebliche Energie, um ihm auch nach seiner Amtsenthebung noch zu schaden. Wüsthoff zählte, wie schon angedeutet, zu den zentralen Akteuren im nationalsozialistischen Machtgeflecht Buxtehudes. Als Chef des städtischen Krankenhauses sowie Facharzt für Chirurgie und Frauenkrankheiten war er in mehreren städtischen Kommissionen vertreten. Zugleich zählte Wüsthoff – der auch als NSDAP-Fraktionsführer wirkte – zu den umstrittensten Persönlichkeiten der Stadt. Selbst Parteigenossen ging sein rabiates, von Ehrgeiz, Rach- und Verleumdungssucht getriebenes Verhalten bisweilen zu weit. Wüsthoff, der frühzeitig in die Partei eingetreten war und in der Parkstraße wohnte (in einem ehemals der Familie Winter gehörenden Anwesen),127 nutzte jedenfalls ab 1933 seine neue Machtfülle weidlich aus.
3.3 Bürgermeister Krancke, um 1930
StadtA BUX, AS 21 Nr. 257
Zur Zielscheibe wurde zunächst der bisherige Bürgermeister Johannes Krancke: Der ausgebildete Jurist war am 9. August 1885 auf Krautsand geboren worden und amtierte von 1920 bis 1923 als hauptamtlicher Gemeindevorsteher in Altkloster, 1923/24 als Bürgermeister im schleswigschen Glücksburg und ab 1. Januar 1925 als Bürgermeister in Buxtehude.128Noch am 14. September 1932 wurde er zum stellvertretenden Mitglied des kommissarischen Kreisausschusses für den gerade neu gebildeten Großkreis Stade bestellt.129