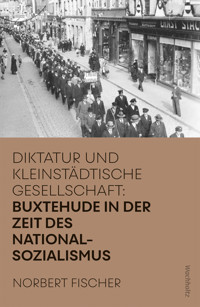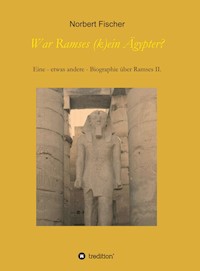
3,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Blickwinkel auf den bekanntesten der Pharaonen - Ramses II.
Das E-Book War Ramses (k)ein Ägypter? wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Ägypten, Alte Kulturen, Pharaonen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Norbert Fischer
War Ramses (k)ein Ägypter?
Eine – etwas andere – Biographie über Ramses II.
© 2019 Norbert Fischer
Autor: Norbert Fischer
Umschlaggestaltung, Illustration: Norbert Fischer
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-7482-8289-1 (Paperback)
ISBN: 978-3-7482-8290-7 (Hardcover)
ISBN: 978-3-7482-8291-4 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Einführung
„Soldaten, vierzig Jahrhunderte blicken auf euch herab!“ Mit diesen Worten soll Napoleon Bonaparte am Morgen des 21. Juli 1798 seine Soldaten angefeuert haben, als diese unter den Pyramiden von Gizeh der mächtigen Mamlukenstreitmacht des ägyptischen Herrschers Murad Bey gegenüber stehen. Obwohl die Schlacht gewonnen wird und Napoleon am 24. Juli in Kairo einzieht, soll die Ägypten-Expedition zu einem Fiasko für die Franzosen werden. Nachdem der englische Admiral Horatio Nelson nur wenige Tage später – am 1. und 2. August – bei Abukir die französische Flotte schlägt, ist der Traum Napoleons, in die Fußstapfen Alexander des Großen zu treten und den Orient zu erobern sowie die Vorherrschaft des britischen Empires zu brechen, bereits ausgeträumt. Ein Jahr später – am 24. August 1799 – verlässt der glücklose Napoleon wieder das Land am Nil. Den größten Teil seiner Expeditions-Armee lässt er jedoch in Ägypten zurück. Die Soldaten können das Land erst nach der Kapitulation von General Menous – im Sommer des Jahres 1801 – verlassen.
Für die Wissenschaft ist die Expedition des Korsen dennoch ein großer Erfolg. Denn unter den Teilnehmern des Kriegszuges befinden sich nicht nur 36.000 Soldaten, sondern auch über 150 Experten aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Fachbereichen. Unter der Leitung von Dominique Vivant Denon (1747-1825) – einem Mitglied der Académie Française – wird alles kartographiert, gezeichnet, vermessen und transkribiert, was den Wissenschaftlern unter die Augen kommt. Denons Interesse gilt jedoch nicht nur dem Ägypten der Neuzeit. Er besucht – während des Kriegszuges unter der Führung von General Desaix in Oberägypten – auch die antiken Stätten aus der Zeit der Pharaonen. Ihm ist es zu verdanken, dass die ägyptische Altertumsforschung seit jenen Tagen einen enormen Aufschwung erfährt.
Vivant Denon gehört mit zu den Privilegierten, die mit Napoleon Ägypten frühzeitig verlassen können. Am 9. Oktober 1799 betreten sie wieder französischen Boden. In Denons Reisegepäck befinden sich einige hundert Blatt Papier mit Zeichnungen, Skizzen und schriftlichen Aufzeichnungen. Diese bilden die Grundlage für sein Buch „Voyage dans la Basse et la Haute Égypte“, welches bereits 1802 erscheint und sofort zum Bestseller wird. Auf Initiative von General Jean-Baptiste Kléber – einem weiteren Teilnehmer der napoleonischen Ägypten-Expedition, der im Juni 1800 in Kairo einem Attentat zum Opfer fiel – wird ein systematisches Verzeichnis aller Entdeckungen erstellt. Diese münden schließlich in die „Description de l’Égypte“, die zwischen 1809 und 1824 unter der Leitung des Mathematikers Jean Baptiste Fourier in großvolumigen Text- und Bildbänden herausgegeben wird. Die Veröffentlichung löst eine wahre Ägyptomanie in nahezu allen Bevölkerungsschichten des 19. Jahrhunderts aus, denen eine beinahe hektische Ausgrabungs- und Sammlertätigkeit nach ägyptischen Altertümern folgt.
Ein weiterer Meilenstein für die Geschichtsforschung ist der Fund des Dreisprachensteins, den französische Soldaten im Juli 1799 bei Schanzarbeiten bei Rosette, dem heutigen Raschid, ausgraben. Diese – 112 mal 76 Zentimeter große und 762 Kilogramm schwere – Basaltplatte ist in drei Textteile gegliedert. Wie aus dem unteren Teil der Platte hervorgeht, den man schnell entziffert hat, da er in griechischer Schrift geschrieben wurde, enthält sie ein Dekret der ägyptischen Priestersynode, die sich zu Ehren des Herrschers Ptolemäus V. Epiphanes (reg. 204-180 v. Chr.) am 27. März des Jahres 196 v. Chr. in Memphis versammelt hatte. Die Inschrift weist außerdem darauf hin, dass das Dokument in drei verschiedene Schriften – der obere Teil Altägyptisch (den Hieroglyphen), das mittlere Drittel Demotisch und der untere Teil Griechisch – abgefasst ist. Nach der Kapitulation der Franzosen in Ägypten wird der Stein in Alexandria von den Engländern beschlagnahmt und nach Portsmouth verschifft. Von dort findet er seinen Weg nach London, ins Britische Museum, wo er seitdem zu sehen ist. Der „Stein von Rosette“, bzw. eine Kopie desselben, soll Jahre später mit die Grundlage dafür bilden, dass die Hieroglyphen entschlüsselt werden. Der schwedische Gelehrte und Diplomat Johan David Åkerblad versucht sich in den folgenden Jahren ebenso daran, wie der englische Arzt und Physiker Thomas Young. Beide können jedoch nur Teilerfolge vermelden. Der endgültige Durchbruch zur Entzifferung der Hieroglyphen gelingt dem Franzosen Jean-François Champollion (1790-1832). Am 14. September 1822 ruft er seinem Bruder zu: „Je tiens l’affaire!“ (Ich hab’s!) und bricht anschließend vor Aufregung und Erschöpfung ohnmächtig zusammen.
Allgemein wird die Geburtsstunde dieses relativ jungen Zweigs der Wissenschaften – der Ägyptologie – auf den 27. September 1822 datiert, als Champollions Schreiben „Lettre à M. Dacier relative à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Égyptiens pour inscrire sur leurs monuments les titres, les noms et les surnoms des souverains grecs et romains“– nach akademischer Sitte war das Werk in Form eines Briefes an eine bedeutende Person des Wissenschaftsbetriebes adressiert – vor der Pariser Académie des Inscriptions vorgestellt wird. Damit ergibt sich für die Ägyptologen erstmals die Möglichkeit, direkt auf altägyptisches Quellenmaterial zurückgreifen zu können.
Auch die überlieferten Aufzeichnungen antiker Reisender und Schriftsteller, welche in griechisch-römischer Zeit Ägypten besuchten, bieten den unzähligen Ägyptologen, Ausgräbern und Forschern – die das Land nach der napoleonischen Expedition geradezu überschwemmen – wertvolle Hinweise auf die vor 5000 Jahren entstandene Hochkultur der Ägypter. Dass die Geschichtsforschung über das alte Ägypten jedoch noch längst nicht abgeschlossen ist, erfahren wir fast täglich immer wieder aufs Neue. Nach über 20 Jahrzehnten Erforschung der Altägyptischen Geschichte werden auch heute noch Aufsehen erregende Entdeckungen gemacht. Eine der Sternstunden der Ägyptologie war wohl – im November 1922 – die Entdeckung des nahezu unberührten Pharaonengrabes Tut-ench-Amuns durch den Engländer Howard Carter (1874-1939) im Tal der Könige. Ob es sich bei den Entdeckungen, welche in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, um Textfragmente, Gräber, Paläste, Statuen oder Pyramidenschächte handelt, oft sind es nur winzige Details, die das Gesamtbild ergänzen oder abrunden. Unser Basiswissen über die Kultur der alten Ägypter bleibt jedoch seit den Tagen Champollions – also seit fast 200 Jahren – nahezu unverändert.
Die Altägyptische Geschichte ist für uns vor allem die Geschichte seiner Herrscher – den Pharaonen. Einer der berühmtesten war unbestritten Ramses II. Er ist – neben dem Pyramidenerbauer Cheops, dem Ketzerkönig Echnaton und seiner Gemahlin Nofretete, dem Kindkönig Tutench-Amun und der Ptolemäerkönigin Kleopatra – eine der bekanntesten Persönlichkeiten der ägyptischen Geschichte, und für uns der Inbegriff eines altägyptischen Herrschers. Seine 66-jährige Regierungszeit (reg. 1279-1213 v. Chr.) wird nur von Pepi II. (um 2200 v. Chr.), einem Herrscher der 6. Dynastie, übertroffen, der als Kleinkind auf den Thron kam und angeblich 94 Jahre regiert haben soll.
Ramses II. lässt so viele Bauwerke errichten, wie kein Pharao vor oder nach ihm. Seine bekanntesten Bauwerke sind die monumentalen Felsentempel von Abu Simbel, der Große Säulensaal im Karnak-Tempel, der Eingangspylon am Luxor-Tempel, sowie sein Totentempel in Theben-West, Ramesseum genannt. Auch die Zahl seiner Nachkommen – nachweisbar sind inzwischen 40 Töchter und 45 Söhne – wird von keinem anderen Herrscher übertroffen. Ramses II. war eben auf allen Gebieten ein Gigant, ein wahrer Dinosaurier unter den Pharaonen.
Die Knechtschaft des Volkes Israel in Ägypten ist – zu Recht oder Unrecht, das sei hier erst einmal dahingestellt – ebenso mit seinem Namen verbunden, wie die Kriegszüge gegen die Hethiter, deren Höhepunkt die Schlacht bei Kadesch war.
Warum also sollte ausgerechnet Ramses II. – schon seine Zeitgenossen verliehen ihm den Beinamen „der Große“ –, kein Ägypter sein? Es gibt jedoch einige Anhaltspunkte im Leben und Wirken Ramses’ II., die den Verdacht aufkommen lassen, dass …
„Ganz allgemein lässt sich sagen, dass alles Dunkle und jeder Fehlschlag im Leben des Pharaos sorgsam unterdrückt wurden, so dass uns gerade die Einzelheiten fehlen, die einer wirklichkeitsgetreuen Geschichtsschreibung erst Farbe und Anschaulichkeit verleihen.“
Sir Alan Gardiner
Geschichte des Alten Ägypten
1. Kapitel:
Von der 18. zur 19. Dynastie
Ramses II. wird etwa 1304/03 v. Chr., als Sohn des Sethos und dessen Gemahlin Tuja geboren. Vermutlich erblickt er in der damaligen ägyptischen Hauptstadt Memphis das Licht der Welt. Dort ist sein Vater zu jener Zeit als Offizier stationiert. Die väterlichen Vorfahren Ramses entstammen einer Offiziersfamilie die ursprünglich in der, im nordöstlichen Nildelta gelegenen, Stadt Avaris beheimatet war.
Ramses’ Urgroßvater, der – ebenso wie Ramses’ Vater – Suti (Sethos) hieß, hatte es bis zum Truppenobersten in den ägyptischen Streitkräften gebracht. Dessen Sohn – Ramses’ Großvater – der um 1360 v. Chr. geborene Pa-Ramses (= Der [Sonnengott] Re ist es, der ihn geboren hat), diente ebenfalls als hoher Offizier in der ägyptischen Armee. Zu seiner militärischen Laufbahn kommen wir am Schluss dieses Kapitels. Die Karriere Pa-Ramses ist eng verknüpft mit der des ehemaligen Generals und Regenten Haremhab, der zur Zeit der Geburt Ramses’ II. auf dem ägyptischen Thron sitzt.
Um nachzuvollziehen, weshalb und warum die Soldatenfamilie von Ramses II. überhaupt den Pharaonenthron Ägyptens in Besitz nehmen konnte, schauen wir etwa 250 Jahre zurück. Wir werfen dabei einen Blick auf die Pharaonen der glanzvollen 18. Dynastie und richten unsere Aufmerksamkeit besonders auf deren verwirrendes Ende, das gleichzeitig den Übergang zur 19. Dynastie darstellt.
Ägypten, Neues Reich – Beginn der 18. Dynastie, etwa 1540 v. Chr.
Menes, der legendäre Reichseiniger und Begründer der 1. Dynastie, lebte bereits vor 1500 Jahren und die Pyramiden von Gizeh, erbaut von den Pharaonen der 4. Dynastie, sind zu diesem Zeitpunkt schon eintausend Jahre alt. Ägypten – altägyptisch Kemet –, das „Schwarze Land“ am Nil, erlebt während der 18. Dynastie kulturell eine seiner Blütezeiten und erreicht in dieser Epoche, auf Grund des Machtanspruchs der herrschenden Pharaonen, seine größte räumliche Ausdehnung.
Im Jahr 1522 vor Christus werden die Hyksos aus dem Land geworfen. Ursprünglich ein vorderasiatisches Nomaden- und Hirtenvolk, setzen sich die Hyksos auf ihrer Wanderung in Unterägypten fest und verdrängen die schwachen Kleinkönigtümer der 15. Dynastie. Sie lassen während ihrer rund 100-jährigen Herrschaft relativ unabhängige Stadtkönigtümer in Mittel- und Oberägypten zu. Unterägypten kontrollieren sie von ihrer –im östlichen Delta gelegenen – Residenz Avaris aus. Die Hyksos – das Wort stammt aus griechischer Zeit und bedeutet so viel wie „Hirtenkönige“ – führen in Ägypten das Pferd und, damit verbunden, den Streitwagen ein. So sind sie den Ägyptern, zumindest auf militärischem Gebiet, weit überlegen.
Unter der Führung des Stadtfürsten von Theben – Sekenen-Re – kommt es schließlich zum bewaffneten Widerstand gegen die Besatzer. Bei seinem Kampf gegen die Hyksos kommt Sekenen-Re ums Leben. Seine Mumie weist Kopfverletzungen auf, die wohl von einem Schwert- oder Axthieb herrühren. Seine beiden Söhne führen jedoch den, unter ihrem Vater begonnenen, Unabhängigkeitskampf fort. Während auch Kamose im Kampf gegen die Hyksos sein Leben verliert, kann der jüngere Sohn – Ahmose (reg. etwa 1539-1514 v. Chr.) – den Befreiungskampf erfolgreich fortsetzen. Ihm gelingt es, die ehemalige Hauptstadt Memphis von den Hyksos zu befreien. Auch Avaris wird von ihm zurückerobert und die Hyksos endgültig aus dem Deltagebiet vertrieben. Im Süden kann der Einflussbereich des thebanischen Herrscherhauses bis zum 2. Nilkatarakt ausgedehnt werden. Ahmose vereinigt die Gaue Ober- und Unterägyptens wieder zu einem Reich und lässt sich zum Pharao krönen. Damit begründet er die 18. Dynastie.
Werden König Menes (um 3000 v. Chr.), der legendäre Gründer von Memphis, als Einiger des Alten Reiches und Mentuhotep II. (reg. etwa 2008-1957 v. Chr.) als Einiger des Mittleren Reiches angesehen, so geht Ahmose als Einiger des Neuen Reiches in die Geschichte des Landes ein.
Seinem Sohn Amenophis I. (reg. etwa 1514-1493 v. Chr.) gelingt es, die Grenzen Ägyptens zu festigen und an die überlieferten Strukturen des Mittleren Reiches anzuknüpfen. Theben rückt sowohl als Hauptkultort des Gottes Amun-Re, wie auch als Verwaltungszentrum in den Mittelpunkt des Landes. Mit dem Aufstieg Amuns zum Reichsgott Ägyptens gewinnen auch die Amun-Priester in Theben zunehmend an Macht und Einfluss. Während der Ramessidenzeit werden Amenophis I. und seine Mutter Ahmes-Nefertari als Schutzgottheiten von Theben-West verehrt.
Als eigentlicher Ahnherr der 18. Dynastie wird jedoch Thutmosis I. (reg. etwa 1493-1482 v. Chr.) angesehen. Er erwirbt die Kronen Ober- und Unterägyptens durch Heirat mit Ahmosis, einer Tochter seines Vorgängers. Thutmosis I. baut die ehemalige Hauptstadt Memphis zur Militärgarnison aus, und dringt von dort – über Palästina und Syrien – bis an den Euphrat vor. An den Ufern „des umgedrehten Wassers“, wie der Euphrat von den Ägyptern genannt wird (weil er entgegengesetzt des Nils von Nord nach Süd fließt), stellt er Grenzstelen auf, um seinen Einflussbereich zu dokumentieren. Die Südgrenze Ägyptens kann er bis zum 4. Nilkatarakt ausdehnen. Als Warnung an Aufständische lässt Thutmosis I. deren Anführer mit dem Kopf nach unten am Bug seiner königlichen Barke aufhängen.
Der Pharao errichtet vor allem in Theben Tempelanlagen und Paläste. So lässt er die Umfassungsmauer um die Tempelanlage von Karnak erneuern und stellt – damit verbunden – zwei mächtige Obelisken auf. Sie sind jeweils 143 Tonnen schwer und über 21 Meter hoch. Als erster Pharao lässt sich Thutmosis I. von seinem Baumeister Ineni im Biban el-Muluk, d. h. Königstor, besser bekannt als Tal der Könige, ein – bisher noch nicht einwandfrei identifiziertes – Grab anlegen. In dem – dem Pharao zugeschriebenen – Grab führt ein unterirdischer Gang zur ovalen Grabkammer, in der sich ein Sarkophag aus rotem Sandstein befindet. Die ovale Form der Grabkammer soll die Königskartusche symbolisieren. Der Totentempel des Pharao wird ebenfalls auf dem westlichen Nilufer errichtet. Er steht auf jenem schmalen Streifen Land, der den Übergang zwischen dem fruchtbaren Ufergürtel des Flusses und der Wüste bildet, die sich unendlich nach Westen hin ausdehnt. Anders als bei den Pyramidenbauten des Alten und Mittleren Reiches bilden Grab und Totentempel keine Einheit mehr, sondern sind räumlich voneinander getrennt.
Die Thutmosis I. zugeschriebene Mumie wurde 1881 in einem Sammelversteck gefunden. Im Juni 2007 wurde sie zahlreichen Gentests und computertomographischen Aufnahmen unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Arme der Mumie sich in einem ausgestreckten Zustand längs des Körpers befinden. Normalerweise liegen die Arme bei königlichen Mumien gekreuzt über der Brust. Eine weitere wichtige Entdeckung waren Metallgegenstände im Oberkörper, so u. a. eine Pfeilspitze unterhalb der elften Rippe. Bisher war man immer davon ausgegangen, dass der Pharao eines natürlichen Todes verstorben ist. Die CT-Aufnahmen zeigten außerdem, dass es sich bei der Mumie um die eines etwa 20- bis 30-jährigen Mannes handelt. Nach herkömmlicher Geschichtsschreibung verstarb Thutmosis I. aber im Alter von über 50 Jahren.
Thutmosis II. (reg. etwa 1482-1479), von dem jeweils ein Feldzug nach Nubien und Palästina bekannt ist, wird mit seiner Stiefschwester Hatschepsut verheiratet. Der Pharao stirbt nach knapp 3-jähriger Regierungszeit und hinterlässt das Reich seinem minderjährigen Sohn, der von einer Nebenfrau des Herrschers – Aset – abstammt.
Thutmosis III. (reg. etwa 1479-1426 v. Chr.) teilt sich den Thron mit seiner Stiefmutter/-tante Hatschepsut (reg. etwa 1479-1458 v. Chr.). Hatschepsut ist eine Tochter Thutmosis’ I. Sie übt für den minderjährigen König, der zu diesem Zeitpunkt etwa 4 Jahre alt gewesen sein dürfte, die eigentliche Regentschaft aus. Doch bereits in ihrem gemeinsamen siebten Regierungsjahr lässt sich Hatschepsut, mit dem Segen Amuns und dessen Priester, zum König – nicht zur Königin – krönen. Wichtigster Berater der Herrscherin ist ihr persönlicher Vermögensverwalter und Günstling Senemut, der auch als Erzieher der Tochter der Königin fungiert.
Von den Bauten während der nun folgenden Alleinherrschaft Hatschepsuts ist vor allem ihr Terrassentempel bei Deir-el-Bahari zu nennen. Der Totentempel der Königin wurde unter der Leitung ihres Günstlings Senemut in den gewachsenen Felsen des Tales hinein gebaut. Zwei Rampen führen noch heute sanft ansteigend zu den Terrassen hinauf. Einst führte eine Allee, gesäumt von 200 Sphingen, welche die Gesichtszüge der Königin trugen, vom Nilufer bis zu ihrem Totentempel. Die Kapelle des Tempels ist der Göttin Hathor geweiht. In der Geburtshalle wird die Geburt der Königin aus der Vereinigung von Amun – ihrem göttlichen Vater – und ihrer irdischen Mutter Ahmosis dargestellt. Mit diesem Hinweis auf ihre göttliche Abstammung versucht Hatschepsut ihren Thronanspruch zu legitimieren. In verschiedenen Inschriften nennt sie sich daher auch „Tochter Amuns“. Bei öffentlichen Zeremonien tritt sie häufig als Pharao, d. h. als männlicher Herrscher, auf. Sie trägt dazu auch die Statussymbole eines männlichen Oberhauptes. Dazu gehört der, um das Kinn gebundene, aus Leder geflochtene Zeremonienbart ebenso, wie den um die Hüfte geschlungenen Schwanz eines wilden Stieres.
Auch in Karnak betätigt sich Hatschepsut als Bauherrin. So lässt sie dort u. a. ein Barkensanktuar zu Ehren Amuns, die so genannte Chapelle rouge errichten sowie vier Obelisken von etwa 30 Meter Höhe aufstellen, von denen heute lediglich nur noch einer aufrecht steht. Im ganzen Land werden von ihr die – von den Hyksos zerstörten – Tempel wieder aufgebaut, restauriert und mit Schenkungen bedacht.
Terrassentempel der Hatschepsut
Ihre Flotte schickt Hatschepsut erstmals in ihrem 9. Regierungsjahr, wie in der linken Pfeilerhalle des Terrassentempels ausführlich dargestellt, unter der Leitung ihres Schatzmeisters Nehesi über das Rote Meer in das Weihrauchland Punt. Das sagenumwobene Land Punt dürfte etwa mit dem Gebiet zwischen dem heutigen Somalia und den Nilquellen identisch sein. Damit knüpft Hatschepsut an eine Tradition der Pharaonen aus dem Mittleren Reich an, die Schiffe für Handelsexpeditionen in ferne Länder ausrüsteten. Die Punt-Expedition der Königin bringt von ihrer friedlichen Mission – neben dem kostbaren Weihrauchharz und grünen Weihrauchbäumen, die entlang des Aufwegs zu ihrem Totentempel gepflanzt werden – Gewürze, Straußenfedern, Elfenbein, Gold, Tierfelle, edle Hölzer und lebende exotische Tiere mit nach Ägypten.
Nach der etwa 20-jährigen Herrschaft Hatschepsuts übernimmt ihr Stiefsohn Thutmosis III. die alleinige Macht über das Land am Nil. Ursprünglich hatte sich Hatschepsut eine Grabanlage in einer fast unzugänglichen Schlucht, etwa eineinhalb Kilometer von ihrem Totentempel entfernt, bauen lassen. Doch wurde das Grab, in dem man auch einen Sarkophag fand, nie belegt. Das eigentliche Königsgrab der Herrscherin befindet sich im Tal der Könige und misst vom Eingang bis zur Grabkammer 213 Meter. Der Engländer Howard Carter, der das Grab 1903 freilegt, findet unter Schutt und Geröll nur noch ein paar zerbrochene Ton- und Steingefäße mit der Namenskartusche der Herrscherin. Das Grab war – wie schon so viele andere – in antiker Zeit aufgebrochen und seiner Schätze beraubt worden. In der Grabkammer standen jedoch noch zwei leere Sarkophage aus gelbem Quarzit, die – laut Inschriften – für Hatschepsut und ihren Vater, Thutmosis I., vorgesehen waren.
Ebenfalls 1903 entdeckt Howard Carter ein weiteres Grab im Tal der Könige. Darin liegen zwei schwer beschädigte Frauenmumien. Carter interessiert sich nicht weiter für das Grab, da es keine Kostbarkeiten enthält. Er versiegelt es wieder. 3 Jahre später öffnet der Engländer Edward Ayrton das Grab erneut und bringt eine der Mumien in ihrem Holzsarg – es handelt sich um Sitre-In, der Amme Hatschepsuts – ins Museum nach Kairo. Die zweite Mumie lässt er jedoch unbeachtet in der Grabkammer zurück. Der Grabeingang wird verschlossen und das Grab gerät lange in Vergessenheit, bevor es der Amerikaner Donald P. Ryan 1989 wieder öffnet. Er legt die unbekannte Frau in einen Holzsarg und sichert den Grabeingang mit einer Tür. Er vermutet, dass es sich bei der 1,55 Meter großen Mumie um die der Königin Hatschepsut handeln könne, da sie – in der für die 18. Dynastie typischen Grabhaltung für königliche Gemahlinnen – den linken Arm mit geballter Faust über die Brust gebeugt, den rechten Arm seitlich am Körper anliegend, mumifiziert worden war. Zudem findet Ryan in einem Haufen staubiger Überreste eine Klammer, wie sie die Pharaonen benutzten, um ihren göttlichen Bart am Kinn zu befestigen. Nun scheinen alle Zweifel beseitigt, die Frauenmumie könnte – muss – die der Hatschepsut sein.
Im Juni 2007 gibt Zahi Hawass – Chef der ägyptischen Altertümerverwaltung – auf einer Pressekonferenz bekannt, dass die zweite Mumie im Grab der Sitre-In anhand von DNA- und computertomographischen Tests als die der Königin Hatschepsut identifiziert worden ist.
Die DNA-Analyse des Gewebes und Vergleiche der Schädeleigenschaften ergaben, so Hawass, dass die Tote mit Hatschepsuts Vater Thutmosis I., ihrem Halbbruder Thutmosis II. und ihrem Stiefneffen Thutmosis III. verwandt gewesen sein muss. Das war aber noch lange kein sicherer Beweis für die Identität der Königin.
Als weiteres Indiz wurde ein 1881 gefundener Kasten hinzugezogen, welcher die Kartusche der Königin trug. Der Kasten aus dem Fundus des Ägyptischen Museums enthielt innere Organe, welche die Jahrtausende jedoch nicht überdauert hatten. Er enthielt zudem aber einen gut erhaltenen Backenzahn. Sollte der Zahn zu Hatschepsut gehören – bzw. die mutmaßliche Mumie Hatschepsuts zu dem Zahn –, müssten beide zusammen passen. Da man es nicht wagt, den starren Kopf der Mumie aufzubrechen, da sonst der Leichnam zerstört worden wäre, entschließt man sich zu einem computertomographischen Test. CT-Spezialisten schieben die mutmaßliche Mumie der Königin in die Röhre und entdecken beim Scannen tatsächlich eine Lücke im Unterkiefer. Die Stelle lässt sich genau vermessen. Der Vergleich der Mumie mit dem Zahn aus dem Kasten zeigte eine hundertprozentige Übereinstimmung.
Die Tests hatten nicht nur die Identität der Königin bestätigt, sondern auch einige andere Details offenbart. Nach Meinung der Forscher soll Hatschepsut übergewichtig gewesen sein. Sie litt an Diabetes und starb im Alter von etwa fünfzig Jahren an Leberkrebs.
Warum und von wem Hatschepsut in das Grab ihrer Amme gelegt wurde, blieb ungeklärt.
Thutmosis III., der als kriegerischster Pharao der 18. Dynastie gilt, begibt sich schon im ersten Jahr seiner Alleinherrschaft auf einen Feldzug, der ihn in die nordöstlichen Provinzen führt. Auf seinen weiteren Kriegszügen zieht er in Jerusalem ein und besiegt in der Schlacht bei Meggido, nach 7-monatiger Belagerung, eine Koalition von abtrünnigen syrischen und palästinensischen Kleinkönigtümern. Thutmosis III. führt seine Armee, wie schon sein Großvater, bis an den Euphrat, der die natürliche Grenze zwischen dem ägyptischen Einflussgebiet und dem Mitanni-Reich darstellt. Obwohl die ägyptische Armee dabei den Fluss auf Flössen überquert, dringt sie nicht weiter in das Reich der Mitanni vor. Am Ufer des Flusses stellt er – ebenso wie einst sein Großvater – Grenzstelen auf. Selbst das – an das Mitanni-Reich – östlich angrenzende Assyrien leistet Tributzahlungen an den mächtigen Pharao.
General Amenemheb, der später Befehlshaber der königlichen Leibgarde werden soll, berichtet über die Feldzüge des Königs. So beschreibt er u. a. auch eine Elefantenjagd, die der Pharao während einer seiner Feldzüge in Syrien unternimmt. Dabei wird Thutmosis III. von dem größten Tier der Herde angegriffen. Amenemheb stürzt sich auf das Tier und haut ihm mit seinem Schwert den Rüssel ab. Zum Dank, dass er dem Herrscher das Leben rettet, wird er von diesem reich belohnt.
An der Südgrenze des Reiches kann Thutmosis III. die Nubier endgültig unterwerfen. Insgesamt führt er zwischen seinem zweiundzwanzigsten (dem ersten Jahr seiner Alleinregierung) und zweiundvierzigsten Regierungsjahr siebzehn Feldzüge. Von den Ägyptologen des ausgehenden 19. Jahrhunderts wird er deshalb auch gerne als altägyptischer Napoleon bezeichnet. Ägypten wird unter Thutmosis III. endgültig zum Weltreich und Theben zur größten Stadt der damals bekannten Welt.
Von seinen zahlreichen Feldzügen in Vorderasien bringt Thutmosis III. seltene Tier- und Pflanzenarten mit nach Ägypten. Der König hat sie als Reliefs im so genannten „Botanischen Garten“ von Karnak darstellen lassen. Hauptbauwerk des Herrschers in Karnak ist jedoch die Festhalle des Amun-Tempels. Der Gebäudekomplex, der aus drei Hauptteilen besteht, dient dem Pharao als Erneuerungstempel bei seinen Thronjubiläen. Neben mehreren Obelisken, die Thutmosis III. in Karnak aufstellen lässt, wird der Heilige See von ihm ebenfalls erweitert. Einer seiner Obelisken wurde im 4. Jahrhundert auf Anordnung von Theodosius I. nach Konstantinopel geschafft, wo er noch heute zu sehen ist.
In seinen letzten Lebensjahren scheint sich Thutmosis III. als Bilderstürmer betätigt zu haben. So sind die Namenskartuschen Hatschepsuts aus vielen Tempelwänden heraus gemeißelt und ihre Statuen zerschlagen. Auch der Terrassentempel der Königin bleibt davon nicht verschont. Im Sommer 2001 entdeckte ein polnisch-ägyptisches Archäologen-Team bei Restaurierungsarbeiten, dass die mit Goldplättchen geschmückte Wanddekoration in der Geburtshalle des Totentempels von ihrem Nachfolger mit einer Staub- und Gipsschicht überzogen wurde, um den Namen der Herrscherin unkenntlich zu machen. Die mächtigen Obelisken seiner Stieftante im Karnak-Tempel lässt Thutmosis III. ummauern. Auf der Königsliste von Karnak (heute im Louvre ausgestellt), welche von Thutmosis III. im Zentrum des Tempels angelegt wird, sind die Namenskartuschen von ihm und seinen Vorgängern aufgeführt. Es fehlt jedoch der Namenszug seiner einstigen Mitregentin.