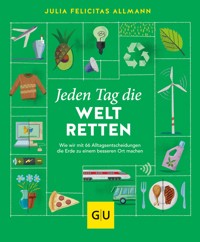Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palomaa Publishing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Gewissheit, dass unser Leben endlich ist, kann uns Angst machen - oder uns spüren lassen, dass unsere Zeit genau deshalb kostbar ist. In diesem Buch erzählen Menschen in persönlichen Gesprächen sehr offen von ihren ganz unterschiedlichen Abschiedsgeschichten. Sie laden uns damit ein, dem Sterben liebevoll und ohne Tabus zu begegnen. Diese Gespräche sind gleichzeitig Lebensgeschichten, die Trost und Kraft schenken und uns bewusst machen, wie schön unser Dasein in allen Facetten ist. Während du dieses Buch liest, wirst du vermutlich berührt sein und mitfühlen. Du wirst innehalten, Neues entdecken und hinterfragen. Du wirst aber genauso lachen, dankbar sein und dich selbst besser kennenlernen. So ging es uns Autorinnen, was uns dazu inspiriert hat, zwischen den Gesprächen eigene Gedanken mit dir zu teilen: kleine Impulse, die dich - und uns selbst - immer wieder erinnern und neu bestätigen dürfen, dieses eine Leben genau jetzt zu leben. "Es ist so wichtig, dass wir uns über unsere Endlichkeit Gedanken machen und auch darüber, wie es nach schweren Abschieden weitergehen kann. DANKE für dieses Buch." - Anna Weilberg, Co-Gründerin von femtastics Mit einem Vorwort von Alexa von Heyden
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Jolle und für alle anderen, von denen etwas bleibt
Wichtiger Hinweis:
In diesem Buch geht es um verschiedene Gesichtspunkte von Tod, Sterben und Trauer. Wir möchten dich zu Beginn darauf hinweisen, dass dieses Buch dadurch auch sehr sensible Inhalte – zum Beispiel zu Themen wie Verlust des eigenen Kindes, Suizid oder Sterbehilfe – enthält, die dich möglicherweise belasten oder triggern können. Bitte sei achtsam mit dir selbst, wenn du dieses Buch liest und hole dir (professionelle) Unterstützung, wenn du mit den Inhalten nicht allein sein möchtest. Im Anhang findest du Adressen verschiedener Anlaufstellen, beispielsweise zu akuten Hilfsangeboten bei suizidalen Gedanken oder psychischen Belastungen.
INHALT
Vorwort von Alexa von Heyden
Schön, dass du da bist …
GEDANKENRAUM – TEIL 1
DR. SYLVIA BRATHUHN
„Es gibt diesen Silberfaden zwischen uns, der für immer bleibt.“
IMPULS : Wie schön es ist, Neues zu wagen
THOMAS KRAUSS
„Mein Mantra war immer: Was sagen wir dem Tod? Nicht heute.“
IMPULS : Mit jeder Welle
MARA BORK
„Wir haben eine
Lego
-Sonderedition mit Särgen und Urnen – damit können die Kinder Trauerfeiern nachspielen.“
IMPULS: Luft zum Leben
JOSEFINE WEBER
„Ich stand bis zum Kinn im Wasser und dachte: Wenn jetzt das Ende kommt, dann kommt es.“
IMPULS : Gefühle sind erlaubt
SABINA BISCEGLIA
„Dann musste ich in einem Satz sagen, dass der Papa nicht mehr lebt – alles andere hätte sich falsch angefühlt.“
IMPULS : Unsichtbare Freiheit
HENDRIK THIELE UND LEO RITZ
„Es ist cool, wenn es ganz unterschiedliche Bestatter:innen gibt und nicht nur Männer im schwarzen Anzug und mit grauem Schnurrbart.“
IMPULS : Unsere Lebenszeit
ABDUL ATTAL
„Es war klar, dass wir nur als Familie fliehen: Entweder wir leben oder wir sterben zusammen.“
GEDANKENRAUM – TEIL 2
MELANIE FALTERMEIER
„Ich dachte, ich könnte jetzt einfach hier aus dem Fenster springen und dann wäre es vorbei – und das hat mir unfassbare Angst gemacht.“
IMPULS : Kleine große Auszeit
CHRISTIAN LANGE
„Ist es nicht okay, wenn Menschen in einem gewissen Alter einfach sterben?“
IMPULS : You can have it all
SILKE STEINRATHS
„Jolle sagte zu mir: Mama, es muss doch jemanden geben, der mich heilen kann – ich bin doch ein Kind.“
IMPULS : Vom Mut, sich zu öffnen
HOLGER SCHARF
„Es war für mich als Sterbebegleiter eine wertvolle Erkenntnis, auch mal sprachlos sein zu dürfen – man muss nicht immer eine Antwort haben.“
IMPULS : Lust auf eine kurze Geschichte?
DOROTHÉE MELLINGHAUS
„Die Aussicht auf einen selbstbestimmten Tod hat mich stets beruhigt.“
IMPULS : Es ist okay.
CHRISTINA WECHSEL
„Ich definierte mich über Leistung und Lebenslauf, und plötzlich liege ich im Krankenhaus und mein Bein wird amputiert.“
IMPULS : Die bunte Vase auf deinem Tisch
JOHANNA KLUG
„Im Sterben ist nichts Aufgesetztes mehr von Bedeutung, es geht nur um das pure Leben.“
IMPULS : Lass los
PHILIPP HANF
„Eine todbringende Erkrankung mit 47? Für mich als Glückskind unvorstellbar.“
GEDANKENRAUM – TEIL 3
Nachwort
Danke
Hilfestellungen und Inspiration
Über die Autorinnen
Weitere Mitwirkende am Buch
Über den Verlag
Vorwort von Alexa von Heyden
Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist die Trauerfeier für meinen Vater. Er hatte sich im Alter von 38 Jahren das Leben genommen.
Zusammen mit meiner Mutter und meinen Geschwistern saß ich in der ersten Reihe in einer schmucklosen Kirche mit niedriger Decke und schaute auf den Sarg aus hellem Holz. Ich drehte mich um und sah in das verweinte Gesicht meiner Tante. Ich war fünf Jahre alt und verstand nicht, was es bedeutet, dass mein Vater „tot“ ist. Er hatte doch gerade noch mit mir im Pool gespielt.
Nach der Trauerfeier lief der Pfarrer hinter meiner Mutter her und rief: „Beruhigen Sie sich doch.“ Aber meine Mutter beruhigte sich nicht. Sie war verzweifelt, weinte wochenlang, manchmal aus dem Nichts im Supermarkt an der Kasse oder einfach so beim Autofahren, wenn ein bestimmtes Lied im Radio lief. Die Menschen um uns herum gaben ihr Tipps, was sie machen könnte, um wieder fröhlicher zu werden: Sport treiben, einen Kuchen backen, Urlaub am Meer verbringen oder sich eine entspannende Massage gönnen. Sie verstanden nicht: Die Trauer um meinen Vater gehörte nun zu unserem Leben. Man konnte sie nicht wegmassieren.
Weihnachten schauten wir uns gemeinsam die Fotoalben an, die mein Vater liebevoll für uns gebastelt hatte, während seine Asche im Meer längst für immer verschwunden war. Meine Brüder und meine Schwester weinten. Ich weinte nie. Mich machte diese melancholische Stimmung bei uns zu Hause wütend. Er hatte uns doch verlassen und meiner Mutter eine Million D-Mark Schulden hinterlassen: Warum auch nur eine Träne an ihn verschwenden? Hätte er ein Grab gehabt, hätte ich den Grabstein umgetreten, ganz sicher.
Ich musste erst lernen, meine Trauer zuzulassen. In der Schule schämte ich mich für das, was in unserer Familie geschehen war. Ich kannte niemanden, der etwas Ähnliches erlebt hatte, wollte nicht als verrückt gelten und verlangte mir deshalb Gefühlskälte ab. Erst als ich zur Uni ging, war ich in der Lage, mich emotional auf jemanden einzulassen. Vorher datete ich nur Jungs, deren Verlust ich verkraften konnte oder von denen ich wusste, dass sie mich irgendwann ohnehin verlassen würden. Zu Gast bei vermeintlich „perfekten“ Familien mit Vater und Mutter saß ich mit am Esstisch und fühlte mich wie ein Alien, das eine andere Spezies beobachtet, so fremd war mir das alles.
Weder in der Schule noch im Fernsehen oder auf öffentlichen Plätzen gab es einen Raum, in dem über das Sterben gesprochen wurde. Hätte es schon damals Bücher wie „BYE“ gegeben, hätte mich das persönlich ermutigt, offen über unsere Geschichte zu sprechen und den Verlust meines Vaters nicht als Stigma, sondern als Teil des Lebens zu begreifen.
Nur in meinem eigenen Buch „Hinter dem Blau“ traute ich mich, über meine Erfahrungen als Kind zu schreiben. Nach der Veröffentlichung hatte ich große Angst, dass ich nie wieder einen Job als Redakteurin bei einem coolen Magazin finden würde. Ich ahnte nicht, was ich mit der Veröffentlichung auslöste. Das Buch stand wochenlang auf der Spiegel-Bestseller-Liste und an meiner Tür klingelten Menschen, die mir mit bebender Stimme gestanden: „Ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber mir ist das Gleiche passiert.“ Wir umarmten uns, eigentlich fremd und doch so vertraut durch die Abschiede, die wir erlebt hatten.
Durch eine eigene Lebenskrise mit anschließender Langzeittherapie fand ich schließlich einen Zugang zu meiner
Trauer, aber auch zu meiner jahrelang unterdrückten Wut. Ich war nicht nur sauer auf meinen Vater, sondern auch darauf, wie ablehnend und schockiert die Gesellschaft auf sein Schicksal und damit auch auf mich als seine Tochter reagierte. Erst nachdem ich mich mit der Krankheit meines Vaters auseinandergesetzt hatte, konnte ich Frieden mit ihm und seinem Tod schließen. Ich machte ihm keine Vorwürfe mehr, dass er uns verlassen hat.
Im Gegenteil: Ich erkannte, wie viel Mitgefühl und Liebe in mir steckt und dass mein Trauma, ihn so früh verloren zu haben, meine Superpower ist. Ich stelle mir diese Energie wie ein Leuchten in meinem Inneren vor. Wenn ich dem nachspüre, kann ich fühlen, wie warm und großzügig diese Kraft ist.
Der Tod und die Trauer haben mich und meinen Blick auf das Leben also geprägt. Aber nicht nur negativ. Der Tod nimmt viel, aber er lässt immer auch etwas zurück. Er trennt, schafft aber auch neue Verbindungen. Ich weiß, dass sich unser Leben von der einen Minute auf die andere ändern kann. Und wie hilflos wir uns fühlen, wenn wir einen Verlust erleben.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Trauer im Laufe eines Lebens nicht weniger wird, man aber lernt, ihr Gewicht zu tragen. Nachdem ich so viele positive Rückmeldungen zu meinem Engagement gegen die Stigmatisierung von Trauer und psychischen Krankheiten bekommen hatte, erkannte ich: Das Gewicht fühlt sich nach einem Austausch mit anderen Menschen leichter an. So als würde man einen Bierkasten nicht allein, sondern zu zweit tragen.
Ich habe meinen Vater verloren, meine Großeltern, meine Tante, meine Schwägerin und ein ungeborenes Kind. Während ich diese Zeilen schreibe, macht sich meine Familie für den nächsten Impact bereit. Schneller als uns allen lieb ist, werde ich wieder ein Paar dieser Hände sein, das auffangen muss. Was ich weiß: Ich schaffe das, denn ich habe meine Superpower trainiert, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Auch wenn das niemals über den Verlust meines Vaters hinwegtröstet: Ich trage diese Kraft heute mit Stolz, denn sie befähigt mich, anderen gegenüber nicht sprachlos zu sein, sondern für sie da zu sein und sie fest in den Arm zu nehmen.
In diesem Sinne wünsche ich dir als Leser:in die Zuversicht, dass du nach der Lektüre von „BYE“ nicht traurig bist, sondern erfüllt von den Geschichten der Protagonist:innen und bestärkt darin zu akzeptieren, dass Abschiede von geliebten Menschen oder Lebewesen unveränderbare Bestandteile des Lebens sind. Auch deines eigenen. Seitdem ich mir meiner Sterblichkeit bewusst bin, lebe ich jeden Tag unter dem Motto: „Jetzt erst recht!“
Alexa von Heyden
Schön, dass du da bist …
… und direkt eine Frage zum Start: Wie fühlst du dich, wenn du an den Tod denkst?
Wenn es dir geht wie den meisten Menschen, dann drehst du dem Thema im ersten Impuls lieber den Rücken zu – aus Unsicherheit, Angst, Schmerz und Sorge. Dabei ist die einzige Gewissheit im Leben, dass wir alle irgendwann Abschied nehmen: von geliebten Menschen, von Lebensabschnitten oder vom Leben selbst.
Deshalb ist es mutig von dir, dass du unser Buch „BYE“ in den Händen hältst. Denn es zeigt, dass du bereit bist, gesellschaftliche und innere Tabus aufzubrechen und dich traust, auf eine besondere Entdeckungsreise zu gehen. Egal, ob du das Buch zufällig entdeckt hast, ob du gerade einen geliebten Menschen verloren hast, ob du in deinem privaten oder beruflichen Umfeld mit dem Tod konfrontiert bist oder ob dieses Buch dich dabei begleitet, selbst Abschied zu nehmen. Dafür wirst du auf den folgenden Seiten Menschen kennenlernen, die dem Sterben und der Trauer auf ganz unterschiedliche Weise begegnet sind und die sehr offen und persönlich davon erzählen. Ihre Geschichten sind sehr bewegend, doch keinesfalls nur traurig. Es sind auch Geschichten vom Leben, von der Liebe und von dem, was wirklich zählt. Es sind Geschichten, die Trost und Kraft schenken und uns einladen, ungeschönt und gleichzeitig liebevoll auf unser jetziges Leben zu blicken. Dazu gibt es kleine Impulse von uns Autorinnen, die wir – oft inspiriert durch die Erfahrungen mit unseren Gesprächspartner:innen – für dich formuliert haben, und drei Gedankenräume, um innezuhalten und nachzuspüren, was du auf dieser Reise erlebst.
All die Eindrücke in diesem Buch hinterlassen Spuren in dir, vielleicht werden sie dich sogar verändern – so, wie es die meisten guten Reisen tun. All das sacken zu lassen und zu verarbeiten, kann auch anstrengend sein, manchmal sogar aufreibend. Sei dir selbst also ein:e liebevolle:r Reisebegleiter:in, bestimme dein eigenes Tempo, lege Pausen ein und achte auf dich. Vielleicht tut es auch gut, dir zwischendurch die Frage zu stellen: Wie kannst du dir das Reisen so leicht und schön wie möglich machen? Da dieses Buch keine chronologische Aneinanderreihung ist, kannst du es auch immer wieder zuklappen und zur Seite legen, die einzelnen Gespräche mit Abstand lesen oder dich ganz bewusst für ein Kapitel entscheiden, dessen Überschrift dich in diesem Moment anspricht. Vielleicht möchtest du es auch mit jemandem gemeinsam lesen. All das ist möglich und wichtig.
Gleichzeitig ist dieses Buch eine Einladung, dir bewusst Zeit für dich zu nehmen, dich treiben zu lassen und Raum für etwas „Serendipity“ zu geben – also für die Offenheit, dass dir abseits des Weges etwas begegnet, nach dem du gar nicht suchst. So passiert es, dass aus dem kurzen Vorbeischauen einer Freundin ein tiefes Gespräch entsteht, weil „BYE“ auf deinem Couchtisch liegt. Vielleicht wird bei dir ein ganz bestimmter Satz hängenbleiben, der ab sofort ein Anker in deinem Alltag ist. Oder du entwickelt ein ganz neues Interesse für etwas, das dir bis zu diesem Tag noch nie aufgefallen ist.
Wenn wir uns etwas für dich wünschen dürfen, dann ist es also, dass du von konkreten Erwartungen oder Vorhaben loslässt und dich überraschen lässt. Immer in dem Vertrauen: Es kann nichts Schlimmes passieren, wenn du in die Welt rund um Abschied und Sterben eintauchst – und im besten Fall sogar etwas sehr Wertvolles für dich entstehen.
Mit dieser Intention haben wir drei besondere Kapitel – sogenannte Gedankenräume – für dich kreiert. Sie sind eine schöne Gelegenheit, deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse und auch Veränderungen auf deiner bisherigen Entdeckungsreise zu reflektieren. Somit wartet vor dem ersten Gespräch ein kurzes Gedankenexperiment, das wir dann in der Mitte und zum Ende des Buches gemeinsam fortführen. Mehr wollen wir dir an dieser Stelle gar nicht verraten, sondern dich, wie oben beschrieben, einladen, dich einfach überraschen zu lassen.
Warum es für uns beide so wichtig ist, dieses Buch in die Welt zu bringen
Die Idee für dieses Buch entstand, als wir nach einem schönen Abendessen in Köln noch zusammen auf der Couch saßen: Ich, Laura, erzählte Julia von meinem Wunsch, ein Buch von unserer Endlichkeit zu schreiben und damit gleichzeitig auch etwas vom Leben zu erzählen. Doch ich war unsicher, ob ich jetzt schon dafür bereit wäre und außerdem wusste ich nicht, wie es funktioniert, ein Buch zu schreiben.
Ich, Julia, war von der Idee sofort begeistert und ermutigte Laura, sie einfach umzusetzen – oder sie mit mir zusammen anzugehen. Ich hätte mich damals noch nicht getraut, mich dem Thema in dieser Intensität allein zu widmen, hatte aber bereits zwei Bücher geschrieben und konnte mein Wissen und meine Erfahrung als Autorin beisteuern. Ich wollte die Audio- und Video-Aufnahmen der Gespräche, die Laura führt, gemeinsam mit ihr in ein Buch verwandeln.
Also starteten auch wir in eine abenteuerliche Reise und seitdem ist dieses Buch ein großer Teil unseres Alltags. Trotz Elternzeit, beruflichem Neuanfang und räumlicher Distanz zwischen Köln und Barcelona haben wir es geschafft, unser Vorhaben zu verwirklichen: Wir haben recherchiert und in Videokonferenzen diskutiert, wir haben Ideen gesammelt, viel geschrieben und Inhalte wieder umgeworfen. Wir haben mitgefiebert, uns gegenseitig bestärkt und uns Halt gegeben. Wir haben miteinander gelacht und ganz viel über unsere Leben und über das Sterben gesprochen. Dabei waren wir unendlich froh, all das gemeinsam zu machen – denn ja, die Gespräche und die Entstehung dieses Buchs haben definitiv etwas mit uns gemacht und sie haben uns noch einmal viel näher zusammengebracht.
Und obwohl wir von so unterschiedlichen Ausgangspunkten in dieses Abenteuer gestartet sind, spürten wir beide von Anfang an den gleichen inneren Auftrag und die damit verbundene gesellschaftliche Relevanz: Wir wollen die Themen Tod und Sterben enttabuisieren, wir wollen sie trotz der Gefühle von Schwere, Traurigkeit und Schmerz, die immer wieder aufkommen, mehr in unseren Alltag integrieren und nicht in einer angestaubten Kiste wegsperren. Und wir wollen sie modern, zeitgemäß und zukunftsfähig angehen: im Inhalt, in der Art und Weise, in der Sprache und auch im Design. Dabei sollte aus diesem Buch kein Trauerratgeber werden, sondern ein Buch, das uns alle erreichen und bereichern kann, einfach, weil der Tod uns alle etwas angeht. Dabei ist uns wichtig, all das mit Respekt, Achtsamkeit und Ernsthaftigkeit zu machen, genauso wie mit einer neugierigen Haltung, mit Leichtigkeit und mit Humor. Denn „BYE“ sollte von Anfang an ein lebensbejahendes Buch sein, das voller Chancen steckt. Jetzt, wo wir das Buch endlich in den Händen halten, glauben wir, dass diese Vision aufgegangen ist.
Was wir dir zu den Gesprächen mit auf den Weg geben möchten
Uns ist bewusst, welche große Verantwortung wir tragen, den persönlichen und berührenden Geschichten in diesem Buch einen angemessenen und wertschätzenden Rahmen zu geben. Wir möchten den 16 Menschen, die uns in ihr Leben lassen und uns ihr Vertrauen schenken, ein gutes Gefühl geben und wir hoffen, dass sie glücklich und vielleicht sogar stolz sind, ein Teil dieses Buchs zu sein. Wir sind auf ganz unterschiedliche Weise auf diese Menschen gestoßen. Einige kannten wir bereits persönlich, andere wurden uns als wertvolle Gesprächspartner:innen vorgeschlagen und nach manchen haben wir gezielt gesucht. Wir folgten bei der Auswahl unserer Intuition, unserer Neugierde und den Fragen, die uns selbst beschäftigen, wenn wir uns mit unserer Endlichkeit konfrontieren und uns ihr gleichzeitig annähern wollen. Wir blicken also in den Gesprächen auf vielfältige Aspekte – ohne dass wir damit eine Vollständigkeit erzielen möchten oder können. Es ging uns außerdem nie darum, in diesem Buch die schwerstmöglichen Schicksalsschläge zu erzählen oder eine Art Ranking zu schaffen, wer wirklich berechtigt ist, von Tod und Verlust zu sprechen – denn das kann und darf jede:r einzelne von uns. Wir alle haben unsere eigene, wertvolle Lebensgeschichte, die sich im Laufe dessen immer neu erzählen lässt, bis wir irgendwann selbst als Sterbende Abschied nehmen.
Du wirst sehen, dass die Gespräche keinem festen Muster oder vorgegebenen Fragenkatalog folgen, es sind echte, persönliche Dialoge. Deswegen haben wir uns entschieden, die Texte so authentisch wie möglich zu lassen und sie gleichzeitig in gut lesbare Kapitel zu verwandeln. Dazu haben wir die wörtlichen Transkripte bearbeitet, einiges weggelassen, lose Gedankenfetzen flüssiger formuliert und auch mal spätere Nachträge an sinnvollen Stellen eingefügt – natürlich alles in Abstimmung mit unseren Gesprächspartner:innen.
Wie du siehst, gendern wir in unseren Texten. In den Gesprächen haben wir die Formulierungen allerdings so beibehalten, wie sie von der jeweiligen Person benutzt wurden. Außerdem haben wir die Antworten von Laura in den Interviews für dieses Buch oft stark gekürzt, da die Protagonist:innen im Fokus stehen sollen. Trotzdem spürst du hoffentlich, dass es keine Frage-Antwort-Interviews sind, sondern ein lebendiger, sehr persönlicher Austausch, in den auch Laura viel von sich selbst gesteckt hat und der sich für dich im besten Fall so anfühlt, als würdest du ebenfalls mit am Tisch im Café oder auf der Parkbank sitzen.
Was wir an dieser Stelle in den Vordergrund rücken möchten: Dass sich diese Menschen so für uns öffnen, ist ein großes Geschenk. Sie teilen ihre Geschichten und somit an vielen Stellen ihre persönliche Meinung zu diversen Themen. Sie geben keine glattgebügelten Antworten oder hochglanzpolierten Statements, sondern sie zeigen sich echt. Dabei kann es gut sein, dass du manche Dinge anders siehst und das ist völlig okay, ja sogar wertvoll, denn aus dieser Reibung kann etwas überraschend Gutes entstehen. Wir möchten dich deswegen ermutigen, offen für all diese Perspektiven zu sein und deine Bewertungen auch mal zu hinterfragen, wenn du an einer Stelle direkt widersprechen möchtest. Wir wissen, das ist manchmal gar nicht so leicht, aber was helfen kann, ist – neben ein bisschen Abstand – die Frage: Was genau stört mich an dieser Aussage – und warum?
Und wir sollten uns bei allem Gesagten immer bewusst machen, dass es sich um Momentaufnahmen handelt. Zum Zeitpunkt des (digitalen) Treffens waren es genau diese Gefühle, Eindrücke und Erinnerungen, die unsere Protagonist:innen beschäftigten. Wenn du dieses Buch liest, kann es schon wieder ganz anders in ihrem Leben aussehen oder sie würden eine Frage aus einem veränderten Blickwinkel heraus beantworten. Andere führen ihr Leben vielleicht auf eine andere Weise, sind in ihrer Trauer oder persönlichen Entwicklung bereits in einer neuen Phase.
Was wir dir zu den Impulsen mit auf den Weg geben möchten
Zwischen den Gesprächen gibt es kürzere Kapitel mit Impulsen von uns beiden, die du dir wie kleine Inseln vorstellen kannst. Inseln, um eine Pause zwischen den berührenden Gesprächen einzulegen, innezuhalten, zu träumen, dich inspirieren zu lassen und um dich an das zu erinnern, was in diesem Augenblick oder in dieser Phase deines Lebens wesentlich für dich ist. In diesen Texten teilen wir mit dir persönliche Gedanken und Fragen, die durch die Gespräche in uns aufgekommen sind oder die uns grundsätzlich im Leben bewegen – besonders, wenn wir an unsere eigene Endlichkeit denken. Mal nachdenklich, mal ermutigend, mal poetisch, mal lustig und immer ehrlich und frei aus unserem Herzen heraus.
Vielleicht kannst du in diesen Kapiteln für dich verlorene Schätze wiederfinden, neue entdecken und diese mit in deinen Alltag nehmen. Und so wie jedes der Gespräche stehen auch die Impulse für sich allein und du kannst sie losgelöst vom Rest des Buchs lesen, wann und so oft du willst.
Hilfestellungen und Inspirationen für dich
Du findest im Anhang dieses Buchs Seiten mit Hilfestellungen, falls du merkst, dass du sie zu bestimmten Themen benötigst. Außerdem haben wir für dich Adressen von Verbänden, Initiativen, Anbieter:innen von Beratungen, Apps, Magazinen etc. zusammengestellt, die uns im Entstehungsprozess und in unserer Recherche begegnet sind und die wir toll finden – was auch bedeutet, dass diese Liste nur ein kleiner Ausschnitt von großartigen Angeboten darstellt. Denn es gibt zum großen Glück so viele Menschen, die Personen liebevoll beim Sterben begleiten, die die Themen Tod und Abschied für jede:n zugänglich machen oder die Trauernde in ihrem individuellen Prozess unterstützen, die moderne und persönliche Bestattungen anbieten, Erinnerungsworkshops für Angehörige gestalten oder die alles dafür tun, um Sterbenden ihre letzten Wünsche zu erfüllen.
Wir freuen uns, wenn wir dir so weitere Anhaltspunkte, Ideen und Inspirationen mitgeben können, die dir helfen, die deine Neugierde erneut wecken und die Lust machen, deine Entdeckungsreise weiter fortzuführen.
Wir wünschen dir eine wunderbare Zeit beim Lesen.
Alles Liebe
Julia & Laura
GEDANKENRAUM – TEIL 1
Die Themen Tod und Sterben sind häufig unsere ungeliebten, manchmal sogar gefürchteten Rumpelkammern – oder zumindest eine Ecke oder Schublade zu Hause, vor der wir am liebsten schnell die Augen verschließen würden. Wir machen sie immer nur kurz auf, um etwas Neues darin zu verstauen, mit dem wir gerade nichts anfangen können – oder nichts anfangen wollen. Erst einmal ist es schön, sich selbst überhaupt einzugestehen, dass es diese Zimmer und Ecken gibt und dass genau das völlig okay ist. Und für uns alle ist es mit Sicherheit auch immer wieder ein befreiender Reminder, dass sie uns alle einen, dass jede:r von uns ein solches Zimmer oder eine solche Ecke hat. Wir brauchen sie also nicht zu verstecken – vor allem nicht vor unseren engsten Vertrauten oder vor uns selbst.
Das Gemeine an diesen Zimmern und Schubladen aber ist: Auch wenn wir die Tür schließen oder sie unters Bett schieben, bleiben sie immer da und sind unterschwellig präsent. Manchmal erinnern wir uns nur im Vorbeigehen an sie, an manchen Tagen spüren wir sie intensiv und sie belasten uns. Und dann wollen wir uns selbst beruhigen, indem wir sagen: „Irgendwann schau ich mir das mal an und bringe das in Ordnung, aber jetzt nicht.“ Dabei brauchen wir dafür gar keinen riesigen Masterplan, sondern wenn wir einfach loslegen und dranbleiben, dann geht es voran, manchmal kommen wir sogar in einen echten Flow. Denn wir machen uns den Berg Arbeit in unserem Kopf oft vorher größer, als er tatsächlich ist. Und genauso machen wir auch die negativen Gedanken, Vorurteile, Ängste oder Befürchtungen zum Thema Tod oft größer und stellen sie uns bedrohlicher vor als sie vielleicht nachher für uns sind, wenn wir uns auf sie einlassen und sie uns überhaupt einmal richtig anschauen. Alles andere wird sich Schritt für Schritt ergeben. Und das Gute ist: Wir können die Tür dieser Kammer zu jeder Zeit wieder schließen oder an ihr vorbeigehen, wenn uns nicht nach ihr ist oder wir gerade keine Kraft haben, uns um sie zu kümmern. Die Tür darf jederzeit geschlossen sein – doch von nun an können wir gut mit ihr unter einem Dach leben.
Außerdem ist so eine Rumpelkammer kein einmaliges Projekt, das man einmal fertigstellt, sondern etwas, das immer mal wieder unsere Aufmerksamkeit und Zeit braucht – wie die meisten Dinge im Leben. Vielleicht wird es mit der Zeit sogar möglich, die eigentlich ätzende Rumpelkammer in einem neuen Licht zu betrachten und neu einzurichten – sodass ein Raum entsteht, um den wir uns zukünftig auch mit mehr Liebe und Sorgsamkeit kümmern wollen.
Ohne zu wissen, was sich am Ende dieses Buches in deiner Rumpelkammer verändert haben wird, entweder nur durch das Lesen oder weil du bewusst etwas in deinem Denken oder Handeln verändert hast, lass uns jetzt mit diesem ersten Schritt anfangen – zusammen geht das ja bekanntlich leichter. Wir verschaffen dir einen ersten Überblick.
Erstbegehung deiner Rumpelkammer
Nimm dir dafür gern einen Augenblick Ruhe und, wenn du möchtest, auch etwas zum Schreiben zur Hand. Dann schließe die Augen und atme vor dem Start dieses kleinen Experiments ein paar Mal tief durch.
ERSTER SCHRITT : Erstelle eine Art Mind Map. Dazu notierst oder malst du zu folgender Frage alles auf, was in dir aufkommt – völlig ungeordnet und ganz wertfrei, direkt ehrlich aus dem Bauch heraus.
Welche Assoziationen kommen dir in den Sinn, wenn du folgende Begriffe liest? Welche Gedanken, Gefühle, Bilder und Empfindungen entstehen?
TodMeine EndlichkeitAbschiedSterbenZWEITER SCHRITT : Sieh dir das Aufgeschriebene oder Aufgemalte an, betrachte es gern mal aus etwas Distanz, zum Beispiel im Stehen. Nimm eine Metaebene ein und stelle dir vor, es wären die Notizen von einer fremden Person.
Was kannst du anhand der Wörter und Zeichnungen von dieser Person und ihrem Raum erfahren? Was siehst du, was nimmst du wahr, was ist besonders sichtbar oder auffällig? Steht etwas besonders im Vordergrund? Welche Aussagen, Fragen, Gefühle sind besonders spürbar? Vielleicht findest du sogar eine Überschrift für das entstandene Werk?
DRITTER SCHRITT : Bewege dich kurz durch, suche dir vielleicht einen neuen Platz im Raum, um wieder deine eigene Sicht einzunehmen.
Welche wesentlichen Erkenntnisse hast du aus diesem kleinen Perspektivwechsel gewonnen?
Welche Intention darf dich beim Lesen dieses Buches und bei der Begegnung mit Tod, Abschied und Sterben begleiten, weil sie dir guttun wird und dir immer wieder Halt gibt?
Notiere dir deine Intention gern auf einem Post-it oder einem Lesezeichen, um es dir ins Buch zu heften und dich selbst immer wieder an diese Intention zu erinnern. Du kannst sie natürlich jederzeit verändern, wenn und wann du möchtest.
Lege deine Aufzeichnungen jetzt zur Seite – du brauchst sie erst für den zweiten Teil unseres Experiments wieder. Nimm dir einen Moment, um diese Übung nachwirken zu lassen und tue dir noch etwas Gutes.
Wie war dieses Gedankenexperiment für dich? „Spannend, schwer mich darauf einzulassen, aufwühlend, hat Spaß gemacht, ungewohnt …“ Egal, was deine Antwort ist: Schön, dass du dich darauf eingelassen hast und den ersten Schritt gegangen bist.
DR. SYLVIA BRATHUHN
„Es gibt diesen Silberfaden zwischen uns, der für immer bleibt.“
Als Philosophie-Dozentin lehrt und diskutiert sie über existenzielle Fragen, als Intensivkrankenschwester arbeitete sie früher an der Grenze zwischen Leben und Tod. Auch persönlich hat Dr. Sylvia Brathuhn (*1957) schon erlebt, wie endlich das Leben ist: Ihre Mutter starb früh, sie selbst erkrankte zweimal an Krebs. Außerdem engagiert sie sich vielseitig, sie war unter anderem vier Jahre Bundesvorsitzende der Frauenselbsthilfe Krebs und ist Mitherausgeberin von „Leidfaden – Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer“. Im Gespräch erklärt sie, warum der Tod immer plötzlich und unerwartet kommt, wieso wir Menschen so sehr mit der Endlichkeit hadern und wie bei diesen schweren Themen auch Leichtigkeit möglich ist.
Frau Dr. Brathuhn, mit unserem Buch möchten wir die Menschen einladen, ins Gespräch zu kommen. Was wäre für Sie persönlich ein passender, schöner Ort oder auch ein Wohlfühlort, um von Tod und Sterben zu sprechen?
Ich habe gerade gestern einen solchen Gesprächsort erlebt: mit einer Freundin im Saunagarten. Wir lagen dort eingemummelt in unsere Handtücher und sprachen über den Tod. Wie es ist, wenn man selbst gerade gar nicht davon betroffen ist und darüber spricht – und wie es ist, wenn man davon betroffen ist und darüber spricht. Über diese Unterschiede. Es war ein sehr schönes Gespräch und ein sehr schöner Ort dafür. Darüber hinaus ist jeder Ort geeignet, wenn der Mensch, der mir gegenübersitzt, diesen Raum eröffnet und der Augenblick stimmt. Dann kann es auch die Bahnhofshalle oder eine Parkbank sein.
Wir lagen dort, guckten in die Wolken und ich erzählte, dass ich mit einer verstorbenen Freundin zuletzt immer Wolkenreisen gemacht habe.
Es hängt also stark von den Menschen ab, die sich begegnen. War es mit Ihrer Freundin eine Gesprächssituation, in der diese Themen zufällig aufkamen, oder wollten Sie in diesem Moment explizit mit ihr etwas besprechen oder ansprechen?
Es ergab sich. Wir lagen dort, guckten in die Wolken und ich erzählte, dass ich mit einer verstorbenen Freundin zuletzt immer Wolkenreisen gemacht habe. Und oft, wenn ich in den Himmel schaue, denke ich daran. So sind wir in dieses Thema hineingekommen. Es war nicht so, dass ich dachte: Wir gehen heute in die Sauna, werden im Garten liegen und jetzt endlich mal vom Tod sprechen – es ergab sich. Es braucht dafür auch die entsprechende Offenheit. Meine Freundin hätte auch einfach sagen können: „Ja, schön.“ Dann verrinnt der Augenblick und man wendet sich der Frage zu, welcher Saunagang als nächstes folgt. Das tat sie nicht und so ergab sich daraus ein tieferes Gespräch.
Würden Sie mir verraten, was sich hinter den Wolkenreisen verbirgt?
Wir haben in unserem Wohnzimmer ein riesengroßes Fenster mit einem gemütlichen Kuschelsofa davor. Als meine Freundin schon sehr fortgeschritten in ihrer Erkrankung war, hat sie viele Stunden auf diesem Sofa verbracht. Sie ist unglaublich gerne gereist, das konnte sie zu diesem Zeitpunkt leider nicht mehr. Dann haben wir irgendwann dort gelegen und ich habe gesagt: „Wie wäre es, wenn wir uns einfach auf eine Wolke setzen und gucken, wohin sie uns treibt?“ Dann waren wir in Neuseeland, ohne dass sie oder ich jemals dort gewesen sind. Wir haben bei Google Earth geguckt, was es da alles gibt. Wir haben uns einfach auf eine Wolke gesetzt, sind manchmal auch nur in die Eifel geflogen. Wir haben viele Orte aufgesucht, Sehnsuchtsorte und Erinnerungsorte von ihr.
Es gab aber genauso Begegnungen, da hätte ich mir einen Reset-Knopf gewünscht.
Das hat für mich etwas von einem Schatz, den wir als Kinder immer wieder für uns entdecken: Wir geben der Fantasie Raum – weil wir in diesem Alter noch nicht die Mittel und Entscheidungsbefugnis haben, um es wirklich zu tun. Aber wir besuchen die Orte in unserer Fantasie und irgendwie fühlt es sich so an, als wären wir wirklich da.
Ich glaube, dass wir diese Fähigkeit immer in uns haben. Die Fähigkeit der Imagination, sie wird häufig so überlagert durch Routine, Gewohnheit, Alltag und Rationalität. Vielleicht legt sich davon wieder etwas frei, wenn wir dem Tod entgegengehen.
Das ist ein sehr schönes Bild. Dann geht es darum, dass wir diese Hüllen, die wir uns im Laufe des Lebens übergeschmissen haben – häufig als Schutz – wieder freilegen. Und uns dadurch auch verletzlich machen.
Jetzt möchte ich der Frage nachgehen, die sich die Leser:innen bestimmt gerade stellen werden: Wer ist diese beeindruckende Gesprächspartnerin, die mit einer Freundin gerne einen gemütlichen Abend in der Sauna verbringt und die auf ihrem Sofa zuhause eine andere Freundin beim Sterben begleitet hat?
Ich denke jetzt gerade an diesen Satz: „Ich bin, ich weiß nicht, wer. Ich komm, ich weiß nicht, woher. Ich geh, ich weiß nicht, wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.“ In diesem mittelalterlichen Satz verbergen sich interessante Menschfragen. Also, wer bin ich? Zunächst würde ich sagen, ich bestehe aus vielen Rollen und Facetten. Ich beginne mit der beruflichen Seite: Ich habe 13 Jahre als Intensivkrankenschwester gearbeitet, da bin ich in Hülle und Fülle mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer in Begegnung gekommen.
Häufig waren es Begegnungen, die gut waren, bei denen ich sehr zufrieden aus den Gesprächen gekommen bin. Es gab aber genauso Begegnungen, da hätte ich mir einen Reset-Knopf gewünscht. Die ständige Unsicherheit war für mich auch eine Belastung. Man muss sich vorstellen, wir reanimieren drinnen einen Menschen und draußen sitzen die Angehörigen und warten. Dann gehen wir raus und sagen entweder: „Sie können jetzt reinkommen, Ihr Mann, Ihre Mutter, Ihre Tochter ist wieder da.“ Oder: „Es ist uns leider nicht gelungen, sie wiederzubeleben.“ Das waren schon schwere Situationen. Wenngleich mein Berufsleben diesbezüglich über 30 Jahre zurückliegt, bin ich sehr überzeugt, dass es noch exakt die gleichen Situationen geben wird. Das ist die eine Seite, die hat mich viel über das Thema gelehrt.
Haben Sie die Entscheidung für die Intensivmedizin sehr bewusst getroffen oder sind Sie da eher hineingestolpert?
Krankenschwester bin ich eher zufällig geworden – ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen sollte. Mein damaliger Freund, der heute mein Mann ist, hatte die Idee. Und ich dachte: „Warum nicht?“ Der Wunsch, dann die Weiterqualifizierung zur Intensivfachschwester zu machen, hatte damit zu tun, dass meine Mutter auf einer Intensivstation verstarb. Sie war 42 und es war ein grässliches Erlebnis. Ich dachte, so darf man nicht mit Angehörigen umgehen. So darf man Sterbende nicht liegen lassen. Es war unsäglich, wie es gelaufen ist. Sie hatte nach einer Gallenblase-OP eine Sepsis bekommen und lag eine Woche auf der Intensivstation. Und dann war sie einfach tot. Es war ganz furchtbar.
Ein sehr einschneidendes Erlebnis. Wie alt waren Sie da?
Ich war 19. Es war eine schreckliche Erfahrung und ich dachte, die hätten anders mit mir umgehen müssen. Meine Mutter wurde nach ihrem Tod auf den Flur geschoben, damit wir sie nochmal sehen können. Sie war nur mit einem Tuch bedeckt. Und nach einer Sepsis sehen Menschen nicht gut aus.
Ich dachte, so darf man nicht mit Angehörigen umgehen. So darf man Sterbende nicht liegen lassen.
Da geht es darum, als Angehörige:r würdevoll Abschied nehmen zu können und als Sterbende:r würdevoll zu sterben. Mensch sein und noch als Mensch gesehen werden – ob als Angehörige:r oder als Sterbende:r.
Was ich denke, was sich Pflegende und Ärzt:innen vor Augen führen müssen: In all den Situationen vorher geht man als Angehörige:r aus dem Krankenhaus raus mit der Gewissheit, dass man wieder zurückkommt. Es ist immer Hoffnung da. Dann plötzlich geht man raus und draußen ist zwar alles unverändert, aber man weiß, dass es das letzte Mal war – man kommt nicht wieder. Außer vielleicht, um Sachen des verstorbenen Menschen abzuholen.
Wenn es auf der Station klingelte, habe ich geguckt, ob jemand anders geht – das kannte ich nicht von mir.
Aus dieser persönlichen schmerzlichen Erfahrung heraus sind Sie bewusst in die Intensivpflege eingestiegen. Und dann?
In der Pflege aufgehört habe ich wieder aus einer sehr einschneidenden Erfahrung heraus, weil ich damals an Krebs erkrankte. Nach meiner ersten metastasierten Krebserkrankung habe ich einfach weitergearbeitet. Dann kam die zweite Erkrankung, wieder ein Rezidiv. Da habe ich gemerkt, dass sich in mir etwas verändert. Ich fühlte, dass ich nicht mehr gut für die Patienten war und sie waren auch nicht mehr gut für mich. Wenn es auf der Station klingelte, habe ich geguckt, ob jemand anders geht – das kannte ich nicht von mir. Dann gab es eines Morgens einen Satz von einem Arzt, der anderthalb Stunden in meinem Kopf herumgeisterte – dann wusste ich: Ich kündige.
Was war das für ein Satz?
Wir hatten freitags einen 42-jährigen Patienten, bei dem eine Not-Operation durchgeführt wurde, es war Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mein damaliger Chefarzt sagte: „Wir müssen alles dafür tun, dass dieser Mann noch einmal nach Hause kann, um Abschied zu nehmen und wichtige Dinge zu regeln. Er hat drei Kinder und gerade eine Autowerkstatt eröffnet.“ So habe ich an dem Wochenende ZwölfStunden-Schichten gemacht, um es zu schaffen. Dann stand ich Montagmorgen vor dem Zimmer des Patienten und ein junger Assistenzarzt kam vorbei und fragte: „Habt ihr den noch das ganze Wochenende durchgeschleppt?“ Ich bin wirklich nicht auf den Mund gefallen, aber in dem Moment wusste ich einfach nicht, was ich erwidern sollte, und spürte ganz deutlich: Ich ertrage das nicht mehr.
Ich habe in der Abendschule das Abitur nachgemacht und guckte, was ich in der Nähe meines Heimatortes studieren konnte, weil ich damals schon einen siebenjährigen Sohn hatte. Da gab es Pädagogik in Koblenz.
Ich finde das unglaublich, was Sie in dieser Grenzerfahrung der zweiten Krebserkrankung alles beschlossen und gemeistert haben. Wie kann ein Mensch das annehmen und auch damit umgehen? Wie war Ihnen das möglich?
Bei meiner Erstdiagnose hatte ich metastasierten Schilddrüsenkrebs, da gab es eine große Operation, ein Jahr später fand man ein neues Rezidiv, da musste eine noch größere OP durchgeführt werden, ich wurde auch bestrahlt. Damals hielt ich es für eine ziemliche Unverschämtheit vom Schicksal, ich fand es frech. Ich dachte, ich bin ein guter Mensch, ich bin eine gute Mutter, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich mache Sport – warum bekomme ich Krebs? Meine Einstellung war: Okay, Irrtümer passieren, eigentlich war ich sicher nicht gemeint, aber da muss ich jetzt durch. Ich bin da ziemlich stramm durchgegangen und weiß noch, dass ich während der Bestrahlungen wieder arbeiten ging, weil ich dachte, das bisschen Bestrahlung macht doch nichts.
Bei der zweiten Diagnose war es irgendwie anders. Da merkte ich, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich hatte in dieser Zeit unfassbare Angst, mein Kind nicht aufwachsen zu sehen. Ich erinnere mich an eine Nacht, in der ich das Gefühl hatte, mit Gott einen Deal auszuhandeln und ihn darum zu bitten, dass ich das überleben darf. Dass ich mein Kind aufwachsen sehen darf. Ich habe wirklich gelobt, immer dankbar zu sein und mich dafür zu engagieren – das tue ich ja auch bis heute. Jetzt habe ich einen neuen Deal: Ich will meine drei Enkelmädchen aufwachsen sehen.
Ich bezeichne mich auch als eine Person, die von einer gesunden Zuversicht gekennzeichnet ist. Ich sehe nicht alles im Leben rosarot und optimistisch – und doch bin ich zuversichtlich, dass etwas Gutes auf mich wartet. Auch wenn ich es im aktuellen Moment vielleicht noch nicht sehe. So habe ich erlebt, dass es für mich unfassbar gute Begegnungen gab und dass sich mir Türen öffneten, die ich gar nicht gesucht habe.
Ich hatte in dieser Zeit unfassbare Angst, mein Kind nicht aufwachsen zu sehen.
Welche Tür hat sich durch Ihr Pädagogikstudium für Sie geöffnet?
Ich habe schon hier gemerkt, dass mich eigentlich nur der existenzielle Ansatz wirklich fesselt. Ein Professor ließ immer wieder philosophische Aspekte einfließen und brachte mir zum Beispiel Martin Buber sehr nahe. Zu diesem Professor bin ich immer wieder in die Sprechstunde gegangen – nicht mit einem Anliegen, sondern einfach, um zu reden. Anfangs war er etwas verwundert, aber später haben wir das über seine Lehrtätigkeit hinaus weitergeführt, ich habe ihn einmal im Quartal besucht, dann sprachen wir über Gott und die Welt.
Ich habe in dieser Zeit ebenfalls angefangen, mich in der Frauenselbsthilfe Krebs zu engagieren. Und aus irgendwelchen Gründen bekam ich erste Anfragen, Vorträge zu halten. Ja, und jetzt bin ich seit über 30 Jahren in der Frauenselbsthilfe Krebs tätig, eine für mich – bis heute – bereichernde und erfüllende Tätigkeit.
Dann habe ich promoviert, weil ich damals einen beeindruckenden Philosophie-Professor an der Uni hatte, der mich forderte und förderte, mich bis heute sehr geprägt hat und noch immer prägt. Ja, und so sitze ich heute hier.
Um da einmal die Brücke zu schlagen: Wir sprechen heute auch miteinander, weil Sie eine meiner Dozentinnen im Fachbereich Philosophie waren. Ich habe damals bei Ihnen ein Seminar über existenzielle Fragen und existenzielle Philosophie belegt, da hat mich vieles sehr berührt und bewegt – Sie als Mensch und die Fragen, die sich in mir aufgetan haben. Verraten Sie doch bitte, was Ihre persönliche Definition von Philosophie ist?
Für mich persönlich ist Philosophie der Antrieb für eine Suchbewegung, die es mir ermöglicht, Fragen zu stellen, Gegebenheiten in Frage zu stellen und eigene Antwortmöglichkeiten zu finden. In diesem Sinne ist die Philosophie für mich auch eine Möglichkeit, die Welt mit ihren vielen Deutungsmöglichkeiten zumindest in Ansätzen zu verstehen. Gleichzeitig sind die Antworten, die gefunden werden, immer nur von zeitlich begrenzter Gültigkeit und wir müssen wieder von vorne beginnen.
Für mich ist es durchaus hilfreich, mein Leben vom Tod aus zu betrachten.
Sie hatten jahrelang mit dem Tod einen nahen Kontakt in der konkreten Praxis. Wie hat es Ihnen geholfen, durch Ihr Studium und Ihre Promotion an diese Praxis nun philosophische Fragen anzuknüpfen? Und inwiefern kann die Philosophie uns alle in der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit unterstützen?
Eine der kantischen Fragen lautet: „Was soll ich tun?“ Sie hat mich zu diesem Zeitpunkt stark beschäftigt. Ich verstand auf einmal, wie die Erfahrung die Theorie befruchtet und die Theorie in die Erfahrung eingeht. Das war ein Kreislauf, der sich mir erschloss. So verstand ich auch ein Stück weit, warum diese Ärzte bei meiner Mutter damals so furchtbar waren. Es hat sich für mich ein Verstehenshorizont eröffnet. Er machte das Ganze nicht besser, aber wenn ich jetzt lehre, dann geht es nie darum zu sagen: „So und so musst du es machen.“ Sondern es geht darum, die eigenen persönlichen Bedürfnisse in solchen Situationen zu reflektieren und gleichzeitig Haltungs- und Handlungsmöglichkeiten zu erkennen.
Ein Satz von Montaigne führt uns alle vielleicht auf eine Spur, wie Philosophie uns unterstützen kann: „Philosophieren heißt sterben lernen.“ Für mich ist es durchaus hilfreich, mein Leben vom Tod aus zu betrachten. Also nicht auf den Tod hin, sondern mich als Sterbende versuchen zu sehen und zumindest in einer Annäherung auf mein bisheriges Leben zu blicken: Womit war ich im Einvernehmen? Was war nicht gut? Wo habe ich nicht so gelebt, wie ich es wollte? Was habe ich unterlassen, obwohl ich es tun wollte? Wo war ich oberflächlich, obwohl Tiefgang gefragt gewesen wäre? So eine Meditation kann immer wieder aufs Neue Kompass für mein Leben sein. Ob das uns schließlich hilft, anders in den Tod zu gehen, wenn es mal so weit ist, bleibt eine große Frage. Doch es kann mich im Hier und Jetzt unterstützen.
Gibt es aus Ihrer Sicht eine philosophische Erklärung, warum der Tod und das Sterben für uns Menschen so beängstigend und gleichzeitig faszinierend sind?
Wir Menschen haben zwar ein Denkwissen darüber, dass wir sterben müssen, auch wenn der Tod „nur“ als kleiner, schwarzer Punkt in weiter Ferne sichtbar oder eben unsichtbar ist. Unser Menschsein impliziert gleichzeitig, dass wir auch in die Zukunft denken und Pläne machen können. Nun steht das Wissen um das Sterbenmüssen der Zukunft im Weg. Also versagen wir uns daran zu denken, weil es uns nicht glücklich macht, wie Blaise Pascal sagt, und wir sind – mit den Worten von Sigmund Freud gesprochen – „unbewusste Unsterblichkeitsillusionisten“. Das heißt: Wir versuchen, den Tod in jeglicher Hinsicht im täglichen Leben zu umgehen. Wir bauen Häuser, die uns nicht auf den Kopf fallen, wir gehen bei Glatteis sehr vorsichtig und in der Medizin haben wir in vielfacher Hinsicht die Fähigkeit erlangt, Leben zu erhalten, sogar dem Tod zu entreißen. Nicht zuletzt fällt es mir als Mensch schwer, etwas zu verstehen und anzunehmen, das außerhalb meines Verstehens liegt.
Wir versuchen, den Tod in jeglicher Hinsicht im täglichen Leben zu umgehen.
Ich finde es extrem bereichernd, dass Sie diese persönliche Berührung mit dem Tod durch die Erfahrung mit Ihrer Mutter und Ihrer eigenen Krebserkrankung, die berufliche Erfahrung und schließlich die philosophische Arbeit miteinander verbinden und dadurch viele Menschen auf so unterschiedliche Weise unterstützen. Gerade ist Ihr neues Buch erschienen: „Wenn das Leben am Tod zerbricht“. Wollen Sie mir einen Einblick geben, was die Intention dieses Werkes ist?
Ich wollte in dem Buch viele praktische Inhalte und auch wertvolle Gesprächsauszüge aus meiner Trauerbegleitung veröffentlichen. Ich protokolliere alle meine Begleitungen und manchmal sagen Trauernde etwas, das druckreif ist. So etwas kann man sich gar nicht ausdenken – es fließt aus den Menschen und ihrer Trauer heraus.
Gleichzeitig hatte ich große Lust, in diesem Buch eigene Gedanken und Modelle einfließen zu lassen. Natürlich stehe ich immer auf den Schultern von Anderen, aber ich gebe den Dingen, die Andere in einer Form vorgedacht haben, eine eigene Richtung und Bedeutung. Ich habe ein Modell entwickelt, das „Grundkompetenzenmodell“, das ich in diesem Buch beschreibe und das Wissensexpertentum mit „Menschexpertentum“ nebeneinanderstellt: Wenn ich als Ärztin einem erkrankten Menschen gegenüberstehe, bin ich ihm mit meinem Fachwissen immer überlegen. Ich bin ihm auch in meiner Position und Rolle (Arzt-Patient-Verhältnis) überlegen. Es ist eine asymmetrische Begegnung. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann weiß ich, dass ich Symmetrie beziehungsweise Augenhöhe erzeugen muss. Ich kann mich nicht nur auf mein Expertentum berufen, denn mir gegenüber steht ein Mensch und dieser befindet sich in einer Notsituation, das muss ich verstehen und entsprechend handeln.
Es sterben in Deutschland 950.000 Menschen pro Jahr – das ist eine Zahl, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Ich habe das im Umgang mit Ärzt:innen auch oft erlebt, wir befinden uns als Patient:innen immer in einer Abhängigkeit. Diese Augenhöhe, dass man sich als Mensch begegnet, die gerät oft in den Hintergrund. Deshalb freut es mich persönlich, dass Sie das zu einem zentralen Punkt in Ihrem Buch gemacht haben. Wenn Sie nun zwei bis drei Essenzen aus Ihrem Buch mit mir teilen, welche sind diese?
Das eine ist, wenn wir auf das Thema Trauer eingehen, muss uns klar sein, welche unfassbare Zäsur der Tod bedeutet. Es sterben in Deutschland 950.000 Menschen pro Jahr – das ist eine Zahl, die wir uns gar nicht vorstellen können. Trotzdem kann ich meinen Kaffee weitertrinken und es haut mich nicht um, es ist einfach so. Auch wenn ich daran denke, was es für die einzelnen Angehörigen bedeutet und es mir dadurch näher kommt, bleibt es abstrakt. Eine der Essenzen des Buchs ist, dass wir um das trauern, was wir lieben, und um den, mit dem wir eine Einheit eingegangen sind. Vor dem Tod gab es eine Wir-Welt, die aus einem Ich und einem Du bestand, diese wurde durch den Tod zerrissen. Wenn ich als Ärztin bei einem Verstorbenen am Bett stehe, bin ich vielleicht für einen Moment bewegt, aber ich kann rausgehen und froh sein, dass alles so weitergeht wie bisher. Für denjenigen, der diesen Verlust erlitten hat, geht nichts so weiter wie bisher. Alles ist plötzlich anders.
Doch der letzte Atemzug, der letzte Augenblick, der letzte Herzschlag, der kommt immer plötzlich.
Ich möchte, dass alle Beteiligten verstehen, dass für die Angehörigen eine – ihre – Welt am Tod zerbricht. Und damit meine ich kein unwiderrufliches Zerbrechen, die Welt kann wieder aufgebaut werden. Aber sie wird komplett anders sein, sie wird Narben und Schraffierungen behalten. Als Begleitende werden wir Zeugen eines existenziellen Erlebnisses – und das ist für mich ein großes und bedeutsames Thema.
Als zweites zentrales Thema habe ich in dem Buch über einzelne Begrifflichkeiten reflektiert. Wenn jemand über Monate oder Jahre an Krebs erkrankt und sein Zustand zusehends schlechter wird und derjenige dann verstirbt, sagen Angehörige oft: Wie kann es sein, es kam so plötzlich? Ich höre immer wieder von Ärzt:innen oder Pflegenden, dass sie sich darüber wundern – schließlich haben sie schon so oft darüber geredet. Doch der letzte Atemzug, der letzte Augenblick, der letzte Herzschlag, der kommt immer plötzlich. Es ist ein anderes „plötzlich“, als wenn jemand bei einem Autounfall ums Leben kommt, aber es wird beides als plötzlich empfunden. Ich möchte, dass man das akzeptiert und versteht und nicht belächelt.
Um dazu noch eine kleine Anekdote zu erzählen: Ich habe neulich in einem Kurs eine Todesanzeige mitgebracht, in der stand, die liebe Mutter, Oma und Uroma sei mit 98 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Viele Studierende fanden das etwas übertrieben – doch eine junge Frau meldete sich und erzählte von ihrer Oma, die mit 89 Jahren starb. Auch das sei plötzlich gewesen. Die Enkelin war einmal in der Woche zu ihr gefahren, hat ihr vorgelesen, es gehörte zu ihrem Leben. Und plötzlich konnte sie ihre Oma nicht mehr besuchen. Daran sieht man: Begrifflichkeiten bekommen im Zusammenhang mit dem Tod eine andere Bedeutung.
Die dritte Essenz, die ich mit dem Buch vermitteln möchte, ist es, auf die Sprache der oder des Anderen zu achten. Ich kann in ein Gespräch gehen und einfach alles erzählen, was ich weiß. Aber ich kann auch auf mein Gegenüber eingehen und herausfinden, welche Wörter benutzt sie oder er, welche Auslassungen werden gemacht und welche Umschreibungen genutzt? Da geht es um eine bestimmte Haltung, mit der ich mich den Trauernden annähern möchte, indem ich eben bewusst ihre Bilder und Sprache aufgreife und mit ihnen weiterarbeite.
Wenn ich das so höre, geht es ja bei diesen Essenzen darum, achtsame Begegnungsräume zwischen unterschiedlichen Welten zu schaffen. Wenn ich beispielsweise als zuständige Ärztin zum ersten Mal nach dem Tod eines Patienten auf dich als Angehörige:n treffe, dann bin ich gerade vielleicht voll im Stress wegen verschiedener Notfälle während meiner Schicht und habe eventuell heute schon den fünften Menschen sterben sehen, aber für dich ändert sich in diesem Moment alles. Dein Leben bricht plötzlich zusammen.
Und wenn die eigene Mutter im fortgeschrittenen Alter stirbt, ist es ja nicht nur die alte Mutter, die stirbt. Sondern auch die Mutter, die von meinem ersten Atemzug an dabei war. Die, die mich getröstet hat und mir vorgelesen hat. Die meinen ersten Freund zum Teufel gejagt hat. All diese Mütter sterben in diesem Moment auch mit. Und es stirbt die mit, die mir etwas über mich erzählen kann. Meine Oma war zum Beispiel die Einzige, die trotz meiner stattlichen Länge von 1,85 Metern „meine Kleene“ zu mir gesagt hat. Als sie starb, sagte das nie wieder jemand zu mir.
Es gibt dazu ein passendes Gedicht von Jewgeni Jewtuschenko. Er sagt: „Und wenn ein Mensch stirbt, stirbt mit ihm sein erster Schnee, sein erster Kuss und sein erster Zorn: und all das nimmt er mit sich fort. Seine geheimen Welten können nicht wieder auferstehen und jedes Mal möchte ich von Neuem diese Unwiederbringlichkeit herausschreien.“
Es stirbt also immer auch ein Teil von uns.
Absolut. Martin Buber sagte einst, der Mensch wird am Du zum Ich. Ich bin zum Beispiel im 43. Jahr verheiratet. Mein Mann ist zu einem Teil von mir geworden und mein Mann hat sich an mir entwickelt – so wie ich mich an ihm entwickelt habe. Er ist mein Resonanzhafen, das ist ein Wort des Seelsorgers Traugott Rosa. Wenn mein Gegenüber jetzt stirbt, dann stirbt auch die Resonanz. Das finde ich so ungeheuerlich, dass dann auf einmal dieser Stillstand eintritt, der für einen Moment allumfassend empfunden wird. Der Stillstand der Welt, der Stillstand von mir, der Stillstand von allem. Dieser Stillstand liegt in der fehlenden Resonanz begründet.
Und wenn jemand Geliebtes stirbt, dann stirbt nicht nur ein Teil von mir mit, sondern ein Teil von dem Anderen bleibt auch in mir. Sigmund Freud sagte einst, wenn ein Mensch stirbt, muss man sich umdrehen und das Objekt der Liebe hinter sich lassen. Das hat er später revidiert, als seine Tochter gestorben ist. Es gibt einfach das Gesetz der fortgesetzten Bindungen. Es gibt diesen Silberfaden zwischen uns, der für immer bleibt.
Das finde ich ein sehr schönes Bild. Können Sie das versuchen, näher zu erläutern: Was ist es für Sie, das bleibt?
Das ist schwer zu beschreiben. Ich nehme mal das Beispiel meiner Schwiegereltern, die ich sehr geliebt habe. Sie sind mit 89 und 90 Jahren verstorben. Meinem Schwiegervater konnte ich viel sagen, aber wenn er keinen Bock mehr darauf hatte, hat er sich mit verschränkten Armen hingesetzt und gesagt: „Du kannst mir viel erzählen, bis mir ein Wort davon gefällt.“ Dieser Satz bleibt bis heute. Er ist präsent, auch nach seinem Tod. Manchmal, vor allem in Verbandsstrukturen und in der Männerwelt, wenn Menschen auf mich einreden, höre ich meinen Schwiegervater, nicke und denke mir genau das: „Du kannst mir viel erzählen, bis mir ein Wort davon gefällt.“
Unser „Wir“ liegt zwar zurück und besteht nur in der Erinnerung, aber diese Erinnerung hat sich in uns eingewoben, sodass sie uns verändert hat. Ich habe zum Beispiel früher nie Krimis gelesen. Meine Schwiegermutter hingegen liebte Krimis – je gruseliger und blutrünstiger, desto besser. Sie lebt nicht mehr, jetzt lese ich Krimis. Dieses Gefühl, dass sie einen Platz in mir hat, das bleibt. Und das Gefühl, geliebt worden zu sein, das bleibt auch.
Manchmal möchte ich weglaufen, weil ich es einfach nicht ertragen kann.
Möchten Sie eine konkrete Hilfestellung mitgeben, wie wir uns die Begegnung mit dem Tod und der Trauer leichter machen oder liebevoller gestalten können?
Ich habe am Ende meines Buches das Akronym „Sei da“ benutzt.
S steht für Situation: Betrachte die Situation, erst einmal die eigene. Bist du total gestresst aus dem Haus, weil die Kinder nicht zur Schule wollten oder der Mann aus Versehen den Autoschlüssel mitgenommen hat? Betrachte deine Situation und die des Anderen.
E steht für Einfühlen: Versuche dich einzufühlen und mache dir auch klar, was deine Einfühlungsgrenzen sind.
I