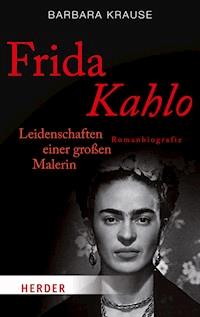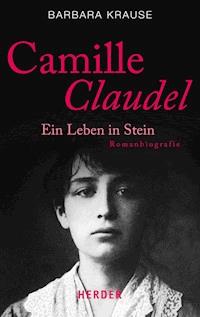
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Sie war jung, außerordentlich begabt und auf der Suche nach Selbstverwirklichung. In einer Zeit, in der Frauen der Hochschulzugang verwehrt war, wurde Camille Claudel zu einer von Kritikern hoch gelobten Bildhauerin, deren Werke heute als genial gelten. Zeitlebens kämpfte sie um ihre künstlerische und gesellschaftliche Eigenständigkeit - und stand doch im Schatten ihres Bruders, dem Dichter Paul Claudel, und dem ihres Lehrers und Liebhabers Auguste Rodins. Barbara Krause zeichnet ein eindringliches Künstlerinnen- und Familienporträt, dass die zeitgenössische Diskrepanz zwischen bürgerlichem Konservatismus und kreativem Freiheitsdrängen vor Augen führt. Die mitreißende Geschichte einer leidenschaftlichen, unkonventionellen Frau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Krause
Camille Claudel
Ein Leben in Stein
Romanbiografie
Impressum
Titel der Originalausgabe: Camille Claudel. Ein Leben in Stein
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: Wikimedia Commons
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80889-0
ISBN (Buch): 978-3-451-06705-1
Das Genie, wo es auftaucht, wird
entweder von der Umgebung erdrosselt
oder tyrannisiert sie …
HESSE
Ich weiß nicht, wie es kommt,
doch stets ist die Armut die
Schwester des Genies.
PETRON
1.
Dezemberstürme fegen über den Tardenois – eigenwillige Landschaft in der Champagne. Am Horizont stehen in tintigem Grün die Kiefernwälder. Im Sommer heben sie sich von der weiten Ebene der Felder ab, wo im warmen Goldton das Getreide reift.
Der Himmel hängt tief über der Ebene. Im fahlen Gelb ergießt sich das Sonnenlicht über die Wiesen und Weiden bis hin zur Anhöhe von Villeneuve.
Die Frau spürt heftigen Schmerz im Kreuz. Es ist so weit. Sie verharrt in der Bewegung. Sie kostet den Schmerz aus. Er kommt alle zehn Minuten. So verbleibt ihr noch Zeit. Noch sagt sie niemandem, dass die Stunde ihrer Niederkunft naht.
Es ist Donnerstag. Der Mann ist in der Kanzlei. Victoire, die alte Haushälterin, macht sich in der Küche zu schaffen. In wenigen Stunden wird der Vater da sein. Der Arzt, zum zweiten Mal Witwer geworden, hat es sich zur Angewohnheit gemacht, gegen Mittag bei der Tochter zu erscheinen. Fünf Kilometer sind es von Villeneuve nach Fère, er legt sie im Einspänner zurück. Die Frau greift nach dem schweren wollenen Umschlagtuch und verlässt das Haus. Sie verharrt zögernd. Der Sturm verschlägt ihr den Atem. Schwerfällig, doch entschlossen, geht sie die vier Stufen der kleinen Treppe hinunter. In trostloser Verlassenheit weitet sich der Marktplatz. Die kleine Stadt – fast menschenleer. Die Frau zieht es auf den Friedhof. Hinter grauer Mauer am Rande der Stadt – der steinerne Totenacker. Der Sturm kommt in Böen. Die Frau muss den Kopf wenden, um Luft zu holen. Es ist ein junges Gesicht mit strengen Zügen. Das Haar ist in der Mitte gescheitelt, zum Zopf geflochten und aufgesteckt. Starke Augenbrauen verleihen dem Gesicht zusätzlichen Ernst. Eine ausgeprägte Nase. Ein zu großer Mund. Ihren Blick wird sie nur im Zorn heben. Später – auf Familienfotos – schaut sie den Betrachter nicht an. Stolz, unnahbar, in aufrechter Haltung, heuchelt sie keine Freundlichkeit. Erst im Alter, wo sich das Leben endlich nach ihrem Willen fügt, wird ihr Blick frei. In Selbstzufriedenheit ruhend, wird sie sich so dem Fotografen stellen.
Die Vorfahren mütterlicherseits waren durch die Revolution von 1789 von fast Leibeigenen zu freien Grundeigentümern geworden. Eine Verehrung für Napoleon I. ist Familientradition. Sie gilt weniger dem eroberungswütigen Kaiser als dem Konsul, der jene Umverteilung des Eigentums beschützte, die sich in den Jahren der Revolution vollzogen hatte, als die Ländereien der Kirche und der adligen Emigranten in die Hände der Bourgeoisie und der Bauernschaft übergingen. So hatte der Großvater der jungen Frau das der Kirche enteignete und der Gemeinde zum Kauf angebotene Pfarrhaus von Villeneuve erworben.
Der Wind hat die Wolken zu drohendem Dunkel zusammengeschoben. Es riecht nach Schnee.
Unter ihren Füßen knirscht der in diesem Sommer angefahrene Kies – Muschel-, Stein- und Kreideschutt aus den Flüssen der Champagne. Vor dem kleinen Grab bleibt die Frau stehen.
Hier weilt sie oft. Die einzige Tanne des Friedhofs steht in unmittelbarer Nähe. Von hier kann sie nach Villeneuve hinüberschauen, dem kleinen Dreihundertseelendorf. Es liegt auf der Anhöhe. Die Kirche ragt zwischen den Baumgruppen hervor. An die Kirche von Villeneuve gepresst – von hier aus nicht sichtbar – liegt das ehemalige Pfarrhaus, in dem sie geboren wurde. Eines Tages wird sie das Haus erben und das Land. Jeden Tag schaut die Frau von der Friedhofsmauer von Fère hinüber nach Villeneuve.
Doch dann senkt sich ihr Blick.
Das Grab des Erstgeborenen, Henri. Kaum vierzehn Tage alt. Im August vorigen Jahres wurde er beerdigt. Noch immer geht sie in Schwarz. Der Stolz, dass der Erstgeborene ein Sohn war, schlug in tiefen Schmerz um.
Die Frau streicht über ihren vorgewölbten Leib. Sie wünscht, der Sohn möge auferstehen in diesem Kind. Der Schmerz im Kreuz wird heftiger. Wie hat sie gewartet auf diesen Tag, diese Stunde. Sie will den verlorenen Sohn zurück. Henri. Gleißend bricht die helle Wintersonne unter dem blauschwarzen Wolkenrand hervor.
2.
Am Donnerstag, dem 8. Dezember 1864, wird dem Staatsbeamten Louis-Prosper Claudel und seiner Frau Louise-Athenaise, geborene Cerveaux, ein Mädchen geboren. Der Onkel der Frau, Pfarrer von Villeneuve, tauft das Kind im Januar 1865 auf den Namen Camille.
So der Wunsch des Vaters.
Nomen est omen.
Camilla – Name der Königin der Volsker, eine der Heldinnen aus Vergils »Aeneis«. Camilla ist berühmt wegen der unvergleichlichen Leichtigkeit ihres Ganges. Der Dichter sagt von ihr, dass sie über ein Ährenfeld zu laufen vermochte, ohne dass die Halme sich bogen, und über die Meeresflut, ohne die Sohlen zu benetzen.
Camille Rosalie Claudel.
Wohl wird Camille als Kind mühelos laufen und klettern können und als junges Mädchen tanzen – doch es bleibt ein leichtes Hinken. Ein Grund mehr für den Vater, dieses Kind zu lieben, zumal die Mutter sich abwendet – in maßloser Enttäuschung –, als sie das Mädchen erblickt. Dieses Kind betrog sie um die Hoffnung, so töricht die Hoffnung war. Befangen in ländlichem Aberglauben, sieht die Frau in dem missgebildeten Fuß des Mädchens ein Zeichen des Teufels. Man sagt den Bewohnern der Champagne nach, zwar Realisten, aber auch Mystiker zu sein.
Mag das Kind dem Vater gehören, der es mit Stolz herumzeigt. Der Krieger Metabus, Vater jener Camilla, machte das Kind zu seiner Gefährtin auf der Flucht. Er weihte es der Göttin Diana, als er das Mädchen an seinen Wurfspieß band, um es über den reißenden Strom zu schießen – aus der Gefahr in die Sicherheit. Er lehrte sie die Kunst von Pfeil und Bogen. Er legte ihr statt Gewänder ein Tigerfell um. Freiheit für die Volsker. Tod den Latinern. Camilla – Amazone – Heldin im Kampf für die Freiheit.
Louis-Prosper Claudel liebt und verehrt diese Tochter über alles.
3.
Mit Unverständnis betrachtet die Frau die Zärtlichkeit des Mannes für das Kind. Sie vermag keine Zärtlichkeit zu verschenken und kein Gefühl zu zeigen. Als Louise-Athenaise vier Jahre alt war, verlor sie die Mutter, eine Thierry, Tochter eines Holzhändlers. Unter den ständigen Auseinandersetzungen des Vaters, der einen unnachgiebigen Charakter hatte, mit dem Bruder hatte das Kind gelitten. Es war an den Zustand familiärer Zwietracht gewöhnt. Von der Stiefmutter übernahm sie die Pflicht, Kinder großzuziehen, für sie zu kochen und zu nähen. Haushalt, Garten, Hof, Kaninchen- und Hühnerställe – in dieser Welt war sie groß geworden. Hier bewies sie ihre Tüchtigkeit, die sich in Geld aufrechnen ließ. Zu Kirche und Glauben hatte Louise-Athenaise kein besonderes Verhältnis. Die Religion vermochte ihr weder Hilfe noch Trost zu spenden. Was ihr Selbstwertgefühl ausmachte, war das Wissen, dass ihr mütterlicherseits ein beträchtliches Erbe zustand, vom Vater sorgsam für die Kinder verwaltet und vor einem Notar 1864 peinlichst aufgeteilt zwischen dem Bruder und ihr, einschließlich der vom Vater erworbenen Güter.
Louise-Athenaise war wohlhabend. Häuser, Wiesen, Land, Weinberge, Wald. Das meiste verpachtet.
Der Steuereinnehmer Louis-Prosper Claudel, der als Staatsbeamter in die Kleinstadt Fère-en-Tardenois berufen wird, lernt bei seiner Tätigkeit den Arzt und Bürgermeister von Villeneuve kennen – Athenaise Cerveaux.
Louis-Prosper bezieht ein ausreichendes Gehalt. Er besitzt einige Wertpapiere an der Börse, einige Kreditbriefe und was das kleine Haus in Gerardmer abwirft. Es lässt sich nicht mit dem vergleichen, was die junge Louise-Athenaise erben wird. Doch was den Beamten Claudel auszeichnet, ist seine Bildung, hat er doch in Strasbourg auf der Jesuitenschule seine Ausbildung mit Auszeichnung beendet, verfügt er über eine umfangreiche Bibliothek, die ihn als gebildeten Humanisten ausweist. Die Werke von Sallust, Tacitus und Cäsar stehen neben Horaz und Ovid, die griechischen Tragödien neben Plutarch, Homer und Demostenes.
Der Arzt und Bürgermeister von Villeneuve, zum zweiten Mal verwitwet, ist angetan von dem Beamten, der mit seinen sechsunddreißig Jahren für die Tochter eine würdige Verbindung zu sein scheint. Die beiden Männer kommen überein, noch bevor das junge Mädchen etwas von dieser geplanten Verbindung ahnt. Erzogen in absolutem Gehorsam und Unmündigkeit, geht sie die Ehe mit dem Mann ein, den ihr Vater für sie bestimmte.
Dennoch schürt die Ehe mit dem Staatsbeamten Claudel ihren Dünkel, stammt er doch aus einer traditionsreichen Beamtenfamilie.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Louis-Prosper Claudel nach seinem Studium einer Freimaurerloge beitrat, die Enge dogmatischen und konservativen Denkens hinter sich lassend und sich den philanthropischen Zielen des Geheimbundes verschreibend.
Seine Ausbildung in der Jesuitenschule ließ in Louis-Prosper Claudel einen tiefen Hass entstehen gegen das bildungsfeindliche Schulwesen, das Pfaffen und Nonnen überantwortet war. Auch die Universitäten unterstanden engstirniger klerikaler Kontrolle, er schwor sich, für seine Kinder die Enge solcher Gedankenwelt zu überwinden und das in seinen Kräften Stehende zu tun, ihnen eine umfassende Bildung zukommen zu lassen.
4.
Am 3. Februar 1862 ehelichte Louis-Prosper Claudel die um vierzehn Jahre jüngere Louise-Athenaise Cerveaux. Durch diesen Ehekontrakt werden gewaltsam zwei Welten vereinigt, die sich wie Feuer und Wasser gegenüberstehen. Ein gebildeter Humanist und eine von Konformismus geprägte junge Frau ohne intellektuelle Neugier und künstlerische Sensibilität, befriedigt durch Besitztum, bestrebt, es zu wahren und zu mehren.
Nach dem mysteriösen Selbstmord des Schwagers 1866 geht an die Claudels dessen Erbe. Louis-Prosper verfügt jetzt über genügend Mittel, von den Nachfahren des Grafen Coigny vierzehn Hektar Wald abzukaufen. Der Onkel, Pfarrer von Villeneuve, hinterlässt nach seinem Tode ebenfalls Besitz und Haus den Claudels. Somit zählen sie – neben dem Grafen – zu den wohlhabendsten Einwohnern dieser relativ armen Gegend. Sie haben Hausangestellte, was im Dorf unüblich ist und die große Ausnahme. Die Claudels …, das sind die Privilegierten des kleinen Dorfes von Villeneuve. Ihre Grabstätte, unmittelbar an der Friedhofsmauer, zeugt als imposanteste des kleinen Totenackers von der achtbaren Rolle, die sie einst innehatten.
Die Ehe der Claudels verlief in Hass, Unfrieden und Streitsucht. Darin erstarrte sie.
Eines Abends – das Ehepaar hat seinen jungen Hausstand in Fère eingerichtet – fragt Louis-Prosper seine Frau, ob sie ihm nicht auf dem Klavier vorspielen wolle. Ihre klösterliche Ausbildung hat auch Klavierstunden beinhaltet. Die Frau entschuldigt sich mit Arbeit in der Küche und gesteht ihre Absicht, nie wieder einen Ton auf diesem Instrument anzuschlagen. Den Nutzen dieses Zeitvertreibs habe sie nie eingesehen. Das seien Allüren, die kostbare Zeit verschwendeten.
Irgendwann sucht der Mann seiner Frau ein Buch aus seiner umfangreichen Bibliothek heraus. Er empfiehlt es ihr. Sie dreht das Buch unschlüssig in den Händen. Flaubert. Emma Bovary. Lust hat sie, dem Mann zu sagen, dass ein Buch nicht satt mache. Doch will sie sich die leichte Verachtung, die sie für die Bücher ihres Mannes hegt, nicht anmerken lassen. Verhehlt sie schon schlecht ihr Ungehaltensein über seine Passivität, wenn sie über zu kaufende Pflaumenbäume spricht, über Weinpreise oder das zu verpachtende Weideland. Man muss schlau zu kalkulieren verstehen.
Der Mann wartet, dass die Frau ein Gespräch über das gelesene Buch beginnen möge. Eines Tages entdeckt er es im Bücherschrank, kommentarlos zurückgestellt.
Enttäuschung. Desillusionierung auf beiden Seiten.
Meist verlässt Louise-Athenaise das Zimmer, wenn sich der Mann über die Wiege der kleinen Camille beugt und seine einseitigen Gespräche mit ihr führt. Sie findet, dass ein solches Verhalten einem Mann nicht zustehe. In seinem Tonfall liegt eine vor ihr verborgen gehaltene Weichheit. Es scheinen Träumereien, die sich in der Zukunft verlieren. Versprechungen, Erwartungen. Louise beginnt ihren Mann zu hassen, der sich eine Tochter wünscht, die das Gegenteil von ihr werden möge. Vielleicht so eine wie jene Emma Bovary?
Louise-Athenaise kann in der Bovary keine Heldin sehen, die aus ihrem Gefängnis von der Ehe und stickiger Kleinstadtatmosphäre auszubrechen versucht, die mehr wollte als die Mittelmäßigkeit, die sie umgab.
Unvermittelt platzt sie heraus, als der Mann leise die Tür zum Kinderzimmer schließt: »Es wäre die Pflicht der Bovary gewesen, ihr Innerstes zu verbergen. Aus Stolz. Sie hätte sich anpassen sollen. Ihrem Mann eine gute Frau sein, ihrem Kind eine gute Mutter!«
Eine gute Frau sein? Kinder gebären, großziehen. Treu sein. Dem Mann gehorchen. Das eigene Ich hinter Pflicht verstecken. Niemandem zeigen, wie einsam und leergebrannt man ist.
Nicht dass Louis-Prosper den Lebenswandel der Bovary billigt. Ihr selbstgewollter Tod gibt ihr eine nachträgliche Weihe.
»Sie hat das Wagnis probiert, lieben zu wollen.«
Da schaut Louise ihren Mann an. Nichtverstehen gepaart mit Verachtung und Mitleid.
Ihr bäuerlicher Instinkt warnt sie. Sich ein Gefühl leisten in dieser Zeit? Ist der Mann größenwahnsinnig? An solch einem Gefühl zugrunde gehen?
Nein. Sich tot stellen. In strenger Pflichterfüllung Befriedigung suchen. Ihr Selbstwertgefühl erschöpft sich in ihrem Besitz. Das kann Liebe nie und nimmer aufwiegen.
So viel hat sie von jener Emma begriffen, dass man sein Herz zu töten hat, ein rebellisches, aufbegehrendes Herz.
Ihr Herz ist tot.
An einem Traum von Liebe geht man zugrunde. In dieser Zeit ist alles käuflich. Jedes Ding und jede Beziehung haben ihren Preis.
Da ist etwas im Wesen ihres Mannes, was Louise Angst macht, von dem sie sich bedroht fühlt, was ihr das Gefühl von Halt nimmt.
Man entwickelt keine solchen Ideen wie der Mann, der sich nach einer Tochter sehnt, die sich, anders als eine Emma Bovary, über Konventionen hinwegsetzen und sich engagiert zu ihrem Ich bekennen soll. Der Vater will ihr einen Fundus an humanistischer Bildung mit auf den Weg geben und sie in einem solchen Anspruch bestärken. Seine Tochter soll sich durch Wissen und Fähigkeiten ihren Weg bahnen.
Louise-Athenaise fürchtet um dieses Kind. Doch der Mann ist besessen, eine Mission zu erfüllen.
Zugleich lodert Hass auf im Herzen der Frau. Zu offenkundig zeigt der Mann seine Nichtachtung für sie. Seine Forderungen an eine Frau sind nicht zeitgemäß. Nein, sie selbst ist nicht gebildet, aber ihr gehört Land in Villeneuve, so weit das Auge reicht.
Die ausschließliche Zuwendung des Mannes zu der Tochter verstärkt ihr Gefühl von Einsamkeit.
Die Frau verschließt sich in Schmerz und Trauer, dass ihr erstgeborener Sohn der von dem Mann vergötterten Tochter den Platz räumen musste. Der Sohn hätte Grund und Boden zu schätzen gewusst. Mit ihm wäre sie nicht so einsam geworden.
5.
Camilles Geburtsjahr, das Jahr 1864, fällt in die Glanzzeit des Zweiten Kaiserreichs, dem Louis-Prosper seine Sympathie versagt. Er ist Republikaner. Umso aufmerksamer verfolgt er die Tendenzen, die sich vor allem in Kunst und Literatur zeigen, um in ihnen Zeichen des Neuen zu entdecken.
Mit großer Genugtuung las er das Buch des Philosophen Ernest Renan »Das Leben Jesu«, dessen antiklerikale Haltung dem Verfasser zunächst den Lehrstuhl kostet. Louis-Prosper hält es für bedeutungsvoll, dass das Erscheinen dieses Buches mit dem Geburtsjahr seiner Tochter zusammenfiel.
Dennoch ist die Salonkunst des Zweiten Kaiserreichs vorherrschend. Sie gibt den Ton an. Sie prägt den Geschmack. Alljährlich werden großartige Kunstausstellungen durchgeführt. Der Salon stellt eine eigenartige Börse der Kunst dar. Unternehmer, die ihr Kapital in Kunstwerken anlegen wollen, erwerben sie hier. Ihr trivialer bürgerlicher Geschmack und die Auffassung der stockkonservativen Jurymitglieder prägen das künstlerische Niveau der »Salonkunst«. Mythologische Themen werden bis zum Überdruss traktiert. Man ist auf äußerliche Reize bedacht. Die Salonkunst verflacht und trivialisiert den Geschmack des Publikums, passt sich dem mittelmäßigen Niveau des Bürgers an, verarmt in geistiger Beziehung. Doch neben dieser Kunst besteht, entfaltet und entwickelt sich in den Sechzigerjahren ein Realismus, der sich mit den Namen Monet, Pissarro, Cézanne und Renoir verbindet. In den Werken Monets bereitet sich in der Malerei der Impressionismus vor. Transparenz. Atmosphäre. Licht.
Louis-Prosper registriert, dass der Historiker und Philosoph Taine den Positivismus auf Kunst- und Literaturwissenschaft überträgt, seine Milieutheorie entwickelt, was auf Zola und den übrigen Naturalismus großen Einfluss haben wird. Umwelteinflüsse, Erbfaktoren und konkrete Zeitbedingtheit – mechanisches Erfassen und Festhalten dieser Faktoren werden die neue Sicht des Künstlers prägen.
Erst im Alter erschließt sich dem Vater die Bedeutung eines Ereignisses, das in das Geburtsjahr seiner Tochter fiel. Ein Ereignis, das nicht ohne Folgen für den Lebensweg Camilles bleiben sollte. 1864 sucht der unbekannte Bildhauer Auguste Rodin erstmals die Öffentlichkeit und stellt sein erstes Meisterwerk – »Der Mann mit der gebrochenen Nase« – der Salonjury vor. Der junge Bildhauer, Mitte zwanzig, der Armut und Hunger kennengelernt hat, wurde von den akademischen Herren übersehen. Sein Werk zurückgewiesen. Wortlos. Man war schockiert.
Doch in dieser Büste, in diesem Gesicht ist alles enthalten – in voller Reife und mit voller Bewusstheit –, was den Künstler Rodin ausmacht. Es vergehen dreizehn Jahre, in denen Rodin weiterhin als anonymer Kunsthandwerker sein Leben fristet, ehe er wieder dem »Salon« anbietet. Zeitgenosse der Impressionisten und selbst Maler, studiert er die Spiele von Schatten und Licht. Auf dem Gesicht des Mannes mit der gebrochenen Nase gibt es keine symmetrischen Flächen. Dieses Gesicht entspricht nicht den Anforderungen akademischer Schönheit, nicht denen der Plastik von Posen und Allegorien, nicht der Wiederholung einiger sanktionierter Gebärden.
»Es ist der Kopf eines alternden hässlichen Mannes, dessen gebrochene Nase den gequälten Ausdruck des Gesichts noch verstärken half; es war die Fülle des Lebens« – schreibt Rilke.
6.
Camille ist noch nicht ein Jahr und drei Monate, da wird der Familie Claudel ein zweites Mädchen geboren. Es erhält den Namen seiner Mutter. Louise.
Das Kind ist gesund. Wieder kein Sohn. Aber diesmal will die Frau ein Kind für sich. Louise wird ihr Liebling. Sie wird das häuslichste der Geschwister. Sie wächst heran im großen Einverständnis mit der Mutter, in dem köstlichen Wissen, den Geschwistern vorgezogen zu werden.
Anderthalb Jahre nach Louises Geburt erblickt am 6. August 1868 das dritte Kind der Claudels das Licht der Welt – Paul.
In den Ferien des Mannes lebt die Familie in Villeneuve. Dort wird der Sohn geboren. Des Vaters Zuneigung erschöpft sich in Camille, die der Mutter in Louise. Paul wird im Großvater seinen Schutzpatron finden. Doch im engeren Familienkreis strecken sich ihm vertrauensvoll und hungrig nach Zärtlichkeit die Arme Camilles entgegen. Er wirft sich hinein. Von ihr will er getragen werden. Ihr folgt er wie ein Hündchen, denn ihre Welt ist voller Wunder. Wie Märchen mutet an, was sie ihm von Felsen und Bäumen erzählt, auf die sie bei ihren Erkundungen stoßen.
Sie weiht ihn in Dinge ein, deren Geheimnisse sich nur ihnen beiden erschließen. Nicht gewohnt, von der Mutter liebkost zu werden, genießt er die stürmische Zuneigung Camilles.
Dennoch kann sich der kleine Paul nicht den Einflüssen von Mutter und Großvater entziehen, nicht den Reden Louises, die eifrig nachplappert, was sie von der Mutter aufgeschnappt hat. Ermunterungen des Großvaters bestärken ihn, dass ihm als einzigem Stammhalter ein größeres Recht zusteht als den Mädchen.
Als jüngstes Kind, von den Schwestern mitunter tyrannisiert, sehnt er sich nach Überlegenheit. Leidenschaftlich bejaht er Bestrafungen Camilles durch die Mutter, wenn die Schwester, wild, ungebunden, selbstherrlich, sich über alle Regeln hinwegsetzt, die für ein Mädchen gelten. Vom Vater wird sie selten getadelt. Paul leidet unter Camille, sosehr er sie braucht, sosehr er sie liebt. Sie ist ein Mädchen und stellt Ansprüche wie ein Junge. Noch in seinem ersten Drama klingt dieser Zorn auf. Da lässt er seinen Helden Goldhaupt sagen: »Das fluchbeladene Weib, es ist da, um daheim zu bleiben und sich einer starken, verständigen Hand zu fügen. Ihr jedoch habt das Weib zu Eurer Herrin gemacht!«
7.
Eines Tages macht Camille eine Entdeckung.
Auf dem Hof des Onkels wird eine Grube ausgehoben. Hässliche Klumpen rot und grau gemaserter Erde liegen auf dem Gras, sein frisches Grün erstickend. Camille starrt in die Grube und kniet sich vor die herausgeschaufelte Erde. Sie untersucht ihr seltsames Aussehen. Da rinnt nichts fort zwischen den Händen. Sie bleibt kompakt, diese Erde, die nichts gemein hat mit Sand. Jenem feinen, weißen Sand, den Camille über alles liebt, weil er sie an das Meer erinnert, das sie sich unendlich groß und blau wie den Himmel vorstellt.
In der Nacht zuvor hatte es geregnet. Die vom Regen benetzte Schicht ist formbar. Ungläubig drückt Camille mit den Fingern Löcher hinein. Nichts rutscht zusammen. Nichts füllt sich auf. Diese marmorierte Erde bewahrt sogar den Abdruck ihrer Haut, die wie zartes Netzgewebe anmutet. Ihre Hände nehmen eine rote Farbe an. Sie drückt und knetet in dieser seltsamen Masse herum. Schließlich hebt sie einen handgroßen Klumpen auf und läuft mit ihm unter die Pumpe, um ihn mit Wasser formbarer zu machen. Sie knetet einen Würfel. Ein heiserer Laut entfährt ihr, ein ungläubiges Lachen. Sie rollt eine Kugel. Und plötzlich hat sie das Bedürfnis, etwas ganz anderes, Wunderschönes zu formen. Erregung überfällt sie. Eine unbekannte Aufregung, die ihr bis in den Hals klopft. Die rotgraue Maserung erinnert sie an die Bunte, die gestern fortgebracht wurde in die Stadt.
Camilles Gesicht beginnt zu glühen. Sie kniet im Gras und formt und verwirft und gestaltet neu …, und plötzlich ist die Katze wieder da. Sie, Camille, hat die Katze wieder entstehen lassen, um die der kleine Paul Tränen vergossen hatte.
Camille läuft ins Haus. Sie kann nicht fassen, dass das, was sie in den Händen hält, ihr eigenes Werk ist. »Paul, Mama, Louise! Ich habe eine Katze gemacht. Eine Katze wie unsere Bunte! Ich kann zaubern! Kommt schnell her!«
Verzaubert ist nur der kleine Paul.
Die Mutter ist erbost.
»Habe ich nicht verboten, an die Grube zu gehen! Wie sieht dein Kleid aus! Schaut sie euch an, wie schmutzig sie ist und wie ungezogen! Was soll deine Katze? Haben wir nicht genug Ärger mit den vielen Katzenjungen. Ich mag keine Katze mehr sehen! Gib das Zeug her!«
Die Mutter will Camille das aus Ton Geformte aus der Hand nehmen. Camille schreit: »Mach das nicht kaputt!«
Etwas ist in dem Schrei – mehr als Ungehorsam und Unwille über verbotene Spiellust –, was die Mutter innehalten lässt.
Sie rührt es nicht an.
»Trag es auf dein Zimmer! Geh dich waschen und lass dich für heute nicht wieder hier unten blicken!«
Camille muss noch einmal an die Grube. Sie braucht mehr von dieser Wundererde.
So begegnet sie der Mutter, als sie in der Schürze die schwere klebrige Masse in die Scheune tragen will, um sie dort zu verstecken.
Die Mutter befiehlt ihr, den Ton sofort an die Grube zurückzutragen. Camille schüttelt wortlos den Kopf. Der Ungehorsam ihrer ältesten Tochter regt die junge Frau auf. Sie will ihr den Ton aus der Schürze reißen, aber Camille krümmt sich zusammen und schützt mit ihrem Körper das Erbeutete.
Der Vater erscheint im Hof.
Die Frau erwartet von dem Mann, dass er den Ungehorsam des Kindes bricht. Camille vertraut seinem Schutz und Verständnis.
Paul erscheint verschüchtert in der Haustür. In den Händen hält er die Katze aus Ton. Er hält sie dem Vater zur Begutachtung entgegen. Camille hatte den ganzen Nachmittag an ihr herumgeformt. Jetzt liegt sie zusammengerollt und schlafend in Pauls Händen.
»Das hast du gemacht?«, fragt der Vater.
Camille nickt triumphierend. Louis-Prosper betrachtet das Gebilde eingehender. Etwas ist da von dem Vertrauen und dem Frieden, der von jeder Katze ausgeht, wenn sie zusammengerollt schläft. Camilles Protest, dass die Bunte gestern aus dem Schlaf fortgegeben wurde? Was ihn anrührt, ist der seltsame Glanz, der in ihrem Blick liegt. Aufgefallen war ihm Camilles zeichnerische Begabung längst.
»Behalte den Ton. Trag ihn vorläufig in den Schuppen!«
Die Mutter dreht sich schweigend um und geht ins Haus. Sie wird am Abend kein Wort mehr mit dem Mann reden.
Als der Vater die Besessenheit wahrnimmt, mit der sie modelliert – mit großem Geschick, verblüffend und originell in ihrer Themenwahl –, sorgt er dafür, dass sie in der Scheune einen Platz erhält, wo sie Tonerde lagern kann, wo ein Tisch aufgestellt wird, unter dem Fenster, der ihr als Arbeitsplatz dient. Auch für den Vater ist es kein Leichtes, diesen Platz für sie zu erkämpfen.
Die Scheune wird gebraucht. Lange Diskussionen. Absolutes Unverständnis, einem Kind, einem Mädchen dazu, einen so notwendigen, zweckgebundenen Platz zu opfern.
Die Scheune ist ein solider Bau. Spitzer Giebel. Fenster, die sogar mit Läden zu verschließen sind. Ein Spalier aus schmalen Holzlatten, an denen Wein rankt.
Die Geschwister sind empört ob solcher Bevorzugung. Paul möchte ebenfalls einen Winkel, in den er sich ungestört und ebenso akzeptiert zurückziehen kann. Doch ihn nimmt man nicht für voll. Eifersucht. Später, als gestandener Diplomat, wenn er seinen Urlaub in Villeneuve verbringt, wird ihm die Scheune gehören. Hier erledigt er seine Korrespondenz und überarbeitet er sein dramatisches Werk. »Ich schreibe aus einer Scheune, in die ich mich flüchten musste, um dem Spektakel in unserem kleinen Haus zu entgehen, das voll von Menschen ist. Jeden Morgen brüten hier die Hennen und ich gemeinsam im Stroh.«
Paul sitzt vor der verschlossenen Scheune. Seit Camille den Ton entdeckt hat, knetet sie nur noch herum und macht sich schmutzig. Er langweilt sich. Wütend beginnt er, mit Händen und Füßen an das Tor zu schlagen. »Du sollst mit mir spielen. Ich will zu dir!« Wenn er genügend Ausdauer aufbringt, öffnet Camille, resigniert und gerührt. Paul schlüpft in die Scheune. »Mach mir wieder die Tür auf!« Seltsames Spiel, das Camille für ihn erfunden hat. Ein Kompromiss, den sie ihm zugesteht. Sie haucht an das Fensterglas der Scheune. Ein schwacher beschlagener Film. Sie malt darauf mit den Fingern einen Türrahmen, eine geöffnete Tür. »Nun geh hindurch. Du kommst in den Regenpalast. Dort findest du mich. Verlier mich nie aus den Augen und pass auf, wann ich dich anlächle!« Ein imaginäres Spiel. Paul folgt ihrer Fantasie und lässt die seine entzünden. Camille modelliert weiter. Paul hockt mit geschlossenen Augen vor dem Scheunenfenster. Der Trick funktioniert. Bedingung: Camille muss ihr imaginäres Ich jedes Mal an einen anderen Ort zaubern, und Paul erzählt ihr am Abend, was er mit ihr erlebte. »Geh durch diese Tür – ich stehe auf der großen Mauer. Schau dich nie um, sonst werde ich stürzen … Geh durch diese Tür …«
Camille möchte der Mutter eine Freude machen. Sie weiß um die Verehrung der Familie Cerveaux für die Errungenschaften der Großen Französischen Revolution, als deren Verkörperung sie Napoleon Bonaparte ansah, der als Konsul ihr gerade erworbenes Land schützte. Eine Büste von Napoleon I. – ein Geschenk für die Mutter. Das Angebot einer Versöhnung, unausgesprochene Bitte um Tolerierung ihrer neuen beglückenden Beschäftigung mit Tonerde.
Der Vater ist verblüfft von der Ähnlichkeit, die Camilles Büste mit den Bildern Napoleons aufweist. Begeistert ist er nicht, dass diesem Mann in der Büste seines Kindes eine Würdigung widerfährt. Er hält es mit dem Dichter Victor Hugo, der sowohl von dem einen wie von dem anderen bonapartischen Machthaber sagte: »Sie meuchelten das Recht, verstopften der Freiheit den Mund, entehrten die Fahne, traten das Volk mit den Füßen und waren sehr glücklich dabei!«
Er nimmt Camilles Büste zum Anlass, um über den »Wunderglauben« der französischen Bauern zu spotten, der durch geschichtliche Tradition entstanden ist, dass ein Mann namens Napoleon ihnen alle Herrlichkeit geben wird. Seine Rede gipfelte in dem Satz: »Die Bauern, die mit Napoleon dem Dritten sympathisieren, sind konservativ!«
Der Vater fällt bei solchen Reden in den unpersönlichen, sehr akkuraten Versammlungston, der das Kind langweilt. Die Losung »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« ist ihm näher als die Prunksucht des Kaisers. Dessen Expansionsgelüste geißelt er mit heftigen Worten. Camille leidet unter diesen Ausfällen des Vaters, auch wenn sie sich gegen den Kaiser richten und nicht an die Mutter oder irgendein anderes Familienmitglied. Doch spricht er so laut, dass es wohl für die Ohren der Mutter bestimmt ist, die sich im Nebenzimmer aufhält. Hatte der neue Napoleon nicht proklamiert, sein Kaiserreich sei der Friede? Und nun stürzt er das Land außenpolitisch in eine Kette von Kriegen – Krim, Italien, Mexiko, Senegal, Indochina, Syrien …
Hatte dieser Napoleon III. nicht auch verkündet, er wolle die Massenarmut beseitigen?
Mussten nicht zehnjährige Kinder in Pas-de-Calais unter Tage arbeiten, fünfzehn bis sechzehn Stunden, ohne ausreichend Geld für ihr Essen zu verdienen? Starben nicht junge Mädchen, Spitzenklöpplerinnen, reihenweise an Tuberkulose? Kleinbürgerliche Kreise machten Bankrott. Dafür schossen Kapitalverbände und Dachorganisationen empor.
Camilles Büste lässt Familienzwist auflodern.
Es gibt Tage, an denen in der Familie vom Morgen bis zum Abend nur gestritten wird.
Die Mutter möchte das Geschenk annehmen und die Büste Napoleons dem Mann zum Trotz auf das Büfett stellen.
Andererseits möchte sie der Tochter nicht diesen Achtungsbeweis ihrer Arbeit geben und meint, keinen Platz dafür zu finden.
Der Großvater beansprucht begeistert diese Büste für sich. Das Werk wird später mit anderen von einem schon anerkannten Bildhauer begutachtet, der sich beeindruckt zeigt.
8.
Dreißig Kilometer entfernt von dem kleinen Villeneuve liegt Reims – Kreisstadt des Départements Miene.
Als der Merowinger Chlodwig im Jahre 496 in Reims getauft wurde, erhielt die Stadt das Privileg verliehen, französische Könige zu salben. In ihrer Bedeutung als Krönungsstadt kann sie sich entfalten und entwickeln. Von 1211 bis 1311 wird die Kathedrale in Reims gebaut. Nicht nur erzbischöfliche Kirche, auch königliche Basilika, bestimmt für die Zeremonie der Salbung.
Die Stadt lässt sich mit der Eisenbahn bequem von Fère erreichen. Im Sommer diese Reise zu unternehmen lehnt die Frau strikt ab. Das Obst reift heran. Das Heu muss eingefahren werden. Viel zu selten sind sie in Villeneuve. Nur der ältesten Tochter wegen will der Mann nach Reims. Soll er allein fahren mit ihr. Ihr will er zeigen, wie aus totem Stein Leben wird, wenn eine Künstlerhand ihn berührt. Wie im Stein aus einer Idee, aus einem Gefühl – ein Kunstwerk entsteht.
Die kleine Louise ist unzufrieden. Sie möchte auch in eine größere Stadt. Sie würde mit Hartnäckigkeit so lange vor einem Schaufenster stehen bleiben, bis ihr eine Herrlichkeit gekauft würde.
Auch Paul ist betroffen, dass der Vater nur mit Camille fährt. Sein Murren ist nicht zu überhören! Der Vater verspricht, wenn Paul größer ist, mit ihm nach Paris zu reisen und dort ein richtiges Theater zu besuchen.
Einst war Reims Hauptstadt des keltischen Stammes der Belgier. Der längsovale Grundriss der Stadt geht auf die Römerzeit zurück. Am Markt kreuzen sich zwei Achsen, die die Stadt durchziehen, sie gleichsam in zwei Zentren teilend. Das eine – der Rathausplatz mit dem Stadthaus und der Reiterstatue Ludwigs XIII. Das andere – das sakrale Zentrum um die Kathedrale und das Erzbischöfliche Palais.
Es ist Louis-Prosper ein Bedürfnis, seinem Kind eines der bedeutendsten Werke der französischen Hochgotik zu zeigen – die Kathedrale von Reims. Er will nicht, dass Camille in dörflicher Beschränktheit aufwächst wie die Mutter.
»Das Frankreich des Mittelalters hat in der Baukunst seine tiefsten und intimsten Gedanken ausgesprochen. Der Stein belebt und vergeistigt sich unter der brennenden und strengen Hand des Künstlers. Der Künstler lässt Leben daraus hervorspringen. Mit vollem Recht heißt er ›Magister de vivis lapidubus‹ – Meister der lebendigen Steine.« Camille liest das zu Hause in einem großen Buch nach, das ihr der Vater aus seinem Bücherschrank sucht.
Karl VIII. nennt die Kathedrale von Reims »die vornehmste unter allen Kirchen des königlichen Frankreichs«.
Viele Baumeister und Bildhauer haben daran mitgewirkt. Trotz ihrer Vielzahl und trotz der langen Bauzeit war es gelungen, eine »steinerne Symphonie« zu schaffen.
In angemessener Entfernung bleibt der Vater, mit der Tochter an der Hand, vor der Westfront Unsrer Lieben Frau stehen. Sie wird beherrscht von den drei Portalen, über denen sich die Zone der Rose aufbaut.
Der Mann versenkt sich in den gewaltigen Anblick einer der vollkommensten Schöpfungen, die aus Menschenhand hervorgegangen sind. Camille zerrt an seiner Hand. Sie will näher. Zu den Skulpturen. Verzauberung und Unglauben.
Maria und Elisabeth.
Das Mädchen vermag nicht in Worte zu fassen, warum es hier verharrt. Welch erlösendes Wort muss sie finden, damit die beiden Frauen zu ihr hinuntersteigen? Ist diese Lebendigkeit aus Stein? Wie sie sich einander zukehren – die junge Maria und die Ältere, die Weise –, kann es nur ein Zauber sein, der über sie geworfen wurde. Immer wieder vergewissert sich das Kind, dass ein Bildhauer sie aus einem Steinblock herausgelöst hat.
Camille schaut Maria ins Gesicht, so wie sie es gewohnt ist, den Nachbarn, den Passanten, dem Fremden ins Gesicht zu schauen, weil die Augen ihr verraten, wie der Mensch ist – böse, streng, freundlich, offen, heuchelnd. Mädchenhafte Verwirrung liegt über Maria und eine große Freude auf die Zukunft. Und doch ist es die Ältere, von der Camilles Blick immer wieder angezogen wird. Die bitteren Falten um ihren Mund sind ihr vertraut. Der Vater muss ihr erklären, wer Elisabeth ist. Die so lang versagt gebliebene Hoffnung auf ein Kind, die Enttäuschung eines gelebten Lebens, das bisher kein Mutterglück kannte, liegen eingegraben um Elisabeths Mund. Doch die Augen sind voller Güte. Ihr war geweissagt worden, dass sie trotz des Alters noch einen Sohn gebären wird. Johannes, den Täufer.
Camille glaubt Elisabeth zu kennen. Vielleicht hat sie Ähnlichkeit mit der alten Victoire, zu der sich Camille stärker hingezogen fühlt als zur Mutter. Wenn Camille sich an Victoires warmen Schoß drängt, wird sie nicht fortgeschoben.
Das in Stein gealterte Gesicht fasziniert Camille.
Des Vaters Erklärungen über den »griechischen Augenblick der gotischen Skulptur«, der in Reims nur von kurzer Dauer war, lassen Camille ahnen, dass eine Fülle von Geheimnissen darauf wartet, von ihr erkannt und durchdacht zu werden.
Neben Maria und Elisabeth steht die Verkündigungsgruppe. Es ist eine andere Maria. Schmalschultrig, im einfachen Gewand, wirkt sie wie eine Fremde vom Land. Ihre Verwirrung über die gute Nachricht verbirgt sie hinter unbeholfener Gebärde. Sie rührt an durch ihr Vertrauen. Es ist nicht das schöne Gesicht, voll Harmonie, Ebenmaß und Feinheit, wie es Michelangelo in seiner »Pietá« schuf. Ihre Züge sind herb und einfach. Camille fühlt sich von diesem Gesicht angezogen, fühlt sich jener Maria nah. Auch in ihrem Inneren ist eine gewaltige Freude auf die Zukunft. Hier – vor diesen Figuren – droht diese Freude sie zu überwältigen. Die stummen Figuren reden mit ihr. Sie versteht die Sprache ihrer Gesten und Blicke. Der lachende Engel prophezeit auch ihr unermessliches Glück. Sie lässt sich anstecken von seiner Fröhlichkeit. Sie greift nach des Vaters Hand und lacht ihn an.
Großes Einverständnis der beiden.
»Ich werde Bildhauer.«
Sie braucht Ton. Viel Ton.
Sie wird Paul modellieren. Die hohe, klare Stirn. Die verträumten Augen, die sich manchmal verschließen können, um nichts von seinem Gefühl preiszugeben. Das Zurückbiegen seines Kopfes, wenn er sich gegen etwas auflehnt. Das scheue Lächeln, wenn er sich der Schwester vertrauensvoll nähert.
Oder Victoire zuerst? Mit ihren Runzeln im Gesicht und dem spitzbübischen Lachen in den Augen.
Jetzt kennt sie einen Ort, wo sie mühelos Ton bergen kann.
Ich werde Bildhauer.
Es gibt Tage, wo sie nicht am Mittagstisch erscheint.
Um nicht gestört zu werden, liegt von innen der schwere Riegel vor dem Scheunentor, erst recht, wenn die Familie einen Verwandtenbesuch plant. Ihr skandalöses Verhalten schürt den Zorn der Mutter.
Bestrafungen werden vom Vater wieder aufgehoben. Morgens, wenn es noch dämmert, verlässt Camille das Haus, um an die Tongrube zu laufen.
9.
Im August 1870 wird der Staatsbeamte Louis-Prosper Claudel nach Bar-le-Duc berufen – ins Hypothekenwesen.
Die Familie zieht um in diese nüchterne, schmucklose Kleinstadt. Strumpfwirkereien. Marmeladenfabriken. Im unteren, unschönen Teil der Stadt liegt die vom Staat zur Verfügung gestellte Wohnung.
Noch ist die Stadt erschüttert von den Kriegswirren.
Juli 1870, der Streit um die Thronkandidatur in Spanien und jene berüchtigte Emser Depesche haben den letzten Anstoß zum Deutsch-Französischen Krieg gegeben. Kaiser Napoleon legt es leichtfertig auf einen Konflikt mit Preußen an. Er möchte die Frankreich bedrohende Herstellung der deutschen Einheit verhindern.
Dabei verkennt er nicht nur das Kräfteverhältnis – er geht auch in die von Bismarck gelegte diplomatische Falle.
Damit läutet die Totenglocke des Zweiten Kaiserreichs.
Der Krieg war über Bar-le-Duc mehrfach hin- und hergewogt. Der Sohn des neuen Nachbarn war in der Nähe, auf einem kleinen Weinberg, erschossen worden, als sie die Deutschen verfolgten. Mit den Claudel’schen Kindern geht der alte Mann bis an die niedrige Mauer aus Feldsteinen, die den Weinberg begrenzt. Immer wieder und immer ausführlicher muss er ihnen erzählen von den Kämpfen und dem Sterben. Diese Schmach, auf eigenem Boden geschlagen zu werden! Hass auf den Kaiser, der dieses Blutvergießen angefangen hat. Und dann am 2. September 1870 die Nachricht – mit der Niederlage von Sedan wurde der Kaiser Napoleon gefangen genommen! Am 4. September spendiert der Vater Sekt – die Dritte Republik ist proklamiert worden. Die Kinder dürfen am Sekt nippen. Ein unvergessliches Erlebnis. Die Mutter verzichtet.
Die Umstellung auf das Leben in der Kleinstadt trifft am stärksten Louise-Athenaise. Gleichsam entwurzelt, lebt sie hier in totaler Bedeutungslosigkeit. Hier ist sie eine von vielen. In Villeneuve war sie privilegiert. Ihr verletzter Dünkel macht sie unnahbar. Auch im Charakter ihres Mannes liegt der Grund, dass die Familie Claudel in den Kleinstädten, in die Louis-Prosper berufen wird, keinen gesellschaftlichen Kontakt pflegt. Die Familie muss sich selbst genügen. Die Frau ist kontaktscheu. Unter Fremden fehlt ihr jegliches Selbstbewusstsein. Und Louis-Prosper als Lothringer wird später von seinem Sohn folgendermaßen beschrieben: »Mit mürrischem Gesicht steht er bei Gesellschaften herum, um sich plötzlich mit groben Ausfällen oder hintergründigen Bemerkungen am Gespräch zu beteiligen.«
So konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Familie auf sich selbst und bedeutet »Hölle für jeden«. Jeder in der Familie ist Opfer und Henker zugleich.
Streitpunkte neuer Art entstehen in Bar-le-Duc. Das Geld. Die Frau, gewohnt, gut zu kochen, aus dem Vollen zu schöpfen in Villeneuve, muss hier für teures Geld Fleisch und Gemüse kaufen. Ständiger Vorwurf des Mannes – Verschwendungssucht. Verschwendung ist aller Laster Anfang. »Er ist geizig wie Judas.« Er gibt ihr nicht so viel Wirtschaftsgeld, wie sie bräuchte. »Soundso viel monatlich. Mehr nicht.« In den späteren Dramen von Paul so aufgearbeitet.
Verbitterung schnürt Louise-Athenaise die Kehle zu. Ihre Verbitterung wird allumfassend. Ihr Los ist es, nicht geliebt zu werden, denn der Mann liebt sie nicht.
Zufrieden in Bar-le-Duc scheint der Vater zu sein. Seine Tätigkeit zieht ihn in die äußere Welt. Er lebt in einer Atmosphäre, der die Frau fernbleibt, die er nach Hause mitbringt, die ihn umschließt wie eine undurchdringliche Hülle. Die Frau bleibt allein – »aus der Vernachlässigung wächst dumpfe Unzufriedenheit«. So Pauls Erinnerungen.
Louis-Prosper, der sich der Schönheit, der Sensibilität und der Aufgeschlossenheit seiner Kinder erfreut, wünscht ein Familienfoto. Was in ihrem Ermessen steht zu verhindern, was der Mann wünscht, wird Louise-Athenaise tun. Sie will kein Familienfoto, das die Familie Claudel in Eintracht und Stolz auf die Kinder darstellt. Sie will nicht heucheln. So geht der Vater allein mit den Kindern zum Fotografen. Rechts neben ihm steht Camille, links Louise, auf dem Schoß hält Louis-Prosper den vierjährigen Paul in Mädchenkleidern – wie es damals üblich war. Am freundlichsten schaut der Vater, am aufmerksamsten und von dem Wunder des Fotografierens fasziniert Camille, trotzig und verschlossen Louise, die Mutter vertretend, Paul scheu und anrührend. Ein paar Jahre später geht der Vater nur noch mit Camille zum Fotografen. Mit seinem Arm umschließt er ihre Schulter – seine kleine Gefährtin, sein selbstbewusstes, kluges Kind.
Am unbekümmertsten stellen sich die Kinder auf die Kleinstadt um. Voll kindlichem Optimismus und Zuversicht nehmen sie das Leben, wie es sich ihnen bietet. Es zieht sie nach draußen. Vor allem wenn Markttag ist.
»Ein Markt ist eine Art Pfingstfest. Eine tägliche Darbringung der guten Dinge unserer Erde. Und der heilkräftige Duft aus der Apotheke, den ich ganz vergessen habe. Ein Markttag wäre nicht vollständig ohne einen bittersüßen Abstecher zum Arzneihändler …
Wie hübsch ist es in einer kleinen Stadt, wenn man aus der Messe kommt und kommuniziert hat und dann die Kaufleute sieht, die ihre Läden öffnen, und überall die taumelnden Schreie der Schwalben inmitten der österlichen Freude hört. Die Luft ist ein wenig grau, aber es ist ein unwirkliches Grau; gleich erscheint die Sonne, sie blickt in alle Scheiben und schüttelt sich vor Lachen.« Die Jahre in den Kleinstädten – sie liegen verklärt in Pauls Erinnerungen.
Hier in Bar-le-Duc besucht Camille die Schule der Schwestern der kirchlichen Lehre. Zugleich öffnet ihr der Vater seinen Bücherschrank, um diese kirchliche Wissensvermittlung aufzubrechen und zu erweitern. Feierlich überreicht er ihr das Buch »Das Leben Jesu« von Ernest Renan, dessen antiklerikale Haltung ihn so befriedigte. Jetzt sollen es die Kinder lesen. Camille verschlingt es. Es ist ihr eine Lust, den kirchlichen Hokuspokus zu verspotten. Bei ihren Reden ist sie sich der Billigung ihres Vaters sicher. Sein Stolz auf sie lässt ihre Worte kühner werden.
Von der Art, wie Renan Jesus beschreibt, ist sie begeistert. Sohn eines Zimmermanns und seiner Frau Maria, ohne unbefleckte Empfängnis. Ein Jesus, dem auch kein Gott erscheint als ein außerhalb seines Bewusstseins stehendes Wesen, der Gott aus seinem Herzen schöpft. Ein Jesus, der sich in seiner herrischen Willenskraft für allmächtig hält. Dem der Ruf des Wundertäters aufgezwungen wird. Der eine ungeheure soziale Umwälzung fordert, wo Rang und Stand umgekehrt werden, wo nicht Reiche, Gelehrte oder Priester das Sagen haben, sondern das Volk. Demütige, Niedrige. Ein Jesus, der das Reich Gottes als die Herrschaft der Armen auffasst. Der die Frömmler verurteilt, ihren äußerlichen Rigorismus, die ihr Heil von bloßen Zeremonien erwarten. Das Buch ist eine Offenbarung für Camille.
Sie steckt alle mit ihrem Atheismus an – sogar die Mutter. Nur Paul schweigt zu Camilles Reden. Stets geht er aus dem Zimmer, wenn Camille ein Kapitel zu Ende gelesen hat und mit ihren öffentlichen Interpretationen beginnt. Seine kindliche Seele dürstet nach einem Mystizismus, der nichts erklärt haben, sondern sich im Geheimnisvollen verlieren will.
Bar-le-Duc hat ein Museum. Mit römischen Skulpturen. Befremdet steht das Mädchen vor ihnen. Sie gefallen ihr nicht. Sie reden nicht. Man weiß nicht, was sie fühlen. Man sieht – sie sind nur aus Stein. Glatt und leer, Imitationen von Kopien. Die Lebensnähe und Lebensgewalt der griechischen Kunst fehlt ihnen. Das Mädchen urteilt intuitiv. Es weiß noch nicht um den Unterschied zwischen römischer und griechischer Kunst. Aber es steht in seinem Urteil im Gegensatz zum Zeitgeschmack, der die römische Antike als Ideal empfindet, dem es nachzuahmen gilt. In das Museum geht sie nur ein Mal.
10.
Die Zeit in Bar-le-Duc ist geprägt von Gesprächen über die Ereignisse in Paris. Die Kommune. Pro und Kontra innerhalb der Familie.
Der aufgeschlossene Louis-Prosper steht einigen ihrer Ideen wohlwollend gegenüber. Louise-Athenaise fürchtet um ihren Besitz. Im Streit der Eltern bilden sich die Kinder ihre eigene Meinung. Worte aus Paul Claudels erstem Drama »Goldhaupt«, die ein Fahnenflüchtiger an die Prinzessin richtet: »Ihr tut rein gar nichts! Ihr seid bloß Luxusvieh! Warum sind manche Leute mehr als die anderen? Warum haben sie alles, was sie nur wollen, so viel sie essen und trinken wollen, und wir haben nichts? Vielleicht soll ich Ziegel fressen, was? … Kann man vom Hunger leben? … Wer lässt denn das Korn und den Roggen wachsen? Wer erntet? Wer drischt? Wer mahlt? Wer macht es – das Brot? … Und der Erzeuger des Brotes – ist der nicht so viel wert wie das Brot selbst? Nicht einmal das Recht hat er, einen Brocken davon für sich zurückzubehalten …!«
In dieser Zeit modelliert Camille eine Büste von Bismarck. Sie ist nicht erhalten. Nie fotografiert. Zu Staub zerfallen. Was bewog das Kind, was wollte es ausdrücken? Abscheu? Hass auf den fremden Eroberer?
Hatte nicht Bismark wesentlichen Anteil an der Zerschlagung der Pariser Kommune? Als er von den Ereignissen des 18. März erfuhr, bot er der Regierung Thiers, die nach Versailles geflüchtet war, zur Niederschlagung der Revolution die Hilfe der deutschen Okkupationstruppen an. Eine Büste für den Vater?
Bei allem patriotischen Gefühl bewahrt sich Louis-Prosper dennoch Objektivität. Er zollt Bismarck als Kanzler Hochachtung, weil er innenpolitisch die katholisch-klerikale Opposition bekämpfte. Er hatte in Preußen ein neues Gesetz erlassen, nach dem die Schulaufsicht den staatlichen Instanzen übergeben und katholische Ordensangehörige vom öffentlichen Schuldienst ausgeschlossen wurden. Es wurde ein Gesetz angenommen, das die Tätigkeit des Jesuitenordens und seiner Kongregationen verbot. Der Staat übernahm in den folgenden Jahren die Aufsicht über die Ausbildung der Geistlichen und behielt sich das Recht zu ihrer Ernennung selbst vor. Damit wurde die Gewalt der höheren kirchlichen Würdenträger über den niederen Klerus und über die Gläubigen eingeschränkt.
Maßnahmen, die in Frankreich erst nach der Jahrhundertwende eingeführt wurden.
Mit dem französischen Schulwesen ist der Vater unzufrieden. Ab 1876 verpflichtet er für seine Kinder einen Hauslehrer, ein Freidenker wie er.
Eine Erinnerung nimmt Camille aus der Kindheit mit – Trauma der Kleinstadt –, Frauen, die sensationslüstern die Köpfe zusammenstecken. Eine Skandalgeschichte, ungeheuerlich, brennend neu, tuschelnd weitergegeben. Belastend für das Kind die Worte der Mutter: »Was die über uns zu reden haben!« Geschürt wird Heimweh. Heimweh nach ihrem Haus in Villeneuve. Von Paul später kritisch resümiert: »Das Haus, das im Schutze seines großen Daches jenen Leuten gleicht, deren Ehrgeiz im Leben darin besteht, nicht aufzufallen. Es ist wie ein Obdach für Leute, die sich nur bei sich selbst wohlfühlen, von Familien, die sich mit einer wilden Anhänglichkeit gegen das Außen zur Wehr setzen, die die öffentliche Meinung zugleich fürchten und verachten, die sie herausfordern und zugleich zu besänftigen suchen durch ein Gemisch aus peinlicher Höflichkeit und sichtbarer großer Nachlässigkeit.«
An solchen Tagen gibt es in der Dämmerung Stunden, in denen Camille und die Mutter Erinnerungen an Villeneuve heraufbeschwören.
Der herbe Duft der schweren Erde.
Die kleine Kirchhofmauer mit den überhängenden Bäumen.
Die Häuser mit ihren weiß gekalkten Giebeln und in den Gärten die hingebreitete Wäsche zum Bleichen.
Das Geräusch, wenn der tauende Schnee auf dem Kirchdach zu rutschen beginnt.
Die bunte Katze, die der Großvater heiliggesprochen hat, weil sie innerhalb von sechs Wochen den weiten Weg von Soissons zurückfand und plötzlich wieder in der Küche stand.
Die Linde vor dem Haus. Schlafraum der Vögel, betäubendes Geschrei in der Zeit, in der sich Hund und Wolf begegnen.
Der Himmel, der sich in den Wasserlachen spiegelt und in den offenen Tonnen, die in den Gemüsegärten stehen. »Bar-le-Duc hat keinen Himmel!«, stellt Camille eines Tages fest. Durch die Häuserzeilen verkürzt, erscheint er abgeschnitten in eintönigem Grau. Der Himmel von Villeneuve ist weit und wild. Von Violett bis Orange. Von Dunkelgrau bis hin zu einem unglaublich getufften Weiß.
Das sind Stunden, in denen Mutter und Tochter sich nahe sind. Stunden, aus denen Camille das Vertrauen schöpft und die Zuversicht, dass die Mutter auch sie liebt. Stunden, die für die Frau ohne Erinnerung bleiben, die nur das Heimweh des Augenblicks schüren oder lindern.
Mit dem Vater kann keine der beiden über Villeneuve reden. Er kennt die Geheimnisse nicht der einsamen Felsen, die die Mutter zu benennen weiß – jene versteinerten Riesen, die die unheimliche Steppe bevölkern. Die Geschwister sind zu klein. Sie haben Villeneuve in seiner Einmaligkeit noch nicht entdeckt.
Die Frau, die sich einsam und verloren fühlt in der fremden Stadt, schließt sie sich in den Stunden großer Verzagtheit der älteren Tochter an? In Camille wächst das erhebende Gefühl, mit der Mutter eng verbunden zu sein.
11.
Ferien in Villeneuve.
Kühle Frische des Morgens. Der beginnende Tag ist voller Verheißung. Camille will zu den Felsen. Dorthin, wo die Bäume vereinzelt stehen, groß und einsam, wo in den Senken sich niedrig das Tannendickicht duckt.
Wenn Paul in der fremden Stadt bat, erzähl mir etwas, verwob Camille gerade Gelesenes mit ihren Erinnerungen an Villeneuve. Sie machte Paul weis, dass die Felsen von Chinchy zu Stein gewordene Lebewesen seien. Das Ungeheuer Medusa hielt sich in einer der Grotten versteckt. Riesen hatten den Kampf aufgenommen. Der Riese Géyn. Höchster Felsen. Weiblein kamen ahnungslos und ohne Arg. Sobald Medusa ihr schlangenumwobenes Haupt zeigte, versteinerten Mensch und Tier. Camille will sich überzeugen, dass ihre fantastische Geschichte nicht abwegig ist.
Aus der Ferne dringt ein Schrei zu ihr. Hell und spitz. Ihr Name wurde gerufen – in Not. Paul.
Camille rennt ins Dorf zurück. Die ersten Gehöfte von Villeneuve. Sie sieht die Jungen des Dorfes, die einen Kreis gebildet haben. Eingeschlossen in diesen Kreis – Paul, der kleine Bruder. Zart, hilflos, versponnen wie er ist, weiß er sich nicht zu wehren. Er lässt sich von einem zum anderen stoßen. Von Weitem noch schreit Camille: »Lasst ihn in Ruhe!« Ihre Augen sprühen vor Zorn und Verachtung.
»Feiglinge, ihr Feiglinge! Sich an einem Kleineren zu vergreifen!« Sie stürzt auf den Kreis zu, der sich widerstandslos öffnet. Bevor sie Pauls Hand ergreift, stößt sie den größten der Jungen mit solcher Kraft, dass er zu Boden fällt.
Man wehrt sich nicht.
Ganz Villeneuve spricht von Camilles Augen. Blau, geschmolzener Stahl – so empfinden es die einen. Für die anderen sind es zwei schöne blaue Augen, aus lauterem, fast schwarzem Blau, wie die Trauben zur Zeit der Lese. Scheu und wild zugleich. Ihr Haar ist von dem dunklen Glanz aufgesprungener Kastanien. Wenn sie es nur mit einem Band hält, fällt es in natürlichen Locken auf die Schulter. Doch die Mutter achtet darauf, dass es streng zu einem Zopf geflochten wird. Ihr kindlicher Körper, ebenmäßig und zart, leugnet das bäuerliche Blut der Thierrys. Auch Louise ist ein hübsches Mädchen. Doch früh liegt auf ihrem Gesicht ein Zug von Hochmut.
In jeden Ferien gibt es die gleichen Kontaktschwierigkeiten mit den Kindern des Dorfes, unter denen Louise und Paul zu leiden haben. Nicht weil sie die Jüngeren waren. Keiner der Jungen im Dorf trägt an einem gewöhnlichen Sommertag eine gebundene Schleife – wie Paul heute. Ihre Hemden sind offen, mitunter schmutzig, manchmal zerrissen. Auch Camilles Aufzug wirkt abenteuerlich. Ferien in Villeneuve bedeuten für sie ein Ausmaß an Freiheit und Ungebundensein. Aus dem Versteck in der Scheune hat sie ihre Schätze geholt – die einem Cousin entwendeten Überziehschuhe, den vom anderen Cousin abgeschwatzten Sweater und die von Victoire, der Haushälterin, erbettelte Kleiderschürze – ausgeblichen, gestopft, herrlich weit. Ihre Arbeitskleidung, wenn sie modelliert.
Die Kinder des Dorfes lachen über Pauls Schleife und über Louises Rüschenkleid.
»Du hast gesagt, du nimmst mich mit!« In Pauls Stimme zittert der Vorwurf.
»Nun gehen wir ja zusammen!«
An manchen Tagen möchte Camille allein sein – so wie an diesem ersten Ferienmorgen. Ungestört und unbeobachtet will sie begrüßen, was ihr vertraut ist. Nun rührt sie die Anhänglichkeit des Bruders. Sie bleibt stehen, bindet ihm die lächerliche Schleife ab und steckt sie in die Schürzentasche. Paul protestiert schwach. Die Mutter möchte, dass er die Schleife trägt, damit der Standesunterschied im Dorf gewahrt bleibt.
»Du gehst doch nicht zur Schule!«
»Nimmst du mich mit in die Grotte?«, fragt Paul mit banger Neugier. Camille nickt.
»Dort ist mein Baum!«, sagt sie und seufzt. In diesem Moment ist sie Pauls Anwesenheit leid.
»Unser Baum!«, verbessert Paul. Auch seine Hand fährt liebkosend am Stamm entlang. Die Wurzeln umgeben den Baum wie eine Krone. Ein Erdrutsch hat sie freigelegt. Jetzt vermag man auf ihnen wie auf einer Bank zu sitzen. Paul weiß, wenn Camille verschwunden ist – nach einem hässlichen Streit mit Louise oder der Mutter –, dann sucht sie bei diesem Baum Zuflucht. In der Stadt hat sie ihm von dieser Eiche ein trostreiches Märchen erzählt.
»Ein Baum ist mir Vater gewesen und Lehrer. Manchmal als Kind überfiel mich bitterlich finsterer Missmut – da wurde mir jede Gesellschaft ein Gräuel, die gemeinschaftliche Luft zum Ersticken. Und ich musste in die Einsamkeit, heimlich dort diese Schwermut pflegen und fühlte, wie sie wuchs in mir. Und ich bin diesem Baum begegnet und hab ihn umarmt.« Pauls Worte.
Der weiße Sand beginnt. Camille zieht ihre Galoschen aus und ihre Strümpfe. Sie lässt den Sand unter sich aufwolken. Nur die oberste Schicht ist von der Sonne erwärmt. Darunter fühlt es sich kühl an. Es riecht nach Heidekraut. Zu einem leuchtenden Lila waren die winzigen Glocken erblüht. Bienen summen – angelockt von der Farbe. Paul fürchtet sich vor ihnen. Stumm bittet er um Camilles Zauberspruch, der die Gefahr bannt. Camille macht weitausholende, streichelnde Bewegungen. Mit leichtem Singsang in der Stimme ruft sie: »Schöne, schöne! Liebe, liebe! Fleißige Biene!«
So werden die Kinder nicht gestochen.
Paul folgt ihr.
Vor ihnen liegt ein ganz mit Heidekraut und weißem Sand überdeckter Hügel. Ungetüme Blöcke, fabelhaft gestaltete Felsen heben sich ab. Sie gleichen vorsintflutlichen Tieren, unentwirrbaren Denkmalresten, Götzenbildern mit falsch aufgesetzten Köpfen und Gliedern …
Paul verliert sich in Betrachtung dieser sagenhaften Welt. Plötzlich wird ihm bewusst, dass Camille verschwunden ist. Noch nie entfernten sich die Kinder allein so weit vom Dorf. Bisher waren sie immer nur bis zum Fünfwegekreuz am Leidenshügel gekommen.
Paul entdeckt Camilles Spur, die zur Grotte führt und darin verschwindet.
»Camille, wo bist du?« Seine Stimme – ein angstvolles Flüstern. Es bleibt still. Nur der Wind in den Birken ist zu hören. »Camiiiille, bist du da? Camiiiille, du sollst antworten!«
Lebt in der Höhle wirklich jenes Ungeheuer?
Camille fürchtet sich vor nichts. Sie wagt Dinge, bei denen andere vergehen vor Angst.
Aus der Grotte dringt ihr erstickter Ruf:
»Ich bin zu Stein geworden. Rette mich!«
Angst lähmt den Jungen. Was er zu tun vermag, ist, sich in den Sand zu werfen, die Füße anzuziehen, sich so klein wie möglich zu machen und den Kopf in den angewinkelten Armen zu vergraben.
Wieder hört er Camilles Ruf. Tiefer presst er sich in den Sand. Der Ruf wird ein Flehen. Die Medusa wird auch ihn versteinern, wenn er Camille zu Hilfe kommt. Bange Minuten, Totenstille.
Etwas berührt seinen Kopf. Camilles nackter Fuß. Sie lacht ihr raues zärtliches Lachen. Sie wirft sich auf ihn und schüttelt ihn. »Du hast mich nicht erlöst! Angsthase, du!« Sie versucht ihn auf die Seite zu drehen.
»Du hast mich einfach allein gelassen. Wir wollten immer füreinander einstehen!«
Paul bleibt stumm und steif.
»Es gibt keine Medusa! Steh auf!«
Paul schämt sich seiner Angst und seiner Feigheit. Immer fällt er in seiner Gutgläubigkeit auf Camille herein.
Da springt er plötzlich auf, greift nach einem Stock, trockener Ast, vom Wind heruntergeschlagen, und pflanzt sich vor dem Riesen Gen auf.
»Camille, ich beschütze dich. Hab keine Angst! Der Riese wird dir nichts tun!«
Er steht in Drohhaltung, fixiert das steinerne Ungeheuer und wartet auf dessen Angriff. Camille kneift die Augen zusammen und betrachtet den Bruder, der sich seiner Feigheit schämt und wiedergutmachen will. Er hält den Stock erhoben. Winzig und schmal steht er vor dem Koloss. David. David und Goliath. Das ist es.
Wieder ist diese seltsame Erregung da, die ihr fast die Luft abschnürt. So wird sie es machen. Nicht diese Gewaltstatue des David, wie sie Michelangelo schuf. Zart und zerbrechlich – ihr kleiner David, beseelt von Mut und Entschlossenheit. Vor ihm Goliath – erdrückend in seiner Größe, selbstsicher, voll Spott und Mordlust.
Paul mit dem Stecken in der Hand, nicht nur seine Schwester verteidigend, gewillt, ein ganzes Volk zu retten. »Komm, wir müssen nach Hause! Du musst mir Modell stehen – so wie jetzt!«
»Dauert es wieder so lange?«
»Sicher.«
»Ich will aber nicht!«
»Du musst. Basta. Nun komm. Ich erzähl dir eine Geschichte. Jetzt holen wir Erde …, und dann mache ich etwas Neues – etwas ganz Großes – wie ein richtiger Bildhauer!«
»Du bist aber keiner! Und du wirst nie einer, sagt Mama, weil du ein Mädchen bist und Kinder kriegst und deinem Mann gehorchen musst!«
»Mama weiß das nicht. Das bestimme ich allein! Und ich sage dir – ich werde Bildhauer!«
»Wirst du nicht! Du bist ein Mädchen!«
Das Blau in Camilles Augen wird so zwingend, dass Pauls Widerspruch verstummt. Die Schwester soll nicht so etwas Großartiges werden. Er ist der Junge. Ihm steht so etwas zu.
»Und ich werde nach Paris gehen!«
Jetzt hatte sie ihren sehnlichsten Wunsch zum ersten Mal ausgesprochen. Aus vagem Wunschtraum hat sie jetzt einen Beschluss gemacht. Paul hat ihn gehört, die Felsen, der Wind – die Welt. Sie geht nach Paris. »Du nicht, du nicht, du nicht!« Paul schreit in verzweifelter Auflehnung. Sie wird ja immer verrückter, immer maßloser in ihren Ansprüchen. Mit ihm wollte der Vater nach Paris. Dem Großvater gehört in Bellefontaine ein Gut, auf dem er die Ziegelei »Augeat« hatte bauen lassen, die fünfundzwanzigtausend Tonziegel fassen konnte. In der Nähe liegt die Tongrube. Von dort holen jetzt Paul und Camille die rote Erde.
Dort steht ein wilder Rosenstrauch. Um Pauls inneren Widerstand und Groll zu erweichen, fragt sie scheinheilig: »Weißt du, was für ein Strauch das ist?« Paul schüttelt den Kopf. Seine Augen bekommen den erwartungsvollen hungrigen Blick – hungrig nach Wundern.
»Das ist der flammende Dornbusch. Und hier liegt mein Ton … Und was sagt dir das?«
In Pauls Augen tritt heiliger Schreck. Die Gnade Gottes, der in einem Dornbusch wohnt, als er sich Moses zeigte, ihn aufflammen ließ, ohne ihn zu verbrennen – hat hier für Camille den Ton bereitgelegt?
Nun hat Camille ein wunderbares Mittel in der Hand, den Kleinen immer wieder an den roten Dornbusch zu schicken, um ihr den nötigen Ton herauszuschleppen.
In Villeneuve ist Louise-Athenaise aufgelebt. Das Gefühl von Souveränität kehrt zu ihr zurück. Hier wird sie gebraucht.
Camille hat die Mutter erschöpft gesehen von dieser Haus- und Gartenarbeit, mit der sich die Frau abrackert, deren Notwendigkeit Camille begreift.
Wenn die Johannisbeeren reifen, werden sie eimerweise gepflückt. Sie werden zu Gelee und Most verarbeitet. Äpfel und Mirabellen müssen ebenfalls gepflückt werden. Sie werden in die Keltereien gebracht, und man erhält dafür Wein.
Manchmal sitzt die Mutter auf einem Stuhl – ganz in sich zusammengesunken, blass. Die Augen geschlossen. Tiefe Ringe werden plötzlich sichtbar. Sie gönnt sich nicht ausreichend Schlaf. Die Hände liegen müßig im Schoß. Es sind nur wenige Minuten, die die Mutter so verbringt. Camille stürzt in ihr Zimmer, um Papier und Stift zu holen. Sie möchte die Mutter malen. Diese tiefe Enttäuschung um den Mund, die sich in dem Moment großer Erschöpfung preisgibt. Arme Mama!
Beim Malen ist Camille der Mutter nah und von tiefem Mitgefühl für sie erfüllt. Als die Mutter unerwartet die Augen aufschlägt und Camille erblickt, die sie zeichnet, springt sie ungehalten auf und reißt der Tochter das Blatt Papier aus der Hand. Ein für alle Mal untersagt sie Camille, sie zu zeichnen. Den Moment ihrer Schwäche will sie nicht festgehalten wissen. Obwohl das begonnene Porträt zerknüllt im Feuer des Herdes landet, sind es Augenblicke, in denen sich Camille von der Mutter widerstandslos vor einen Johannisbeerstrauch setzen lässt, den sie bis zum Abend leerzupflücken hat.
Dann geschieht es, dass der Vater Camille in seine Bibliothek ruft, um sie an einen neuen Autor heranzuführen. Goethe. Shakespeare. Wenn die Mutter den vor dem Strauch vereinsamten, fast leeren Eimer findet und Camille zur Pflicht ruft, scheint der Mann auf diese Aufforderung gewartet zu haben, um mit kränkenden und verletzenden Worten für die Frau – dass es zwischen Himmel und Erde noch etwas anderes gäbe als Gelee und Kochtöpfe – Camille in ihrem Recht zu lesen zu bestärken.
Vor den Kindern geschmäht zu werden trifft die Mutter. Es trifft auch Camille, die sich für den Vater schämt, dass er sich an der Würde seiner Frau vergreift. Die Mutter tut ihr leid. Sie nimmt sich vor, am nächsten Morgen den Frühstückstisch zu decken.
Camille empfindet den Vater in manchen Situationen als ungerecht. Nicht immer akzeptiert sie sein Inschutznehmen. Sie spürt, dass er die Mutter kränken möchte – für ihr Desinteresse an seinen Büchern, für ihr amusisches Verhalten.
Eines Tages fordert die Mutter, Louise müsse Klavierunterricht nehmen. Diese Tochter soll Camille nicht nachstehen. Bereitwillig stimmt der Vater zu. Louise soll Pianistin werden. Gegen diesen Anspruch hat er nichts einzuwenden. Louise klimpert nun eifrig auf dem Klavier herum. Sie braucht ebenfalls kein Gemüse zu putzen. Louise darf bei Feierlichkeiten in der Schule der Schwestern vorspielen. Dafür braucht sie ein neues Kleid.
Wenn Louise am Klavier sitzt, ordentlich gekämmt, sauber und adrett angezogen, schaut Camille bewundernd zu, wie die Finger ihrer Schwester über die Tasten gleiten. Dann wird der Unterschied zu ihr augenscheinlich. Sie selbst in schmutziger Kittelschürze, gelöstem Haar, in den Galoschen des Cousins. Mit einem Finger kann Camille ebenfalls ein Lied auf dem Klavier spielen – von dem Mädchen in den Holzpantinen, das von einem Königssohn geliebt wird.
Sowie sie den Finger auf die Tasten setzt, beginnt Louise die Mutter herbeizuschreien.
Es ist Camille untersagt, das Klavier zu berühren.
Der Vater hat Camille die Werke des schottischen Dichters Macpherson herausgestellt – meisterhafte Nachahmungen alter Volkspoesie mit Anklängen an die Bibel, Homer und Milton. Paul bettelt schon am frühen Morgen: Lies mir vor!
»Vater der Helden, o Trenmor!
Hoher Bewohner wirbelnder Winde, wo der Donner schwarzrot die sich ballenden Wolken durchzuckt,
öffne deine stürmigen Hallen!
Lass kommen die Barden der Vorzeit,
lass sie sich nah’n mit Gesängen
und ihren halb unsichtbaren Harfen.«
Paul versenkt diese Worte gleichsam in seinem Inneren. Er nimmt den Rhythmus in sich auf, bewahrt ihn. Er scheint wieder hervorzubrechen, als der Mann selbst zur Feder greift.
»Im Namen des Donnerhalls und bei der Schwefelzunge des rosigen Blitzstrahls!
Bei dem Gespann der Winde und ihrem Rädergeroll über die aufhüpfenden Massen brüllender Wälder!
Beim Winter mit dem Sturm, der die Bäume krümmt und die Welten von Wolken jagt …«
Louise spürt die Missbilligung der Mutter den Geschwistern gegenüber. Wenn der Vater nicht da ist, macht sie sich ein Vergnügen daraus, die beiden in ihren Verstecken aufzuspüren und zu verpetzen.
Dann trollt Paul zu seinem anderen Zufluchtsort, wo die Welt für ihn heil ist und voller Aufmerksamkeit. Zum Großvater. Dieser weiß bereits um seine Krankheit. Magenkrebs. Ein qualvoller Tod erwartet ihn. Doch wenn Paul bei ihm ist, er seine Augen sieht, die noch alle Wunder der Welt für möglich halten, dann mag es den alten Mann drängen, in den Enkel zu versenken, was seinem eigenen Leben Wert und Sinn gegeben hat. Wie ein Märchen erzählt er ihm die Familiengeschichte, die Jahrhunderte zurückreicht. Und plötzlich tauchen Details auf, Bilder, Erinnerungen, die Paul kennt, die nicht nur in früheren Zeiten, die auch heute noch im Dorf, in der Familie eine Rolle spielen. Der Kleine fühlt sich mit einbezogen in die Geschichte. Ein Gefühl von Tradition entsteht. Ein Sendungsbewusstsein, dass er etwas fortzuführen habe. Paul nickt ernsthaft: Ich werde alles aufschreiben. Ich werde Schriftsteller.