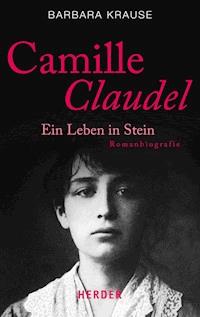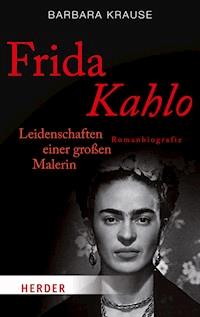
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Frida Kahlo ist eine der großen, starken Frauen des letzten Jahrhunderts, die gegen alle Konventionen lebte. Das Malen war Obsession und Kraft zugleich, sie litt unter den Schmerzen ihrer körperlichen Behinderung. Es sind Bilder voller Intensität sie spiegeln das faszinierende Leben der surrealistischen Malerin wider. Ihr Leben ist auch die Geschichte ihrer großen Liebe zu Diego Rivera, einer Liebe, so kompliziert, fesselnd und intensiv wie ihr ganzes Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Krause
Frida Kahlo
Leidenschaften einer großen Malerin
Romanbiografie
Impressum
Titel der Originalausgabe: Frida Kahlo. Leidenschaften einer großen Malerin. Romanbiografie
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Nickolas Muray
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80888-3
ISBN (Buch): 978-3-451-06812-6
1.
Der Windhund unter der Sonne, er jagte über das sonnendurchglühte Fruchtland. Unter der weißen Hirtin war er kühlend über ihre offenen Wunden gestrichen. Kleines Wild, von Pfeilen durchbohrt. Immer verletzt. Niemals erjagt. Diego hatte sie gegen Morgen gefunden. Er hatte sie auf dem Lager der Eidechsen und Salamander entdeckt. Er hatte sich ihrer angenommen. Pore um Pore. Berührungen. Zärtlichkeit. Glück, das ihr die Wangen netzte. Ihr Herz klopft noch immer vor Erregung und Angst. Angst vor neuen Wunden. Angst, die stets an wahnsinnige Freude gefesselt ist. Angst und Freude – Zwillinge, die einen gemeinsamen Lebensnerv hatten. Furcht vor Diegos vertrauensvoll anmutender Mitteilsamkeit, wenn er von Charme und Grazie und Schönheit anderer Frauen erzählte, wenn er auf Ausführlichkeit verzichtete und nur einen Frauennamen erwähnte. Dann brachte Fridas Fantasie die quälendsten Szenen zustande.
Im Traum wurde es Frida bewusst, dass tausende Kilometer Ozean zwischen Diego und ihr lagen. Nur ein Traum konnte ihre Sehnsucht nach Diego stillen. Sie hatte Diego im Arm gehalten, und er war ihr Kind geworden. Den Geschmack seiner unwahrscheinlich weißen, zarten Haut trägt sie noch immer auf den Lippen. Sie hatte ihn gewiegt. Und er hatte ihr das wunderbare Gefühl geschenkt, seine Mutter zu sein. Er hatte es genossen, wie ein Kind in ihren Armen zu liegen. Diego hatte sie glauben gemacht, dass er sich nur in ihrer Liebe selbst zu begreifen vermag und die Welt, dass er nur durch ihr Dasein in das Universum eingehen kann. Sie sollte sich den Traum aufschreiben und ihn Diego schicken.
Ungewohnte Geräusche in der fremden Wohnung. Defektes Rauschen einer Wasserspülung. Das kurze Aufweinen eines Kindes, das gleich wieder abbricht. Unterdrückter Husten von Jacqueline aus dem Nebenzimmer. An die Fensterscheiben schlägt schon die ganze Nacht der Regen. Nicht auf die Uhr schauen. Europa ist unfreundlich. Der Januar in Paris ist trist. Sich nicht vom Wetter abhängig machen. Sich einreden, dass sie Regen liebt. Auch nicht den Ärger über Breton hochkommen lassen, der nicht das Geringste für ihre Ausstellung vorbereitet hatte. Große Worte damals in Mexiko. Versprechungen. Er hatte Frida gepriesen als seine überraschende Entdeckung – eine mexikanische Surrealistin, die in Paris Triumphe feiern werde. Frida hatte schon damals nicht viel auf sein Lob gegeben. Anders Diego. Er hatte Bretons Worte in sich aufgesogen, um sie überall zu wiederholen, sie in der ihm eigenen Weise auszuschmücken, Bretons Lob zu ergänzen und zu interpretieren … Sie hatte Diego längst durchschaut.
Die Atemzüge des kleinen Mädchens sind plötzlich verstummt. Frida schaut zu dem Kind hinüber, mit dem sie die enge Kammer teilt. Das Kind hat sich unter der Bettdecke versteckt. Es hat sich ein kleines Luftloch geschaffen, durch das es die fremde Frau mit einem verängstigten Spähblick zu beobachten scheint. Auf Verdacht lächelt Frida hinüber und macht mit der Hand die winzige Geste eines Grußes. Jäh verschwindet die Öffnung. Fridas Französisch ist so miserabel, dass sie keinen vernünftigen Satz für das Kind zusammenstellen kann. Sogar der Name des kleinen Mädchens ist ihr entfallen. Jacqueline hatte ihn übersetzt – ein neuer Tag beginnt.
Nichts hatte André vorbereitet. Nicht einmal die kleine Tochter vorgewarnt, dass in ihrem Zimmer auf dem Fußboden Besuch einquartiert werde. Die Matratzen hatten sie um Mitternacht vom Boden geholt. Stuhl und Tischchen hastig vor das Fenster geräumt, als wenn nicht seit Wochen der Tag von Fridas Ankunft in Paris festgestanden hätte. Der Zug hatte Verspätung gehabt. Niemand hatte am Bahnhof auf sie gewartet. Frida wollte sparsam in Paris leben, so hatte sie versucht, Bretons Wohnung mit der Metro zu erreichen. Beim ersten Umsteigen hatte sie kapituliert und sich ein Taxi genommen. Der Taxifahrer hatte sich von ihrem exotischen Erscheinungsbild beeindrucken lassen. Er hatte sie wie eine aztekische Prinzessin behandelt. Es war ein seltsames Haus, in dem die Bretons wohnten. Eigentlich Hinterhaus, zu dem es kein richtiges Vorderhaus gab und Frida sich mit dem Taxifahrer, der ihr Gepäck trug, durch eine übel riechende, dunkle Durchfahrt tasten musste. Die Bretons hatten kein Namensschild an der Tür. Der Mann lauschte an den Wohnungstüren und klopfte tatsächlich an der richtigen.
Frida war todmüde gewesen. Ihr sehnlichster Wunsch war, ein Bad zu nehmen und zu schlafen. Die Wohnung besaß kein Bad. Also schlafen. Die Matratzen lagerten auf dem Hausboden. Dann stellte sich heraus, dass das Schloss der Kammertür defekt war. Frida konnte nicht einmal die Tür hinter sich schließen. Natürlich liebte sie Kinder. Aber das musste sie nicht in den Nächten der kommenden Wochen beweisen. Sie hätte weinen mögen. Auf die Anteilnahme der Bretons hatte Frida keine Lust einzugehen, nachdem André sie auf die Frage nach ihren Bildern lachend beruhigen wollte, dass diese beim Zoll bestens aufgehoben wären. Eine geeignete Galerie müsste erst noch gefunden werden. Und Frida hatte geglaubt, sie käme nach Paris, um ihre Ausstellung zu eröffnen. André Breton hatte sich mit Arbeit entschuldigt. Um sein Vielbeschäftigtsein zu beweisen, hatte er noch drei Stunden nach Mitternacht im Wohnzimmer verbracht, an seinem Schreibtisch. Das Licht seiner Tischleuchte fiel direkt auf den Spalt der Kammertür. Und dieser Spalt hatte sein Licht unmittelbar auf Fridas Kopfkissen geworfen. Jede geschriebene Seite las Breton sich mit verhaltener Stimme vor, deutlich akzentuierend, dem Klang des gesprochenen Wortes nachlauschend. Hinzu kam der quälende Husten von Jacqueline, deren Echo sich die Wände der schlecht beheizten Wohnung unablässig zuwarfen.
Der »Papst des Surrealismus« war im vorigen Jahr nach Mexiko gekommen, vom Ministerium zu einer Vortragsreise entsandt. Seine Frau, die zauberhaft blonde Jacqueline, hatte ihn begleitet. Ihr hatte sich Frida sogleich freundschaftlich verbunden gefühlt, zumal die andere auch Malerin war. Breton selbst hatte Frida in seiner Selbstherrlichkeit und Arroganz nicht sonderlich gemocht. Gerührt hatte Frida die überschwängliche Begeisterung, die Breton ihren Bildern entgegenbrachte. Er verstieg sich zu der Behauptung, Mexiko sei der eigentliche Ort des Surrealismus. Auf den gemeinsamen Ausflügen sah Breton in jedem kahlen Felsgestein, in den trunkenen Blüten der Floripondien, in der Wortkargheit der Indios, in den an der Kirchenwand aufgestellten Votivbildern den Beweis der Sur-Realität.
… »Nie hatte ich einen Klumpen roter Erde in meiner Hand gehalten, der die Statuetten von Colima – halb Weib, halb Grille – göttlich geschminkt, entstiegen sind. Und schließlich hatten auch meine Augen sie nie erblickt, die den Statuetten so überaus gleicht, in der Haltung und im Schmuck einer Märchenprinzessin, mit magischen Kräften in den Fingerspitzen, im Lichtstrahl des Vogels Quetzal, der, wenn er davonfliegt, Opale auf den Felskanten zurücklässt: Frida Kahlo de Rivera.«
In dieser seiner Begeisterung, der Begeisterung des Europäers, des Angereisten, in seiner Überheblichkeit, den von ihm kreierten Surrealismus in der mexikanischen Natur und Tradition entdecken zu wollen, fand Frida einen Grund, den Surrealistenfürsten, diese Lokomotive des Unbewussten, zu belächeln. Seine Theorien und seine Manifeste, die er Frida vermachte, hatten sie gelangweilt.
Sie muss auf die Toilette. Der Körper schmerzt. Mit ihrem Fuß hat sie Mühe aufzustehen. Frida humpelt durch das Wohnzimmer. Sie hört den »Fürsten« allgewaltig schnarchen. Im Spiegel erblickt sie eine übermüdete Frida. Augenränder. Ihr offenes schwarzes Haar lässt ihre Haut noch durchscheinender wirken als sonst. Diego liebt ihr langes dunkles Haar, das sie aufsteckt und mit Blumenkronen schmückt in der Art überlieferter Indio-Traditionen. Wenn sie einmal die Kraft gefunden haben sollte, sich von Diego scheiden zu lassen, wird sie sich ihr Haar wieder kurz schneiden. Wie schon einmal … Als die Sache mit Christina passierte …
Das Wasser stürzt mit Getöse in den Behälter. Der Schnarchton setzt für kurze Zeit aus. Jetzt schaut Frida doch auf die Uhr. Zehn Minuten nach sieben. Wenn sie in San Angel wäre, würde sie aufstehen und frühstücken. Diese neue Freiheit, die sie hier in Europa üben und sich beweisen will, besteht zunächst in der Unfreiheit, in die enge dunkle Kammer zurückzuschleichen, sich auf dem Fußboden zusammenzurollen und zu warten, dass die Gastgeber erwachen. Das Kind schläft wie ein Engel. Es hat sich aus der Betthöhle befreit. Die Wangen sind gerötet. Das Haar ist nassgeschwitzt und lockt sich um Stirn und Schläfen.
Aube – jetzt ist Frida der Name des Kindes eingefallen. Kleine Aube – Verpflichtung im Namen. Beginn. So sollte auch Frida es sehen. Für sie beginnt ab heute ein neues Zeitalter. Unabhängigkeit. Die Kapsel ihrer Angst ist gesprengt. Sie hat sich frei gemacht. Sie ist in Europa angekommen. Sie hat die Reise ohne Diego unternommen. Es geht um ihre Ausstellung. Ihre erste Ausstellung in Europa. Es geht nicht um Ruhm und Anerkennung. Wer sie kennt, weiß, wie unwichtig ihr der Erfolg ist. Es geht um ihre verdammte Selbstständigkeit. Und die erreicht sie nur über ihre Bilder.
Regen. Wenn der Regen nicht wäre. Der Regen mit den schlechten Assoziationen. Am Tag ihrer Geburt hatte der Himmel geweint. Der kalte Morgen des 6. Juli. Sie hatte es sich von Mati erzählen lassen. Mati verfügte über wenig Fantasie. Die kargen Erinnerungsfetzen der großen Schwester reichten jedoch aus, sich mit Konsequenz vom Tag ihrer Geburt loszusagen und sich den darauffolgenden Tag, den siebenten Juli, auszusuchen und an ihm Gratulationen und Glückwünsche entgegenzunehmen. Wenn es am Tag ihrer Geburt nicht geregnet hätte … Wenn sich in ihrer Vorstellungswelt Regen nicht mit Trauer und Tränen verbunden hätte … Die traurig-trostlose Vorstellung der deutschen Romantik. Der Himmel hatte das Schicksal des Neugeborenen beweint.
Zwei kleine Mädchen kauerten ungekämmt und ungewaschen unter der gemeinsamen Bettdecke. Sie lauschten auf das Wimmern und die Schreie der Mutter. Niemand fragte sie, ob sie Hunger hätten. Niemand drang darauf, dass sie sich endlich anzögen. Die Schreie der Mutter wurden gellender. Die neunjährige Matilde beschloss halblaut, nie Kinder zu bekommen. Ich auch nicht – bekräftigte Adriana, die fünf Jahre alt war. Ein verfluchter Tag – dieser sechste Juli. Die spontanen Wünsche der beiden Schwestern an diesem 6. Juli finden grausame Erfüllung. Sie schwitzten in ihrer Betthöhle und hielten sich die Ohren zu. Dann unerwartete Stille, der sie misstrauten. Der Schrei wie von einem heiseren Papageien. Vier Kinderbeine schoben sich aus dem Bett. Auf Zehenspitzen näherten sie sich dem Schlafzimmer der Eltern. Großmutter Isabel hatte nicht Auge noch Ohr für sie. Ihr gegerbtes, zerfurchtes Gesicht hatte die vertraute Güte und Aufmerksamkeit verloren. Es war von Sorge entstellt. Der Tod stand am Bett der Mutter.
Betet, dass eure Mutter am Leben bleibt!
Eine fremde Frau, die das Neugeborene bündelt, erlöste die beiden von der Spannung. Ihr habt ein Schwesterchen bekommen! Maßlose Enttäuschung. Die beiden hatten einen Bruder gewollt. Schwestern waren sie selber und Stiefschwestern hatten sie obendrein. Es war kalt im Haus. Eisiger Wind presste sich durch Türen und Fenster. Die Mädchen froren. Sie flohen in ihre Betthöhle zurück.
Lieber Gott, mach bitte, dass wir nicht ins Waisenhaus müssen! Lieber Gott, lass die Mutter nicht sterben!
Der Vater hatte am Fenster gestanden. Er konnte keinen Gott um Beistand bitten. Er glaubte nicht an ihn. Auch er hatte Frida später, als er an ihrem Krankenbett saß, den Morgen ihrer Geburt geschildert. Was nach den Tagen anhaltender Hitze wie Labsal gewirkt, was in den Nächten mit friedlichem Rauschen schläfern gemacht hatte, weitete sich an jenem 6. Juli zu einer ungeheuren Trostlosigkeit aus. Die letzten Jasminblüten waren von Wind und Regen abgeschlagen. Die braune Erde des Innenhofes verwandelte sich in eine unansehnliche Pampe, die den Mann an Hundekot erinnerte. Der Himmel beweinte hemmungslos und unbeherrscht, was an diesem Tag im Haus von Coyoacán geschah.
Frida hatte das gnadenlose Bild ihrer Geburt vor einigen Jahren gemalt. Malen müssen. Das Bild, das jetzt ebenfalls beim Zoll herumstand. Ihre Geburt – abgestellt und verstaubt in den fensterlosen Lagerräumen einer fremden Behörde, unter einem trommelnden Regen.
Frida hatte einen kahlen, leeren Raum gemalt. Ein Bett nur. Darauf eine Tote, die ein Kind gebiert. Das Gesicht der Frau ist mit einem weißen Tuch zugedeckt. Der Kopf des Kindes, das Fridas Züge trägt, liegt auf dem durchbluteten Laken. Der Körper steckt noch im Mutterleib. Über dem Bett hängt das Bild der schmerzensreichen Mutter, »durchstoßen mit den sieben Dolchen des Schmerzes, die den Aufriss möglich machte, aus dem das Kind Frida kommt«, und die Tränen weint über das, was unter ihr geschieht. Die Tränen des Himmels. Die auf den unteren Bildrand gemalte Banderole, auf die bei Votivbildern freundliche Bitten oder Danksagungen geschrieben wurden, hatte Frida leer und unbeschrieben gelassen. Für diesen Tag hatte sie sich nie bedanken wollen. Den Betrachter sollten Kälte und Einsamkeit anspringen und dunkle Vorahnungen streifen. Sie hatte in ihrem Leben viel Zeit gehabt zu grübeln, wann es seinen Anfang genommen haben könnte, dass sie eine Gefangene ihrer Einsamkeit geworden war. Die glückhaften Momente der Einheit schürten nur den Schmerz der Trennung. Soweit sie sich zurückerinnern kann – immer das Gefühl, ausgestoßen zu sein, abgesondert, herausgelöst, vereinzelt.
Ungeliebt, weil sie den Tod in die Nähe der Mutter gelockt hatte. Immer musste sie nach Zuwendung schreien. Es reichte bis an den verfluchten Tag ihrer Geburt zurück. Regen. Nacht. Das Baby schrie. Niemand schien es zu hören, niemanden zu stören. Lieber Gott, mach, dass wir nicht ins Waisenhaus müssen. Lass die Mutter nicht sterben! Mit diesen gemurmelten Worten waren die beiden großen Schwestern in den Schlaf gefallen. Das Baby schrie. Versuche, sich in Erinnerung zu bringen, seine Forderungen nach Liebe und Zuwendung anzumelden. Man hatte seine Wiege in das entlegenste Zimmer gestellt. Wach wurde Mati, die Neunjährige.
Der Regen schlug an das Fenster. Feuchtigkeit drang durch das Mauerwerk. Musste ein Baby die Nacht über schreien? Großmutter und Vater hatten nur Sorge um die Mutter. Sie verließen kaum das Krankenzimmer und wechselten sich ab, am Bett zu wachen. Das Baby schrie, weil es allein war. Sollte das Baby bestraft werden? Wenn die Mutter sterben würde, wäre es seine Schuld? Die kleine Matilde versuchte, wieder einzuschlafen. Am nächsten Tag sollte eine Milchfrau kommen, eine Amme, damit das Baby nicht verhungerte. In der letzten Bibelstunde hatte der Katechet über Barmherzigkeit gesprochen. Man musste dem Nächsten helfen, so viel man vermochte. Die Neunjährige war aufgestanden und hatte sich durch die Zimmer getastet bis hin zu dem Wesen, das unerwünscht in diesem Hause schien. Mit sanftem Streicheln berührte sie das Gesicht, das sich heiß und feucht anfasste. Das Köpfchen fuhr suchend herum. Die Lippen ertasteten einen Finger von Mati und begannen zu saugen. Das Schreien verstummte. Matilde zog erschrocken ihre Hand fort. Das heisere Papageiengeschrei begann von neuem. Mati nahm das Baby vorsichtig in ihre Arme und wiegte es. Sie war barfuß und begann zu frieren. Ihren Zeigefinger überzog sie mit dem Ärmel des Nachthemdes und überließ ihn dem saugenden Mund. Unentschlossen stand sie an der Wiege. Ein Gefühl von Mütterlichkeit durchströmte sie in heißen glücklichen Wellen. Mit dem Baby auf dem Arm ging sie langsam in ihr eigenes Bett zurück.
Am nächsten Morgen herrschte unter den Erwachsenen Aufregung. Fragen. Beteuerungen. Hektik. Großmutter Isabel erschien im Kinderzimmer. Das Neugeborene war verschwunden. Die Amme war erschienen. Doch das Baby war fort. Matis Bettdecke wölbte sich seltsam. Die Großmutter zog der Schlaftrunkenen die Decke fort. Fast erstickt, hochrot, aber schlafend – im Schlaf die Wärme der Schwester fühlend – das Baby. Man schimpfte mit Mati. Ihr wurde verboten, künftig die Schwester aus der Wiege zu nehmen. Sie könnte ihr aus dem Arm fallen und Schaden nehmen. Nahm die kleine Frida keinen Schaden, wenn sie Tag und Nacht nach Zuwendung schrie?
Ein Luftzug streift Fridas Gesicht. Jäh richtet sie sich auf. Das Mädchen stürzt an ihr vorbei. Auf der Flucht vor etwas Furchtbarem. Das lange Nachthemd bis zu den Knien gerafft, um im Davonlaufen nicht behindert zu werden. Frida hört ihren unterdrückten Aufschrei und Jacquelines besänftigende Abwehr. Aube scheint aus einem Albtraum erwacht zu sein. Ein Wort wiederholt sich ständig – le pied. Der Fuß. Frida schaut an ihren Matratzen entlang. Siedend heiß steigt ihr die Röte ins Gesicht. Scham und Verlegenheit. Und Zorn über die Zumutung der Bretons, sie in der Kinderkammer miteinquartiert zu haben. Ihr hässliches Geheimnis! Jahrelang gehütet, eitel versteckt, geschickt verborgen – an diesem Pariser Morgen ragt es aus der Bettdecke heraus. Verkrüppelt und entstellt, Halt gefunden in Eisenschienen, blutverkrustet.
Frida zieht die Bettdecke über ihren Kopf, presst die Füße an ihren Körper, versucht, sich klein zu machen, unsichtbar. Sie sehnt sich nach Diego. So verharrt sie eine geraume Weile, bis sie zu ersticken droht. Wut und Entschlossenheit überkommen sie. Sie wirft das Bett zurück. Jetzt ist egal, dass ihr als Gast nicht zusteht, in der fremden Wohnung als Erste aufzustehen. Sie will die Gelegenheit nutzen, im Moment mit niemandem die Kammer zu teilen und in Ruhe ihren verkrüppelten Fuß unter dem langen Tehuana-Rock zu verstecken. Die meisten ihrer Röcke haben den breiten weißen Spitzen- oder Plisseevolant. So schreibt ihn die Tracht vor. Ungeeignet für dieses mistige Pariser Regenwetter. Frida überlegt, ob sie es sich leisten könnte, ein Hotelzimmer zu nehmen. Ein billiges. Aber mit Bad. Oder sie fährt sofort zurück. Sie kann ohne diese Pariser Ausstellung leben.
In der Toilette starrt Frida angeekelt in das Waschbecken. Abgesetzte Schmutzränder vergangener Tage und Wochen. Ein Stück Seife, auf dem schwarze Schaumbläschen erstarrt sind. Frida sucht nach einem Lappen und einem Scheuermittel. In einem flachen Pappkarton, der sich vor Feuchtigkeit aufplustert, findet sich etwas, das wie Scheuersand anmutet. Sie opfert ihr Taschentuch, um damit das Becken zu reinigen. Mit einiger Zufriedenheit betrachtet sie die weiß gewordene Emaille. Dann lässt sie sich Wasser einlaufen und macht sorgfältige Morgentoilette. Sie scheitelt ihr Haar in der Mitte, flicht sich zwei Zöpfe, die sie wie eine Krone über dem Kopf zusammenlegt. Aus ihrer kleinen Schmuckschatulle wählt sie die Ohrgehänge aus mit den schwarzen und weißen Tropfen. Andere Frauen machen sich zum Ausgehen für den Abend zurecht, wie es Frida jeden Morgen für den Tag tut. Der Tag ist ihre Lebenszeit. Der Abend bedeutet für sie in der Regel Schmerz und Erschöpfung.
Als sie an Bretons Schlafzimmer vorbeigeht, ruft Jacqueline sie mit heiserer Stimme an: Hallo, Frida! Schon auf? Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen. Vielleicht findest du in der Küche etwas zu essen! Fühl dich wie zu Hause! Ich stehe auch bald auf. Ihr Englisch klingt drollig. Aber Frida ist jedem dankbar, der nicht Französisch mit ihr spricht.
Frida will Briefe schreiben. Trotzdem schaut sie in die Küche. Ein vernünftiger Mensch muss morgens etwas essen. Sie kapituliert vor der Unordnung, den sich im Ausgussbecken stapelnden Töpfen, die wegen angebrannten Essens voll Wasser stehen. Auf dem Tisch türmen sich Berge benutzten Geschirrs. Angetrockneter Käse auf dem Küchenschrank. Schimmelndes Brot vor dem Küchenfenster.
Das halte ich nicht aus … das halte ich nicht eine Woche aus. Was mutet mir Diego zu?
Frida kramt in ihrem Gepäck nach einer Kekspackung, aus der zerkrümelte Reste rieseln. Sie verzieht resigniert das Gesicht. Irgendwo muss eine halbe Tafel Schokolade versteckt sein. Ein Brief von Diego fällt ihr in die Hände. Er ist vom Dezember. Er hatte ihn ihr nach New York geschickt. Das Papier war zusammengeknüllt und wieder geglättet worden. Frida faltet es auseinander.
Mein kleines Mädelchen,
Du hast mir so viele Tage lang nicht geschrieben, und ich bin ganz unruhig geworden … Sei bloß nicht albern und lass Dir um meinetwillen nicht die Chance entgehen, Deine Bilder in einer Pariser Galerie auszustellen. Nimm vom Leben alles, was es hergibt, was immer es auch bieten mag, vorausgesetzt, es ist interessant und macht Dir Freude. Wenn man einmal alt ist, weiß man, was man verpasst hat, weil man nicht zur rechten Zeit den Verstand hatte, die Gelegenheiten zu ergreifen. Wenn Du mir wirklich etwas Gutes tun willst, dann merk Dir, dass Du mir keine größere Freude machen kannst, als wenn ich weiß, Du bist froh. Und, mein Kleines, Du verdienst wirklich jede Freude … Ich kann niemandem böse sein, wenn er diese Frida mag, denn ich mag sie doch auch, und zwar mehr als alles in der Welt …
Dein Unkenfrosch Nr. 1 Diego.
Wieder hat sie Lust, den Brief zu zerknüllen und ihn in den Kehricht zu werfen. Jeder Satz eine Ermahnung, eine Erziehungsmaßnahme, eine Reglementierung, eine Rechtfertigung seiner selbst. Und trotzdem mit jedem Wort Diego, den sie liebt. Er fordert sie auf, das Leben anzunehmen, es in vollen Zügen zu genießen – wie er es tut, weil er sich nichts versagen kann. Er zeigt sich sogar bereit, ihre Liebschaften zu tolerieren. Diese Großzügigkeit schmerzt. Zu so viel Verständnis ist er nur imstande, wenn er ein schlechtes Gewissen hat. Ansonsten ist er von schießwütiger Eifersucht. Aus einem winzigen Nebensatz zieht Frida Kraft und Hoffnung. Sie legt ihre Hände auf das Papier und schließt die Augen … mehr als alles auf der Welt. Diego liebt sie mehr als alles auf der Welt. Ihr großer, unförmiger Unkenfrosch. Die Wärme seiner Zuneigung spürt sie durch den kalten Januarregen. Die Entfernung ist aufgehoben. Diego, ich werde den Traum von heute Nacht malen – später … Das Universum wird die Erde umarmen. Auf dem Schoß der Erde werde ich sitzen und dich in meinen Armen halten und Du, niño mio, hältst die ewige Flamme in deinen Händen. Ich werde dir das dritte Auge des Verräters auf die Stirn setzen – warum hast Du mich nach Paris geschickt?
2.
Gegen halb zehn wird stürmisch an die Tür geklopft. Da sich im Schlafzimmer der Bretons nichts rührt, geht Frida öffnen. Sie steht einem fünfzigjährigen Mann gegenüber, groß, schlank, hohe intelligente Stirn, mit sichtlicher Überraschung im Blick.
Madame Rivera?
Er stellt sich mit Marcel Duchamp vor. Der Mann ist eine elegante Erscheinung. Mantel mit Pelzkragen. Ein ins Gesicht gezogener Hut. Als er ihn abnimmt dunkles, zurückgekämmtes Haar. In Fridas Kopf beginnt ein verzweifeltes Suchen nach einer Zuordnung. Der Name Duchamp verbindet sich mit etwas Geheimnisvollem, mit der Negation der Kunst. Der Maler, dessen Experimente zur Aufhebung seines Berufes als Künstler führten.
Maler? –, fragt sie. Was müsste ich kennen?
Duchamp lächelt auf die unnachahmlich nachsichtige Weise eines Gymnasialprofessors.
Mona Lisa Gioconda mit Bart … Akt, eine Treppe hinabsteigend. 1922 deswegen großer Trubel auf der New Yorker Armory Show. Es wäre jedoch verzeihlich, wenn es sich nicht bis nach Mexiko herumgesprochen hätte.
Frida erinnert sich der lächelnden Gioconda mit dem spitz aufwärts gebogenem Oberlippenbart und dem dünn angesiedelten Spitzbart. Eine Collage aus den frühen zwanziger Jahren. Duchamp bringt den Duft frischen Brotes mit in den kleinen Flur. Fridas Hunger lässt sich kaum mehr unterdrücken. Sie suchen beide nach einer Möglichkeit, Duchamps regenfeuchten Mantel zum Trocknen aufzuhängen. Duchamp ist älter als Breton. Er wird auch älter als Diego sein. Die Krähenfüße unter den Augen verraten ihn. Er spricht ein gutes Englisch. Auf Fridas Verwunderung hin erklärt er, dass seine Lebensgefährtin Amerikanerin sei. Er geht mit Frida ins Wohnzimmer und schließt mit Nachdruck die Tür. Als wäre er der Hausherr, bietet er ihr Platz an. Frida starrt auf seine Hand. Sie mag nervig lange Hände, behaart und mit kräftigem Druck. Diegos Hand ist klein, fast weibisch mit zarter Alabasterhaut. Auch Diegos Händedruck ist fest. Was würde sie darum geben, diese über alles, über alles geliebte Hand zu liebkosen. Offensichtlich ist Duchamp von Frida beeindruckt.
Verzeihung … Sie sind mit Ihrer Mutter angereist? Warum fragen Sie? Meine Mutter ist 1932 gestorben. Duchamp lächelt verlegen. Ihn quält Unsicherheit.
Sind Sie die Tochter der Malerin? Riveras Tochter? Nein. Ich bin seine Frau. Ich bin Frida Kahlo.
Der Mann lacht seltsam glucksend auf. Erleichtert. Kopfschüttelnd zugleich.
Ich kenne Rivera. Aus seiner Pariser Zeit vor zwanzig Jahren. Er lebte damals mit einer Russin zusammen und hatte mit ihr einen Sohn. Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht mit alten Geschichten verletzen und auch nicht aufdringlich sein … Der Sohn müsste älter sein als Sie. Es ziemt sich nicht, Sie nach Ihrem Alter zu fragen …
Frida lacht. Nein, das ziemt sich nicht.
Seit sie Diego kennt, gibt sie das Jahr 1910 als ihr Geburtsjahr an. Nicht, um sich drei Jahre jünger zu machen. Nein – um als Kind der Revolution zu gelten. 1910 – das Jahr, in dem der bewaffnete Aufstand gegen den Diktator Díaz begann. Eine Revolution, die ihren Zustrom aus der Bauern- und Partisanenbewegung von Pancho Villa und Emilo Zapata gefunden hatte. Ihr Wunsch war es gewesen, ein Kind der Revolution zu sein. Warum soll Frida sagen, dass sie zwei Jahre über dreißig ist, wenn man sie auf Mitte zwanzig schätzt. Dass sie sich uralt fühlt, weiß nur sie allein.
Duchamps Anteilnahme, seine Sorge um ihr Wohlbefinden tun Frida wohl. Er verspricht ihr, sich um ihre Bilder zu kümmern. Er erklärt sich bereit, Frida noch heute auf das Zollamt zu begleiten, wenn es ihr recht wäre.
Bretons Löwenkopf erscheint im Türrahmen. Ich rieche Croissants!
Er wird immer fetter –, denkt Frida, deren kühler Blick ihn streift. Sein dunkelblondes volles Haar, auf eine Länge geschnitten und nach hinten gekämmt, fällt ihm jetzt wirr an den Schläfen herunter. Mit der ihm typischen Geste fährt er mit der Hand durchs Haar, um es zurückzustreichen. Vor gut einem Jahr war sie ihm in Amerika das erste Mal vorgestellt worden. Ein eleganter, gutaussehender, stattlicher Mann. In seinem Schlafanzug wirkt er unappetitlich … Sie muss ja nicht mit ihm schlafen!
Breton merkt, dass sein Auftritt unerwünscht ist. Er schließt wieder die Tür. Eine laute Aufforderung geht an Jacqueline, Kaffee zu kochen.
Sie sind das erste Mal in Europa? Duchamp rettet sich in Konversation. So belanglos die Frage, so beredt sein Blick. Frida übt auf ihn eine fast magische Anziehung aus. Ihr seltsam verschleierter Blick, der ganz andere Dinge zu sehen scheint als die Unordnung in Bretons Wohnzimmer, der unwahrscheinliche Schmelz von Jugend und Reife, von Begehren und Verzicht. Das Talent einer Frau, das den Sprung über den Ozean geschafft hat, weckt unbezähmbare Neugier in ihm.
Ja … nur Paris war nie das Ziel meiner Wünsche.
Frida steht auf und stellt sich vor das Fenster. Diese verdammten Rückenschmerzen! Der Regen war lautloser geworden. Schneekristalle haben sich unter ihn gemischt. Perlenketten hängen an den schwarzen glänzenden Zweigen der Bäume. Sie vermögen die negativen Assoziationen nicht aufzuheben. Frida zieht das große wollene Umschlagtuch enger um ihren Körper. Es ist nicht sehr warm im Zimmer. Der Mann starrt auf ihre fast knabenhafte Figur, deren schmale Hüften den langen Rock kaum zu halten vermögen. Ein exotischer Rock. Sie mutet in ihm an wie ein fremder Schmetterling.
Mein Vater ist Deutscher … Pforzheim … Baden-Baden …
Jude? Duchamp hatte seine Stimme gesenkt. Er scheint erschrocken über seine Frage und hebt abwehrend die Hände, um sie an einer Antwort zu hindern.
Ja. Mein Vater ist Jude. Mein Großvater kam aus Österreich-Ungarn. Er war Juwelier. Mein Vater ist als sehr junger Mann nach Mexiko ausgewandert … Er ist Atheist. Aber das würde wohl heute in Deutschland nicht interessieren.
Sie wollen Deutschland keinen Besuch abstatten?
Ich habe dort nichts verloren. Vor Jahren wollte ich meiner Jugendliebe nachreisen, die vor mir bis nach Europa geflohen war.
Frida lacht. Es liegt keine Bitterkeit in ihrer Stimme.
Sie haben einen deutschen Vornamen.
Nun nicht mehr! Als Hitler an die Macht kam, habe ich das e aus meinem Namen streichen lassen … Allerdings hat mein Vater mir seine deutsche Gründlichkeit vererbt, obwohl ich ihn als Kind deswegen oft aufgezogen habe. Mein Vater ist ein wunderbarer Mensch. Er hat sehr viel Verständnis für mich gehabt.
Frida haucht an die Fensterscheibe, malt eine kleine Tür, wischt sie sofort wieder weg. Duchamp hat die Erinnerung an ihren Vater geweckt. Er begreift, dass die junge zerbrechliche Frau gewohnt ist, in Einsamkeit zu leben. Sie beschwört sich eine Welt herauf, zu der er keinen Zugang hat. Sie vermag das Zimmer mit Erinnerungen aufzufüllen und so ihr Alleinsein aufzuheben.
Als sehr kleines Mädchen hatte sie eine stumme, scheue Zuneigung zu dem Vater gehegt, der sich selten um seine vier Töchter gekümmert hatte. Doch es passierten Dinge mit ihm, meist bei hereinbrechender Dunkelheit, die der kleinen Frida Angst gemacht hatten, die ihr unverständlich blieben. In ihrer kindlichen Fantasie warf ein böser Zauberer seinen Fluch über den Vater. Der Böse erschien alle drei bis vier Wochen, um ihren Vater zu strafen. Der Unheimliche schlich im Schutze der späten Abende in das Haus, sodass Frida ihn nie zu Gesicht bekam. Er fiel den Vater von hinten an und warf ihn nieder. Er tat ihm weh, denn der Vater wand und krümmte sich. Schaum trat vor seinen Mund. Frida und Christina, die beiden jüngsten Kinder, wurden aus dem Zimmer geschickt. Am Abend des Inquisitors galten keine der üblichen Regeln. Nur eine Order gab es – zu verschwinden. Die Mutter hatte zu tun, den Bösen zu vertreiben. Aus dem ruhigen, beherrschten Vater wurde etwas beunruhigend Wehrloses. Die Peitsche geißelte ihn erbarmungslos. Frida bekam Angst. Sie kroch zu Mati ins Bett und wartete auf die größere Schwester, obwohl die Mutter das verboten hatte. Frida wollte nicht neben der schlafenden Christina liegen, deren Sorglosigkeit sie verletzte, die die Unheimlichkeit dieser Abende unberührt ließ. Am nächsten Morgen taten alle so, als wäre nichts geschehen. Der Vater war freundlich und ausgeglichen wie immer. Frida hatte Scheu vor ihm. Es dauerte Tage, bis sie diese verlor. War der gespenstische Abend vergessen, wiederholte er sich. Wieder und wieder.
Mein Vater hatte einen Unfall in Deutschland … Auf seltsame Weise hat sich das Unglück in Mexiko wiederholt. Die Sonne war explodiert. In seinem Leben und in meinem. Vielleicht hat uns das in den schlimmen Jahren so eng aneinander geschmiedet. Frida wendet sich wieder dem Mann zu, dessen ungeteilte Aufmerksamkeit ihr gilt.
Er kann mit ihren spärlichen Worten nichts anfangen, sie in keinen Zusammenhang setzen. Ehrfurcht verbietet ihm, Neugier zu zeigen und nachzufragen. Doch sein Blick gleicht einem wunderbaren Gefäß, das all ihre Worte, Andeutungen, Erinnerungsfetzen aufnehmen wird, bewahren, bis sich das Geheimnis dieser Frau erahnen lässt. Es wird an die Tür gestoßen. Duchamp springt auf, um sie zu öffnen. Jacqueline erscheint mit einem Tablett. Sie trägt einen hellblauen Morgenmantel. Ihr blondes Haar ist frisch frisiert. Die Locken neu aufgesteckt. Tiefe Wellen kunstvoll um den Hinterkopf gelegt. Es umgibt sie der angenehme Duft eines zarten Parfums.
Ma chère, comment as-tu dormi? Bonjour Marcel!
Es ist ein raues Flüstern. Jacqueline stellt das Tablett ab und küsst beide auf die Wangen.
Aube schiebt sich hinter ihrer Mutter in das Zimmer. Mit unverhohlener Neugier starrt sie auf Fridas Rock. Frida schiebt ihre Hände bis auf die Knie. Einmal hatte ihr Lupe den Rock hochgerissen. In einem Anflug flammender Eifersucht. Frida war gerade eine Woche mit Diego verheiratet gewesen, und er war zwei Jahre von Lupe geschieden. Diesen Krüppel hat er mir vorgezogen! Schaut sie euch an! – hatte Lupe gerufen, blitzschnell nach Fridas Rocksaum gegriffen und ihn ihr fast über den Kopf geschleudert.
Jacqueline fährt ihrer Tochter mit der Hand über das Haar. Sie hatte einen Albtraum! Frida soll ein ausgestopftes Eisenbein haben. Duchamp und Jacqueline lachen pflichtschuldigst bei dieser Vorstellung. Die Kleine geht schmollend aus dem Zimmer. Sie weiß, was sie gesehen hat.
Ich habe ihr das Bild zeigen müssen, wo Frida mit Trotzki tanzt.
Frida trägt ihre langen Röcke nicht aus Gefallsucht. Natürlich kleidet sie sich Diego zuliebe in der Tehuana-Tracht. Er sieht in ihr das Urbild der Mexikanerin und möchte in dieser Illusion mit ihr leben … Diego ist nicht in Paris. Sie versteckt unter dem langen prachtvollen Rock der Indio-Frauen ihr entstelltes Bein. An Abenden, an denen sie besonders ausgelassen scheint und sich überreden lässt zu tanzen – sind ihre Schmerzen unerträglich. Sie verlacht, sie vertanzt den Schmerz, um plötzlich von Diego ohnmächtig aus dem Raum getragen zu werden.
Das Kaffeewasser kocht gleich. Honig und Konfitüre?
Frida nickt. Jacqueline streicht ihr über die Wange und wirft ihr ein winziges verschwörerisches Lächeln zu. Frida erwidert es. Als die Bretons in Mexiko waren, haben sich die beiden Frauen mit eben diesem Lächeln aus den Gesprächsrunden der Männer gestohlen, weil sie vor Langeweile umkamen. Jacqueline verschwindet wieder in der Küche.
Wer fährt heutzutage freiwillig in das faschistische Deutschland –, sagt Duchamp, um ihr karges Gespräch nicht ganz versickern zu lassen.
Der Hohn ihres Lebens … Die Revolution, als deren Kind Frida immer gelten wollte – diese Revolution hatte die Familie fast an den Bettelstab gebracht. Unter dem Diktator Porfirio Díaz war Wilhelm Kahlo, Guillermo, – wie er sich in Mexiko genannt hatte, als Fotograf zu Ansehen und Geld gekommen. Er hatte Regierungsaufträge erhalten, die das Feigenblatt des Diktators waren, sich als guter Mexikaner aufzuspielen und die Bauwerke einheimischer Traditionen wie die Monumente der Kolonialarchitektur fotografieren zu lassen. Ahnungslos hatte der junge Deutsche der Regierung Hinweise geliefert, wo die Schätze des Landes lagen, die an die ausländischen »Wissenschaftler« verkauft wurden. Der Vater hatte das Land seiner Träume bereist, die Zeugen seiner mystischen Geschichte auf Platten gebannt und gut bezahlte Bilderserien zusammengestellt.
Ihr Vater ist Juwelier?
Duchamps Frage lässt Frida verwirrt aufschauen. Sein Blick liegt auf ihren Händen. Fast an jedem Finger trägt sie einen Ring. Massives Gold. Kunstvoll verarbeitet. Seltene Steine, fast jeder ein Symbol.
Nein. Kunstfotograf. Der Großvater war Juwelier. Mein Vater sollte das Geschäft übernehmen … sicherlich. Er wurde nach Nürnberg geschickt. Die Stadt sei berühmt gewesen für die Herstellung von Blattgold. Ich glaube, mein Vater war ein Träumer. Er träumte schon damals von Mexiko. Er wollte auf den Spuren Humboldts wandeln. Dieses Land war seine heimliche Liebe … Er hat mir diesen verhängnisvollen Tag oft erzählen müssen … Freiheit bedeutete für ihn auch, reiten zu können. Reiten habe ich mir stets vorgestellt als die Umsetzung, Freiheit leben oder erleben zu können. Unabhängigkeit. Dahinfliegen. Zeit aufheben und alle Grenzen. Vergangenheit hinter sich lassen. Zukunft gewinnen. Lauer Wind, gesättigt von Lindenblütenduft … Lindenblütenduft – diesen Verzicht muss ich wohl leisten … Ich hätte gern einmal unter einem Lindenbaum gestanden … Es gibt ein so wunderschönes deutsches Lied … Unter einer Lindenallee hinwegreiten … Reiten … Eins werden mit dem Tier. Über die Erde fliegen. Der Traum meines Vaters. Mein Traum. Weite gewinnen. Entfernungen schrumpfen lassen. Die Leichtigkeit genießen, Ziele zu gewinnen. Die Verwirklichung des Traums. Meine schönsten Träume lebe ich in der Fantasie. Es ist ungeheurer Gewinn. Was in die Vergangenheit gefallen ist, lebt sowieso nur in der Erinnerung. Was spielt es für eine Rolle, ob das Erlebnis in der Fantasie oder in der Wirklichkeit stattgefunden hat … Ein weißes Pferd. Eine Araberstute. Die Farbe des Fells so makellos, dass es nur einem Märchen entstiegen sein kann …
Breton erscheint in der Tür, trägt einen Hausanzug aus braunem Samt, mit einem losen Blatt Papier in der Hand.
Mir ist heute Nacht das Gedicht in die Hände gefallen, das mir Peret vor einigen Jahren gewidmet hat. Ich hatte es völlig vergessen. Ich muss es euch vorlesen. Dann frühstücken wir.
Wie ein professioneller Komödiant stellt er sich in den Türrahmen, das Blatt mit ausgestreckter Hand weit von sich haltend und rezitiert in seiner ihm eigenen, leicht affektierten Sprechweise:
Die Gazellen haben ihr Gedächtnis getätschelt / aus ihm löst sich ein Tross / ein schönes bloßes Gesicht / ein Gefährt dessen Ohren horchen horchen horchen / und vor Langweile sterben / Die Langeweile gehätschelt in kostbarsten Wintergärten / entfaltet sich zum Anführer der Piraten / Ich unter ihnen.
Beifall oder Zustimmung erheischend schaut Breton auf Frida und Duchamp. Frida greift ungeniert nach einem der Croissants. Duchamp hatte sich bemüht, Frida die Verszeilen leise ins Englische zu übersetzen.
Ich werde nicht aus Langeweile, sondern aus Hunger Pirat – sagt Frida trocken. Sie weiß, dass diese Feststellung Bretons Selbstgefälligkeit verletzt. Doch aufgeräumt gesteht der Surrealistenfürst ein:
Señora, Sie haben recht! Solche Verse gehören nicht an den Frühstückstisch und nicht in die Enge dieses Zimmers und nicht in den Kreis von drei Personen. Ich werde sie eines Abends bei Miró in Erinnerung bringen.
Er legt das Blatt in den Bücherschrank und schenkt Kaffee aus. Während des Frühstücks teilt Duchamp den Bretons mit, dass er mit Frida noch an diesem Vormittag die Bilder vom Zoll holen und sich dann sofort um eine Galerie bemühen werde.
Are you vexed?, fragt Jacqueline und legt ihre Hand wie zur Entschuldigung auf Fridas Arm. Es fällt Frida schwer, aus Höflichkeit zu lügen. Es ist ihr Recht, verärgert zu sein. Die Überfahrt hatte gerade genug gekostet. Maximal hatte sie drei bis vier Wochen bleiben wollen. Wenn jetzt erst eine Galerie gesucht werden musste … Bis zur Vernissage können Wochen vergehen! Wenn sie vor Beendigung der Ausstellung zurückfährt, kann sie sicher sein, ihre Bilder nie wiederzusehen – bei Bretons Schlamperei und Unzuverlässigkeit.
Die kleine Aube sitzt neben ihrem Vater. Unablässig beobachtet sie den fremden Besuch. Sie flüstert ihrem Vater etwas ins Ohr. Der übersetzt.
Sie fragt, ob Frida nicht französisch sprechen kann.
Ma petite chérie, je parle très mal français. Es ist unverzeihlich, niemand hat mich eurer süßen Tochter vorgestellt. Moi, je suis Frida. Bonjour, Aube!
Die Kleine errötet. Sie rutscht von ihrem Stuhl und reicht Frida die Hand. Ihre Neugier ist stärker als ihre Scheu.
Warum hast du so viele Ringe auf?
Gefallen dir Ringe?
Die Kleine nickt ernsthaft. Dann nimmt sie ihren ganzen Mut zusammen und fragt mit erhobener Stimme: Stimmt’s, du hast ein krankes Bein?
Frida zieht Aube etwas zu sich heran und flüstert ihr, unhörbar für die anderen, ins Ohr: C’est notre secret!
Das Kind nickt beglückt. Mit sichtlicher Zufriedenheit kehrt es, zum Geheimnisträger erkoren, an seinen Platz zurück.
Jacqueline bietet Frida einen ihrer Pelzmäntel an, wenn sie jetzt mit Duchamp zum Zoll will. Frida kann nicht widerstehen. In den USA hatte sie sich einen Pelzmantel zugelegt, ihn dann aber verschenkt. Der aus rotem Fuchsfell scheint ein Erbstück zu sein, in dem sich bereits die Motten eingenistet hatten. Frida entscheidet sich für den dunklen, langhaarigen Pelz, dessen Name jetzt niemandem einfällt. Duchamps Auto steht vor der Haustür. Es ist ein altes Vehikel.
3.
Frida fühlt sich Duchamp gegenüber in zunehmendem Maß verpflichtet. Sie ist ihm dankbar, dass er als männliche Begleitperson mit den Zöllnern verhandelt. Sie vermag nicht zu unterscheiden, ob es Scherz oder ernste Absicht war, ihre Bilder auf die nächste Auktion zur Versteigerung zu bringen, weil man den Besitzer verschollen glaubte.
Endlich hatten sie die Bilder in den hintersten Lagerräumen entdeckt. In der Tat völlig verstaubt. Aus Platzmangel seien sie immer weiter nach hinten gewandert, was der Verpackung nicht sonderlich gut bekommen war. Bei einem Bild war sie beträchtlich eingerissen. Ein anderes musste im Regen gestanden haben.
Duchamp hat Mühe, dem Zollbeamten begreiflich zu machen, dass Frida nicht nur die Besitzerin, sondern die Malerin ist und dass es um eine Ausstellung dieser Werke geht, dass folglich die Bilder wieder nach Mexiko zurückkehren. Man scheint die Frau nicht als Malerin akzeptieren zu wollen. Wegen der »Allüren« einer Frau ein solcher Aufwand? Wie zurückgeblieben war man in Europa? Wie konservativ in Paris?
Duchamp ist von dem kleinen Format ihrer Bilder überrascht. Nur eines von ihnen erreicht die Länge von einem knappen Meter. So hat er keine Mühe, die neunzehn Bilder in seinem Auto zu verstauen. Er schlägt Frida vor, ihre Bilder vorläufig in seinem Wohnatelier unterzustellen.
Ich bin neugierig.
Fridas Interesse an seinem Schaffen scheint ihn verlegen zu machen. Ein Schatten von Resignation fliegt über sein Gesicht. Sein Atelier diene heute als Abstellraum und Fundbüro. Er versucht, das Auto anzulassen und murmelt dabei, dass er aufgegeben habe.
Wir fühlten uns einst als Kinder der Revolution. Heute sind wir alte Kinder! Auch Antikunst funktioniert nicht! Ich wollte einen Gegenstand finden, der bar aller Interpretationsmöglichkeiten sei. Es funktioniert nicht. Die Sucht der Menschen, in den banalsten und trivialsten Dingen einen Sinn zu entdecken wie in einem Flaschentrockner zum Beispiel – macht auch Antikunst unmöglich. Jahrelang habe ich die Blindstelle gesucht, die Sinn und Bedeutung ausschaltet. Ich habe den Flaschentrockner ausgesucht. Doch in diesem Moment, wo ich ihn auswählte, entriss ich ihn der allgemeinen Gleichgültigkeit. Er wurde geradezu zum Stimulus interpretatorischer Willkür. Verstehen Sie, was ich meine?
Frida gibt vor, zu verstehen. Was redet Duchamp von einem Flaschentrockner? Sinn und Bedeutung ausschalten? Was würde Diego dazu sagen, wollte man den Sinn aus seinen Bildern entfernen?
Sie kennen Breton. Er wacht noch immer wie ein Polizeihund über die Reinheit seiner Theorie, die sich längst überlebt hat. Praktisch habe ich mich schon seit Jahren aus diesem Kreis gelöst.
Ein Grund für Frida, Duchamp sympathisch zu finden. Ihr eigenes Verhältnis zum Surrealismus ist zwiespältig. Dass Breton in ihr die mexikanische Surrealistin par excellence sah, mag in ihm selbst begründet liegen.
Was Duchamp eben von seinem Kunstverständnis preisgegeben hat, berührt Frida nicht. Sie sieht keine Parallelen, keine Anknüpfungspunkte. In ihrer Malweise und Sicht auf die Dinge ist sie mit keinerlei revolutionärem Anspruch aufgebrochen. Frida zieht sich in ihr Pelzungetüm wie in eine Höhle zurück. Im Auto entsteht eine angenehme Wärme und vermittelt einen Hauch von Gemütlichkeit. Fast Häuslichkeit – bei dem Gedanken, ihre Bilder in unmittelbarer Nähe zu wissen. Ihre Bilder – das ist das Intimste, das Ureigene. Das sind die lautlosen Schreie. Das ist ihr Leben. Gemalt mit Blut und Tränen.
Absichtsfreies Spiel der Gedanken. Denkdiktat bar jeder Vernunftskontrolle. Bar ästhetischer und ethischer Normen. All das traf mit Sicherheit nicht auf ihre Bilder zu. Sie waren auch keine Experimente, die die im Unterbewusstsein verschütteten Bilder einer »Über«-Wirklichkeit zutage fördern sollten. Im Grunde fühlt sich Frida in Paris als Hochstaplerin.
Sie fahren an der hohen Uferstraße der Seine entlang. Alle Konturen verschwinden. Graues, einhüllendes Licht. Platanen. Immer wieder Platanen. Duchamp macht sie auf den Eiffelturm aufmerksam. Durch die beschlagenen Fensterscheiben wirft Frida einen unkonzentrierten Blick auf diese ingenieur-technische Meisterleistung. Wie ein Fremdenführer fühlt sich Duchamp verpflichtet, Jahreszahlen, Entstehungsgeschichtliches und Informatorisches zum Besten zu geben. Es hat aufgehört zu regnen. Wolkenfetzen hängen an der Krone des Turms, von dem man einhundertvierzig Kilometer weit ins Land schauen soll. Duchamp kennt nicht die Berge Mexikos, von denen der Blick von einem Ozean zum anderen schweifen kann.
Der Mann spürt, dass Fridas Interesse an der Stadt in diesem Moment nicht zu wecken ist. Jetzt fahren sie durch eine verwahrloste Gegend. Duchamp lacht auf. Er unterbreitet ein anderes Gesprächsangebot.
Wissen Sie, wo wir uns befinden? Rue de Saix … Sagt Ihnen das etwas? Nein … Hier hat Rivera mit Angelina gewohnt.
Es gibt einen Stich. Das ist verjährt. Verjährt. Verjährt. Jetzt ist sie Riveras Frau. Seine dritte Frau. Es wird keine vierte geben. Auch nicht, wenn Frida sich scheiden lassen sollte. Diego hat es ihr geschworen.
Ein typisches Pariser Mietshaus. Sehen Sie, dort rechts … Eine kleine Wohnung in der ersten oder zweiten Etage.
Frida versucht, sich die Lage der Straße und die des Hauses einzuprägen. Eine Spur von Diego in dieser fremden Stadt. In den nächsten Tagen wird sie allein hierhergehen. Sie wird nach Zeichen von ihm suchen. Zeichen, die schmerzen werden. Diego hatte ihr von diesem merkwürdigen Mietshaus erzählt, in dem sich mit dem Aufschließen der Haustür sofort das Licht einschaltete und erlosch, wenn man die Treppe erreicht hatte, wo dann automatisch die Beleuchtung der ersten Etage anging und so weiter fort bis nach oben. Übersprang man die entscheidende, Licht auslösende Treppenstufe, begann eine entsetzliche Klingelei im ganzen Haus, die eine aufgebrachte Mieterschaft aus den Wohnungen riss … In diesem Haus hatte es bei Diego angefangen, in dieser kleinen Wohnung ohne Bad, dass er Waschen und Körperpflege, der Not gehorchend, als überflüssig empfand. Was hatte sie für Mühe aufbringen müssen, ihren gewaltigen Unkenfrosch in das Nass einer Badewanne zu locken und seinen Alabasterkörper, der bis auf die Füße weiß und rein und Schmutz abstoßend blieb, mit Wasser zu benetzen. Was konnte Diego für kindliche Freude bei dem Geruch seiner Füße entwickeln, wenn er sich der Schuhe entledigte.
Diese kleine, blonde Russin! Wissen Sie, was aus ihr geworden ist? Sie hat so tapfer Spanisch gelernt. Mexiko war ihre Heimat geworden, obwohl sie das Land nie gesehen hatte. Sie war voller Hoffnung, dass Rivera sie nachkommen lassen würde, wenn er in Mexiko wieder Fuß gefasst hatte. Sie und den Sohn.
Frida schaut unbeteiligt aus dem Fenster. Ein Karussell dreht sich für ein einziges Kind. Es hat seine Arme um den weißen Hals eines hölzernen Pferdes geschlungen. Tatsächlich scheint es dem kleinen Mädchen zu gelingen, aus dieser grauen Stadt zu reiten, eine andere Welt zu finden, die voller Sonne und Wärme ist.
Frida bemüht sich, die Frage des Mannes sachlich zu beantworten: Diego hatte Lupe kennengelernt, seine zweite Frau. Angelina ist später allein nach Mexiko gekommen. Als sie sich das Geld für die Überfahrt zusammengespart hatte … Der Traum von Mexiko, den Diego in der Fantasie eines Menschen zu wecken vermag, bleibt unzerstörbar und unauslöschlich.
Die kleine, blonde Russin … die ein paar Jahre älter als Diego war … Mutter seines ersten Sohnes … »die beste aller Mütter« … In Diegos weitschweifigen und ausmalenden Erzählungen war vor Fridas widerstrebendem geistigem Auge schließlich dieser einzige große Wohnraum entstanden, den das Ehepaar durch einen Hängeboden in zwei Etagen geteilt hatte. Oben schliefen Diego und Angelina. Oben wurde auch gekocht. Unten wurde gemalt. Damals versuchte sich Diego noch im Kubismus, später im Konstruktivismus à la Cézanne – wie tausend andere Gigolos der Malerei. Doch nicht Diego war der Herr im Hause. Die zarte kleine Angelina schaffte Geld herbei. Unter Aufbietung all ihrer Kräfte fertigte sie Fälschungen von Meisterwerken an, die ihr ein Pariser Antiquariat abkaufte. Diego half ihr lediglich, wurmstichiges Holz zu suchen und alte Schinken der betreffenden Epoche, deren Leinwand Angelina benutzte. Diego schwärmte mitunter von Angelinas fantastischer Fabrik für italienische, flämische und katalonische Primitive. Vielleicht war es Angelina, die Diego für immer geprägt hatte. Mit und seit ihr liebte er erfolgreiche, finanziell unabhängige Frauen. Deshalb hatte er sie, Frida, nach Paris geschickt, um sie als Surrealistin feiern zu lassen.
Angelina, die alles für Diego getan hatte, spanisch gelernt, Ehrenburgs Buch über Diego aus dem Russischen ins Französische übersetzt … Alle Frauen, die Diego liebten, gaben das Letzte für ihn … Es lag nicht an den Frauen.
An einer öffentlichen Bedürfnisanstalt hängt ein ausgeblichenes Plakat. »An den Galgen mit Franco! Kanonen für die spanischen Republikaner! Hoch Thorez!«
Ein Kommunistenviertel!, sagt Duchamp, der sich Fridas bevorzugtes Interesse an dem brusthohen Wellblechschirm der Bedürfnisanstalt zu erklären versucht.
Die Aufschriften auf der Innenseite sind noch aufschlussreicher!, fügt er hinzu.
Es hat nichts geholfen. In Fridas Stimme klingt unüberhörbare Enttäuschung. Vielleicht rührt ihre Resignation und Traurigkeit daher … Musste sie nach Europa fahren, um die Niederlage in Spanien hautnah zu erleben?
Die Bilder wechseln. Schreiende Reklame an den Giebeln für Cinzano und Byrrh.
Wir sind gleich da. Das ist jetzt der Boulevard du Montparnasse.
Sie biegen in eine Seitenstraße ein. Duchamp hält vor einem Haus, das einen vertrauenerweckenden Eindruck macht. Er möchte Frida nicht zumuten, die vielen Treppen zu seinem Wohnatelier hinaufzusteigen, das sein Junggesellendasein in der ihm eigenen Vorstellung von Ordnung und Bequemlichkeit dokumentiere. Doch Frida besteht darauf. Sie lässt sich von Duchamp drei ihrer kleinsten Bilder in den Arm legen, was dieser unter Sträuben tut.
Ich bin nicht aus Zucker!
Duchamp misstraut ihrer Forschheit. Er folgt ihr mit der Hälfte der übrigen Bilder. Als sie den dritten Treppenabsatz erreicht haben, legt Frida wortlos die Bilder auf die Stufen und lehnt sich an das Flurfenster. Den niederdrückenden Mantel lässt sie von den Schultern fallen. Die Wirbelsäule droht zu brechen. Ein hilfloses Lächeln der Entschuldigung.
Ich wusste nicht, dass wir in ein Wolkenschloss steigen müssen. Sie lässt sich auf die Treppenstufen sinken. Auch Duchamp legt seine Bilder aus der Hand. Er hebt den Pelz auf und klopft ihn ab. Er tut es automatisch.
Ich werde Ihnen einen Stuhl bringen.
Warum? Ich sitze gut. Kümmern Sie sich nicht um mich. Ich werde nachkommen.
Es sind noch einmal zwei Treppen.
Das Monster können Sie gleich ins Auto schaffen. Sie weist auf den Pelzmantel. Duchamp steht unentschlossen. Er weiß nicht, wohin mit dem Pelzmantel. Er entschließt sich, ihn mit ins Atelier zu nehmen. Frida hört ihn leichtfüßig die restlichen Treppen hinauflaufen. Es ist ein gepflegter Aufgang. Ein Läufer aus dunkelrotem Plüsch fällt über die Stufen, von glänzenden Messingstangen gehalten. Duchamp rasselt mit einem Schlüsselbund. Eine Tür knarrt. Dann setzt ein lang anhaltendes Poltern und Schurren und Möbelrücken ein. Unterdrücktes Fluchen. Der Arme – er glaubt, ein Mehr an Übersicht und Ordnung herstellen zu müssen.
Jetzt ist das Packpapier endgültig zerrissen. In unbekümmerter Nacktheit schiebt sich ein fünfjähriges Mädchen aus der Hülle. Es steht auf dem Hof des blauen Hauses von Coyoacán. Coyoacán, das einst, als der Vater zu bauen begann, nichts als Weideland war und wieder Weideland, Hütten und abermals Hütten, Indios und nochmals Indios. Das Kind hatte geglaubt, das blaue Haus stehe im Zentrum von Mexiko, im Mittelpunkt der Welt. Es war ihm stets wie eine Muschel der Geborgenheit erschienen. In Wirklichkeit befand sich das Haus nahe dem Marktplatz, gegenüber einer Molkerei, nicht weit von der Kirche, in der die Mutter eine Kirchbank für sich und ihre Töchter reserviert hatte.
Gemalt ist das Haus in der Unendlichkeit des Weidelandes und den vereinsamten Hütten der Indios und dem kargen Felsmassiv des Pedregal. Im Vordergrund die Unwirtlichkeit einer Kakteenlandschaft. Im Hintergrund die Weite des Ozeans. In unmittelbare Nähe des blauen Hauses gerückt – ein armselig anmutendes Stück Land mit Waschküche. Maiskolben und Tabakblätter an der Hauswand zum Trocknen aufgefädelt. Davor der Wäscheplatz. Ein künstlich angelegtes Tümpelchen mit zwei Enten. Die kleine Frida steht im Hof, über den sie hinausgewachsen ist. Das Apfelsinenbäumchen erreicht gerade die Höhe ihres Knies. Sie steht im Mittelpunkt, in der Sicherheit des blauen Hauses, steht dort mit Bubikopf und Ponyfrisur. Steht in der kindlichen Selbstverständlichkeit, dass diese Welt ihr gehört.
Vor allem gehört ihr der Vater. Ihr allein. Mit diesem Besitzanspruch hatte sie sich gemalt. Ihr allein gehört das Haus. Nicht, dass es auch die Kindheit der Schwestern war. Das wird ihr jetzt bewusst. Sie wird ein anderes Bild malen müssen, mit Mati, Adriana, Christina und vielleicht deren beiden Kindern …
Im Hof blühen Sträucher und Sonnenblumen. An kleinen Bäumen reifen Früchte. Gemalt ist der bastgeflochtene Gartenstuhl. Er verrät Lebensraum. Von allen Zimmern des Hauses hat man Zugang zum Hof. Von der Straße her gleicht das Haus einer uneinnehmbaren Festung. Im Hof ein Brunnen – weit gerundet. Das Plätschern des Wassers erfüllt den Hof – heiter, beruhigend, erfrischend.
Das Kind steht im Schutz seines Vaters, an seine Brust gelehnt, ein Bild enger Zusammengehörigkeit. Der Mann wächst hinter dem blauen Haus hervor, mit seinem Oberkörper die Hausfront einnehmend. Ein schöner Mann. Mit vollkommener Stirn und den großen hellen Augen, die das Gesicht beherrschen voll Unruhe und Schwermut. Dichtes, kastanienbraunes Haar, das sich lockte, trüge er es länger. Ein gepflegter Oberlippenbart. Er lächelt nicht.
Niemand lächelt auf ihren Bildern – ausgenommen die Calavera, die grinsende Totenfrau. Und die riesige Judasfigur. Verrat trägt eine lachende Grimasse.
Auch die Mutter ist auf dem Bild. Vater und Mutter als Brautpaar. Nach dem Hochzeitsbild gemalt. Immer muss sie Fotografien zur Hilfe nehmen, wenn sie malt. Ein Beweis, dass sie überhaupt keine Malerin ist. Die Mutter im hochgeschlossenen weißen Kleid mit gerüschtem Volantkragen. Es ist langärmlig, mit gepuffter Schulter. Im schwarzen Haar trägt sie eine weiße Blütenkrone. Über der linken Brust ist ebenfalls eine weiße Blütendolde festgesteckt. Die Mutter ist weit abgerückt vom Kind. Es gibt keine Berührungspunkte. Die Frau steht erhöht und hinter ihrem Mann. Der Kopf des Vaters erreicht gerade deren Schulter. Die Mutter macht ihren Besitzanspruch geltend, indem sie ihren linken Arm um seine Schulter legt. »Chefin« haben die Kinder sie später in distanzierter Ablehnung genannt. Missmutig schaut sie. Dennoch galt sie als Schönheit. Christina hat ihre großen Augen geerbt, die vollen Lippen und das schöne Oval mit dem energischen Kinn.
Sie war wie eine kleine Glocke von Oaxaca. Wenn sie zum Markt ging, gürtete sie ihre schlanke Taille und trug ihren Korb ausgesprochen kokett – erzählte Frida manchmal den Freunden. Je nach Stimmung – Freundliches oder Distanzierendes.
Die Mutter steht außerhalb des blauen Hauses. Nicht sie ist es, die Geborgenheit vermittelt. Doch sie steht in der Nähe der Blume des Lebens, noch vor der Unfruchtbarkeit des Pedregal. Sie steht in der Nähe der Zeugung, versinnbildlicht durch Eizelle und Samen. Vier Töchtern hat sie das Leben geschenkt und doch nur einer von ihnen die Fruchtbarkeit des Leibes.
Gemalt ist die Braut mit dem sichtbaren Embryo im Leib, das sich wie Schutz suchend unter den eigenen kleinen Händen verbirgt. Von dem weißen Kleid der Mutter – ein Weiß, das das Bild beherrscht – strömt Kälte aus.
Gemalt sind auch die Großeltern des kleinen Mädchens. Die aus Mexiko und die aus Europa. Europa, das rechts von Mexiko liegt, weit hinter dem großen Wasser. Auf einer Wolke ruhend – die Porträts der Großelternpaare. Wie Zügel hält das Kind die roten Bänder in der Hand, die es mit Vater und Mutter und den Großeltern verbindet. Über Mexikos unwegsamem, zerklüftetem Felsmassiv die Gesichter von Großmutter Isabel und Großvater Antonio, dem Indio. Dunkelhäutig dieser. Hart und kantig das Gesicht der Großmutter, die zwölf Kinder zur Welt gebracht hatte.
Die andere Großmutter, die aus Baden-Baden, ist jung und schön. Wie Schwingen der Vögel wölben sich ihre Augenbrauen. Das Kind im Hof hat die ihren von dieser Großmutter geerbt. Manchmal hat der Vater darüber gestrichen, wenn er an Fridas Bett gesessen hatte, behutsam, mit der Kuppe eines Fingers, wenn er in deutsche Erinnerung versank. Jener verhängnisvolle Tag seines Unfalls. Sein Pferd, dessen Weiß ihn glauben ließ, einem Märchen entstiegen zu sein, war von hinterhältiger Krankheit infiziert. Niemand hatte den Glanz in seinen Augen bemerkt. Die Beine brachen unter ihm weg. Das Dahinfliegen endete in jähem Zusammenbruch des Pferdes. Den Körper des jungen Mannes trug es fort – gleichsam schwerelos. Die Geschwindigkeit hatte er verinnerlicht. Er gewann an Höhe und hatte sich vom Pferd gelöst, das irgendwo unter ihm zurückgeblieben war. Sekunden eines wunderbaren Fluges.
Die Sonne explodierte.
Sie explodierte in Europa, wie sie eines Tages in Mexiko explodierte, im achtzehnten Jahr ihres eigenen Lebens. Flackerndes Gaslicht. Notbeleuchtung in der Armseligkeit eines Krankenhauszimmers. Es war Nacht, als Wilhelm Kahlo erwachte. Er konnte sich nicht erinnern, was passiert war. Er wollte, dass die Mutter an seinem Bett säße. Er liebte die Schwingen des Vogels – diese wunderbaren Brauen, auf denen ihre gemeinsamen Träume von dem fernen, legendenumwobenen Land über den Ozean geflogen waren.
Der Vater wird bis an das Ende seiner Tage an den epileptischen Anfällen leiden. Eine Wunde im Kopf, in die sich die Krankheit voller Heimtücke geschlichen hatte, sich vergraben, um ihn unerwartet niederzuwerfen, ihm das Bewusstsein zu rauben, seinen Körper mit konvulsivischen Zuckungen zu geißeln.
Seine Mutter war gestorben. Nicht er.
Die Nachricht von seinem Unfall hatte sie niedergeworfen, ihres Lebensmutes beraubt, sie der Verzweiflung ausgeliefert. Dieser Träumer war ihr das vertrauteste von den Kindern gewesen, ihr Verbündeter gegen den geschäftstüchtigen Ehemann. In fatalistischer Selbstaufgabe war sie sicher, den Sohn nie wieder aus seiner Bewusstlosigkeit erwachen zu sehen. Sie war ihm entgegengegangen.
Der deutsche Großvater, nach einer späteren Fotografie gemalt, ruhte in erfolgreicher Selbstgefälligkeit in sich, präsentierte sich in fast großväterlicher Behäbigkeit. Sehr bald hatte er wieder geheiratet. Noch bevor der Sohn das Krankenhaus verlassen hatte. Bereits ergraut, verdeckte er die angehende Glatze eitel mit herübergezogenem Scheitelhaar.
Natürlich trog das Bild, indem es Geborgenheit vermittelte. Frida hatte andere, einsamere Bilder über ihre Kindheit gemalt.
Vergeblich versucht sie, das Bild unter dem zerfetzten Papier wieder zu verstecken. Duchamp nimmt es ihr aus der Hand. Ein seltsam zufriedener Laut dringt aus seiner Kehle. Er stellt sich mit dem Bild vor das Fenster des Treppenflurs. Er betrachtet es lange und eingehend. Frida wird unruhig. Sie erhebt sich. Er soll sich nicht äußern. Bis an ihr Lebensende wird Befangenheit sie unfrei machen, wenn Kritiker ihre Bilder begutachten. Erst in diesen Momenten wird ihr eindringlich bewusst, dass sie Bilder nie für andere, nie zum Verkauf, nie zum Lebenserwerb, nie für Ausstellungen gemalt hat, sondern ausschließlich für sich, um ihren Schmerz, ihre Einsamkeit darüber abfließen zu lassen.