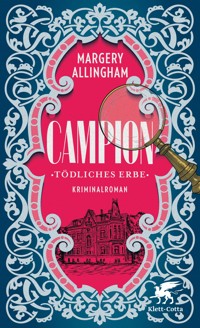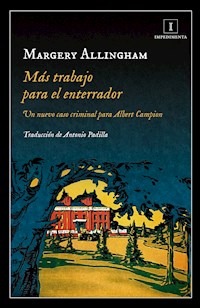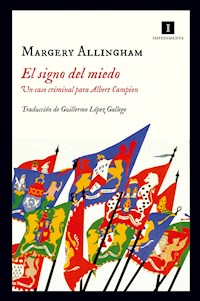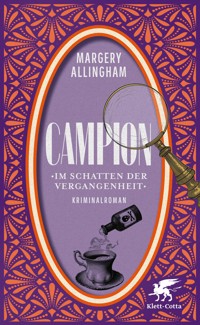
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Campion
- Sprache: Deutsch
»Margery Allingham sticht heraus wie ein Licht in der Dunkelheit.« Agatha Christie Ein weiterer Auftritt für Privatdetektiv Albert Campion – er findet sich auf einem ehrwürdigen Herrensitz in Cambridge wieder, wo das Verbrechen Einzug hält. Zwei der Bewohner sind bereits auf mysteriöseArt und Weise ums Leben gekommen, und die Kette erschreckender Ereignisse will einfach nicht abreissen. Ein rasanter Fall aus dem goldenen Zeitalter des Kriminalromans. Als Albert Campion von der Verlobten eines alten Studienfreundes hinzugezogen wird, um das Verschwinden ihres Onkels zu untersuchen, rechnet er kaum mit der Flut von Todesfällen und Gefahren, die sich unter den bizarren Bewohnern von Socrates Close in Cambridge ereignen. Eine Leiche mit Kopfschuss wird gefunden. Eine Tante wird tot in ihrem Bett entdeckt, vergiftet durch ihre morgendliche Tasse Tee. Und so neigt sich die Familie Faraday immer weiter dem Untergang zu. Jeder in dieser Familie ist verdächtig, jeder hat etwas zu verbergen. Campion und der ihm gut bekannte Polizist Stanislaus Oates müssen vorsichtig vorgehen und alte Familiengeheimnisse ergründen, um diesen Fall zu lösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Margery Allingham
Campion
•Im Schatten der Vergangenheit•
KRIMINALROMAN
Aus dem Englischen von Friedrich A. Hofschuster
KLETT-COTTA
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Police at the Funeral« im Verlag Jarrolds Publishing, London
© International Literary Properties UK Limited, through ist subsidiary Worldwrites Holdings Limited, 1933
Für die deutsche Übersetzung
©1989 Diogenes Verlag AG Zürich
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: © Zero-Media.net, München
Illustration: ©FinePic®, München
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96676-3
E-Book ISBN 978-3-608-12469-9
•1•
»Hier ruht ein Wohltäter«
Wenn einer einen anderen verfolgt, mag der Verfolger oder der Verfolgte es noch so diskret anstellen: dennoch wird es in den Straßen von London nur sehr selten unbemerkt bleiben.
Und so gab es denn mindestens vier Personen, denen auffiel, dass der erst kürzlich zu den Großen Fünf beförderte Inspector Stanislaus Oates, als er den High Holborn entlangging, von einem kleineren, untersetzten, schäbig gekleideten Mann verfolgt wurde, der trotz allem das schwer definierbare Gebaren ehemaliger Kultiviertheit an sich hatte.
Der Inspector hatte die Hände in die Taschen seines Regenmantels gesteckt und den Kragen hochgestellt, dass dieser fast die Krempe seines abgetragenen Filzhutes berührte. Er hatte die Schultern hochgezogen, seine Füße waren nass, und schon sein Gang drückte deutliche Niedergeschlagenheit aus.
Es gab nur sehr wenige Anhaltspunkte für die Passanten, dass der untersetzte Mann, der der Schlepper eines Buchmachers hätte sein können, dem Inspector folgte. Er selbst wäre sehr erstaunt gewesen, wenn er erfahren hätte, dass irgendjemandem sein Interesse für den Polizeibeamten aufgefallen war, aber die alte Mrs. Carter, die vor der Provincial Bank Blumen verkaufte, erkannte Mr. Oates, beobachtete den Mann, der sich an ihn gehängt hatte, und fragte sich, was er wohl vorhatte, fragte sogar laut ihre Tochter, die auf den Lieferwagen des Evening Standard mit der Spätausgabe wartete und ihre hochhackigen Schuhe voll Wasser bekam von der Flut, die den Randstein entlang in die Gullys sprudelte.
Dem Portier, der auf der Treppe des großen Hotels Anglo-American stand, fielen die beiden Männer ebenfalls auf; er war stolz darauf, dass ihm in der Regel nicht viel entging. Und auch Old Todd, der Fahrer des letzten Taxis in der Reihe vor der Staple Inn, vermerkte das Schauspiel ebenfalls, als er lustlos über die metallgerahmten Gläser seiner Brille hinweg den Gehsteig beobachtete, auf das Abendgeschäft wartete und sich überlegte, ob die eine noch funktionierende Bremse seines Wagens bei dieser verdammten Nässe ausreichen würde.
Und schließlich war sich auch der Inspector selbst über die Sachlage im Klaren. Man ist nicht fünfundzwanzig Jahre lang Polizeibeamter, ohne in besonderer Weise empfänglich zu werden für den Umstand, dass man nicht allein vor sich hinschreitet, und der stumme Begleiter in diskretem Abstand wird dabei ebenso real, als wenn er neben einem herginge.
Heute war sich der Inspector dieses Umstandes bewusst, nahm aber keine Notiz davon. Es gab vermutlich viele, die genügend Groll gegen ihn hegten, dass sie sogar einen Überfall auf Mr. Oates ins Auge fassen mochten, aber seines Wissens keinen, der das Risiko eingehen würde, einen solchen Versuch bei hellem Tageslicht und mitten im Herzen der Stadt zu unternehmen. Daher ging er platschend weiter durch den Regen, versunken in seine eigene, rein persönliche Depression. Dieser eher magere, gutmütige Mann, der nur um den Bauch herum einen Ansatz von Fett zeigte, wurde in Wahrheit von nichts Ernsterem als leichten Verdauungsbeschwerden geplagt, gepaart mit der unangenehmen Vorahnung, dass seine Glückssträhne zu Ende sei und in Kürze etwas Unangenehmes geschehen würde. Er war kein sonderlich phantasiebegabter Mensch, aber Vorahnung ist Vorahnung, und er war eben erst den Großen Fünf beigetreten, so dass sich seine Verantwortung für den Fall größerer Schwierigkeiten jedenfalls nicht verringert hatte. Außerdem waren da noch der Regen, das Verdauungsproblem, das ihn zu diesem Spaziergang veranlasst hatte, und noch einmal der Regen.
Mitten in diesem wütenden Sturm, der durch den Viaduct fegte, blieb er stehen und machte sich Vorwürfe. Die vage Gegenwart hinter ihm bereitete ihm noch den geringsten Kummer. Aber verdammt! Dieser Regen durchnässte ihn bis auf die Haut. Er befand sich in einer Gegend, wo es keine Hotels gab, und dank der Umsicht und Fürsorge einer großmutterhaften Regierung würde es noch eineinhalb Stunden dauern, ehe die Pubs öffneten. Die Hosenbeine klatschten ihm klamm um die Knöchel, und als er sich aufgerichtet hatte, ergoss sich ihm ein kleiner Wasserfall von der Hutkrempe in den Nacken.
Es gab tausend Dinge, die er hätte tun können. Er hätte sich ein Taxi zurück zum Yard oder zu einem Restaurant oder Hotel nehmen und sich dort in Ruhe und Gelassenheit trocknen lassen können, aber er befand sich nun einmal in einer merkwürdigen Stimmung und schaute sich jetzt nach allen Seiten angriffslustig um. Selbst der dienstjüngste Constable in diesem Revier musste ein schützendes Dach kennen, eine Zuflucht in dieser Wüste aus Bürohäusern, wo sich ein Mensch trocknen und wärmen und vielleicht ein verbotenes Pfeifchen rauchen konnte, in angenehmer, und sei es auch staubiger, Zurückgezogenheit.
In London gibt es wie in allen großen Städten, an denen tausend und mehr Jahre gebaut und wieder gebaut worden ist, alle möglichen Ecken und Winkel, kleine, vergessene Fleckchen wertvollen Bodens, die immer noch der Allgemeinheit gehören, und seien sie auch noch so versteckt zwischen den gewaltigen Steinmassen privaten Besitzes. Während er am Viaduct stand, musste Stanislaus Oates an die Zeit vor zwanzig Jahren denken, als er selbst noch Constable in London gewesen und frisch aus der Provinz in die große Stadt gekommen war. Sicher war er oft genug nach der letzten Runde in seinem Revier in Holborn auf dem Nachhauseweg durch diese langweilige Straße gekommen; bestimmt hatte es damals irgendeine stille Ecke gegeben, wo er die Antworten für das bevorstehende mündliche Examen präpariert hatte, das ihm im Frühjahr gedroht hatte, oder wo er einen absurd verklärten Bericht über seine Tätigkeit an seine vertrauensvolle und bezaubernde Marion geschrieben hatte, die damals noch in Dorset lebte.
Sicher, die Häuser hatten sich seit damals verändert, aber ihre Lage war geblieben. Die Erinnerung kehrte zurück, erst stückweise wie eine Landschaft, die man durch die Blätter eines Baums betrachtet, doch dann erinnerte er sich auf einmal an den modrigen Geruch warmer Säcke und heißer Wasserrohre. Und plötzlich fiel es ihm wieder ein: der dunkle Durchgang mit dem dünnen Lichtstrahl am Ende, die rote Tür mit dem Eimer davor und der Steinfigur gegenüber.
Augenblicklich besserte sich seine Laune beträchtlich, und er ging weiter, drang tiefer in die Stadt ein, bis ihn eine plötzliche Wende zu einem schmalen Bogengang brachte, der sich zwischen den palastartigen Eingängen von zwei Großhandelsfirmen hindurchzwängte. Die Pflastersteine in diesem Durchgang waren abgetretene, schmale Steinplatten, schief und schräg zusammengesetzt, und an der weißgetünchten Mauer war eine kleine, abgeblätterte Schrift zu erkennen, geschwärzt vom Rauch und zusätzlich von der Dunkelheit in dem Durchgang überschattet, eine Schrift, die schlicht verkündete: ZUM GRAB.
Und diesen Durchgang betrat Inspector Stanislaus Oates, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern.
Nach etwa fünfzehn Metern kam er in einen kleinen Hof, der in all den Jahren, seit er ihn entdeckt hatte, und vermutlich auch die letzten hundert Jahre davor, unverändert geblieben war. Hier ragten braunschwarze Gebäude auf allen vier Seiten steil in die Höhe und ließen nur einen kleinen Ausschnitt eines grauen, unfreundlichen Himmels frei. Der Anlass für diesen merkwürdigen Luftschacht inmitten eines alten Gebäudeblocks nahm den größten Teil des Hofs in Beschlag und bestand aus einem Rechteck spärlichen, gelblichen Rasens, der von einem niedrigen Geländer umgeben war, und in seiner Mitte erhob sich das in Stein gehauene Abbild eines Mannes in Wams und Kniehose. Eine Tafel am Postament der Statue verkündete den Neugierigen:
SIR THOMAS LILLYPUT
ER KAUFTE DIESES LAND, DASS SEINE GEBEINE DORT RUHEN SOLLEN.
STÖRT IHM DIE RUHE NICHT, DASS NICHT DEREINST DIE EURE EBENSO GESTÖRT.
LORD MAYOR VON LONDON, 1537
und darunter, in einer moderneren Schrift:
Hier ruht ein Wohltäter.
Dass keiner seine Gebeine entferne.
Die frommen oder vielleicht auch abergläubischen Magnaten eines späteren Londons hatten bisher Sir Thomas und seine letzte Ruhstätte immerhin respektiert und ihre Geschäftsbauten um ihn herum und nicht direkt darüber oder darunter errichtet.
Die Erbauer des Blocks über dem Durchgang hatten jedoch den Hof als einen Zugang für Kohlentransporte genutzt, da die eigentliche Zufahrt zu schmal war, als dass man sie als Wareneinfahrt hätte benützen können, und die rote Tür rechts von dem Standbild, an die sich der Inspector erinnert hatte, führte denn auch in den etwas archaischen Heizungskeller der alten Firma, die sich in dem östlichen Gebäude befand.
Die Tür wurde durch einen Eimer offen gehalten, genau wie damals. Es schien sogar derselbe Eimer wie damals zu sein, stellte der Inspector mit sich belebendem Blick fest, und er fragte sich schon, ob auch der alte Foxie – der Name fiel ihm mit herzerwärmender Vertrautheit wieder ein – immer noch für den Betrieb der Heizung sorgte. Mit jedem Schritt schwand seine Depression; er kam geradezu beschwingt näher und widerstand mit Mühe der verrückten Versuchung, dem alten Eimer einen Tritt zu geben, als er an ihm vorbei in das Halbdunkel des Heizungsraums trat.
»Und da, mein lieber Watson, kommt, wenn ich mich nicht sehr irre, unser Klient«, sagte eine Stimme aus dem Halbdunkel. »Aber nein! Großer Gott! Die Polizei!«
Nach kurzer Überraschung fuhr der Inspector herum und stand einem jungen Mann gegenüber, der etwas unsicher auf einem Trümmerhaufen in der warmen, modrigen Zuflucht des Heizungskellers hockte. Ein Lichtstrahl aus der Feuerung fiel auf die Gestalt und zeigte sie in scharfgeschnittenem Relief.
Der Inspector sah eine schlanke, makellos gekleidete Figur, gekrönt von einem blassen Gesicht, das halb verdeckt war durch eine riesige Hornbrille. Die altmodische Mütze mit den hochgestellten Ohrenschützern, die ein wenig schief auf dem Kopf des jungen Mannes saß, vermittelte den Eindruck einer gewissen Widersprüchlichkeit.
Detective Chief Inspector Stanislaus Oates begann zu lachen. Dabei hatte er noch vor zehn Minuten geglaubt, dass er wohl nie mehr spontane Fröhlichkeit empfinden würde.
»Campion!«, sagte er. »Wer hat Sie denn hier hereingetrieben?«
Der junge Mann kämpfte sich von seinem Thron aus Trümmern und streckte dem Inspector die Hand entgegen.
»Ich warte auf einen Klienten«, antwortete er dann nonchalant. »Ich bin schon eine halbe Stunde hier. Und was suchen Sie?«
»Wärme und ein bisschen Ruhe«, erwiderte der Inspector mit klagender Stimme. »Dieses Wetter geht mir an die Nieren.«
Er zog seinen Regenmantel aus, schüttelte ihn mit entschiedener Gebärde und breitete ihn dann über den Platz aus, auf dem Mr. Campion bis dahin gehockt hatte. Er wiederholte die Prozedur mit seinem Hut und drückte sich dann so nahe an den Boiler, wie er konnte, ohne sich zu verbrennen. Der andere betrachtete ihn mit leicht amüsierter Miene auf dem etwas nichtssagenden Gesicht.
»Reminiszenzen an den kleinen Polizisten, wie mir scheint«, sagte er. »Was soll dieser Besuch? ›Alter Bobby kehrt an die Szene seines ersten Arrests zurück?‹ – ›Die sentimentale Reise von einem der Großen Fünf?‹ Wissen Sie, Stanislaus, ich will nicht neugierig erscheinen, aber ich erwarte tatsächlich einen Klienten, wie ich vorhin sagte, oder, genauer gesagt, eine Klientin. Als ich Ihre Schritte hörte, dachte ich schon, Sie seien die geheimnisvolle ›Sie‹, und ich gestehe Ihnen ehrlich, dass ich bei Ihrem Anblick ein wenig enttäuscht war.«
Der Inspector wandte sich von der Heizung ab und schaute seinen Freund scharf an. »Und wozu diese Verkleidung?«, fragte er.
Mr. Campion nahm das monströse Gebilde aus Tweed von seinem Kopf und betrachtete es liebevoll.
»Auf dem Weg hierher war ich kurz bei Belloc«, erklärte er, »und da hab ich das Ding gesehen. Sie stellen jährlich nur ein Exemplar davon her, für einen ländlichen Dekan, der die Mütze bei der alljährlichen Rattenjagd trägt. Ich hab sie gesehen und musste sie haben. Genau das Richtige, um sich mit einer romantischen Klientin zu besprechen, finden Sie nicht?«
Der Inspector grinste. Die Wärme drang allmählich bis in seine Knochen, und seine bonhomie kehrte schnell zurück.
»Sie sind wirklich ein außergewöhnlicher Bursche, Campion«, sagte er. »Es wundert mich schon nicht mehr, wenn Sie an den überraschendsten Orten auftauchen. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein halbes Dutzend Londoner gibt, die dieses kleine Versteck kennen. Aber ich komme zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wieder hierher, und Sie sitzen hier, in dieser Maskerade. Wie machen Sie das nur?«
Campion knöpfte nachdenklich die Ohrenklappen seiner Mütze auf. »Der gute Lugg hat mich darauf gebracht«, sagte er. »Er ist immer noch bei mir, Sie wissen ja, eine Kombination aus junger Bulldogge und femme-de-chambre. Ich habe einen passenden Ort gesucht, um dort eine junge Dame zu sprechen, die dem Irrtum erlegen ist, mich für einen Privatdetektiv zu halten.«
Der Inspector klopfte seine Pfeife am Boiler aus.
»Komisch, wie sich solche Fehlinformationen verbreiten«, sagte er. »Als was bezeichnen Sie sich derzeit?«
Campion schaute ihn tadelnd an. »Beauftragter in Sachen Abenteuer«, sagte er. »Ich bin erst neulich darauf gekommen. Aber ich finde, es beschreibt mich vortrefflich.«
Der Inspector schüttelte ernst den Kopf. »Kein Gralsritter mehr?«, fragte er. »Das letzte Mal haben Sie mir ganz schön Angst eingejagt. Ich fürchte, früher oder später werden Sie größte Schwierigkeiten haben.«
Der junge Mann strahlte. »Ihre Vorstellung von Schwierigkeiten muss von recht fortgeschrittener Art sein«, murmelte er.
Der Inspector lächelte nicht. »Ich meinte damit eher solche Schwierigkeiten«, bemerkte er und deutete dazu durch die offene Tür hinaus auf den mit dem niedrigen Eisengeländer umgebenen Grasfleck. »Nur, dass es wahrscheinlich niemanden gibt, der zu Ihren Füßen eine Tafel mit der Inschrift Hier ruht ein Wohltäter aufstellen wird. Was ist es diesmal? Ein Skandal in ersten Kreisen? Oder sind Sie dabei, das gesamte Spionagenetz des britischen Weltreichs zu zerstören?«
»Weder noch«, sagte Mr. Campion bedauernd. »Sie finden mich hier, Stanislaus, in dem äußerst kindischen Verlangen, jemanden zu beeindrucken. Und, nebenbei, um zu mir selbst zu finden. Ich treffe eine Dame hier – aber das habe ich Ihnen inzwischen ungefähr sechsmal gesagt. Sie können ruhig hier bleiben. Ich kenne sie nicht, und ich glaube, dass Ihre Anwesenheit sogar das Niveau des Gesprächs noch verbessern würde. Sagen Sie, könnten Sie nicht rasch rausgehen auf die Straße und sich einen Helm borgen von einem Ihrer Bobbys, die da draußen Streife schieben? Dann wüsste die Dame, dass ich die Wahrheit sage, wenn ich sie mit Ihnen bekannt mache.«
Mr. Oates war beunruhigt. »Wenn Sie irgendeine Verrückte hier treffen, sagen Sie ihr bloß nicht, wer ich bin«, warnte er den anderen. »Was soll das Ganze eigentlich?«
Mr. Campion zog ein zusammengefaltetes Blatt eines dicken grauen Briefpapiers aus seiner Innentasche.
»Das ist der Brief eines Anwalts«, sagte er. »Ich schätze, er hat dabei weder Kosten noch Mühen gescheut. Lesen Sie ihn, ich helfe Ihnen bei den komplizierteren Wörtern.«
Der Inspector nahm den Brief und las ihn für sich, wobei er jedes Wort mit den Lippen formte und gelegentlich ein gedämpftes Grollen ausstieß, als er manche Sätze leise vor sich hinsagte.
Soul’s Court 2, Queen’s Rd., Cambridge.
Mein lieber Campion,
ich hätte mir eher vorgestellt, dass Du einmal zu mir kommst, um mich in einer meinen Beruf betreffenden Angelegenheit zu konsultieren, als umgekehrt. Doch die Götter des Zufalls waren von jeher launisch wie eine Frau – und natürlich ist es eine Frau, um deren süß-törichten Anliegens willen ich um Deinen Dienst bitte.
Du hast mich mit so vielen amüsanten Bagatellen überhäuft, als ich Dir meine Verlobung mitteilte, dass ich sicher bin, Du hast das Ereignis selbst schon wieder vergessen. Aber ich schreibe diesen Brief wegen meiner Verlobten Joyce Blount.
Wie ich Dir vielleicht mitgeteilt habe, ist sie derzeit – armes Kind – auf dem Besitz ihrer Großtante als eine Art Haustochter und Gesellschafterin beschäftigt, und die Großtante, eine sagenhafte alte Hekuba, ist die Witwe des verstorbenen Doktors John Faraday, der circa 1880 Rektor des ›Gnats‹ gewesen sein muss. Die Faradays sind eine alte Familie von geradezu lächerlichen Ausmaßen, und die Aufgaben, die sich meiner Verlobten stellen, sind alles andere als einfach.
Kommen wir zum Postulat. Derzeit macht sich Joyce, wie ich finde, absurde Sorgen über das Verschwinden ihres Onkels Andrew Seeley, der auch zum Haushalt ihrer Großtante gehört und seit einer Woche verschwunden ist. Ich kenne den Mann, eine schrullige Type und ein Schmarotzer wie übrigens die meisten Mitglieder der Familie. Ich selbst halte es für sehr wahrscheinlich, dass er ein paar Pfund bei einer Pferdewette gewonnen hat und nun einmal eine Woche lang der eisernen Disziplin seiner Tante Faraday entkommen will.
Joyce ist freilich ebenso hartnäckig wie liebenswert, und da sie sich entschlossen hat, morgen in die Stadt zu kommen (also am Donnerstag, dem Zehnten), um in dieser Angelegenheit einen geeigneten Spezialisten aufzusuchen, war es das Geringste, was ich tun konnte, ihr Deinen Namen und Deine Adresse zu geben und Dir dann einen Brief zu schreiben, um Dich zu warnen.
Sie ist, wie ich fürchte, eine sehr romantische Natur, und sie führt ein verhältnismäßig unromantisches Leben. Wenn Du ihr wenigstens den Kitzel vermitteln würdest, dass sie den Detektiv persönlich und vielleicht sogar mitten im Ermitteln beobachten könnte, würdest Du mich zu Deinem ewigen Schuldner machen.
In alter Treue, mein lieber Studienkollege, immer Dein
Marcus Featherstone
P. S.: Könnte ich doch nur in London sein, ich wäre von dem geradezu absurden Verlangen besessen, Euer Gespräch heimlich zu belauschen.
P. P. S.: Gordon, an den Du Dich bestimmt erinnerst, ist nach Indien gegangen, um dort die britische Herrschaft zu verteidigen, und ich bin sicher, es wird ihm gelingen. Henderson schreibt mir, dass Gordon dabei war, vor die Hunde zu gehen, was immer das bedeuten soll. Aber es wäre typisch.
Der Inspector faltete den Brief zusammen und gab ihn Campion zurück.
»Ich glaube nicht, dass ich mich mit dem Burschen anfreunden könnte«, bemerkte er. »Sicher ist er sehr nett«, fügte er rasch hinzu. »Aber wenn man bei so einem auf den Zeugenstand gerufen wird und er einen dann ausquetscht, steht man wie ein Narr da, und der Fall tritt auf der Stelle. Er glaubt, dass er alles weiß, und er weiß ja auch fast alles – über Bücher und tote Sprachen –, aber hat er auch nur die leiseste Ahnung von dem Gedankenprozess, der dazu führte, dass der Angeklagte die Klägerin 1927 in Chiswick heiratete, wo er doch seit dem Jahre 1903 bereits mit der Zeugin Nummer eins verheiratet war? Nie im Leben.«
Mr. Campion nickte. »Da haben Sie vermutlich recht«, sagte er. »Obwohl Marcus ein sehr guter Solicitor ist. Aber ich glaube, die Fälle, die in Cambridge vors Gericht gehen, sind in der Regel von überaus gepflegter Art. Ich wollte, das Mädchen würde jetzt auftauchen – vorausgesetzt, dass sie überhaupt kommt. Ich habe Lugg ausdrückliche Instruktionen gegeben, dass er sie hierherschickt, sobald sie in der Bottle Street eintrifft. Ich dachte mir, dass sie auf diese Weise einen Blick in einen Bereich der Unterwelt von London werfen könnte, der zugleich anständig, sicher und erbauend ist. Ein Mädchen, das von Marcus zu einem Heiratsversprechen überredet werden konnte, muss geistig behindert sein. Abgesehen davon, dass auch mir ihre Sorge geradezu absurd vorkommt. Sie hat einen mehr als unangenehmen Onkel verloren – warum sollte sie sich die Mühe machen, ihn nun auch noch zu suchen? Ich dachte mir, ich setze mich hier auf diesen bequemen, wenn auch nicht dafür gedachten Haufen Sperrmüll, schmücke mich mit meiner Rattenfängermütze und gebe ein paar offene und ungeschminkte Bemerkungen über Onkel Andrew von mir. Die junge Frau wird tief beeindruckt zu Marcus zurückkehren und ihm getreu alles berichten, was sie gesehen und gehört hat – das tun solche Frauen immer. Marcus wird daraus erkennen, dass ich mich in galoppierendem Tempo Richtung Klapsmühle bewege, er wird meinen Namen aus seinem Adressbuch streichen und mich von da an in Ruhe lassen. Wie gehen Ihre Geschäfte?«
Der Inspector zuckte mit den Schultern. »Ich kann nicht klagen«, sagte er. »Beförderungen sind immer mit Ärger verbunden, soweit ich mich erinnere.«
»Hören Sie!«, rief Campion plötzlich. »Sie kommt!«
Die beiden Männer standen da und lauschten. Schwankende Schritte hallten in dem engen Durchgang. Sie näherten sich dem Hof, dann schienen sie sich wieder ein wenig zu entfernen.
»Ein Lahmer mit Stiefeln Schuhgröße neun, Stumpen rauchend, von Beruf Handlungsgehilfe«, murmelte Campion und setzte seine Tweedmütze auf. »Außerdem hört es sich nach orthopädischen Schuhen an«, fuhr er in ernsterem Ton fort. »Hoffentlich hat sich Marcus nicht eine von den wuchtigeren englischen Rosen erwählt.«
Mr. Oates warf einen Blick durch den Spalt zwischen der halb offenen Tür und dem Türrahmen. »Ach«, sagte er dann nebenhin, »der Kerl schon wieder.«
Mr. Campion zog fragend eine Augenbraue hoch.
Der Inspector erklärte es ihm. »Ich bin heute vom Yard aus bis hierher verfolgt worden«, sagte er. »Um ehrlich zu sein, bei dem heftigen Regen und Sturm habe ich den Mann ganz vergessen. Vermutlich hat er draußen vor dem Eingang herumgehangen, seit ich hier hereingekommen bin. Vielleicht hat er etwas gegen mich, oder es ist ein Verrückter, der mir anbietet, jeden kriminell Veranlagten auf den ersten Blick zu erkennen. Sie würden sich wundern, was mir alles angeboten wird, Campion. Aber ich glaube, ich sollte rausgehen und mit ihm reden.«
Der Regen hatte vorläufig aufgehört, doch der Himmel war noch bedeckt und grau. Stanislaus Oates trat hinaus auf den kleinen Innenhof, ging auf die Mündung des Durchgangs zu, warf einen Blick hindurch und trat dann wieder in den Schutz des Hofes. Campion stand unter der Tür des Heizungsraums, um die Komödie zu beobachten, schlank und gepflegt wie immer, abgesehen von der lächerlichen Tweedmütze, die schief auf seinem Kopf saß.
Wieder waren die Schritte zu vernehmen, und einen Augenblick später kam der untersetzte Mann mit dem Gebaren ehemaliger Kultiviertheit auf den Hof.
Aus der Nähe bot er eine komplexere Erscheinung als von fern. Sein gerötetes Gesicht war aufgeschwemmt; raue Haut und tiefe Falten überdeckten fast die natürliche Regelmäßigkeit seiner Züge. Sein Anzug, den er mit Haltung trug, war unansehnlich und voller Fettflecke, ein Zustand, der keineswegs dadurch verbessert wurde, dass er nun auch noch völlig durchnässt war. Trotz der scheuen, flüchtigen Blicke nach allen Seiten verbreitete er einen Eindruck von Aufsässigkeit, und sobald er den Inspector erblickt hatte, musterte er ihn scharf mit seinen etwas blutunterlaufenen Augen.
»Mr. Oates«, sagte er, »ich möchte mit Ihnen reden. Ich habe eine Information für Sie, die Ihnen und Ihren Freunden sehr viel Mühe und Ärger ersparen kann.«
Der Inspector antwortete nicht, sondern wartete die weitere Entwicklung ab. Der Mann sprach mit einer bemerkenswert tiefen Stimme und unerwartet gebildetem Akzent. Interessiert näherte sich Mr. Campion aus seinem Versteck. Der Eindringling brach abrupt ab, als er Campions etwas ungewöhnliches Aussehen registrierte, und riss den Mund weit auf.
»Ich wusste nicht, dass Sie nicht allein hier sind«, sagte er mürrisch.
»Vielleicht sogar mit einem Zeugen«, legte ihm der Inspector in trockenem Ton nahe.
Mr. Campion nahm die Mütze ab und kam heraus auf den Hof.
»Wenn Sie wollen, kann ich gehen, Inspector«, sagte er und hielt dann aber abrupt inne.
Alle drei Männer standen da und schwiegen. Aus dem Durchgang hörte man das vielfache Echo hochhackiger Schuhe, die auf dem Pflaster klickten. Mr. Campions Klientin war im Anmarsch.
Einen Augenblick später stand sie in dem kleinen Hof – die absolute Antithese seiner Erwartungen. Eine große, schlanke junge Frau, schick gekleidet in der besten Tradition gepflegter junger Frauen vom Land. Außerdem war sie jung – wesentlich jünger, als Campion vermutet hatte. Sie sah, bemerkte der Inspector später, wie die jüngere Schwester von netten, sympathischen Leuten aus. Sie war keine Schönheit. Ihr Mund war ein wenig zu groß, ihre braunen Augen lagen zu tief, dennoch wirkte sie auf eine sehr persönliche und durchaus ungewöhnliche Weise attraktiv. Mr. Campion war froh, dass er seine Rattenfängermütze abgenommen hatte. Zugleich stieg in seinem Unterbewusstsein die Meinung, die er sich über seinen Freund Marcus gebildet hatte. Er trat einen Schritt vor, kam auf sie zu und streckte ihr seine Hand hin.
»Miss Blount?«, fragte er. »Mein Name ist Campion. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen die Mühe, hierherzukommen, nicht ersparen konnte.«
Weiter kam er nicht. Das Mädchen, dessen Blick von ihm zu den beiden anderen Männern gewandert war, sah nun den untersetzten Fremden, der dem Inspector etwas von so großer Wichtigkeit mitzuteilen hatte. Ein Ausdruck entsetzten Wiedererkennens trat auf ihr Gesicht, und der junge Mann beobachtete mit Schrecken, wie sich kalkige Blässe vom Hals aus über ihr Antlitz ausbreitete. Im nächsten Moment machte sie einen unsicheren Schritt zurück, und Campion packte sie am Arm, damit sie nicht stürzte. Der Inspector war mit einem Satz daneben, um sie ebenfalls vor einem Sturz zu bewahren.
»Passen Sie auf«, sagte er. »Beugen Sie ihren Kopf nach unten. In einer Minute ist sie wieder auf dem Damm.«
Er suchte nach seiner Taschenflasche, als sich das Mädchen von selbst aufrichtete.
»Entschuldigen Sie«, sagte sie. »Es geht mir schon wieder besser. Wo ist er?«
Die beiden Männer drehten sich um, aber von ihrem untersetzten Bekannten war keine Spur mehr zu sehen. Rasch davontrabende Schritte im Durchgang legten Zeugnis ab von seiner Flucht. Oates rannte hinter ihm her, aber als er das Ende des Durchgangs erreicht hatte und die Straße auf und ab schaute, war der abendliche Betrieb in vollem Gang. Auf den Gehsteigen drängten sich die Menschen, und von dem geheimnisvollen Fremden, dessen Anblick Mr. Featherstones Verlobte so erschreckt hatte, war nichts mehr zu sehen.
•2•
Onkel Andrews Glück
Als sie im Taxi saßen und über die regenglatten Straßen zur Bottle Street 17 A, der Adresse von Mr. Campion in Piccadilly, fuhren, betrachtete Miss Joyce Blount den jungen Mann, der neben ihr saß, und den Inspector, der gegenüber auf dem Klappsitz Platz genommen hatte, mit dem gewinnenden Lächeln der Jugend und log.
»Der Mann, der bei Ihnen in dem kleinen Hof war?«, fragte sie als Reaktion auf eine prüfende Frage des Inspectors. »O nein, den habe ich nie zuvor gesehen.« Sie schaute den beiden Männern ins Gesicht, wobei sich die Farbe ihrer Wangen eine Spur verdunkelte.
Mr. Campion war überrascht, und sein freundlich-nichtssagendes Gesicht verzog sich zu einer Karikatur tiefen Nachdenkens.
»Aber als Sie ihn sahen«, erlaubte er sich zu erinnern, »hatte ich den Eindruck, als würden Sie ohnmächtig werden. Und als es Ihnen – äh – wieder besser ging, sagten Sie: ›Wo ist er?‹«
Die Röte auf den Wangen des Mädchens vertiefte sich, aber sie lächelte die beiden noch immer unschuldig und gewinnend an.
»O nein«, wiederholte sie mit ihrer klaren, etwas kindlichen Stimme, »Sie müssen sich getäuscht haben. Ich habe den Mann ja kaum ein paar Sekunden lang gesehen. Er sagte mir nichts. Wie hätte er auch?« In ihrem Ton lag deutliche Entschlossenheit, und nachdem sie gesprochen hatte, herrschte für einen Augenblick Schweigen. Der Inspector warf einen Blick auf Campion, aber die Augen des jungen Mannes hinter der riesigen Brille waren ausdruckslos.
Das Mädchen schien die Situation zu überdenken, denn nach ein paar Sekunden wandte sie sich erneut an Campion.
»Schauen Sie«, sagte sie, »ich habe den Eindruck, als hätte ich mich sehr töricht benommen. Aber ich mache mir schreckliche Sorgen, und ich habe noch keinen Bissen gegessen. Ich bin heute Morgen ohne Frühstück aus dem Haus gegangen und hatte keine Zeit für den Lunch, und – na ja, so kam eines zum anderen, und ich bin ein bisschen wackelig auf den Beinen, fürchte ich.« Sie hielt inne, weil sie merkte, dass ihre Erklärungen nicht sonderlich überzeugend klangen.
Mr. Campion jedoch schien sich damit zufriedenzugeben. »Es ist sehr gefährlich, nicht zu essen«, sagte er ernst. »Lugg wird sich darum kümmern, sobald wir da sind. Ich kannte einmal einen Mann«, fuhr er in feierlichem Ton fort, »der aus Kummer, geistiger Anstrengung und ähnlichen Dingen für eine beträchtliche Zeit aufgehört hatte zu essen. Er hatte es sich regelrecht abgewöhnt, und als er dann einmal bei einer steifen Dinnerparty saß, war er völlig verwirrt. Stellen Sie sich vor: Hier die Suppe, dort der Hauptgang, und die Austernschalen steckte er sich in die Taschen seiner Smokingjacke. Es war ein Fiasko.«
Der Inspector schaute geistesabwesend auf seinen Freund, mit nach innen gerichtetem Blick; das Mädchen dagegen, das keine Erfahrung mit Mr. Campions Phantastereien hatte, warf ihm unter den Wimpern einen eher zweifelnden, skeptischen Blick zu.
»Sie sind also Mr. Campion, der Freund von Marcus?«
Campion nickte. »Wir haben uns in unserer Sturm-und-Drang-Zeit kennen gelernt«, sagte er.
Das Mädchen lachte, ein nervöses, explosives Kichern. »Die kann bei Marcus nicht lange gedauert haben«, sagte sie. »Es sei denn, er hätte sich verändert.« Sie schien diese Bemerkung augenblicklich zu bedauern, denn jetzt stürzte sie sich kopfüber auf das eine, wichtige Thema, das ihre Gedanken beherrschte. »Ich wollte Sie bitten, uns zu helfen«, sagte sie jetzt langsam. »Natürlich hat Marcus Ihnen geschrieben, nicht wahr? Er nimmt die Sache nicht ernst. Aber sie ist ernst.« Ihre Stimme entwickelte einen Ton offener Ehrlichkeit, der ihre Zuhörer fast erschreckte. »Mr. Campion, Sie sind doch eine Art Privatdetektiv – ich meine, ich habe schon von Ihnen gehört, bevor Marcus es mir sagte. Ich kenne ein Ehepaar in Suffolk, Giles und Isobel Page, Sie sind mit Ihnen befreundet, nicht wahr?«
Mr. Campions übliche Miene eines lässig-zufriedenen Schwachsinnigen verschwand augenblicklich. »Das bin ich«, bestätigte er. »Zwei der nettesten Menschen, die ich kenne. Hören Sie, ich will erst einmal reinen Tisch machen. Also, zunächst einmal bin ich kein Detektiv. Wenn Sie einen Detektiv brauchen, hier ist Mr. Oates, und er ist einer der Großen Fünf. Ich bin ein berufsmäßiger Abenteurer – im besten Sinne des Wortes. Ich werde gern alles für Sie tun, was in meiner Macht steht. Worum geht es denn?«
Der Inspector, erschrocken darüber, dass Campion so freimütig seinen offiziellen Rang verraten hatte, vernahm mit Erleichterung, was das Mädchen als Nächstes ankündigte. Dazu lächelte sie ihn entwaffnend an.
»Es – es ist keine Angelegenheit für die Polizei«, sagte sie. »Es macht Ihnen doch nichts aus – oder?«
Er lachte. »Ich bin froh, das zu hören. Ich bin nur ein alter Freund von Campion. Und nach dem, was ich bisher gehört habe, scheint er der richtige Mann dafür zu sein. Da sind wir. Ich lasse Sie jetzt mit Ihrer Klientin allein, Albert.«
Mr. Campion machte eine wegwerfende Handbewegung. »Wenn Sie meinen. Falls ich in ernsthafte Schwierigkeiten kommen sollte, benachrichtige ich Sie, und Sie können mich dann einbuchten, bis die Gefahr vorüber ist.«
Der Inspector verabschiedete sich, und während Campion den Taxifahrer bezahlte, schaute sich das Mädchen um. Sie befanden sich in einer kleinen Sackgasse, die vom Piccadilly abzweigte, direkt vor einer Polizeistation, aber die Nummer 17 A prangte an einem seitlichen Hauseingang, durch den man eine Holztreppe nach oben erkennen konnte.
»Als ich heute Nachmittag hier war«, sagte sie, »hatte ich schon befürchtet, dass es die Polizeistation sei. Ich war sehr erleichtert festzustellen, dass sich Ihre Wohnung in einem der Stockwerke darüber befindet.« Sie zögerte. »Ich – ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der mir sagte, wo ich Sie finden könne. Ein ziemlich seltsamer Mensch.«
Mr. Campion schaute sie zerknirscht an. »Er hat seine alte Uniform getragen, nicht wahr?«, sagte er. »Die zieht er nur an, wenn wir versuchen, die Leute zu beeindrucken.«
Das Mädchen schaute ihm gerade ins Gesicht. »Marcus hat Ihnen wahrscheinlich gesagt, dass ich ein Kind bin, das eine kleine Meise hat. Und Sie haben sich entschlossen, mich einen Tag lang zu unterhalten, nicht wahr?«
»Sie dürfen einen großen Mann nicht verspotten, auch wenn er einmal einen Fehler macht«, sagte Mr. Campion, während er sie nach oben geleitete. »Vergessen Sie nicht: Selbst Jonas, der große Prophet, ist einmal ausgerutscht – mit schrecklichen Folgen. Aber nein, jetzt meine ich es völlig ernst.«
Nach zwei Absätzen war die Treppe auf einmal mit einem Teppich bespannt, waren die Wände holzgetäfelt. Zuletzt blieben sie vor einer schweren Tür aus Eichenholz stehen, im dritten Stock des Gebäudes. Mr. Campion zog einen Schlüssel heraus, und dann wurde das Mädchen durch eine Diele in einen kleinen, komfortabel möblierten Raum geführt, der ein wenig an die attraktiveren Studios in einem College erinnerte, wenngleich die Trophäen an den Wänden eine weitaus sensationellere Vielfalt zeigten, als sie selbst der hoffnungsvollste Student je hätte erwerben können.
Das Mädchen ließ sich in einem tiefen Sessel mit Armlehnen nieder, der vor dem offenen Kamin stand. Mr. Campion drückte auf eine Klingel.
»Wir werden einen Bissen essen«, sagte er. »Lugg behauptet, dass der High Tea die einzige Mahlzeit am Tage ist, die das Leben lebenswert macht.«
Das Mädchen wollte widersprechen, aber in diesem Augenblick betrat Mr. Campions Faktotum den Raum. Er war ein großes, kummervoll dreinblickendes Individuum, dessen bleiche Wüste eines Gesichts durch einen gewaltigen schwarzen Schnurrbart belebt wurde. Er war in Hemdsärmeln, was ihm angesichts des Mädchens überaus peinlich schien.
»Donnerwetter, dachte, Sie sind allein«, bemerkte er. Dann wandte er sich dem Gast zu mit dem Schatten eines Lächelns. »Ich bitte um Nachsicht, Miss, dass ich hier sozusagen im Negligé erscheine.«
»Unsinn«, sagte Campion. »Sie haben ja Ihren Schnurrbart. Er ist übrigens eine ziemlich neue Anschaffung«, fügte er hinzu, während er sich an Joyce wandte. »Und er ist ein Gewinn für uns, finden Sie nicht?«
Mr. Luggs Ausdruck wurde noch eine Spur melancholischer in dem Bemühen, eine kindliche Befriedigung zu verbergen.
»Er ist zauberhaft«, murmelte das Mädchen, das nicht ganz wusste, was man von ihr erwartete.
Mr. Lugg errötete beinahe. »Es stimmt, er sieht gar nicht so übel aus«, räumte er bescheiden ein.
»High Tea?«, fragte Campion. »Die Dame hat den ganzen Tag noch nichts gegessen. Sehen Sie, was Sie zustandebringen, Lugg.«
Das kummervolle Gesicht des Mannes wirkte beinahe lebhaft. »Überlassen Sie das ruhig mir«, sagte er. »Ich serviere Ihnen einen Festschmaus.«
Einen Moment lang zeigte sich hinter Mr. Campions riesigen Brillengläsern ein besorgter Ausdruck.
»Aber keine Heringe«, sagte er.
»Verderben Sie mir nicht den Spaß«, brummte Mr. Lugg, während er sich zurückzog. Unter der Tür blieb er stehen und betrachtete nachdenklich den Gast. »Ich nehme an, Sie hätten keine besondere Lust auf Hering in der Dose mit Tomatensauce?«, erlaubte er sich zu äußern, doch als er ihre ablehnende Miene erkannte, wartete er nicht erst auf eine Antwort, sondern schlurfte hinaus und schloss die Tür hinter sich.
Joyces Blick traf sich mit dem von Mr. Campion, und daraufhin lachten beide.
»Was für ein köstlicher Typ«, sagte sie.
»Absolut charmant, wenn man ihn näher kennt«, stimmte er ihr zu. »Früher war er Einbrecher, wissen Sie. Es ist die alte Geschichte – er hat mit den Jahren die Figur verloren. Wie er selbst sagt: Es verdirbt den Stil, wenn man bei Fluchtmöglichkeiten nur noch an die Doppeltüren in der Diele denken kann. Jetzt ist er schon seit längerer Zeit bei mir.«
Wieder warf ihm das Mädchen einen langen, durchdringenden Blick zu. »Hören Sie«, sagte sie dann, »haben Sie das wirklich gemeint, als Sie sagten, dass Sie mir helfen wollen? Ich befürchte nämlich, dass sich etwas Schreckliches ereignet hat – oder dass es sich in Kürze ereignen wird. Können Sie mir helfen? Sind Sie – nun, ich meine …?«
Mr. Campion nickte. »Sie wollen wissen, ob ich ein ernsthafter Praktiker bin oder jemand, der den Clown spielt? Ich kenne das Gefühl. Aber ich versichere Ihnen, dass ich ein erstklassiger Profi bin.«
Einen Augenblick lang waren die hellen Augen hinter der riesigen Brille so ernst wie die ihren.
»Und ich meine es absolut ernst«, fuhr er fort. »Meine freundliche Idiotie ist zwar überwiegend natürlicher Art, aber sie gehört zugleich auch zu meinem Repertoire. Ich bin ehrlich, ordentlich, unberechenbar wie der Gewinner beim Derby vom nächsten Jahr, und ich tue, was ich kann. Wäre es jetzt nicht angebracht, dass Sie mir ausführlich berichten, worum es geht?«
Dann nahm er den Brief von Marcus heraus und warf einen Blick darauf.
»Ein Onkel von Ihnen ist verschwunden, nicht wahr? Und Sie machen sich Sorgen um ihn – ist das der wirkliche Kummer?«
Sie nickte. »Ich weiß, es klingt ganz gewöhnlich, und mein Onkel ist natürlich alt genug, dass er sich um sich selbst kümmern kann, aber in Wirklichkeit ist es sehr seltsam, und ich werde das Gefühl nicht los, dass da etwas Furchtbares dahinter steckt. Nur weil ich solche Sorgen hatte, bestand ich darauf, dass mir Marcus Ihre Adresse gab. Wissen Sie, ich meine, dass sich jemand mit der Sache befassen sollte, der zumindest freundlich ist gegenüber der Familie, außerdem jemand, der nicht vorbelastet ist durch die Vorstellungen eines Orts wie Cambridge und eingeschüchtert von meiner Großtante.«
Campion nahm ihr gegenüber Platz. »Sie müssen nur erst einmal die Verhältnisse innerhalb der Familie klarmachen«, sagte er. »Es handelt sich für Sie im Grunde um ziemlich entfernte Verwandte, habe ich recht?«
Sie beugte sich vor, und ihre braunen Augen spiegelten ihr Bemühen, sich verständlich zu machen.
»Ich bin sicher, Sie können sich momentan nicht alles merken, aber ich werde versuchen, Ihnen eine Vorstellung von uns zu geben, so, wie wir momentan sind. Also, da ist vor allem Großtante Caroline Faraday. Ich kann sie sicher nicht so beschreiben, dass es ihr gerecht wird, aber vor fünfzig Jahren war sie eine große Dame, die Frau von Großonkel Doktor Faraday, dem Rektor des Ignatius-College, und sie ist immer die große Dame geblieben. Letztes Jahr ist sie vierundachtzig geworden, aber sie ist dennoch die lebendigste Person im ganzen Haus und leitet den Betrieb mit großartiger Haltung – ich würde sagen, Queen Elizabeth und der Papst in einer Person. Was Großtante Faraday sagt, das gilt.
Dann ist da Onkel William, ihr Sohn. Er ist über sechzig, hat vor Jahren sein ganzes Vermögen bei einem großen Wirtschaftsschwindel verloren und war gezwungen, zurückzukommen und unter den Fittichen der Großtante, seiner Mutter, zu leben. Sie behandelt ihn, als wäre er etwa siebzehn, und das tut ihm gar nicht gut.
Kommen wir zu Tante Julia, seiner Schwester, der Tochter der Großtante. Sie ist unverheiratet und hat das Haus praktisch nie verlassen. Sie wissen ja, wie das früher manchmal war.«
Mr. Campion begann, Hieroglyphen auf die Rückseite eines Briefumschlages zu zeichnen, den er aus einer Tasche gezogen hatte.
»Ich nehme an, sie muss auch Ende fünfzig sein?«, fragte er.
Das Mädchen schaute ihn etwas vage an. »Ich weiß es nicht«, antwortete sie. »Manchmal glaube ich, dass sie älter ist als Großtante Faraday. Sie ist – na ja, die typische alte Jungfer der Gemeinde, wenn man so sagen darf.«
Mr. Campions Augen hinter der großen Brille wirkten gütig. »Ein bisschen schwierig?«
Joyce nickte. »Ein bisschen bestimmt. Dann gibt es Tante Kitty, die jüngere Schwester von Tante Julia. Sie hat zwar geheiratet, aber als ihr Mann starb, war kein Geld mehr übrig. Also musste auch sie zurückkommen in ihr Elternhaus. Und damit wären wir bei mir. Meine Mutter war die Schwester ihres Mannes. Meine Familie ist früh gestorben, und Tante Kitty hat sich um mich gekümmert. Als der Zusammenbruch ihrer Familie erfolgte, habe ich mir einen Job besorgt, aber Großtante Faraday hat mich kommen lassen, und in den letzten achtzehn Monaten bin ich für sie alle eine Art Gesellschafterin. Ich bezahle die Rechnungen und arrangiere die Blumen, kümmere mich um die Bettwäsche, lese der Familie vor und so weiter. Ich spiele auch gelegentlich Schach mit Onkel William.«
»Alles, was Spaß macht, wirklich«, murmelte Mr. Campion.
Sie lachte. »Es macht mir nichts aus«, sagte sie.
Er zog wieder den Brief zu Rate. »Moment mal, wie passt eigentlich Onkel Andrew da hinein? Wie ich sehe, ist sein Name Seeley.«
»Auf ihn wollte ich gerade kommen. Sehen Sie, eigentlich ist er gar kein richtiger Onkel. Er ist ein Sohn des jüngeren Bruders von Großtante Faraday. Er hat sein Geld durch denselben Schwindel verloren wie Onkel William, und er lebt etwa auch seit diesem Zeitpunkt bei der Familie. Das muss jetzt ungefähr zwanzig Jahre her sein.«
»Zwanzig Jahre?« Mr. Campion schaute sie überrascht an. »Haben sie denn alle seither nichts getan? Ehrlich gesagt, das reißt mich doch vom Sessel, mit Verlaub.«
Joyce zögerte. »Sie waren wohl alle nicht besonders talentiert zum Arbeiten«, sagte sie. »Ich nehme das jedenfalls an. Und ich bin sicher, mein Großonkel war sich darüber im Klaren; deshalb hat er den größten Teil seines Geldes seiner Frau vermacht, obwohl sie selbst schon über ein eigenes Vermögen verfügte. Ich muss Ihnen noch etwas erklären, bevor ich zum wichtigen Teil meines Berichts komme. Wenn ich sage, dass die Großtante den Laden schmeißt, dann meine ich das wörtlich. Die Lebensgewohnheiten des Hauses haben sich nicht mehr verändert, seit sie von ihr in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts festgelegt worden sind. Der Haushalt läuft wie ein Uhrwerk. Alles pünktlich und zu seiner Zeit. Jeder geht am Sonntagmorgen zur Kirche. Die meisten von uns fahren mit dem Wagen – ein Daimler von neunzehnhundertdreizehn aber einer von uns begleitet wechselweise die Großtante, die sich im Sommer mit einer zweisitzigen Victoria-Kutsche und im Winter in einer geschlossenen Brougham-Kutsche zur Kirche bringen lässt. Der alte Christmas, ihr Kutscher, ist fast so alt wie sie selbst. Aber natürlich kennt sie ein jeder, und wenn ihre Kutsche auftaucht, wird der ganze Verkehr angehalten, damit nichts passiert.«
Erleuchtung breitete sich auf Campions ausdruckslosem Gesicht aus. »Oh! Ich habe sie schon gesehen«, sagte er. »Ich habe mit Marcus in Cambridge studiert, wie Sie wissen. Damals habe ich oft die Auffahrt zur Kirche beobachten können. Mein Gott, ist das lange her!«
»Wenn es ein graues Pferd war – das haben sie immer noch«, sagte Joyce. »Pecker, der Unübertreffliche. Moment mal, wo bin ich stehen geblieben? Ah, ja. Nun, wir leben alle in Großtante Faradays Besitz an der Trumpington Road, ein Stück außerhalb der Stadt. Es ist das große, L-förmige Haus, das an der Ecke der Orpheus Lane etwas zurückgesetzt im Garten steht. Es ist von einer hohen Mauer umgeben. Großtante denkt übrigens daran, die Mauer noch erhöhen zu lassen, denn wenn man mit dem Bus vorbeifährt, kann man drüberschauen.«
»Socrates Close«, sagte Mr. Campion.
Sie nickte. »Woher kennen Sie den Namen?«
»Der Besitz ist eine Sehenswürdigkeit«, sagte Mr. Campion schlicht. »Vielleicht kenne ich ihn auch aus meinen frühen Tagen. Kommen wir jetzt zu Onkel Andrew.«
Das Mädchen atmete tief ein. »Es geschah am Samstag der letzten Woche, beim Dinner«, sagte sie. »Es ist sicher nicht nett, wenn ich so etwas sage, aber ich glaube, dass Sie es verstehen werden: Großtante behandelt alle anderen wie abhängige Kinder, und da sie schon ziemlich alt und auch nur Menschen sind, neigen sie dazu, in einer mürrischen, altmodischen Weise miteinander zu streiten. Ausgenommen die liebe, alte Tante Kitty. Sie ist nur lieb und töricht und ziemlich hilflos. Sie wird von Tante Julia völlig beherrscht. Tante Julia versucht auch, die beiden Männer zu unterdrücken, und sie scheinen sie zu hassen, obwohl sie sich untereinander auch nicht ausstehen können, und manchmal sind sie dann tagelang eingeschnappt. An dem bewussten Samstag hatte eine von diesen Streitigkeiten schon seit einer Woche in der Luft gelegen, und es wäre wohl zu einer offenen Auseinandersetzung gekommen, wenn da nicht die Großtante gewesen wäre, die offenen Streit ebenso wenig zulässt wie die Tasse Tee frühmorgens im Bett und Grammophonmusik am Sonntag.
Nun, als wir beim Dinner saßen – acht Gänge, und alles ernst und steif –, als die Atmosphäre längst unerträglich geworden war und ich dachte, Onkel William würde sich vergessen und Onkel Andrew ohne Rücksicht auf die Großtante mit einem Esslöffel eins über den Schädel geben, als Tante Julia am Rand eines hysterischen Anfalls war und Tante Kitty bescheiden in ihren Salat weinte, gab es den furchtbarsten Krach, und das auch noch mitten im Zimmer, den man je im Leben gehört hat. Tante Kitty schrie auf, was wie das Pfeifen der Lokomotive eines Bummelzugs klang, und sprang hoch. Onkel William vergaß sich und sagte ›Verdammt‹ oder ›Hölle und Teufel‹ oder was weiß ich. Tante Julia wollte sich gerade endgültig ihrer Hysterie hingeben, und Onkel William ließ die Gabel fallen – als sich die Großtante in ihrem Stuhl mit der hohen, geraden Lehne steif und aufrecht hinsetzte und mit ihren Fingerknöcheln auf die Tafel klopfte. Sie hat sehr harte, knochige Finger, als ob sie Fingerhüte aus Elfenbein drangesteckt hätte. Sie sagte sehr ruhig: ›Setz dich, Kitty.‹ Dann wandte sie sich an Onkel William und sagte: ›Ich bitte dich! Du lebst nun lange genug in meinem Haus, um zu wissen, dass ich es nicht dulde, wenn an meinem Tisch obszöne Worte gesprochen werden. Abgesehen davon solltet ihr alle wissen, dass dieses Uhrgewicht alle fünfzehn Jahre herunterfällt.‹ Onkel William sagte ›Ja, Mutter‹, und bis zum Ende der Mahlzeit sprach keiner mehr ein Wort.«
»Nach dem Dinner öffneten Sie die Tür der Großvateruhr«, sagte Mr. Campion, »und stellten fest, dass das Uhrgewicht heruntergefallen war. So forschen alle großen Detektive – schnell und treffsicher.«
Sie nickte. »Auf dem Boden der Uhr war eine ziemliche Delle im Holz. Ich fragte Alice – sie ist das Hausmädchen, auch schon seit fünfunddreißig Jahren –, und Alice sagte, dass die Großtante ganz recht habe, das Gewicht sei zuletzt vor fünfzehn Jahren heruntergefallen. Alice war die Letzte, die das Gewicht sah, bevor es verschwand. Ich weiß, das hört sich alles nicht besonders wichtig an«, fuhr sie rasch fort, »aber ich muss die Dinge in der richtigen Reihenfolge erzählen, sonst kommen wir durcheinander.«
In diesem Moment wurde sie durch die Ankunft von Lugg unterbrochen, jetzt in einer prächtigen grauen Wolljacke. Er schob einen Teewagen vor sich her, auf dem eine Mischung der von ihm selbst am meisten geschätzten Delikatessen aufgebaut war.
»So, da wären wir«, verkündete er mit verzeihlichem Stolz. »Shrimps in Butter, Relish, Eier und ein schönes Stück Schinken. Ich habe Tee gemacht. Ich selbst bevorzuge zwar Kakao, aber ich habe Tee gemacht. Hoffe, dass es Ihnen schmeckt.«
Campion winkte ihn hinaus, und er verschwand, hörbar etwas von Undankbarkeit murmelnd.
»Aus Ihrer Beschreibung der Verhältnisse in Socrates Close schließe ich, dass man Lugg da auf alle Fälle heraushalten muss«, bemerkte Mr. Campion.
Joyce betrachtete ihn ernst. »Das wäre ratsam«, räumte sie ein. Während des Essens setzte sie ihre Geschichte fort. Ihr Gesicht wirkte lebhaft, aber ihre Sorge befreite sie von dem Verdacht der Sensationslüsternheit.
»Onkel Andrew verschwand am Sonntag«, sagte sie. »Wenn Sie unseren Haushalt kennen würden, wüssten Sie, dass das an sich schon merkwürdig genug ist. Sonntag ist nämlich der Tag, wo uns Großtante Caroline praktisch von früh bis spät unter Aufsicht hat, und wenn sich jemand unbemerkt davonmachen wollte, wäre der Sonntag der ungünstigste Zeitpunkt dafür. Diesmal durfte ich im Brougham fahren. Großtante Caroline steigt nicht vor Ende Mai auf den Victoria um. Natürlich mussten wir zwanzig Minuten vor den anderen losfahren, und danach machen sie normalerweise eine kleine Rundfahrt, so dass sie etwas nach dem Pferdewagen zurückkommen. An diesem Sonntag waren Tante Julia und Tante Kitty schon zurück, als wir eintrafen«, fuhr sie fort. »Großtante Caroline war darüber ziemlich ärgerlich, denn sie meint, ein bisschen Herumfahren tue ihnen nur gut. Sie erkundigte sich nach den anderen, und Tante Julia sagte, dass Onkel William und Onkel Andrew zu Fuß nach Hause gehen wollten. Das war an sich schon sonderbar genug, weil die beiden Alten schon seit über einer Woche miteinander auf Kriegsfuß standen. Immerhin war Großtante daran sehr interessiert. Sie meinte, dass die Betätigung ihnen vielleicht gut tun würde und dass sie dabei lernen könnten, sich wie Gentlemen zu benehmen und nicht wie zwei Milizoffiziere. Sie war dann allerdings ziemlich verärgert, als sie zum Lunch noch nicht da waren, obwohl Tante Kitty und ich den Beginn des Mittagessens so lang wie möglich hinausgezögert hatten.
Wir waren etwa zur Hälfte mit der Mahlzeit fertig, als Onkel William hereinkam. Er war wütend und erhitzt vom eiligen Marsch; außerdem schien er sehr überrascht zu sein, dass Onkel Andrew nicht schon vor ihm eingetroffen war. Soweit wir seinem Bericht entnehmen konnten, hatte Onkel Andrew darauf bestanden, von der Kirche zu Fuß nach Hause zu gehen, während Onkel William eigentlich keine große Lust dazu hatte, und dann hatte er ihn auch noch auf einen lächerlichen Umweg geführt – ich glaube, Onkel William sagte, über Sheep’s Meadow. Schließlich hatten sie sich furchtbar über die Route gestritten.«
Sie hielt inne und schaute den jungen Mann entschuldigend an.
»Sie wissen, über was für alberne Dinge zwei Menschen streiten, die einander nicht ausstehen können.«
Er nickte verständnisvoll, und sie fuhr fort.
»Onkel William bereute jetzt natürlich, was in dem Streit gesagt worden war, weil ein solcher Streit immer sehr albern klingt, wenn man ihn jemandem schildert. Aber es schien allein Onkel Andrews Schuld gewesen zu sein – das jedenfalls behauptete Onkel William. Onkel Andrew wollte über Grantchester nach Hause gehen, was natürlich ein gewaltiger Umweg gewesen wäre. Onkel William war kalt geworden, und er hatte Hunger, daher sagte er zuletzt – oder er behauptete, dass er es gesagt hätte«, korrigierte sie sich rasch, »–›Geh du deiner eigenen verdammten Wege, Andrew, und rutsch mir den Buckel runter! Ich nehme den Weg, den ich für richtig halte.‹ Also trennten sie sich, und Onkel William kam zurück, im Gegensatz zu Onkel Andrew. Er ist seither nicht wieder aufgetaucht. Ich meine, er ist einfach verschwunden – nirgends ein Zeichen von ihm. Er kann nicht weit gegangen sein, weil er kein Geld dabei hatte. Das weiß ich, weil er sich von Tante Kitty eine halbe Crown für die Kollekte geborgt hat, und außerdem gibt ihm Großtante Caroline sowieso kein Geld in die Hand, weil er es sonst sofort zum Buchmacher trägt.«
»Eine Tatsache, die Sie nicht übersehen dürfen«, sagte Mr. Campion hilfreich. »Vielleicht hat er etwas gewonnen. Das kommt schließlich vor.«
»Oh, aber das war nicht der Fall – nicht bis dahin!« Das Mädchen sprach mit großem Nachdruck. »Sehen Sie, das ist ja noch nicht die ganze Geschichte. Großtante Caroline ist der Ansicht, dass Pferdewetten nicht nur verrucht, sondern, und das gibt den Ausschlag, auch ziemlich vulgär sind. Um uns die unangenehmsten Szenen zu ersparen, taten wir alles, um Onkel Andrews kleine Investitionen so weit wie möglich zu verschweigen; immer, wenn Großtante Caroline etwas Derartiges zu Ohren kam, gab es eine fürchterliche Szene. Onkel Andrew verlor dann die Beherrschung und gab ihr heraus mit kleinen Sticheleien und Frechheiten, bis sie endgültig zornig wurde und ihn in sein Zimmer schickte wie einen Schuljungen. Dann musste er wirklich gehen. Ich nehme an, für einen Außenstehenden klingt das alles ziemlich furchtbar«, fügte sie hinzu.
»Ganz und gar nicht«, sagte Mr. Campion höflich. »Erzählen Sie weiter.«
»Nun, normalerweise mache ich jeden Abend eine Runde durch die Schlafzimmer, um zu kontrollieren, ob Alice die Betten ordentlich aufgedeckt hat. Natürlich hat sie das immer, aber Großtante Caroline mag es, wenn ich kontrolliere. Als ich am Sonntagabend in Onkel Andrews Zimmer kam, lagen zwei fertige Briefe auf dem Tisch, bereits im Umschlag, adressiert und mit Briefmarke versehen, und einer, der erst zur Hälfte geschrieben war und an dem er, wie ich annehme, gesessen hat, als die Glocke zum Kirchgang läutete. Sehen Sie, deshalb kann er gar nicht vorgehabt haben, einfach zu verschwinden. Man geht nicht weg, lässt fertige Briefe liegen und einen weiteren zur Hälfte geschrieben auf dem Tisch. Ich habe die zwei Briefe, die er fertig hatte, abgeschickt, und den dritten, unfertigen, unter die Schreibunterlage gesteckt. Einer der Briefe, die ich abschickte, war an seinen Buchmacher gerichtet, an den anderen Adressaten erinnere ich mich nicht mehr. Als er am Montagmorgen nicht zurück war, verhielt sich die Großtante äußerst streng und zurückhaltend. ›Schlechtes Blut, Joyce‹, sagte sie zu mir. ›Kein Gefühl für Disziplin. Sag deinem Onkel Andrew, er solle zu mir in den Salon kommen, sobald er hier eingetroffen ist.‹ Tante Julia und Tante Kitty schwiegen die meiste Zeit. Ich glaube, Tante Kitty sagte etwas von ›Armer, verirrter Andrew‹, aber daraufhin stürzte sich Tante Julia wie eine Tonne Ziegelsteine auf sie. Onkel William gab sich übertrieben nett und tugendsam. Ich glaube, er ist sehr froh, dass Onkel Andrew weg ist. Er kann jetzt endlich so aufgeblasen sein, wie er will, ohne von Onkel Andrew verspottet zu werden. Aber gegen Ende der Woche waren wir dann doch alle ziemlich beunruhigt, und am Sonntag sprach Tante Julia erstmals davon, dass man zur Polizei gehen und ein SOS oder was auch immer senden sollte, wenn es etwas Derartiges gebe. Doch Großtante Caroline entsetzte allein schon der Gedanke an die Polizei, und Onkel William war auf ihrer Seite. Sie meinte, es sei schließlich undenkbar, dass Onkel Andrew das Gedächtnis verloren habe, das sei noch bei niemandem, der auch nur in weitläufigster Verbindung mit den Faradays stand, jemals vorgekommen. Die Großtante sagte, sie habe nie die Polizei im Haus gehabt und wolle sie auch jetzt nicht im Haus haben, aber wenn Tante Julia wirklich beunruhigt sei, könne sie ja an die anderen Verwandten schreiben und taktvoll nachfragen, ob sie Andrew gesehen hätten. Tante Kitty bewirkte eine kleine Sensation mit dem Geständnis, dass sie das bereits getan habe, schon am Dienstag nach dem Verschwinden von Onkel Andrew, und dass niemand etwas von ihm gehört hätte. Damit wurde die Sache vorläufig fallen gelassen.
Dann, am Montag …« – das Mädchen sprach jetzt rascher, und ihre Wangen waren stark gerötet – »… ereigneten sich zwei sehr seltsame Dinge. Erstens kam ein Telegramm für Onkel Andrew. Alice brachte es direkt zu mir, denn es gab eine Vereinbarung mit Onkel Andrew, damit die Großtante nichts vom Buchmacher erfuhr. Dementsprechend ging jedes Telegramm, wenn er nicht im Hause war, direkt an mich. Ich öffnete es, und darin stand: ›Fliegender Teppich gewonnen 75-1 Gratulation. Scheck folgt. Syd.‹
Da es vom Buchmacher stammte, half es uns nicht viel weiter, also legte ich es in seine Schreibtischschublade. Am nächsten Morgen musste ich den Brief mit dem Scheck abpassen.«
Sie hielt inne und schaute Mr. Campion mit unerschrockenen jungen Augen an. »Es war nicht nur Neugier«, sagte sie, »und ich habe ihn auch nicht über Dampf aufgemacht oder so etwas, sondern einfach mit dem Brieföffner. Sehen Sie, ich dachte, wenn es um eine kleine Summe ging, würde sich der Onkel nicht viel dabei denken und sich auch nicht die Mühe machen zurückzukommen und dabei einen furchtbaren Krach mit der Großtante riskieren. Aber wenn es eine größere Summe war, dachte ich, würde er den Gewinn in den Zeitungen nachschlagen, erkennen, wie viel er gewonnen hatte und das Geld kassieren, auch wenn er dabei mit einem Krach rechnen musste. Als ich den Scheck gesehen habe, bin ich erschrocken. Er war über eine Summe von fast siebenhundertfünfzig Pfund ausgestellt. Ich legte ihn zu dem Telegramm in die Schublade und fühlte mich von da an wesentlich glücklicher, weil ich wusste – ja, ich fühlte es mit Sicherheit –, dass Onkel Andrew im Lauf des Tages zurückkommen würde. Aber am Nachmittag geschah dann noch etwas Idiotisches, was mich irgendwie entsetzte, ich weiß auch nicht, warum. Ein Mann kam, um die Großvateruhr zu überprüfen. Es gab eine Verzögerung, und man stellte fest, dass das Uhrgewicht verschwunden war.«
Jetzt schaute sie den jungen Mann skeptisch an. »Ich nehme an, das klingt alles furchtbar trivial.«
Mr. Campion lehnte sich in seinem Sessel zurück und betrachtete sie ernst durch seine Brille.
»Nein«, sagte er. »Nein, ich pflichte Ihnen vollkommen bei. Das ist wirklich eine scheußliche Sache, die da passiert ist. Natürlich haben Sie danach gesucht, nehme ich an. Haben jeden im Haus danach gefragt, nicht wahr?«
»O ja, natürlich. Wir haben überall danach gesucht. Aber wir haben das Gewicht nicht gefunden, und, wissen Sie, eigentlich verliert man so etwas nicht so leicht.«
Campion nickte. »Das ist sehr interessant«, sagte er. »Wann haben Sie sich entschlossen, in dieser Angelegenheit Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen?«
»Gestern. Ich habe den ganzen Montagabend gewartet, und den Dienstag, und gestern noch den Vormittag, und meine Sorge ist immer größer geworden. Ich ging zur Großtante, doch die blieb hart, was die Polizei betraf. Schließlich gelang es mir, sie zu überreden, dass wir die Sache in Marcus’ Hände legen. Er war natürlich furchtbar erhaben über solche Affären, aber zum Schluss hat er mir dann Ihre Adresse gegeben, und da bin ich.«
»Ach ja, Marcus«, sagte Mr. Campion. »Wie gehört der eigentlich dazu? Er ist noch ein bisschen jung und unreif, um schon der Familienanwalt der Faradays zu sein, nicht wahr?«
Das Mädchen lächelte. »Das ist er vermutlich«, stimmte sie ihm zu, »aber sagen Sie ihm das bloß nicht! Genau gesagt, ist der alte Hugh Featherstone der Anwalt von Großtante Caroline, aber er ist schon sehr betagt, also macht Marcus praktisch die ganze Arbeit.«
»Ich verstehe«, sagte Mr. Campion. »Und warum wollen Sie nun Onkel Andrew finden?«
Die Frage erschreckte sie, weil sie so unvermittelt kam, und ihre Antwort erfolgte erst nach kurzem Zögern.
»Ich selbst habe offen gestanden keinen besonderen Anlass dazu«, sagte sie schließlich. »Das heißt, keinen persönlichen, wenn Sie das gemeint haben sollten. Onkel Andrew ist alles andere als ein liebenswürdiger Mensch. Aber das sind sie eigentlich alle nicht, ausgenommen vielleicht die arme Tante Kitty oder Großtante Caroline selbst in ihrer erschreckenden und beeindruckenden Art. Das Haus ist ruhiger ohne Andrew. Aber ich will ihn finden, weil ich Angst habe. Ich will wissen, dass es ihm gut geht und dass nicht etwas ganz Schreckliches geschehen ist.«
»Ich verstehe«, sagte Mr. Campion langsam. »Vermutlich haben Sie bereits einige Schritte unternommen – ich meine, haben Sie schon irgendwelche Nachforschungen angestellt? Haben sich nach ihm umgesehen? Er hat sich doch nicht seinen Knöchel verstaucht und liegt in einem Graben, und er ist auch nicht im Boar oder irgendeinem anderen Pub versumpft?«
Sie schaute ihn vorwurfsvoll an. »Natürlich habe ich nachgefragt«, sagte sie. »Aber glauben Sie mir, es gibt absolut keine Spur von ihm. Ich habe es zwar vermieden, Aufsehen zu erregen, wissen Sie, weil … Nun ja, Gerüchte verbreiten sich in Orten wie Cambridge mit Windeseile, auch ohne dass man sich besonders darum bemüht. Sie finden es wohl ziemlich töricht von mir, dass ich mit so wenig Konkretem zu Ihnen komme. Aber ich weiß nicht … Ich fürchte …«
Mr. Campion nickte. »Sie fürchten, dass ihm etwas anderes, Ernsthafteres als ein gewöhnlicher Unfall zugestoßen ist«, sagte er und fügte mit entwaffnender Offenheit hinzu: »Außerdem denken Sie dabei an etwas ganz Bestimmtes, habe ich recht? Jetzt kann es der Inspector nicht hören – wollen Sie es mir nicht sagen? Wer war der Mann in dem kleinen Innenhof, der Ihnen einen solchen Schrecken eingejagt hat?«
Das Mädchen wandte sich ihm zu, und ihre Wangen waren sehr rot.
»Sie haben recht«, sagte sie. »Ich habe vorhin gelogen. Ich habe ihn tatsächlich erkannt. Aber er hat nichts mit dieser Sache zu tun. Bitte vergessen Sie alles, was mit ihm in Zusammenhang steht.«