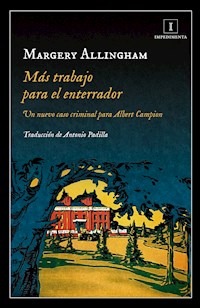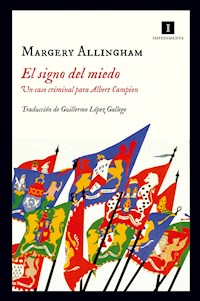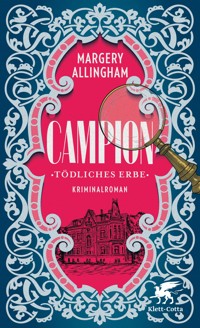
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Campion
- Sprache: Deutsch
»Margery Allingham sticht heraus wie ein Licht in der Dunkelheit.« Agatha Christie Die große Wiederentdeckung der Legende des Golden Age of Crime Albert Campion. Einer der cleversten Detektive der Krimiliteratur Die Familie Gyrth ist im Besitz eines legendären Kelches. Sein Alter, seine Schönheit und die Legenden, die sich um ihn ranken, machen ihn unersetzlich. In einer fensterlosen Kapelle aufbewahrt, sollte er vor Diebstahl sicher sein. Aber als Percival, der derzeitige Erbe der Familie und der Hüter des Kelches, Opfer eines verpfuschten Entführungsversuchs wird, ahnt er, dass der Schatz sich in Gefahr befindet. Albert Campion ist mit seiner dünnen, blassen Erscheinung nicht gerade eine imposante Figur. Er wirkt, als wäre er seinen Klienten keine große Hilfe. Aber der Schein trügt, denn er ist einer der besten Detektive, die England je kannte. Als Percival sich an ihn wendet, enthüllt Campion, dass der Familienkelch von einem skrupellosen Ring reicher Diebe ins Visier genommen wurde, die ihre privaten Kunstsammlungen aufstocken wollen. In Suffolk, auf dem Familiensitz der Gyrths, werden Campion und sein treuer Assistent Magersfontein Lugg mit albtraumhaften Ereignissen konfrontiert. Als Percivals Tante tot aufgefunden wird, mit einem Ausdruck des Entsetzens auf dem Gesicht, muss Campion nicht nur die Sicherheit des Kelches, sondern auch die der Familie Gyrth gewährleisten. Er mag daran gewöhnt sein, Kriminelle zu überlisten, aber kann Campion auch einer der reichsten Gangs der Welt auf die Schliche kommen und diesen Fall lösen? »Fangen Sie nicht an, diese Bücher zu lesen, wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie mit der Sucht auch umgehen können« - Independent »Die wahre "Queen of Crime"«- Guardian »Allingham fängt ihren Detektiv Albert Campion perfekt ein... Für alle, die klassische Krimis lieben« - Daily Express »Ein herausragendes Werk - originell, clever, verblüffend« - Daily Telegraph
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Margery Allingham
Campion
•Tödliches Erbe•
KRIMINALROMAN
Aus dem Englischen von Edith Walter
KLETT-COTTA
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Look To The Lady« im Verlag Jarrolds Publishing, London
© International Literary Properties UK Limited, through its subsidiary Worldwrites Holdings Limited, 1931
Für die deutsche Übersetzung
© 1990 Diogenes Verlag AG Zürich
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: © Zero-Media.net, München
Illustration: © FinePic®, München
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP – Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96675-6
E-Book ISBN 978-3-608-12385-2
•1•
»Wenn Sie das hier annehmen, Sir«, sagte der Polizist, während er dem heruntergekommenen Mann einen Schilling in die Hand drückte, »haben Sie einen Nachweis, dass Sie nicht mittellos sind, und ich muss Sie nicht festnehmen. Aber ich muss Sie bitten weiterzugehen«, fügte er leicht verlegen hinzu. »Der Inspektor kann jeden Moment hier vorbeikommen.«
Percival St. John Wykes Gyrth, einziger Sohn des Baronet Colonel Sir Percival Christian St. John Gyrth, des Herrn von Tower bei Sanctuary in der Grafschaft Suffolk, wurde rot vor Scham, steckte die Münze in die Hosentasche und lächelte seinen Wohltäter an.
»Danke, Baker«, sagte er. »Das ist wirklich sehr nett. Ich werde es Ihnen nicht vergessen. Und wo, zum Teufel, kann ich mich hinsetzen, ohne verjagt zu werden?«
Der Polizeibeamte blickte nervös die South Molton Street hinauf und sah den Inspektor bereits herankommen.
»Ebury Square – gleich an der Southampton Row«, murmelte er hastig. »Dort sind Sie hundertprozentig sicher. Gute Nacht, Sir.«
Damit war das Gespräch beendet; der Inspektor hatte die beiden inzwischen fast erreicht. Val Gyrth schob seinen schäbigen Hut tief in die Stirn, zog die Schultern hoch und trottete in Richtung Oxford Street. Der Nachweis, dass er nicht mittellos war, hüpfte einsam in der einzigen unversehrten Tasche seines Anzugs, eines Anzugs, den ihm einst ehrfürchtig der Schneider überreicht hatte, an dessen Laden er gerade vorbeiging. Er betrat die Oxford Street und strebte dem Oxford Circus zu.
Es war kurz nach Mitternacht, und die breite Straße lag fast leer da. Nur ein paar heimkehrende Nachtschwärmer waren zu sehen, hier und da ein Taxi und gelegentlich ein Bus.
Val Gyrth hielt sich nach Möglichkeit im Schatten der Häuser. Der Sommergeruch der Stadt, vertraut, warm und ein wenig an eine Drogerie erinnernd, stieg ihm in die Nase, und trotz seiner Müdigkeit schritt er rasch aus. Er machte sich die bittersten Vorwürfe. Die Situation war unmöglich, verfahren und lächerlich. Der alte Baker hatte ihm einen Schilling geschenkt, um ihn davor zu bewahren, an seiner eigenen Schwelle als Landstreicher festgenommen zu werden. Unvorstellbar!
Er hatte seit dem vergangenen Abend nichts gegessen, doch an der Imbissstube, die an seinem Weg lag, ging er achtlos vorbei. Seit vier Uhr nachmittags verspürte er zu seinem Erstaunen keinen Hunger mehr. Das leichte Schwindelgefühl, das ihn stattdessen befallen hatte, erschien ihm bedeutend angenehmer.
Sein Fuß brannte dort, wo er durch ein Loch in der Sohle seines teuren Schuhs mit dem Pflaster in Berührung kam, und er begann zu hinken, als er schließlich auf einen schmuddeligen kleinen Platz einbog, dessen gepflasterter Mittelpunkt von zwei Reihen staubiger Platanen gesäumt wurde. Unter den Bäumen standen, umgeben vom Abfall eines langen Sommertages, mehrere wacklige Holzbänke, auf denen sich bereits einige zweifelhafte Gestalten niedergelassen hatten. Val Gyrth entschied sich für eine freie Bank, die etwas abgesondert unter einer Straßenlaterne stand. Er sank darauf nieder und spürte zum ersten Mal richtig, wie müde er war.
Er nahm den Hut ab und fuhr sich mit den Fingern durch das sehr helle Haar, über dessen zunehmende Länge er sich immer wieder ärgerte. Er war ein kräftiger junger Mann Mitte zwanzig mit einem vollen, keineswegs unschönen Gesicht und einem eigensinnigen Ausdruck; ein reiner angelsächsischer Typ, dessen starke Knochen durch eine unnatürliche Magerkeit noch hervorgehoben wurden.
Er seufzte, schlug den Kragen hoch und wollte gerade die Füße aus dem Durcheinander von Papiertüten, Orangenschalen und Zigarettenschachteln heben und auf die Bank legen, da stutzte er. Er richtete sich auf und starrte vor sich auf den Boden. Es überlief ihn siedend heiß. Ein Schreck durchfuhr ihn, der sein Herz unangenehm hämmern ließ.
Mitten unter all dem Abfall erblickte er seinen eigenen Namen auf einem zerfledderten Briefumschlag.
Er hob ihn auf und bemerkte erstaunt, dass seine Hand zitterte. Der Name war unverwechselbar: P. St. J. W. Gyrth, Esq. stand da deutlich in einer Handschrift, die er nicht kannte.
Er drehte das Kuvert um. Es war aus teurem Papier und leer. Am oberen Rand war es von einer anscheinend ungeduldigen Hand aufgerissen worden. Er starrte es eine Weile an und fühlte sich irgendwie unwirklich. Die Adresse war ihm völlig unbekannt: Kemp’s, 32a Wembley Road, Clerkenwell, EC l.
Er starrte die Wörter an, als müssten sie sich vor seinen Augen verwandeln, doch sie blieben klar und unmissverständlich. P. St. J. W. Gyrth, Esq.
Ihm fiel nicht ein, daran zu zweifeln, dass es sich um seinen eigenen Namen handelte und dass der Brief ursprünglich für ihn bestimmt gewesen war. Der Name Gyrth – an sich schon ungewöhnlich – zusammen mit dieser Ansammlung von Initialen ließ ihn gar nicht auf den Gedanken kommen, der Brief könnte an jemand anderen gerichtet sein.
Nachdenklich betrachtete er die Handschrift und versuchte, sie jemandem zuzuordnen. Sie gab ihm Rätsel auf. Sie war klar und eckig, mit dicken Abstrichen und scharfem griechischen E; eine individuelle Handschrift, nicht leicht zu vergessen. Er untersuchte den Poststempel, und seine Verwirrung wandelte sich in blankes Erstaunen. Der Stempel war vom 15. Juni. Heute war der 19. Juni. Der Brief war also nur vier Tage alt.
Val besaß seit über einer Woche keine Adresse mehr. Und doch war er sicher, obwohl es ihm etwas unheimlich vorkam, dass jemand ihm geschrieben hatte und jemand anderes den Brief erhalten und den Umschlag weggeworfen hatte, damit er ihn finden sollte.
Er sah sich noch einmal die Adresse auf dem rätselhaften Kuvert an: 32a Wembley Road, Clerkenwell. Das war nicht weit von dem Platz entfernt, wo er gerade saß, und der Drang hinzugehen, um herauszufinden, ob es etwa noch einen P. St. J. W. Gyrth auf der Welt gab, wurde sehr stark.
Eigentlich war er ein konservativer Mensch, und unter normalen Umständen hätte er die Sache vielleicht mit einem Achselzucken abgetan. Aber im Moment war er völlig auf den Hund gekommen. Ein Mann, der buchstäblich haltlos ist, ist wie ein Strohhalm im Wind: der geringste Lufthauch genügt, ihn in eine neue Richtung zu treiben. Zeit und Energie haben keinen Wert, alles ist der Mühe wert. Von Neugier getrieben stand er daher auf und überquerte den Platz.
Clerkenwell nach Mitternacht ist eine der scheußlichsten Gegenden im Osten Londons, und die abgerissene und heruntergekommene Erscheinung des jungen Mannes erregte bei den wenigen Leuten, die noch unterwegs waren, keinerlei Aufmerksamkeit.
Er entdeckte zwei Polizisten, die er nach dem Weg fragte. Dabei hielt er krampfhaft den Schilling umklammert, den ihm ihr Kollege geschenkt hatte. Sie erklärten ihm gemächlich den Weg, und schließlich überquerte er eine schmutzige, schlecht beleuchtete Straße, gesäumt von niedrigen Häusern und schäbigen kleinen Läden, deren verstaubte Auslagen alle aus zweiter Hand zu stammen schienen.
Nummer 32a war eins der wenigen Etablissements, die noch offen hatten.
Es handelte sich um ein nicht sehr vertrauenerweckendes Restaurant, dessen Eingang im Souterrain einen guten halben Meter tiefer als der Gehsteig lag. Sogar Val Gyrth, den eigentlich nichts mehr schreckte, zögerte, bevor er eintrat.
Die halbverglaste Eingangstür des Lokals war mit billiger Reklame für Schuhcreme und Karamellbonbons beklebt, und das Licht von drinnen drang nur schwach durch das schmutzige Ölpapier.
Gyrth warf noch einmal einen Blick auf den Briefumschlag und fand, dass er zweifellos an der richtigen Adresse war. Die Nummer 32a stand auf einem weißen Emailschild über der Tür, und der Name Kemp’s war in halbmeterhohen Lettern an der Hausfront angebracht.
Abermals kam ihm die Absurdität seines Tuns zu Bewusstsein, und er zögerte, doch dann wiederholte er sich, dass er nichts zu verlieren und nur seine Neugier zu stillen hatte. Er drehte den Türknauf und stieg in den Raum hinab.
Drinnen war die stickige Luft so von Dampf erfüllt, dass er einen Moment lang nicht sehen konnte, wo er sich befand. Er blieb kurz stehen und versuchte, in dem Dunst etwas zu erkennen. Schließlich machte er einen langen, tristen Raum mit hohen schmierigen Nischen an den Seiten aus, in denen aber anscheinend niemand saß.
Am Ende des Ganges zwischen den Tischen befanden sich ein Tresen und ein Herd, der das meiste zur Beschaffenheit der Atmosphäre beitrug. Auf diesen gastronomischen Altar schritt nun der junge Mann zu, den Briefumschlag in der Manteltasche fest umklammernd.
Da niemand zu sehen war, klopfte er zaghaft auf die Theke. Im nächsten Moment wurde eine Tür rechts neben dem Herd aufgerissen, und es erschien ein Koloss von einem Mann mit dem größten und traurigsten Gesicht, das Val je gesehen hatte. Der Mann hatte statt einer Schürze ein kleines Tischtuch vorgebunden, und seine mächtigen muskulösen Arme waren bis zu den Ellbogen entblößt. Im Übrigen war er kahlköpfig, und sein Nasenbein hatte einen nicht wieder gutzumachenden Schaden erlitten.
Er betrachtete den jungen Mann aus kummervollen Augen.
»Eine schöne Zeit, sich auf einen Happen Essen zu besinnen«, bemerkte er, mehr bekümmert als wütend, mit Grabesstimme. »Alles ist aus, außer Wurst und Kartoffelbrei. Ich esse gerade den letzten Rest Gulasch.«
Gyrth fühlte sich von dieser melancholischen Leutseligkeit beruhigt. Es war einige Zeit her, seit ein Wirt ihn mit so etwas wie Höflichkeit behandelt hatte. Er zog das Kuvert aus der Tasche und legte es vor den Mann auf den Tresen.
»Sehen Sie sich das bitte einmal an«, sagte er. »Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?«
Kein Muskel in dem traurigen Gesicht regte sich. Der Koloss beäugte das Kuvert eine Zeit lang, als habe er etwas Derartiges noch nie gesehen. Dann drehte er sich plötzlich zu dem jungen Mann um, schaute ihm fest in die Augen und gab ihm eine unter diesen Umständen höchst ungewöhnliche Antwort.
»Wie ich sehe«, sagte er deutlich und eine Spur zu bedächtig, »nehmen Sie den langen Weg.«
Gyrth starrte ihn an. Er spürte, dass eine Antwort von ihm erwartet wurde, dass die Worte eine Bedeutung besaßen, deren Sinn er nicht begriff. Er lachte verlegen.
»Ich verstehe nicht ganz«, sagte er. »Oder meinen Sie damit, dass ich herumvagabundiere? Aber ich wollte mich über den Brief erkundigen. Haben Sie ihn schon einmal gesehen?«
Der Dicke brachte die Andeutung eines Lächelns zustande, so gut es ihm seine Gesichtszüge gestatteten.
»Und wenn?«, fragte er vorsichtig. »Was dann?«
»Er ist zufällig an mich gerichtet, und ich möchte gern wissen, wer ihn geöffnet hat«, entgegnete Gyrth kurz.
»Ist das Ihr Name?« Der Dicke legte den massigen Zeigefinger auf die Adresse. »Beweisen können Sie’s wohl nicht, oder?«
Gyrth wurde rot vor Verlegenheit.
»Ich kann niemanden beibringen, der mich identifiziert, falls Sie das meinen, und ich habe keine Visitenkarte bei mir. Aber«, fügte er hinzu, »falls Sie so freundlich wären, meinem Schneider zu glauben – hier in meiner Jacke ist ein Namensschildchen.«
Er knöpfte das fadenscheinige Kleidungsstück auf, bog den Rand der inneren Brusttasche um und zeigte das Webetikett vor, auf dem mit Tinte sein Name und das Datum vermerkt stand. In seinem Eifer fiel ihm das Absurde der Situation gar nicht auf.
Der traurige Mann las das Etikett und musterte seinen Besucher eingehend.
»Wurde das auch wirklich für Sie gemacht?«, fragte er.
Gyrth knöpfte die Jacke wieder zu.
»Ich bin dünner geworden«, antwortete er knapp.
»Na schön. Nichts für ungut. Ich glaube Ihnen. Andere würden es nicht tun. Ich heiße Lugg. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Übrigens, ich habe noch einen Brief für Sie.«
Er drehte sich schwerfällig um, kramte zwischen den Tellern und Tassen auf einem Regal und zog ein Kuvert hervor, das dem, welches Gyrth auf die Theke gelegt hatte, glich wie ein Ei dem anderen. Es war noch ungeöffnet.
Völlig verwirrt nahm der junge Mann es entgegen. Er wollte gerade das Siegel erbrechen, als der Wirt, der sich eben mit solcher Freundlichkeit vorgestellt hatte, ihm auf die Schulter klopfte.
»Setzen Sie sich erst mal hin«, empfahl er. »Ich bringe Ihnen einen Schluck Kaffee und ’ne heiße Bockwurst. Um diese Zeit – in der Nacht wird mir auch immer ganz flau.«
»Ich habe bloß einen Schilling –«, begann Gyrth verlegen.
Lugg zog die Brauen hoch.
»So?«, sagte er. »Na, setzen Sie sich ruhig, mein Junge. Bei mir kriegen Sie schon für sechs Pence ein Festessen. Dann können Sie immer noch nachweisen, dass Sie nicht mittellos sind, und zwei Pence für Notfälle bleiben Ihnen auch noch.«
Er tat, wie ihm geheißen, schob sich auf eine der schmierigen Bänke und setzte sich vor einen sauber gedeckten Tisch. Mit ungeschickten Fingern riss er das dicke Kuvert auf. Der Geruch im Lokal hatte seinen Hunger wieder geweckt und er hatte scheußliche Kopfschmerzen.
Drei Dinge fielen auf den Tisch: zwei Pfundnoten und eine geprägte Visitenkarte. Fassungslos starrte er auf die Karte. Da stand:
Mr. Albert Campion
zu Hause
Darunter, in der bekannten eckigen Schrift:
Jeden Abend nach zwölf Uhr.
Förderliche Konversation.
Bier, gepflegte Weine und kleine rosa Kuchen.
Bitte kommen Sie!
Die Adresse war gedruckt:
17 Bottle Street, W1
(Eingang links vom Polizeirevier)
Auf der Rückseite standen hingekritzelt die Worte: Verzeihen Sie bitte die Formlosigkeit des Darlehens. Kommen Sie, sobald Sie können. Es ist wichtig. Seien Sie vorsichtig. A. C.
Val Gyrth drehte die Karte um und um. Die ganze Geschichte wurde immer unheimlicher.
Er grübelte noch über die ungewöhnliche Botschaft nach, als der düstere, ebenfalls etwas unheimliche Lugg erschien und etwas brachte, was er sich anscheinend unter einem Festmahl vorstellte. Val aß, was ihm vorgesetzt wurde, mit einem wachsenden Gefühl der Dankbarkeit. Als er fertig war, blickte er zu dem Mann auf, der noch immer neben ihm stand.
»Hören Sie mal«, sagte er, »haben Sie je etwas von einem Mr. Albert Campion gehört?«
Die kleinen Augen des Mannes betrachteten ihn ernst.
»Kommt mir bekannt vor«, antwortete er. »Ich weiß aber nicht, wo ich ihn hintun soll.«
Sein ausdrucksloses Gesicht verriet, dass weitere Fragen zwecklos waren. Val nahm die beiden Banknoten und die Karte in die Hand.
»Woher wissen Sie«, sagte er plötzlich, »dass ich der Mann bin, für den der Brief bestimmt ist?«
Lugg schaute ihm über die Schulter auf das andere Kuvert.
»Das ist doch Ihr Name, oder?«, fragte er. »Jedenfalls ist das der Name in Ihrer Jacke. Sie haben ihn mir gezeigt.«
»Ja, ich weiß«, sagte Val geduldig. »Aber woher wissen Sie, dass ich Percival St. John Wykes Gyrth –«
»Himmel! Alle die Namen stecken dahinter?«, staunte Lugg. »Damit haben Sie Ihre Frage selbst beantwortet, mein Junge. Es gibt keine zwei Mütter, die ihrem Balg so etwas auf den Lebensweg mitgeben. Stimmt schon, das ist Ihre Einladung. Keine Bange. Ich würde mich ranhalten – es wird spät.«
Gyrth betrachtete noch einmal die Karte. Einfach verrückt. Und doch war er schon so weit gegangen, dass es ihm unlogisch erschien, jetzt noch einen Rückzieher zu machen. Wie um sich selbst den Rückweg abzuschneiden, bezahlte er das Essen aus seinem neu erworbenen Vermögen, gab dem Wirt ein verschwenderisches Trinkgeld, wünschte ihm eine gute Nacht und verließ das leere Restaurant.
Erst draußen vor der Tür begann er zu überlegen, wie er wohl das Transportproblem lösen könnte. Zum Piccadilly waren es quer durch die Stadt gute drei Meilen, und obwohl er seinen Hunger gestillt hatte, war er immer noch todmüde. Außerdem war es schon sehr spät und es hatte in Strömen zu regnen begonnen.
Während er noch unentschlossen dastand, hörte er das leise Geräusch von Autoreifen hinter sich.
»Taxi, Sir?«
Val drehte sich langsam um, nannte dem Fahrer die Adresse, die auf der Karte stand, und stieg ein.
Als er in die Polster sank, überkam ihn ein wohliges Gefühl. Das Taxi fuhr schnell durch die nass glänzenden Straßen, die er vor weniger als einer Stunde müde entlanggestapft war.
Ein paar Minuten lang dachte er über die ungewöhnliche Einladung nach, die er so blindlings angenommen hatte.
Noch einmal zog er die Karte aus der Tasche und beugte sich vor, um sie im Schein der Taxameterbeleuchtung zu lesen. Er konnte gerade noch die hingekritzelten Worte Kommen Sie, sobald Sie können. Es ist wichtig. Seien Sie vorsichtig! erkennen.
Aus dem letzten Satz wurde er nicht recht klug. Unter den gegebenen Umständen kam ihm der Rat so albern vor, dass er fast gelacht hätte.
Genau in diesem Moment bog das Taxi nach rechts in die Gray’s Inn Road ein – und da erst fiel ihm ein, dass die Chancen, um drei Uhr früh in der Wembley Road in Clerkenwell zufällig ein Taxi zu bekommen, eins zu einer Million standen und dass es ziemlich unwahrscheinlich war, dass ein Taxifahrer ihn in seinem gegenwärtigen Aufzug für einen zahlungskräftigen Fahrgast halten könnte. Sein Herz begann heftig zu klopfen, er beugte sich vor und fuhr mit der Hand an der Wagentür entlang. Es gab keine Türgriffe. Auch die Fenster schienen verriegelt zu sein.
Ziemlich erschrocken klopfte er heftig an die Trennscheibe zwischen sich und dem Fahrer.
Der Fahrer beugte sich über das Lenkrad und trat schwer auf das Gaspedal.
•2•
Val saß im Halbdunkel auf der Sitzkante und spähte hinaus. Seiner Schätzung nach fuhr das alte Taxi mit einer Geschwindigkeit von rund dreißig Meilen in der Stunde. Die regennassen Straßen waren leer, und er merkte, dass sie in die falsche Richtung fuhren.
Entweder war der Fahrer betrunken oder taub. Wieder trommelte er an das Glas und versuchte, durch das Sprachrohr zu schreien.
»Ich will in die Bottle Street – gleich beim Piccadilly!«
Diesmal zweifelte er nicht daran, dass der Fahrer ihn gehört hatte, denn dieser schüttelte den Kopf und das Taxi schaukelte und schlingerte gefährlich. Val Gyrth musste sich mit der Situation abfinden, so absurd sie auch war. Er war ein Gefangener, der einem unbekannten Ziel entgegenfuhr.
In den letzten achtzehn Monaten hatte er sich in so manch unangenehmer Lage befunden, doch nie war rasches Handeln so nötig gewesen wie jetzt. Ein anderes Mal hätte er vielleicht gezögert, bis es zu spät war, doch heute war ihm alles egal, und er befand sich noch immer in der verwegenen Stimmung, die ihn dazu verleitet hatte, der Sache mit dem weggeworfenen Briefumschlag nachzugehen und die unkonventionelle Einladung des mysteriösen Campion anzunehmen. Überdies hatte die freundliche Bewirtung durch Lugg nicht nur seine Lebensgeister, sondern auch sein Temperament wiedererweckt.
In diesem Moment, als er in dem Taxi saß, war er ein gefährlicher Mensch, die Hände waren zu Fäusten geballt, der Unterkiefer trotzig vorgeschoben. Kaum war ihm der Einfall gekommen, da setzte er ihn auch schon entschlossen in die Tat um.
Er bückte sich und streifte den schweren Schuh mit der dünnen Sohle ab. Diese beachtliche Waffe umklammerte er mit der einen Hand, mit der anderen hielt er sich fest. Er war noch immer erstaunlich stark und legte seine ganze Kraft in den Schlag. Die Glasscheibe zersplitterte und sein Arm sauste wie ein Schmiedehammer auf den Kopf des Fahrers nieder.
Dann ließ er sich zu Boden fallen, rollte sich zusammen und bedeckte den Kopf mit den Armen. Die dicke Mütze des Fahrers hatte den Schlag gedämpft, aber der Angriff war so plötzlich gekommen, dass der Mann die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Taxi geriet auf der glitschigen Straße ins Schleudern, fuhr auf den Gehsteig und krachte gegen eine Steinbalustrade.
Der Zusammenstoß war furchtbar. Der Wagen prallte von der Balustrade ab, schwankte einen Moment lang und kippte dann seitwärts um.
Val wurde gegen das mürbe Verdeck des Wagens geschleudert, das unter seinem Gewicht riss. Er spürte warmes Blut aus einer Schnittwunde auf der Stirn über sein Gesicht fließen und hatte sich eine Schulter verstaucht, hatte sich aber nicht ernstlich verletzt. Er war immer noch aufgebracht, immer noch wütend. Er arbeitete sich durch die zerfetzte Plane hinaus und sah sich die Bescherung an.
Der Taxifahrer lag unter den Wrackteilen begraben und gab keinen Laut von sich. Doch die Straße blieb nicht lange leer. Fenster wurden geöffnet und von allen Seiten näherten sich Stimmen und eilige Schritte.
Val hatte keine Lust, zu bleiben und Fragen zu beantworten. Er wischte sich mit dem Ärmel das Blut vom Gesicht, zog den Schuh an, den er immer noch in der Hand gehalten hatte, und verschwand wie ein Schatten in einer Seitenstraße.
Den Rest des Weges legte er zu Fuß zurück.
Die einzelne blaue Laterne über dem Polizeirevier wirkte wenig einladend, doch die Tür von Nummer 17, gleich links daneben, stand einen Spalt breit offen. Er stieß sie behutsam auf.
Fast am Ende seiner Kräfte stieg er mühsam die Holztreppe hinauf und stand endlich vor einer geschnitzten Eichentür, an der auf einem schlichten kleinen Messingschild Mr. Albert Campion stand.
Bevor er den schönen florentinischen Türklopfer benutzen konnte, ging die Tür auf, und in der Öffnung erschien ein schmaler junger Mann mit blassem, harmlosem Gesicht und freundlichen Augen hinter riesigen horngefassten Brillengläsern, der ihn freundlich anlächelte. Er trug einen tadellosen Abendanzug, doch die Korrektheit seiner Erscheinung wurde ein wenig dadurch getrübt, dass er einen Bindfaden in der Hand hielt, an dem ein grellrosa Luftballon befestigt war.
Sobald er seinen Besucher erblickte, schien er sich dieses unpassenden Angebindes bewusst zu werden, denn er unternahm mehrmals den vergeblichen Versuch, den Ballon hinter seinem Rücken zu verbergen. Dann streckte er die Hand aus.
»Doktor Livingstone, nehme ich an?«, fragte er mit einer kultivierten, etwas hohen Stimme.
Val reichte ihm zutiefst verwirrt die Hand.
»Ich weiß nicht, wer Sie sind«, begann er. »Aber ich bin Val Gyrth, und ich suche einen Mann, der sich Albert Campion nennt.«
»In Ordnung«, sagte der Fremde, während er mit der Miene eines Mannes, der sich eines ärgerlichen Problems entledigt, den Luftballon zur Zimmerdecke entschweben ließ. »Das bin ich – meine Tür, mein Luftballon. Bitte treten Sie ein und nehmen Sie einen Drink. Sie sind spät dran – ich hatte schon Angst, dass Sie gar nicht mehr kommen.«
Er führte seinen Besucher durch einen schmalen Gang in ein kleines, aber sehr gemütlich und originell eingerichtetes Wohnzimmer. Val Gyrth sank in den Sessel, den ihm sein Gastgeber zurechtschob. Dieses unerwartete Ende seines nächtlichen Abenteuers, das an sich schon erstaunlich genug gewesen war, hatte ihm nun vollends die Sprache verschlagen. Er nahm den Drink, den ihm der blasse junge Mann in die Hand drückte, und begann wortlos daran zu nippen.
Campion schien erst jetzt die Schnittwunde an der Stirn seines Besuchers zu bemerken.
»Sie hatten also einigen Ärger beim Herkommen?«, erkundigte er sich besorgt. »Hoffentlich hat man Sie nicht zu hart angefasst.«
Val setzte das Glas ab, beugte sich vor und blickte seinem Gastgeber ins Gesicht.
»Hören Sie mal«, sagte er, »ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, und die ganze Geschichte kommt mir vor wie ein Märchen. Ich finde einen geöffneten, an mich gerichteten Briefumschlag mitten auf dem Ebury Square. Aus verrückter Neugier gehe ich der Sache nach. In Kemp’s Restaurant in Clerkenwell erwartet mich ein Brief von Ihnen, der zwei Pfundnoten und eine merkwürdige Einladungskarte enthält. Ich steige in ein Taxi, um hierherzufahren, und der Fahrer versucht mich zu entführen. Ich entgehe dem Desaster ziemlich angeschlagen, der Taxifahrer noch angeschlagener, und als ich hier ankomme, treffe ich Sie, der mit einem Luftballon spielt und über meine Angelegenheiten offenbar bestens informiert ist. Vielleicht bin ich verrückt – ich weiß es nicht.«
Campion schaute gekränkt drein.
»Das mit dem Ballon tut mir leid«, sagte er. »Ich war gerade von einer Galavorstellung im Athenaeum zurückgekehrt, als Lugg mich anrief und angekündigt hat, dass Sie auf dem Weg sind. Er ist heute Abend nicht da, deshalb musste ich Sie selbst hereinlassen. Darüber können Sie sich doch wohl nicht beschweren. Das mit dem Taxi klingt bös. Ich nehme an, Sie sind deshalb so spät gekommen?«
»Schon gut«, sagte Val, immer noch erregt. »Aber Sie müssen doch einsehen, dass ich eine Erklärung verlange, und Sie wissen ganz genau, dass Sie mir eine schulden.«
Da trat Mr. Albert Campion zur Seite, so dass das Licht der Leselampe, die hinter ihm auf dem Tisch stand, seinem Besucher voll ins Gesicht fiel. Er räusperte sich und sprach mit einer eigenartigen Bedächtigkeit, die sich von seinem vorherigen Tonfall gänzlich unterschied.
»Wie ich sehe, nehmen Sie den langen Weg, Mr. Gyrth«, sagte er ruhig.
Val zog fragend die Brauen hoch. Zum zweiten Mal heute Nacht hörte er diese schlichte Feststellung, und beide Male hatte der gleiche sonderbar fragende Ton darin mitgeschwungen.
Er starrte seinen Gastgeber verständnislos an, doch das Gesicht des blassen jungen Mannes blieb ganz ohne Ausdruck. Seine Augen hinter den dicken Brillengläsern waren nicht zu erkennen. Er stand regungslos da und wartete zweifellos auf eine Antwort, und Val wurde bewusst, dass er weniger denn je eine Ahnung hatte, was hier gespielt wurde.
•3•
Val Gyrth erhob sich.
»Der Mann bei Kemp’s hat das auch zu mir gesagt. Ich weiß nicht, was es bedeutet – und es muss etwas bedeuten. Was soll ich Ihnen darauf antworten?«
Campion änderte daraufhin sofort sein Verhalten. Er wurde liebenswürdig und charmant.
»Behalten Sie doch Platz«, bat er. »Ich schulde Ihnen eine Erklärung. Leider, wissen Sie, bin ich nicht der Einzige, der sich für Sie interessiert. Und warum ich mich für Sie interessiere, werde ich Ihnen auch erklären müssen. Doch wenn die Konkurrenz Sie zuerst erwischt hätte –«
»Dann?«, warf Val ein.
»Dann«, sagte Campion, »wüssten Sie eventuell über den langen Weg Bescheid. Doch nun, da wir miteinander sprechen können, möchte ich Ihnen mein Herz ausschütten – das heißt, wenn Sie nicht zuvor einen Tropfen Jod auf Ihre Wunde haben möchten.«
Val zögerte und sein Gastgeber fasste ihn unter.
»Ein bisschen warmes Wasser und ein Stückchen Mull aus meinem Verbandskasten werden Ihnen guttun«, sagte er. »Niemand kann aufmerksam einer guten Geschichte lauschen, wenn ihm ständig Blut in die Augen läuft. Kommen Sie.«
Nach zehn Minuten kehrten sie ins Wohnzimmer zurück und Campion füllte seinem Gast das Glas.
»Ich finde«, sagte er, »Sie sollten sich zuerst einmal diese Seite aus der Society Illustrated von letzter Woche ansehen. Es betrifft in gewisser Weise auch Sie.«
Er ging und holte aus einem Queen-Anne-Sekretär ein Exemplar der bekannten Illustrierten. Er schlug das Heft bei einem ganzseitigen Foto auf, das eine etwas dümmlich dreinschauende Frau über fünfzig zeigte, die eine moderne Version eines mittelalterlichen Gewandes trug und in den Händen einen herrlich geformten Kelch hielt. Der geschickte Fotograf hatte es verstanden, das Auge des Betrachters von den Unzulänglichkeiten der Dame weg auf den einmalig schönen Gegenstand in ihren Händen zu lenken.
Ein massiver Becher aus poliertem Gold, etwa 45 Zentimeter hoch, auf einem mit Edelsteinen besetzten Sockel. Die Bildunterschrift lautete: Eine charmante Priesterin und darunter ging es weiter:
Lady Pethwick, vor ihrer Verehelichung mit dem nunmehr verstorbenen Sir Lionel Pethwick allgemein als Miss Diana Gyrth bekannt, ist die Schwester von Colonel Baronet Sir Percival Gyrth, Besitzer des Tower bei Sanctuary in Suffolk und Hüter des uralten Kelches der Familie Gyrth. Unser Bild zeigt Lady Pethwick mit dem kostbaren Kleinod, das aus vornormannischer Zeit stammen soll. Sie ist auch stolze Trägerin des Ehrentitels einer »Maid vom Kelch«. Die Gyrths erachten die Obhut über den Kelch als heilige Familientradition. Dies ist die erste Fotografie, die jemals von dem Kelch gemacht wurde. Unsere Leser entsinnen sich vielleicht der berühmten Geschichte, derzufolge es im Gyrth-Tower einen geheimen Raum geben soll.
Val Gyrth nahm die Illustrierte ohne großes Interesse in die Hand, kaum hatte er jedoch das Foto erblickt, da sprang er auf. Sein Gesicht war dunkelrot, seine tiefblauen Augen wurden schmal. Als er die Bildunterschrift lesen wollte, zitterte seine Hand so heftig, dass er die Zeitschrift auf den Tisch legen musste. Als er fertig war, richtete er sich auf und wandte sich an seinen Gastgeber.
»Natürlich«, sagte er finster. »Ich verstehe. Sie tun das für meinen Vater. Ich soll nach Hause zurückkehren.«
Campion betrachtete seinen Besucher erstaunt.
»Es freut mich, dass Sie so empfinden«, sprach er. »Aber ich arbeite nicht für Ihren Vater, und ich hatte keine Ahnung, dass diese Geschmacklosigkeit Sie so aufregen würde.«
Val schnaubte. »Geschmacklosigkeit?«, wiederholte er. »Nun ja, Sie sind ein Außenstehender, aber vielleicht begreifen Sie, wie schwer es mir fällt zu erklären, was uns« – er zögerte – »der Kelch bedeutet.«
Campion hüstelte.
»Hören Sie«, sagte er schließlich. »Wenn Sie nicht so abweisend gegen mich wären, könnte ich Ihnen etwas Hochinteressantes erzählen. Tun Sie mir den Gefallen, setzen Sie sich und seien Sie nicht so abweisend.«
Val lächelte und ließ sich wieder in den Sessel fallen.
»Entschuldigen Sie«, sagte er, »aber ich weiß ja nicht, wer Sie sind. Verzeihen Sie, dass ich immer wieder darauf zurückkomme«, fügte er verlegen hinzu, »aber es erschwert die Sache, verstehen Sie? Wissen Sie, bei uns zu Hause wird der Kelch nie erwähnt. Er gehört zu den ungeheuer bedeutsamen Dingen, über die man nicht spricht. Dieses Foto hat mich tief erschüttert. Mein Vater muss verrückt geworden sein oder –« Er setzte sich voll banger Erwartung auf. »Es ist ihm doch nichts zugestoßen?«
»Nein«, versicherte der blasse junge Mann. »Dieses Foto wurde wahrscheinlich ohne sein Wissen aufgenommen und der Presse überlassen. Ich nehme an, es hat deshalb einigen Ärger gegeben.«
»Worauf Sie sich verlassen können«, versetzte Val grimmig. »Sie werden das wohl kaum verstehen, aber das ist ein Sakrileg.«
Dunkle Röte überzog sein Gesicht, und Campion begriff, dass Val sich schämte.
In sich zusammengesunken saß er im Sessel, das aufgeschlagene Heft nun auf dem Schoß.
Campion seufzte, ließ sich auf der Tischkante nieder und begann zu sprechen.
»Passen Sie auf«, sagte er. »Ich halte Ihnen zunächst einen Vortrag in Sozialwissenschaft, und anschließend erzähle ich Ihnen ein Märchen. Ich verlange nichts weiter von Ihnen, als dass Sie zuhören. Ich glaube, Sie werden es nicht bereuen.«
Val nickte.
»Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind«, sagte er, »aber schießen Sie los.«
Campion grinste.
»Hören Sie mich an, und ich zeige Ihnen hinterher meinen Taufschein, wenn Sie wollen. Lehnen Sie sich zurück, es geht los.«
Val lehnte sich gehorsam zurück und Campion beugte sich vor. Sein harmloses, nichtssagendes Gesicht nahm einen etwas intelligenteren Ausdruck an.
»Ich weiß nicht, ob Sie zu den Kaufleuten gehören, die Psychologie und Volkswirtschaft und dergleichen studieren«, begann er. »Falls ja, dann müssen Sie bemerkt haben, dass – wenn man nur reich genug ist – man irgendwann an den Punkt kommt, wo einem alles andere egal ist, außer dem, was man im Augenblick begehrt. Damit meine ich, dass man sich über Lappalien wie Gesetz und Ordnung und den nächsten Derbysieger nicht den Kopf zerbricht.«
Er zögerte. Val schien zu verstehen.
»Nun«, fuhr Campion fort, »vor rund fünfzig Jahren machten sechs der reichsten Männer der Welt – zwei Briten, ein Amerikaner, zwei Spanier und ein Franzose – diese interessante Entdeckung im Hinblick auf das Sammeln von Kunstgegenständen. Glücklicherweise ritt ein jeder von ihnen ein anderes Steckenpferd, doch alle waren sie von der Sammelleidenschaft besessen.«
Er legte eine Pause ein.
»Hier endet die Vorlesung und das Märchen beginnt. Es waren einmal sechs Herren, die sich für ihre jeweiligen Sammlungen, die ihnen äußerst lieb und teuer waren, fast alles kaufen konnten, was sie wollten. Dann begann einer von ihnen, ein habgieriger Mensch, sich nach Dingen zu sehnen, die nicht zu kaufen waren; nach Dingen, die so wertvoll waren, dass bedeutende Philanthropen sie den Museen übergeben hatten. Auch nach nationalen Kulturgütern von großem historischen Wert. Können Sie mir folgen?«
Val nickte.
»Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen«, sagte er, »aber ich höre zu.«
»Der erste Mann«, fuhr Campion fort, »den wir Ethel nennen wollen, weil er ganz bestimmt nicht so hieß, sprach zu sich: ›Ethel, du hättest gern das Porträt von Marie Antoinette, das im Louvre hängt, aber es ist leider unverkäuflich, und wenn du versuchen würdest, es zu kaufen, käme es höchstwahrscheinlich zu diplomatischen Verwicklungen, und du wärst nicht mehr so reich wie heute. Daher gibt es nur eine Möglichkeit, dieses schöne Bild in deinen Besitz zu bringen.‹ Und er sagte zu seinem Diener George, der ein Genie, doch leider auch ein Tunichtgut war: ›Was meinst du, George?‹ Und George meinte, man könne das Bild stehlen, wenn genügend Geld zur Verfügung wäre, da er zufällig einen Mann kenne, der ein Meister im Bilderstehlen sei. Und so«, sagte Campion mit vor Begeisterung schriller Stimme, »hat alles angefangen.«
Val richtete sich auf.
»Erwarten Sie etwa, dass ich Ihnen das glaube?«, erkundigte er sich.
»Hören Sie zu«, gebot sein Gastgeber scharf. »Mehr verlange ich nicht von Ihnen. – Als Ethel das Gemälde hatte, forschte die Polizei von vier Ländern überall danach, nur nicht in Ethels Privatsammlung in seinem Landhaus, weil er eine ›bedeutende Persönlichkeit‹ war. Eines Tages kam Evelyn, einer seiner Freunde, genauso reich wie er und passionierter Porzellansammler, zu ihm ins Haus, und Ethel konnte der Versuchung, ihm das Porträt zu zeigen, nicht widerstehen. Nun, Evelyn war über die Maßen beeindruckt. ›Wie hast du es gekriegt?‹, fragte er. ›Wenn du dein Bild von Marie Antoinette bekommen hast, kann ich doch auch die Ming-Vase aus dem Britischen Museum bekommen. Ich bin schließlich genauso reich wie du.‹ ›Tja‹, sagte Ethel. ›Weil du mein Freund bist und mich nicht erpressen wirst, denn dazu bist du zu ehrenhaft, will ich dich mit meinem Diener George bekannt machen, der sie dir besorgen könnte.‹ Und das tat er. Und George besorgte sie, doch diesmal über einen Meister im Vasenstehlen. Danach freute sich Evelyn sehr und konnte nicht widerstehen, seinen Freund Cecil einzuweihen, der ein kleiner König und ein großer Juwelensammler war. Natürlich gingen sie schließlich zu George, und alles geschah wie zuvor. Im Laufe von fünfzig Jahren«, sagte Campion langsam, »haben viele steinreiche Leute George und Georges Nachfolger beauftragt, mit dem Erfolg, dass es heute eine beachtliche Anzahl von Ethels und Cecils und Evelyns gibt. Sie bilden keinen Verein, aber man könnte sie vielleicht einen Ring nennen – den mächtigsten und reichsten Ring der Welt. Diese Leute sind keine Verbrecher im herkömmlichen Sinne. George und Georges Freunde sind diejenigen, die sich mit den Folgen auseinandersetzen müssen, falls es welche gibt, und sie stecken auch das ganze Geld ein. Außerdem rühren sie nie etwas an, das es auf dem freien Markt zu kaufen gibt. Man kann ihnen nichts anhaben, den Ethels und den Cecils, weil sie erstens große Tiere sind und weil zweitens niemand außer George und Georges Nachfolgern weiß, wohin die Schätze gehen. Das ist die Stärke des ganzen Systems. Begreifen Sie jetzt, worauf ich hinauswill?«
Als seine Stimme verklungen war, breitete sich eine drückende Stille in dem kleinen Raum aus. Trotz der Leichtigkeit seines Vortrags hatte Campion es verstanden, seiner Geschichte einen Anstrich von Realität zu verleihen.
Val starrte ihn an.
»Ist das wahr?«, fragte er. »Wenn ja, dann ist die Sache so phantastisch wie alles andere, was mir heute passiert ist. Ich begreife nur nicht, was mich das angehen soll.«
»Darauf komme ich gleich zu sprechen«, entgegnete Campion geduldig. »Ich versichere Ihnen, dass meine kleine Geschichte wahr ist – auch wenn Sie es nicht für möglich halten. Ist nicht zum Beispiel einmal die Mona Lisa verschwunden und erst unter höchst rätselhaften Umständen wieder aufgetaucht? Denken Sie doch zurück. Von Zeit zu Zeit verschwinden immer wieder unersetzliche, unverkäufliche Kunstschätze. Alles Dinge, die, wie Sie bemerken müssen, aufgrund ihrer Berühmtheit auf dem Markt ohne jeglichen Wert sind.«
»Einige der ursprünglichen Mitglieder dieses – dieses Rings sind inzwischen doch wohl gestorben?«, fragte Val, der unversehens in den Sog der phantastischen Geschichte geraten war.
»Ah«, machte Campion. »Darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Während der letzten fünfzig Jahre ist die Zahl der Millionäre beträchtlich gestiegen. Der kleine Kreis reicher Sammler ist gewachsen. Kurz nach dem Krieg gab es etwa zwanzig Mitglieder – Männer aller Länder und Hautfarben –, und die Organisation, die für eine kleine Anzahl so erfolgreich gearbeitet hatte, kam an ihre Grenzen. Da nahm eines der Mitglieder, ein Organisationsgenie, ein Mann, dessen Name auf drei Kontinenten berühmt ist, die Sache in die Hand und setzte vier oder fünf allgemeine Regeln fest, straffte das ganze Unternehmen und stellte es auf eine geschäftliche Basis. Der Verein, oder wie auch immer Sie es nennen wollen – meines Wissens hat er keinen Namen –, ist also in seinem eigenen Bereich praktisch allmächtig. Ich kenne nicht einmal die Hälfte der Mitglieder beim Namen und die kann ich Ihnen auch nicht verraten. Doch wenn ich Ihnen eröffne, dass weder Scotland Yard noch die Sûreté etwas wahrhaben wollen, mit dem sie immer wieder konfrontiert werden, dann werden Sie begreifen, dass Ethel und seine Freunde ziemlich bedeutende Leute sind. Wenn die Sache aufgedeckt würde, gäbe das einen ungeheuren Skandal.«
Val runzelte die Stirn.
»Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie es gemacht haben«, sagte er, ohne auf Campions letzte Bemerkung einzugehen. »Der George in Ihrem Märchen – wie hat er das angefangen?«
Campion zuckte die Achseln.
»Ganz einfach. Etwas Klügeres hätte sich der frühere Kammerdiener nicht einfallen lassen können. Er etablierte sich als Hehler und ließ an einschlägigen Orten durchsickern, für den verlangten Artikel würden sagenhafte Summen gezahlt. Das kommt Ihnen vielleicht etwas unglaubwürdig vor, aber Sie können Onkel Albert ruhig beim Wort nehmen. Man zahlt sein Geld und hat die Wahl.«
Val seufzte.
»Nicht zu fassen«, sagte er. »Aber was habe ich damit zu tun? Ich bin kein berühmter Verbrecher«, fügte er lachend hinzu. »Ich fürchte, ich bin außerstande, etwas für Sie zu klauen.«
Campion schüttelte den Kopf.
»Sie haben mich missverstanden. Ich gehöre der Firma nicht an. Begreifen Sie denn nicht, weshalb ich Sie hergebeten habe?«
Val schaute ihn einen Moment lang verständnislos an, dann kam ihm langsam die Erkenntnis und Entsetzen überkam ihn. Er starrte Campion an.
»Großer Gott!«, stieß er hervor. »Der Kelch!«
»So ist es«, sagte Campion ernst. »Der Kelch.«
»Das ist doch unmöglich!« Val hatte den Gedanken nach kurzem Nachdenken bereits als absurd abgetan. »Ich will nicht darüber sprechen«, sagte er. »Was soll’s? Sie sind ein Fremder Sie haben keine Ahnung – Sie können gar keine haben –, wie abwegig eine solche Vorstellung ist!«
»Mein lieber Junge«, sagte Mr. Campion bedächtig, »man kann eine Sache nicht beschützen, solange man sich nicht eingesteht, dass sie in Gefahr ist. Ich habe die letzten zwei Wochen lang versucht, Sie zu finden, weil ich zufällig mit Sicherheit weiß, dass der Gyrth-Kelch sich binnen sechs Monaten in der Privatsammlung eines besonders illustren Muslims befinden wird, wenn Sie nichts unternehmen.«
»Mein lieber Mann, Sie sind verrückt«, sagte Val lachend.
»Wie Sie meinen«, entgegnete Campion. »Aber was glauben Sie, wer sich die Mühe gemacht hat, Sie mit einem Taxi zu entführen? Wie erklären Sie sich den Umstand, dass meine Haustür zurzeit von vier Herren beobachtet wird? Sie können sie wahrscheinlich sehen, wenn Sie einen Blick hinauswerfen.«
Val schüttelte den Kopf.
»Das ist doch nicht Ihr Ernst!«
Campion nahm die Brille ab und blickte seinem Besucher fest in die Augen.
»Jetzt hören Sie gut zu, Val Gyrth«, empfahl er. »Sie müssen mir glauben. Ich weiß über die Bedeutung, die der Kelch für Ihre Familie – und das Land – hat, besser Bescheid, als Sie ahnen. Indem ich Sie warne, stelle ich mich einer der mächtigsten Organisationen dieser Welt in den Weg. Indem ich Ihnen meine Hilfe antrage, bringe ich mein Leben in Gefahr.«
Er machte eine Pause und fuhr dann fort: »Soll ich Ihnen etwas von den Zeremonien erzählen, die um den Kelch herum abgehalten werden? Von den Besuchen des Großschatzmeisters, die seit der Restauration im Jahre 1660 regelmäßig alle zehn Jahre stattfinden? Oder über die Urkunde, derzufolge der gesamte Besitz an die Krone fällt, wenn der Kelch verloren geht? Ich kann Ihnen noch viel mehr erzählen. Ihrer Familientradition zufolge werden Sie an Ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag volljährig, und dann findet im Ostflügel des Tower eine Zeremonie statt. Deshalb werden Sie nach Sanctuary zurückkehren müssen.«
Val schöpfte tief Atem. Er hatte seine Bedenken überwunden. Der Umschwung in Campions Betragen hatte etwas Überzeugendes.
»Auf jeden Fall dürften Ihnen und Ihrer Familie unruhige Zeiten bevorstehen«, fuhr Campion fort. »Deshalb habe ich mich mit Ihnen in Verbindung gesetzt. ›Ethel‹ und seine Freunde haben es auf den Kelch abgesehen. Und sie werden ihn bekommen, wenn wir nichts unternehmen.«
Val schwieg ein paar Minuten lang und musterte seinen Gastgeber mit kritischen Blicken. Er war rot angelaufen und die starken Wangenmuskeln traten unter den Bartstoppeln hervor.
»Die Schweine!«, sagte er plötzlich. »Wenn ihnen das gelingt, sind wir erledigt. Da Sie so viel wissen, ist Ihnen sicherlich auch klar, dass wir unsere Existenz nur dem Kelch verdanken. Wir sind eine der ältesten Familien in England. Aber wir betätigen uns weder politisch noch auf anderen Gebieten. Wir widmen uns nur der Aufbewahrung des Kelches.«
Er verstummte plötzlich und warf seinem Gastgeber einen argwöhnischen Blick zu.
»Warum interessieren Sie sich überhaupt so für die Sache?«, wollte er wissen.
Campion zögerte.